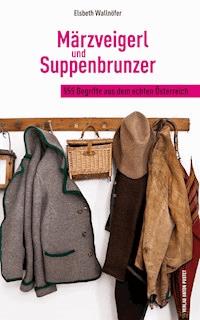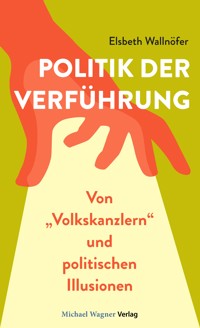
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Michael Wagner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Lust des Herrschens und Beherrschtwerdens Apell an unsere innersten Begehren Elsbeth Wallnöfer erzählt von mächtigen Gestalten und ihren Gesten: vom betenden Altkanzler Kurz in der Wiener Stadthalle, der rasenden Alice Weidel im deutschen Bundestag, der brüllenden Meloni in Italien, einem Bier-auf-ex-trinkenden amtierenden Kanzler, vom bekanntesten Clown Großbritanniens, Boris Johnson, und vielen anderen Populist*innen und Demagog*innen aus den Reihen der Politik. Sie zürnen, toben und verbreiten Unwahrheiten, sie sind misogyn und xenophob, appellieren an unsere innersten Begehren und haben damit Erfolg, denn sie erobern die Parlamente mit unserer Zustimmung. Sie rufen das "Volk" an, doch wer ist denn das Volk? Sie spielen mit dem Eros von Reichtum und Macht und wir spielen mit. Politische Verführungskünste des 21. Jahrhunderts Was passiert, wenn Kommunikationsberater*innen in das Tagesgeschäft der Politik eingreifen, Hashtags wie #söderisst Erfolg zeitigen, Wahlkampfwandertage in parteifarbenen Trachten-Accessoires abgehalten werden, ein Wir-Gefühl beschworen wird, das am Ende zu einer Trennung zwischen "Normalen" und den anderen führt, zeichnet die Autorin mit ihrem Blick auf die politische Ikonografie nach. Sie legt die Verführungskünste offen und zeigt, was als repräsentativ für die Politik des 21. Jahrhunderts gilt. Damit wir uns nicht wundern, wenn kommt, was mancherorts schon ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Geleit
Der Anlass
Standort
Alles eine Frage der Macht
Das Volk, il popolo, le peuple I
Das Volk, le peuple, der „Volkist“ II
Rasend oder faunisch
Das Volk und das Wir
„Wir“, im Zorn vereint
Von der Selbstliebe & dem Selbstvertrauen
Verführungskräfte, Verführungstechniken
Von der Kunst der Repräsentation: laute und stille Gesten
Krawall, plakative Sprüche, Antifeminismus
Die Mitte, nichts als ein schmaler Grat
Verführungskunst I – Namensänderung
Verführungskunst II – politischer Folklorismus
Kontrolle und Blendung – Verführungen III
Kontrollen: kleine Beispiele von großem Wert
Bilder, Fotografen, Geschau
Immer da! Daheim bei Fremden
Führung, Führer, Volkskanzler
Von der Liebe, einmal mehr!
Gesinnung, nichts als Gesinnung
Taktiken
Grobheit & Despektierlichkeit
Fanfaren und Applaus
Sie spielen mit dem Staat und wollen, dass wir mitspielen
Mit und ohne Feminismus
Fesch und teuer
Kein Grund zum LachenPolitik der Täuschung I
SlickPolitik der Täuschung II
„Künstliche Empörung“Politik der Täuschung III
Politische Philosophie & politische Praxis
Traditionen, Rituale, Hierarchien
Tabu, Macht, Ekstase
Wenn Recken sich strecken
Attitüden
Kaiserinnen, Königinnen, Ministerpräsidentinnen tragen (keine) Blazer
Blazer, Uhren, Suppen
Blöße, Bluse, Charme & Amüsement
Ordnung der Macht mit Frack
Der Anzug & Triumph des T-Shirts
Politisch-religiöse Allianzen
Lustprinzip, falsche Könige (Populist oder Demagoge), echter Applaus
Private Öffentlichkeit. Geteilte Leben. Wir und die Macht
Zum Abschied eine Hundegeschichte:Dudù, Buffy, Bo. Von der Verführungskraft des lieben Viehs
Anmerkungen
Lasciate ogni speranza, voi ch’ entrate[Lasst alle Hoffnung fahren, Ihr, die ihr eintretet]1DanteInschrift am Höllentor
Geleit
Ein Buch ist wie eine Frucht, es bedarf eines Biotops, eines idealen Bodens, auf dem zu gedeihen es imstande ist. In diesem Fall erwuchs es aus dem Boden, um nicht zu sagen aus dem Sumpf, des aufstrebenden Populismus. In der europäischen Politik erstmals mit Silvio Berlusconi in Erscheinung getreten, schien dessen zunächst befremdlich unterhaltsamer Lärm eine kurzzeitige Laune der Geschichte, die bald wieder vorbei sein würde. Doch dem war nicht so. Nach und nach erfasste der boulevardeske Radau Europa und die Welt und wie auf einem Jahrmarkt reihte sich eine Clownerie an die andere. Schon bald zeichnete sich ab, dass groteske Verführungskünste mehr und mehr selbstverständlicher Teil politischen Machtstrebens wurden, Magie und das Streben nach Macht der Sachpolitik den Rang abliefen, seltsame Illusionen und ethnische Kollektivierungsträume um sich griffen und die bisherige solide Mitte ausfransten, wenn nicht gar vollständig verdrängten. Dies alles lässt sich nachzeichnen.
Als tagespolitisch interessierte, kulturpolitisch geübte, philosophisch-anthropologisch geschulte Ethnografin verzeichnete die Autorin eine stetig zunehmende Anzahl von „ausfransenden“ Politikstilen bei bisherigen Parteien und eine Zunahme bukolischer Verführungskünste in Form von politischem Folklorismus. Das Werben ums Volk zeitigt bizarre Liebesstrategien, zornige Eruptionen, tierische Zuneigungen nebst einem verstärkt auftretenden xenophoben und misogynen Habitus, die Faszination von Glamour und Eros des Geldes tut ihr Übriges. So mancher Trend, der gerade noch alle ergriffen hatte, ist während der Durchsicht des Typoskripts vor Drucklegung bereits keiner mehr und sich abzeichnende Tendenzen bei der politischen Mitte nach rechts haben sich nicht etwa unter Rückgriff der Vernunft aufgelöst als vielmehr manifestiert. Der Unterschied der Populisten hin zu den Demagogen wurde immer geringer, der sprachpolitische Duktus künftiger Volkskanzler schärfer. Immer mehr wurde die Politik der Verführung zu einem Spiel um diktoriale Macht.
Das Geschäft mit der Illusion vom Volk blüht. Es wird getäuscht, getrickst, gelogen, aufdirndlt und bierlaunig folklorisiert, applaudiert und schnell vergessen, was gestern noch als unumstößlich erklärt wurde. Wie sehr sich diese Politik des Folklorismus in nur allzu menschliche historische Muster totalitärer, demokratiefeindlicher Politiken einfügt, will hier angerissen werden. Wie viel Illusion und Suggestion, Pathos, Begehren und Spiegelungen sich dabei Raum schaffen und was das mit uns zu tun hat, ist Absicht zu zeigen. Das Buch teilt sich grob in drei Dachthemen ein. Einmal kommt es zu einer Standortbestimmung des Volkes und dessen Begehrens. Diese führt uns weiter zu den Taktiken einer Politik der Täuschung, und gegen Ende schauen wir auf die gestisch-kulturellen Attitüden politischer Verführungen. Nicht immer sind die Unterordnungen auf einen der Dachbegriffe beschränkt, zu verwoben sind sie miteinander. Einiges wird sich bis Erscheinungstermin verändert, manches wie von selbst kannibalisiert haben. Trotz allem bleibt zu hoffen, dass der Verlust der Mitte nicht der Verlust des Maßes dessen, was eine Demokratie ausmacht, bedeutet, wir uns nicht politischen Illusionisten opfern werden und dabei einen Rückfall in vormoderne Zeiten in Kauf nehmen.
Die SeeleAuch ein Bub hat Seele eine,Ist sie voll, dann hat er eine,Ist sie leer, dann hat er keine.Darum ist es eine Seele eine.Ernst Herbeck2
Als im Oktober 2021 in Österreich ein gerade mal 35-Jähriger seinen Rückzug aus der Politik verkündete, meinte dieser leicht verschnupft: „Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher.“ Mit diesem einen Satz versuchte er alles zurückzunehmen, was ihm und den Seinen bis anhin erstes Ziel war, und wahrlich auch gelang: Glanz und Gloria, trunkene wie willfährige Bewunderung jener Art zu erringen, wie sie uns nur aus den Erzählungen über antike Volkstribune, mittelalterliche Könige und von Führern totalitärer Systeme bekannt sind.
In Gestalt dieses Kanzlers eines Kleinreichs von nicht ganz neun Millionen Einwohnern3 verdichtet sich ein allgemein gesellschaftspolitischer Trend, der weltweit zu beobachten ist: ein Aufstieg von Populisten und Demagogen, Schwätzern und Entertainern. Was mit Silvio Berlusconi in Italien seinen Ausgang nahm, mit Donald Trump in den USA einen weltpolitisch relevanten Kulminationspunkt erreichte und immer mehr ähnliche Politikernaturen wie Marine Le Pen in Frankreich, Boris Johnson in Großbritannien, Jair Bolsonaro in Brasilien, Giorgia Meloni in Italien oder auch Javier Milei in Argentinien zum Erfolg führte, sagt mehr über eine Gesellschaft aus, als uns vielleicht lieb ist. Denn ihr Aufstieg zeigt, wie sehr wir es lieben, zu jubeln, zu klatschen und mit „Volk“ angesprochen zu werden. Dieses Volk ist es, das bei Begegnungen mit Populisten vor Bewunderung wie besinnungslos zu deren Füßen feiert. Das Volk, das wie im Rausch auf Kundgebungen zürnt, bierselig auf Volksfesten schunkelt und auf Demonstrationen brüllt.
Doch was ist die Kraft, die solch ein Verhalten auszulösen imstande ist, was sind die Mechanismen und Instrumente, die eine derartig volkstümliche Verehrung bedingen, und worin genau besteht das Faszinosum, das von Populisten und Demagogen, von Hetzern ausgeht? Was ist das Band, das Volksführer und Volk verbindet?
Auf der Suche nach historischen Vergleichsmöglichkeiten stößt man auf eine in Fachkreisen bekannte wie brillante Erörterung eines Historikers, der sich in einer „Studie zur politischen Theologie des Mittelalters“ mit den „zwei Körpern des Königs“ (The Kings’ Two Bodies) beschäftigte.4 Wenngleich wir es dabei mit einem rechtshistorischen Kompendium zu tun haben, das die juristische Bedeutung der geheiligten Rolle ehemaliger Könige erörtert, ist es dennoch unerwartet aktuell. Denn es behandelt den Personenkult rund um Könige und deren rechtswirksame Unantastbarkeit ihrer symbolischen Rolle. Wir erkennen dabei Parallelen zu Repräsentanten des gegenwärtigen Populismus. Damals wie heute haben wir es mit einem durch und durch anthropologischen Phänomen zu tun: den Politiken und Praktiken von Adoration, dem Eros der Macht, den Verführungskünsten und Gesten der Repräsentation von Macht.
Dieses Gemisch ist es, dem hier auf den Grund gegangen werden soll. Wir suchen nach dem schillernden „Göttlichen“ selbsterklärter „Volksvertreter“, den Tricks, mit denen sie uns zu umgarnen versuchen und denen viele von uns aufsitzen.
Wie einst im Absolutismus (also bis in nach-revolutionäre Zeiten), zu Hochzeiten des Hoch- und Landadels und dessen Allianzpartners, der mächtigen Kirche, dreht sich auch gegenwärtig alles um dieses besondere, schleierhafte Etwas, das beinahe Religiöse, das Magische, das vielfach entweder zu bedingungs- und kritikloser Gefolgschaft oder aber zu radikaler Ablehnung führt. Wir stoßen auf bekannte Heroen der Macht, ihre repräsentativen Gesten wie ihre schillernden oder zurückhaltenden Dramaturgien, wir begegnen einer Faszination, die seit Menschengedenken nichts an Wirkung verloren zu haben scheint, und müssen mit Schrecken feststellen, dass sie nichts von ihrer faustischen List verloren hat. Einst wie heute ist das Zusammenspiel von Machtstreben und schillerndem Blendwerk ein nicht zu unterschätzender Faktor auf dem Weg zur totalen Macht.
Was heute von der vulgärdeutsch genannten „Message Control“, von professionell-strategischen Kommunikationsberatern also, in die Hand genommen wird und darauf abzielt, stylisch smarte oder knallig laute Kandidaten zu kreieren, gab es in der ein oder anderen Form schon immer. So wir historischen Quellen Glauben schenken, dass auf dem Weg zur Herrschaft das vorrangige Ziel darin bestanden hat, ein perfektes Image zu kreieren, den grellsten Schein zu erzeugen, möglichst die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ein diffuses Begehren und die Aura von Macht in uns, dem Volk, dem populus, zu nähren. Wir haben es also auch mit menschlichen Tricks zu tun, die uns in ihren Bann ziehen (sollen), um Gefühle in uns zu erzeugen, um Illusionen entstehen zu lassen, die dazu führen, jemanden zum „Volkskanzler“ krönen zu wollen.
Es geht also um den Komplex Macht und die damit verbundenen Verführungskünste, um unsere Empfänglichkeiten dafür.
Eines wird beim Schreiben dieser Zeilen schnell klar: In Zeiten des überbordenden Populismus über Macht nachzudenken und zu schreiben, führt an den Rand der Verzweiflung, wie schon Klügere vorher befanden, die sich Gedanken darüber machten und zum unweigerlichen Schluss kamen, dass sich dabei recht bald „Vorsicht und schließlich [ … ] Resignation“5 einstellt. Doch lasst uns nicht verzweifeln, nicht den Glauben an die parlamentarische Demokratie verlieren.
Denn sie birgt wie kein anderes politisches Modell die Chance für Individuen, nicht in der Resignation verharren zu müssen, sie allein vermag die Welt und die in ihr beheimatete Macht der Individuen voll zu entfalten.
TeufelIn der Hölle entfacht der Teufel sein Grauen.Der Teufel lockt die Menschen in seinen Feuerzauber.In der Hölle gibt es brüllende Offiziere.Die Teufel lungern stinkfaul in den Höllenlöchern.Sie scheuen Müh und Plag.Ganze Nächte tanzen die Teufel im Reigen der Schlachtgesänge.Sie wippen mit ihren Schwänzen und treiben die Mücken in Abwehr.Auf der Welt erscheinen sie als Fehlerteufel.Im ewigen Feuer gibt es keine Seife zum Händewaschen.Im Inferno fühlen sich die Gehörnten pudelwohl.Georg Paulmichl1
Der Anlass
Der Anlass zu diesen Überlegungen ist einem gefühlten Wandel im Politikstil geschuldet. Starten wir zur Veranschaulichung mit einem Beispiel, das wirklichkeitsgetreu sowie symbolisch für einen Generationenwechsel von einer klassischen Politik konservativer Mitte hin zu einer volatilen populistischen Politik steht.
Die Szene: Ein smart-juveniler Kanzler eines kleinen Landes weilt auf Staatsbesuch in der Hauptstadt Deutschlands. Bei diesem bilateralen Treffen zwischen Österreich und Deutschland begegnet ein Regionalpolitiker – gemessen an seinem Vis-à-Vis – auf eine an Erfahrung reiche und geopolitisch versierte Playerin: Kurzum, Sebastian Kurz trifft Angela Merkel.
Spürbar, mit leichtem Befremden beim Lesen, schrieb damals der Deutschlandkorrespondent einer großen Schweizer Tageszeitung: „Merkel mag mit Kurz, der Sehnsuchtsfigur der Konservativen, nicht richtig warm werden.“2 Diese Bemerkung ist, auch wenn sie nur ein Gefühlsbild eines Journalisten wiedergibt, eine wichtige Botschaft. Es ließe sich einwenden, solche und ähnliche „Stimmungsberichte“ seien eben nur genau das, eben sehr subjektiv. Aber diese Zeilen erzählen uns sehr viel mehr. Sie erzählen davon, was in der politischen Welt beim Ringen um Macht immer öfter eine Rolle spielt: Stimmungen zu verbreiten, gefühlte Wahrheiten zu erzeugen, sie spürbar werden zu lassen. Oftmals erfolgt dies durch Körpersprache, Blicke, Gesten des Grußes oder repräsentativen Symboliken wie Kleidung.
So war es in diesem Fall ein Gefühl, die Stimmung eines Journalisten, die den Gegensatz zwischen der damals mächtigsten Frau der Welt mit einem der weltweit wirtschaftlich leistungsfähigsten Länder im Rücken und dem ehrgeizigen Vertreter einer Kleinrepublik ohne größere wirtschaftsschwangere Ressourcen aufzeigte. Was beide, Merkel und Kurz, nicht aussprachen, ja, vermutlich gar bemüht waren zu verbergen, war dennoch spürbar und blieb nicht folgenlos. Es war nicht messbar und dennoch von Bedeutung, da das Ereignis einen generellen Wechsel des Politikstils der deutschsprachigen Konservativen markierte.
Hier bekamen wir eine gereifte, hochgebildete Frau, deren Markenzeichen ihre Zurückhaltung war, zu sehen, und daneben stand ein gerade eben 30-jähriger Studienabbrecher ohne einen bis dahin beruflichen Erfolg3 – außer den des gelernten Parteifunktionärs –, aber ausgestattet mit der Begabung zur Selbstdarstellung. Der junge Herr Kurz redete viel in wohltemperierten Phrasen und gestikulierte stets mit einem leichten Hauch von theologischem Pathos in Richtung Pressevertreter. Sie, die Antagonistin, war reserviert bis maulfaul. Kein Wort zu viel kam ihr über die Lippen, keine bemüht extemporierte Nebensächlichkeit setzte sie ein. Wohlformuliert und mit Bedacht sprach sie in diesem Moment, jedes Wort hatte seinen vorgesehenen Platz. Es war zu spüren, dass sie es vorzog, im Zweifelsfall lieber zu schweigen. Das war der exemplarische Augenblick eines europäischen Politikwandels. Hier die klassisch wertkonservative, bedächtige, die in ihrem Habitus stets etwas pesante deutsche Bundeskanzlerin auf der einen Seite, und dort der an Erfahrung blanke, geopolitisch unbeleckte wie charmante Schwiegermutter-Typ Kurz, Kanzler von Österreich. Obwohl beide derselben Parteienfamilie angehör(t)en, sind sie doch pars pro toto eines neuen Trends, oder doch nicht?
Es handelte sich bei diesem Treffen nicht um eine bloß klassisch-politische Begegnung zwischen zwei europäischen Politikern gesinnungsverwandter Parteien. Dieses Setting markierte vielmehr eine Art Stellvertreter-Moment jüngster Geschichte, der einen Generationen- und Stilwechsel im Selbstverständnis dessen, was Politik war und im Begriff war zu werden, verdeutlicht. Diese Begegnung veranschaulicht wie keine vor ihr den Unterschied zwischen klassisch distinguierter Politik und flapsigem Populismus. Sie steht für einen Übergang, einen inhaltlichen Stilwechsel in der Politik – auch für den Verlust der Mitte. Sie steht für einen Wechsel des Politikstils, der mit der Formel „von der Kraft der Überzeugung zur Kraft der Verführung“ umrissen werden kann. Beide verkörpern diesen Wechsel, beide demonstrieren auf ihre Weise die Kraft populistischer Ikonografie und den repräsentativen Charakter von Macht, den Nimbus derselben.
Da solche Ereignisse unser aller Emotionshaushalte nähren, unsere inneren Begehren, unsere Wünsche spiegeln, da sie wirken, noch bevor wir hingehört haben, was gesagt wurde, hat die Politik der Verführung selbstverständlich auch mit uns zu tun. Wir sind es, die die Mächtigen zu dem ermächtigen, was sie am Ende sind. Und so ist der Zauber angeführter Szenerie etwas, das uns ergreift, in seinen Bann zieht, weil wir es zulassen.
Atmosphärische Lagen sind es also, die uns in ihren Bann ziehen, die in uns etwas wachrufen, das dazu führt, schleichend Gefallen oder spontane Abneigung für die Mächtigen zu entwickeln. Dieselbe Kraft ist es, die uns auch zu willfährig gehorsamen Anhängern werden lässt. Diese Stimmungen, diese irisierenden Aufladungen, sind das Schmieröl im Motor hierarchischer Ordnungen und somit der Strukturen von Macht generell. Sie sind unter anderem das Band zwischen „Volk“ und „Volkskanzlern“. Und je mehr wir und die Politik uns vom Bedürfnis einer ruhigen, wohlbedachten Sachpolitik wegbewegen, umso mehr müssen wir uns auf solche Stimmungen verlassen. Je mehr wir die Gestikulierer und Parlierer bevorzugen, umso mehr erliegen wir den Dynamiken dieses (populistischen) Werbens.
Wie wir schon zuvor festgestellt haben, wissen wir von der Macht, dass sie nach den Regeln eines Spiels funktioniert, das so alt wie die Menschheitsgeschichte ist. Die Literaturen sind voll von Erzählungen politischer Ränkespiele. Wir haben es also keineswegs mit einer Erfindung der jüngsten Epoche zu tun. Die Techniken derzeitigen politischen Machtstrebens reihen sich in eine habituell und gestisch kulturell lange Tradition ein. Es läuft nur alles – untertrieben formuliert – ein wenig schneller. Der Augenblick, der Moment symbolisch repräsentativer Techniken und Mechanismen einstiger Kaiser, Könige, Fürsten, Vögte und auch Päpste beim Streben nach Macht scheint sich angesichts der Digitalisierung für aufstrebende Regierungschefs, Präsidenten, Ministerinnen auszudehnen. Es ist heutzutage nämlich möglich, zur selben Zeit quasi überall auf der Welt präsent zu sein, ohne anwesend sein zu müssen.
Im Prinzip jedoch scheinen immer schon die gleichen Praktiken und menschlichen Tricks dabei zum Einsatz zu kommen. Repräsentieren, hofieren, informieren – und mindestens genauso wichtig und immer öfter: desinformieren. Dies alles, um das Verlangen, mächtig zu werden oder zu bleiben, zu stillen. Formvollendet zeigt sich die Macht von ihrer repräsentativen Seite im Glanz und im Ritual, in hochsymbolischen Gesten, in aufgeladenen Szenerien, die, garniert mit süßlichen Worten oder flammenden Reden, Mensch und Welt vibrieren lassen.
Von der Macht reden heißt deshalb, von der Balance zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen zu reden, von Verführungskünsten und immer öfter auch von hochbezahlten Stylisten, Stil- und Farbberatern, von Scharen an Kommunikationsprofis.
So schickt sich die Politik an, das Schöne zum Nützlichen werden zu lassen – während das Vernunftmäßige, die Sachpolitik, zum lästigen Beiwerk verkommt. Und noch ehe wir uns versehen, werden der Stylist und die Kommunikationsberaterin, vermutlich ohne sich dessen gewahr zu werden, zu gewichtigen politischen Beratern.4
Strapazieren wir zur Vertiefung deswegen noch einmal die Protagonisten des Berliner Treffens. Auf der einen Seite begegnen wir in der Person Angela Merkel, deren uniforme Sakkos betonten, was sie sonst noch schien: eine exzellent gebildete, doch stets etwas gefühlskühl distanzierte, ja, emotional hoch kontrollierte, etatistisch-trockene Konstanz verströmende Politikerin zu sein. Auf der anderen Seite steht der blasierte, spürbar um Aufmerksamkeit heischende Ex-Student Sebastian Kurz, der kaum realpolitische Erfolge vorzuweisen hat, jedoch eine Fülle redundanter Sätze zur Lösung der Probleme der Welt anbot. Kurz reiste stets mit einem hochbezahlten Tross von Medien- und Kommunikationsarbeitern und machte mit seiner immer zu jeder Zeit perfekt sitzenden Frisur auf sich aufmerksam. Hat sich das Spiel um Macht in Europa also mit dieser Begegnung endgültig von der imperialen Intrige à la Shakespeare oder einer trockenen Sach- und Staatspolitik verabschiedet und hat es sich zu einem politischen Folklorismus und anderen seichten Populismen hin verschoben?
Als der österreichische Jurist, Richter und Autor Oliver Scheiber jüngst mit seinem Buch über die Österreichische Volkspartei die Frage Konservative Wende oder konservatives Ende5 in den Raum stellte, stand dies unmittelbar in Zusammenhang mit der Person Sebastian Kurz. Auch ihm fiel auf, dass es hier um mehr als um einen Personalwechsel innerhalb der Partei ging, dass mit dessen Politikstil und den von diesem kultivierten rechtstendenziösen Populismus, seiner – inzwischen nachgewiesenen – Klientelpolitik für einige handverlesene Freunde, sich eine ganz Partei änderte. Kurz personifiziert einen vollendeten Stilwechsel im Ringen um politische Macht innerhalb der österreichischen Volkspartei, was tatsächlich auch Auswirkungen auf die deutschen Volksparteien CDU und CSU hatte. Denn der unmittelbare Vergleich Kurz-Merkel ließ die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel, und ihre CDU wie eine dröge, wenngleich solide, unaufgeregte, ja beinahe unzeitgemäße Vertreterin der Konservativen dastehen. Da Kurz nicht nur ob seiner Jugendlichkeit leuchtete, sah man ihn über Österreichs Landesgrenzen hinaus als Hoffnung bringenden Kometen am Firmament der deutschen Volksparteien. Er schien der bisher gemäßigt wirtschaftsliberalen alten Tante Volkspartei mit seiner libertären und in der Tendenz autokratischen Haltung neues Leben einzuhauchen. Die österreichische Volkspartei, die bis dahin immer einen Hauch von biederer habsburgischkatholischer Land- und Bauerntreue verströmte, schickte sich unter seiner Übernahme an, „ein hippes Ding“ zu werden. Es dauerte auch nicht lange, bis der etwas altbacken gemächlichen, sympathisch konservativen Partei das Streben nach Glanz und Gloria der „nouveau riche“ nachgesagt wurde. So schien es für einen Augenblick, als hätte die schillernde Macht der Jugend gesiegt, als sei die mächtigste Frau der Welt von nichts als dem schönen Schein blühender Adoleszenz in eine Nebenrolle gedrängt, eben entmachtet, worden.
Die Faszination von Macht und das Begehren, sie zu besitzen, sind – so möchte man meinen – durch den stetigen Fortgang bisheriger Demokratisierung sachlicher, aufklärerischer widerständiger, rationaler, kurzum weniger imperial im Gestus geworden. Doch scheint dies bei genauerer Betrachtung der aktuellen Populismusauswüchse nicht der Fall zu sein. Der Aufschwung von Populisten und Demagogen, besonders die aggressive Selbstbehauptung von Rechtspopulisten, wirkt wie ein Abschied von bisherigen Prinzipien geltender Staatsräson, die sich selbst unter Zuhilfenahme des demokratisch zustande gekommenen Rechts eine Form von Objektivität und Respekt verpasste. Im Spiel um die Vorherrschaft von Macht müssen jene, die einen Machtwechsel herbeiführen wollen, entweder auf Bewährtes setzen und garantieren, dass alles so bleibt, wie es ist, oder sie müssen zu neuen Mitteln der Verführung greifen.
Berlusconi verließ sich in Italien auf seinen stereotyp männlichen Habitus, auf sich als bonviantes Vorbild für Millionen von Italienern. Kurz wiederum warf Jahre später seinen juvenil treuherzig lieblichen Charme in die Runde. Sich ins Werk zu setzen, war das Angebot an die Wähler. Kein wirtschafts-, sozial- oder kulturpolitisches Konzept sollte dem im Wege sein. Sie selbst waren das Angebot und die Verführungskünstler, die mit zunehmendem Maß die repräsentative Bedeutung des Staates vom Parlament auf ihre Person verschoben. Sozusagen das „positive Recht“ zugunsten einer Politik des schönen Scheins, des gelungenen Habitus und der plakativen Sprüche aufgaben.
Immer öfter stehen zuletzt für diesen Trend vor allem die ehemals christsozialen Volksparteien. So macht sich mit ihnen auf dem Parkett politischer Macht eine Stimmung breit, die bisherige strukturelle Grenzen eines parlamentarischen Staates zusehends verwischt. Es kommt zu einem Stilwechsel, einem Gefühlswechsel, einem Mentalitätswechsel im nationalen Geist.
Dies hat bei rechtstendenziösen, also rechts von der Mitte angesiedelten Journalisten und Politikern zur Folge, dass sie unumwunden der Meinung sind, das Recht hätte der Politik zu folgen.6 Man schreckt auch nicht davor zurück, bisherige internationale Konventionen wie die UN-Menschrechtskonvention in Frage zu stellen oder die Bedeutung des humanitären Völkerrechts zu schmälern.
Im Überbietungswettbewerb vom Schlechtreden des Staates und der gleichzeitig stattfindenden Fokussierung auf ein Führerprinzip setzt sich ein Mechanismus der Selbstermächtigung in Gang, der nicht einmal mehr ein Mindestmaß an politischem Anstand verlangt und für den die Fähigkeiten logischen Schließens ein Hindernis darstellen. Immer öfter scheint es, als bestünde Demokratie nur mehr aus Regierungen ohne Parlament im Rücken, aus Ministerpräsidenten und Landeshauptleuten, die perfekt ausgeleuchtet in stereotypen Motiven ein Sujet – sich selbst – in allen möglichen Alltagsverrichtungen verkaufen. Dadurch wird der Staat überflüssig und der selbst ausgerufene Vorsteher des Volkes mit seinem eigenen Willen zur Macht umso wichtiger. Kurzum: Damit ist die Epoche des Populismus eingeläutet.
Der Aufstieg der Populisten wird somit zum Symbol der Erosion des Respekts vor dem parlamentarischen Staat mit Gewaltenteilung. Potenzielle Schulterschlüsse unter selbstdarstellerischen Autokraten, herrschsüchtigen Demagogen oder gar tyrannischen Despoten zeichnen sich ab. So sind wir angekommen im Zeitalter trügerischen Glanzes, wo Blazer, Pudel, Glamour, Volksfeste, auf denen Bierkrüge gestemmt werden, die politischen Stimmungen dominieren und der parlamentarische Staat nur als Staffage von Emporkömmlingen dient.
Standort
Alles eine Frage der Macht
Die Lust nach Macht ist das Verlangen nach einem Imperium, einem Staat, und, nun, wahrlich etwas zutiefst Menschliches, das uns gerade deshalb vermutlich immer erhalten bleiben wird. Wir begegnen ihm allüberall, schon in der kleinsten Organisationsform: der Familie. Es beginnt am Küchentisch, setzt sich fort in allen weiteren Zellen einer Gemeinschaft, es begegnet uns als historische Ränkespiele in Büchern und Filmen bei Königen, in der Kirchengeschichte von Päpsten und den zahlreich überlieferten politischen Machtkämpfen von Regierungen.
Die Macht trägt Glanz wie Schrecken in sich. Sie zeigt sich von ihrer hässlichsten Seite, in pervertierten oder tyrannischen Gesten von totalitären und autoritären Staaten, von ihrer schönsten Seite in der parlamentarischen Demokratie.
Macht ist in ihrer anthropologischen Dimension eine der Hauptspuren allgemeinen Handelns, Ursache für das Glück oder Unglück vieler oder einiger. Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Status und Reputation. Sie wird demonstrativ zur Schau gestellt oder sehr subtil ausgeübt, sie steht für ein Verlangen, das in den meisten von uns steckt. Wir begegnen ihr auf kleinstem Raum innerhalb der Verwandtschaft ebenso wie im politisch öffentlichen Raum. Ihre Gestalt ist vielerlei, sei es als pater familias antiker römischer Familien, als Rädelsführer einer Gruppe, als Stammesälteste, als Oba im Königreich Benin oder wie bei den Lobi in Westafrika, wo es in jedem „Haus“ einen „Familienchef“ (tyordarkuun) gab, der über absolute Autorität über die „Hausbewohner“ (tyordara) verfügte,1 als Dienststellenleiter in einem Ministerium. All diese und noch unzählige andere Rollen repräsentieren Macht, ihre Inhaber können nach ihrem Gutdünken „machen“, was sie für richtig halten.
Die politische Macht jedenfalls kennt eine Armee von Mächtigen, darunter einige exzentrische Prachtexemplare. Die Galerie politischer Kämpen und irisierender Despoten ist so lang wie die Menschheitsgeschichte, deren Fama nahezu endlos schillernd. Für das 20. Jahrhundert erinnern wir an illustre Figuren wie den Äthiopier Haile Selassie (1892–1975), Josef Stalin (1878–1953), Che Guevara (1928–1967), den Libyer Muammar al-Gaddafi (1942–2011). Dabei zeigen diese Beispiele schon eines deutlich: Politisch Mächtige gibt es in jeder politischen Färbung und nicht alle missbrauchen ihre Macht auch zu ihren Gunsten, aber doch recht viele.
Besonders al-Gaddafi und Selassie erlaubten sich ihre eigenen besonderen Eskapismen, die dafür sorgten, ihr Gegenüber wegen ihres exotischen Charmes für sie einzunehmen und dabei altbekannte Stereotypien in uns von exaltierten Berberführern und afrikanischen Königen zu bedienen. Egal wo Gaddafi – „the flamboyant colonel“,2 wie ihn die Franzosen nannten – auf Staatsbesuch im Ausland weilte, er schlug stets in männlich tribalistischer Manier seine (Beduinen-)Zelte auf.3 Allein dies sorgte bereits für ein Schillern und Staunen, dem sich zu entziehen schwer war.
Solche Übertreibungen des Selbstgefälligen sind Exempel gewiefter Gesten, um Aufmerksamkeit zu generieren; zu zeigen, dass man qua Macht imstande ist, sich mehr herauszunehmen, als rundum geltende gesellschaftliche Konvention es vorsehen. Gaddafis Auftritte jedenfalls veranschaulichen, worauf Macht auch beruht, vom Flair und dessen Wirkung auf andere, vom Draufgängertum und einer demonstrativen Selbstbehauptung.
Die Magie der Macht bedarf, wie wir hier lernen, zu ihrer vollen Entfaltung eines gewissen Maßes an Eskapismus. Dazu gehört ein imposantes Auftreten, nicht zuletzt, um zu zeigen, wo die Grenzen der anderen, der weniger Mächtigen, enden. Wer diese Magie herzustellen imstande ist, ist mächtig und verweist die Gewöhnlichkeit der anderen in ihre Schranken. Somit scheidet sich recht bald die Welt in auserwählte Mächtige und viele andere Nicht-Mächtige, gar Ohnmächtige.
Die grenzenlose Lust am Herrschen, das Begehren, derart mächtig zu werden, dass kein Gesetz der Welt für einen gilt, diese Lust personifizieren die selbstgefällige nordkoreanische Kim-Dynastie, eine einstige Reihe von Päpsten und (römischen) Kaisern der Vergangenheit, aber auch Demagogen wie Donald Trump. Wer, wie Letzterer, vorgibt, er würde „nur für einen Tag Diktator“ sein wollen, nämlich am ersten Tag seiner Amtseinführung,4 leistet damit einen Offenbarungseid, ein Bekenntnis zu totalitären Strukturen, zur totalen Macht. In den Kreis derer, die ihre Macht über alle nicht selbstgestrickten Gesetze stellen, gehören alle Despoten dieser Welt und ganz besonders Wladimir Putin. Sie stehen für einen völlig entgrenzten Willen zur Macht, für eine Politik der harten Hand und das Verlangen, entweder durch offen zur Schau gestellte oder im Verborgenen gepflegte Exaltiertheit gerühmt zu werden. Sie zeichnet aus, Jongleure der Selbstdarstellung zu sein, sie sind Experten im Erfinden von Huldigungsritualen und Meister des Verbergens eigener Verfehlungen. Sie beherrschen die scheinbar generösen, großen Gesten perfekt, so wie sie nur Selbstdarsteller imstande sind zu zeigen. Meistens führen sie ein Doppelleben, ein öffentliches und ein privates, das den durch die Kraft der Macht verliehenen Luxus entweder verbergen (Putin) oder mit ihm beeindrucken (Trump) will.
Gewiss ist, sie alle hatten Vorgänger und werden auf ihre Weise Nachahmer finden, denn Herrschaftssucht, Selbstverliebtheit, Mitteilungslust und Ringen um Anerkennung scheinen ein substanzielles anthropologisches Prinzip zu sein.
Der ewige Hunger Einzelner auf Macht ist es, der die Welt in Bewegung hält, und leider auch sehr gefährlich macht. Besorgniserregend zeigt sich, dass das Buhlen um Macht speziell bei Populisten, Demagogen und Despoten spürbar entfesselter vonstattengeht, als dies bei Demokratie und dem Parlament verpflichteten Politikern der Fall ist.
Vor allem Populisten scheinen zu wissen, dass sie die perfekte Dramaturgie gleißender Inszenierungen zum Erfolg führt. Daher lieben sie alles, was der politische Folklorismus zu bieten hat. Volksfeste, Brauchtümer und Rituale, beispielsweise politische Aschermittwoche. Ihre Entourage ist ein handverlesener Haufen, der hauptsächlich gesinnungstreu ist und sich entsprechend gerne mit dem Abglanz ihrer populistischen Lichtgestalt begnügt. Der Mächtige wiederum weiß, dass er ohne Gleichgesinnte allein dastünde. Wer gar ein Volkskanzler werden will, braucht nicht nur Wähler, er oder sie braucht ein gesinnungsgleiches (willfähriges) Volk – oder eine mächtige Illusion davon.
Das derzeit von Populisten, Autokraten und Demagogen nur zu gern beschworene Volk meint also tatsächlich auch nur „ein“ Volk und keine Gesellschaft. Sie sehen in ihm nicht eine sozial strukturierte Gesellschaft, sie meinen „ein“ Volk, das geboren aus einem Ideal, verbunden in einer gemeinsamen kulturellen Projektion, zusammengehalten von einem Bluts- und Stammesdenken, einem Ius-sanguinis-Denken, wird.
Populisten, Autokraten, Demagogen und Despoten suchen nach Widerhall, erwarten ein Echo der Zustimmung, verlangen nach Bewunderung. Sie dürsten nach möglichst viel und lautem Applaus. Sie rufen, in religiöser Manier, die „einfachen Menschen“ an, feuern sie an. Sie brauchen den per tosendem Applaus herbeigeführten Rausch. Sie lechzen nach Atmosphäre, nach emotionaler Stimmung, nach der Hitze der Emotion. Denn sie ziehen den Genuss ihrer politischen Legitimation aus genau dieser Stimmung. Wenn Sie, verehrter Leser, sich im Bierzelt dieser Stimmung hingeben, euphorisiert schunkeln und klatschen, werden Sie am Ende dieses Klatschen sehr wahrscheinlich in eine Wahlstimme umwandeln. Deswegen stemmen „Volkskanzler“ und solche, die es noch werden wollen, im Trachtenjanker Bierkrüge und hopsen zu Blasmusik, hauen mit der Faust auf den Tisch und erzeugen die Stimmung von Revolten.
L’esprit de l’egalité estque chaque individu soit une portion égale de lasouveraineté,c’est-à-dire du tout.[Der Geist der Gleichheit ist, dass jedes Individuum eingleicher Teil des Souveräns ist. Allgemein gesprochen.]1Saint-Just, 1791
Das Volk, il popolo, le peuple I
Die Vorstellung davon, was ein Volk im politischen Sinne ist, folgt neuerdings immer öfter den Gesetzen einer hochidealisierten Fantasie. Das „Volk“ oder der „Pofel“, il popolo, le peuple, wir also, sind, was die Macht des Mächtigen ist: realpolitische Verhandlungsmasse ebenso wie fantastisches Gebilde. Wir sind aber auch die Claqueure, die Klatscher, die bereitwillig applaudieren und adorieren. Wir sind auch jene, die auf den Straßen zürnen und über die Macht verfügen, die Mächtigen zu Fall zu bringen. Wir, das Volk, sind in einer Demokratie eine Gesellschaft, also diejenigen mit der rechtlich verbrieften Freiheit, die Mächtigen (friedvoll) abwählen zu können. In anderen Systemen als einer Demokratie müssten wir sie stürzen.
Wer Volk statt Gesellschaft sagt, meint meist nicht eine heterogene Gesellschaft. Wer Volk sagt, der meint ein im Geiste vereinigtes Volk, ein hermetisches Kollektiv, das keine sozialen Nuancierungen kennt.
Doch ist das Volk tatsächlich eine idealisierte, archaische Masse, die zu ritualisierten Zeiten als bierschwangeres folkloristisches Spektakel in Erscheinung tritt und vor Begeisterung klatscht, sobald ein Kanzler (so unlängst in Österreich passiert) auf einem Volksfest ein Bier „auf ex“ trinkt? Ist ein Volk, ein perfektes, geistig harmonisiertes Volk, das es lässig findet, wenn sein „Stammesführer“ den auf einen Schluck leer getrunkenen Bierkrug wie eine Trophäe in die Luft streckt? Sind ein Volk, und noch ein Volk, und noch ein Volk mehr von Gewicht und besser als eine Gesellschaft? Ist das Volk ein „erzeugender Geist“, wie der Philosoph Fichte in seinen Reden an die Nation 1808 einst meinte? Wohl kaum. Oder doch?
Das Volk und seine Mächtigen befinden sich in einer verhängnisvollen Liaison, die sich, wie jede Beziehung, von der Spiegelung gegenseitigen Begehrens nährt. In dieser politischen Beziehung ist es also wie im eigenen privaten Beziehungsgeflecht: Wo die Grenzen von Individuen mit denen anderer verschwimmen, verschwimmen zugleich auch ihre Identitäten. „Wir“ werden eins, „wir“ sind die Welt. Diese Sehnsucht nach einem „Wir“ muss wohl aus dem romantischen Bedürfnis nach Harmonie resultieren und einer ewigen, sehnsuchtsvollen Erzählung. Es hat vermutlich mit dem Wunsch in uns, in jedem Einzelnen von uns zu tun, ähnlich oder gleich sein zu wollen wie andere. Es steht in Zusammenhang mit dem Begehren nach Harmonie, aber auch der geballten Macht eines Kollektivs, sei es als Nation, als Ethnie, als bionationale Entität. Wer „unser Volk zuerst“ oder „America first“ skandiert, signalisiert, dass er eine Idealvorstellung von einem Volk in Harmonie hat. Wer umgekehrt nach einem Volkskanzler für alle begehrt, muss wohl ein ähnlich homogenes Volk von Gleichen im Kopf haben. Spinnen wir den Gedanken weiter: Was würde es für eine Gesellschaft, für uns alle, tatsächlich bedeuten, ein Volk zu sein und einen Volkskanzler an der Spitze des Staates zu haben, welche Menschen, welche Lebensstile würden zum stellvertretenden Maßstab für das Volk?
Das Angebot, „Volkskanzler“ werden zu wollen, sich als Stimme eines Volkes, eines „Wir“ auszugeben, ist demnach wohl nichts mehr als eine bittere Verheißung, die sich gerade nicht an eine Gesellschaft richtet. Ein Volkskanzler, der sich an ein Volk wendet, hat kein Interesse an einer pluralistisch-sozialheterogenen Gesellschaft. Da der demokratische Staat, und nur der demokratische Staat, vom Prinzip des individuellen, personalen Rechts ausgeht, ermöglicht eine Demokratie einer Gesellschaft ein Höchstmaß an unterschiedlichen Lebensweisen und Lebensstilen. Richtet sich ein Volkskanzler an ein Volk, dessen Merkmale per se feststehen – nämlich ethnisch und kulturell homogen zu sein –, stellt er sich folgerichtig früher oder später gegen den demokratischen Staat und jene Teile der Gesellschaft, die sich nicht ins Volkskonzept fügen. Anders formuliert: Ein Volkskanzler ist gegen Vielfalt und im Kern anti-demokratisch. Wer Volkskanzler sein will, ist anti-pluralistisch und damit anti-demokratisch.
Denn eine Gesellschaft entspricht im realen Leben nie einer gefühls- und gedankengleichen Illusion. „Ein Volk“ hingegen schon. Sollte es am Ende des Tages der Geschichte und der Demokratien doch zur politischen Realität eines Volkes kommen, wird die rein idealisierte Gesinnung zur Vermessung des Volkes herangezogen werden, und das wären ethnische und kulturpolitische Kriterien. Die Macht, die von einem solchen Volke ausgeht, ist, weil sie alle realen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren unberücksichtigt lässt, konsequenterweise die Macht eines Idealbildes, in das nicht alle im Staate Lebenden passen.
Macht, besonders politische, beruht stets auf vertikallinearen Ordnungen. Ganz oben steht in einer Demokratie das positive Recht, ihm haben sich ausnahmslos alle unterzuordnen. Es kann nur mit der und durch die Kraft des Parlamentes verändert werden. In autokratischen und totalitären Systemen ist hingegen der Präsident ad personam die letzte Instanz. Er steht als Einziger über dem Recht, weil er nicht das Recht repräsentativ verkörpert, sondern er selbst das Recht ist. Er bekleidet nicht nur für bestimmte Zeit einer Wahlperiode die Rolle eines ersten, obersten gemeinsamen Volksgeistes – er ist der Geist.
Da in einer parlamentarischen Demokratie die Gewaltenteilung dafür sorgt, dass es zu keiner Machtkonzentration auf eine Person, Institution oder Gesinnungsgemeinschaft kommt, ist nachvollziehbar, woher das Begehren aufstrebender Volkskanzler herrührt, einem Volke vorzustehen. Der Rechtsstaat, wie ihn Volkskanzler vertreten, meint also einen Staat, in dem das Recht der Politik zu folgen hat, und zwar einer Politik, die der Volkskanzler ad personam vorgibt.
Einen Volkskanzler, der über ein Volk herrscht, das sich durch nichts als eine Gesinnungsgemeinschaft auszeichnet, sollten wir fragen, was mit jenen Menschen passiert, die aufgrund ihres sozialen, religiösen, politischen, individuellen Lebensstils außerhalb des festgelegten Volksbegriffes bewegen. Die für sich einen Lebensstil gewählt haben, der sich einem allgemeinen Diktat (Volkswillen) nicht unterzuordnen bereit ist. „Wir“ sollten uns fragen, was passiert unter der Herrschaft von Volkskanzlern mit den Befürwortern einer parlamentarischen Demokratie und Gewaltenteilung, den Vertretern von Pressefreiheit, den Verteidigern und Verteidigerinnen von universellen Menschenrechten und Völkerrecht, den Kritikern der Volksgemeinschaft?
Sie genießen, so lehrt uns die Geschichte, nicht die volle Fürsorge der Volkskanzler, weil diese schlicht und einfach selbst bestimmen, wen sie zum Volk zählen und wen nicht. Für Volkskanzler sind sie im Grunde nicht sichtbar oder, noch schlimmer, lästige Störer und nicht Teil des gemeinsamen Volksgeistes. Sie gelten als anders oder fremd, gar als störend. Daher unterliegen sie ausgeklügelten Strukturen von Observanz des Volkswillens und des Volkskanzlers. Ausgeliefert der Gnade einer Volksidee und nicht geschützt von einem allgemeingültigen positiven Recht.
So gipfelt die zur Perfektion getriebene Macht eines Volkskanzlers in der Herrschaft einer finsteren Illusion, einem Ideal im Kopf, wie wir das sonst nur vom Totalitarismus kennen. Aus historischer Anschauung wissen wir, dass der Weg von einer heterogenen Demokratie in die Herrschaft eines Volkes über die teilparlamentarische Autokratie führt. Es sei denn, es erfolgt durch einen Putsch ein drastischer Systemwechsel von einer demokratischen Gesellschaft in ein Volkssystem. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns gegenwärtig der Anzeichen einer Erosion der Demokratie gewahr werden.
In der politischen Praxis beinhaltet der Weg in eine Autokratie Attacken auf Parlament und längst ausgehandelte universelle Rechte gleichermaßen wie gegen nicht gesinnungsgleiche Medien. Auf der geistigen Ebene kommt es dabei zu einer Art Umformung einer diversen Gesellschaft in eine reine, homogene Illusion von einem Volk und Angriffen auf nicht gleichgesinnten „Eliten“. Die Geschichte des „deutschen Volkes“ hat uns dies gelehrt und die Gegenwart, so scheint es, wiederholt gerade die Geschichte.
Ein wenig anders verhält es sich mit dem Traditionsbegriff des französischen le peuple oder des italienischen il popolo, die aus sozialpolitischen Revolten und Revolutionen hervorgingen. So ist das deutsche Volk immer schon auferstanden als ewiger Selbstbehauptungswille politischer Niederlagen (vor allem gegen die Franzosen) und andere geistiger Ideale. Das deutsche Volk zählte den Pöbel (vulgus) nie zu seinem „bürgerlichen Ganzen“, der Nation, wie Kant es einst formulierte.2 Das Volk der Deutschen war immer schon die bloße Vorstellung eines elitären Bürgertums, nie Ausdruck einer Gesellschaft. Es war also immer schon auf eigene Weise national idealisierend, somit ausgrenzend, nicht einend.
Deswegen sind die Vertreter der reinen Idee eines Volkes nur zu gern dem Geist des deutschen Idealismus verpflichtet und nicht an einer sozial heterogenen Gesellschaft interessiert. Darum betreiben sie eine Politik der Destruktion und attackieren bestehende Konzepte einer diversen Gesellschaft. Eben darum mangelt es ihnen an inhaltlichen Programmen, denn sie verlassen sich auf eine historische, elitäre Idee. Und unter Zuhilfenahme der Illusion von einem Volk in einem national-religiösen und kulturellen Erweckungsgeist schielen sie einmal mehr auf eine Alleinherrschaft.
Die Vorstellung eines Volkes, bestehend aus reinen Menschen mit reiner Seele und einer „ethnischen Kontinuität“,3 wie es der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl schonungslos ehrlich und erschreckend formulierte, ist – gemessen an den sozialen Wirklichkeiten – eine altbackene Idee, deswegen aber keineswegs unbedenklich. Sie mag als politisches Programm populismustauglich sein, führt jedoch an den tatsächlichen Problemen einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts vorbei. Eine schemenhafte Volksidee zum Programm zu erheben, dient daher nur einem Zweck: den kollektiven Selbstbehauptungswillen der Deutschen (und Österreicher) zu wecken, um damit nach der Macht zu greifen. Die Illusion vom Volk wird in seiner Bedeutung aufgebläht, indem dessen Bedrohung düster gezeichnet wird, und dafür verantwortlich gemacht werden alle repräsentativen Institutionen eines demokratischen Staates. Daraus resultiert die Devise Das Volk gegen den demokratischen Staat. Ein verhängnisvolles Verlangen.
Dazu passt, dass auf einem der letzten Parteitage der AfD unumwunden die Demontage der EU in der Präambel des Leitantrages zur Europawahl offengelegt wurde. Erst angesichts der Reaktionen auf die politische Brisanz dieses Bekenntnisses ruderte die Partei mit der Begründung, dies sei „ein Versehen“ gewesen, zurück.4 doch fällt es schwer, dem Glauben zu schenken, zumal wir von Ungarn ein lebendiges Beispiel zur Umsetzung solcher Ideen geliefert bekommen. Viktor Orbán macht es uns seit geraumer Zeit vor, lange (zu lange) geduldet, gar unterstützt, von den europäischen Volksparteien. Und auch in Italien macht sich die Postfaschistin Giorgia Meloni aktuell daran, um vermeintlich im Sinne des italienischen Patriotismus Änderungen demokratischer Strukturen, zum Beispiel des Wahlrechts, vorzunehmen. Alle diese rechten Volksillusionisten betonen unermüdlich, für ihr Volk da zu sein, Stimme ihres Volkes zu sein, und alle meinen nur einen gewissen Anteil der Bevölkerung des Staatsvolkes. Was sie dabei eindeutig nicht tun: die Interessen einer Gesellschaft vertreten, die realpolitischen Probleme zu lösen. Doch wie gelingt ihnen das so gut, wie kommen sie zu immer mehr Wählerstimmen, wenn sie Wahlen doch eigentlich am liebsten gleich ganz abschaffen würden?
Sie alle eint: Sie beschwatzen uns, sie repräsentieren und promenieren, sie plustern sich auf, sie befeuern uns, sie frömmeln, biedern sich dem Volke als Beschützer vor einer Gefahr an, die sie selbst vorzeichnen.
Obwohl sie überdurchschnittlich verdienen (oft bis zu zehnmal mehr als das Medianeinkommen beträgt), gerieren sie sich als Volksvertreter, als Stimme „einfacher Menschen“, als Vertreter einer Macht, die vorgibt, gegen den Moloch eines demokratischen Staats aufzustehen, um eine neue Gerechtigkeit herzustellen. Diese schon demagogische Manier hat sich inzwischen zu einer Mode ausgewachsen, der besonders die konservativen Parteien bereit sind zu folgen. Tragischerweise praktizieren derlei konservative Parteien. Schlecht über amtierende, demokratisch gewählte Regierungen oder den Staat zu reden, hat sich besonders bei der bisherigen konservativ-demokratischen Mitte in Deutschland zu einem Trend entwickelt. Während in Österreich die bis 1999 durchaus als solide Mitte geltende und gerade regierende Volkspartei seit einigen Jahren eine besonders paradoxe Doppelrolle einnimmt. Sie spielt Regierung und Opposition zugleich, fantasiert von einem Volk „Normaldenkender“ und teilt damit die Gesellschaft in Normale und Nicht-Normale ein. Dabei wird kein Hehl daraus gemacht, wer als normal gilt: wer nicht gendert, wer viel Fleisch isst, wer ein Auto mit Verbrennermotor fährt, wer sein Geld für Schweinsbraten und Schnitzel ausgibt und nicht für den Döner – camoufliert formuliert „klassisch-regionaltypisch“ isst. Derlei wird zu allem Überfluss noch mit einem Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz unter ideologischer Berufung auf die Pflege „kulinarischen Erbes“ verbrieft.5 Der Kanzler selbst, Karl Nehammer, nahm ohne einen Anflug von Scham eine Definition des „Normalen“ vor und verschob damit en passant die Grenzen des gemeinhin als normal Geltenden (nämlich nicht amtlich bestätigt unzurechnungsfähig zu sein), indem er Klimaaktivisten mit Rechts- und Linksliberalen in einen Gulaschtopf von Nicht-Normalen warf. Dies wurde dann selbst dem Bundespräsidenten zu viel. Er wandte sich umgehend an die Österreicher und Österreicherinnen und warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft.6 Woraufhin sich wiederum der Kanzler auf allen denkbaren Social-Media-Kanälen bockig im Habitus und indirekt gegen den Bundespräsidenten – immerhin der oberste Mann im Staate – in Stellung brachte, er lasse sich das Wort nicht verbieten, das sei alles nicht mehr normal. Politisch geschulten Ohren fiel auf, dass der ÖVPKanzler dabei weit von einer geziemenden Mitte-Haltung abrückte und vielmehr einen rechtspopulistisch-demagogischen Schwung anspitzte: Er – der sein Amt im Übrigen nur vom ursprünglich hochgelobten Volkskanzler Sebastian Kurz übernommen, also nur geerbt hatte – stellte die demokratisch legitimierte Autorität des direkt gewählten Bundespräsidenten in Frage. Im Stile eines „Volkskanzlers“ erweckte er den Eindruck, der Ruf nach Mäßigung durch den Bundespräsidenten wäre eine Attacke auf das „Volk der Normalen“. Ohne es auszusprechen, verwandelte sich der damals amtierende Kanzler aller Österreicher und Österreicherinnen zu einem Volkskanzler für einige Auserwählte.
Das Volk, le peuple, der „Volkist“ II
Als im Jahr 1846 erstmals das Buch Le peuple als Das Volk1 in deutscher Übersetzung erschien, führte der Autor und Historiker Jules Michelet den Begriff Volk als kollektive, gesellschaftliche und sozial nuancierte Größe, als Masse, als identitätspolitische Kategorie in die europäische Bildungselite ein. Damit unterschied sich sein Konzept, das „Volk“ als soziale Melange zu denken, markant vom deutschen Volksbegriff eines geistig-lyrisch idealisierten, bürgerlichen Volkes. Heute würde er vermutlich an die Stelle von Volk Gesellschaft schreiben.
Das deutsche Volk entspringt in seiner (nicht endgültig geklärten) etymologischen Herkunft dem germanischen „volc“, womit – vor allem militärisch-aggressiv besetzt – ein Heerhaufen gemeint war. Seine heutige ethnisch-kulturelle Assoziation erlangte es während der Erweckungsphase der Nationalstaaten, samt romantischidealisierender Note, und seine hässlichste Seite gipfelte in der rassischen Volkstumsideologie der Nationalsozialisten. Die zurzeit gebräuchliche Abkehr vom politischen Begriff der Gesellschaft oder Gemeinschaft und einer ihr zugrunde liegenden Ansammlung heterogener Menschen zur Hinwendung eines homogenen Volkes rekurriert auf ein Konzept der „Geburt des Volkes aus dem Geiste eines Ideals“2, wie wir inzwischen wissen.
Nicht frei von Sarkasmus drängt sich beim derzeitigen lauten Gewese ums Volk die Frage auf, warum der gesellschaftliche Diskurs bis jetzt deutsch-sprachlich keine „Volkisten“ hervorgebracht hat. Wir kennen, in Anlehnung an das lateinische populus, den Populisten und jüngst wieder, in Österreich, einen Anwärter auf das Amt eines Volkskanzlers, aber einen Volkisten kennen wir nicht. Ein Schalk, wer jetzt lautmalerisch das Wort Volkist rezitiert. Aber gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Populisten, dem Volkskanzler und dem sprachlich noch nicht bekannten Volkisten?