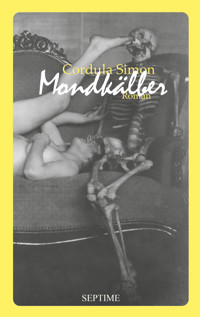45,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend academics
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein wissenschaftlich fundiertes Buch über Sprache und Wissenschaft, aber nicht über Politik: Beantwortet wird die Frage, ob die sogenannte politisch korrekte Sprache einer moralisch besseren Welt dienlich ist. Slogans wie Sprache sind ein Abbild der Welt. Sprache lenkt das Denken, Sprache ist Handeln, Sprache ist Macht und Sprache ist Gewalt. Cordula Simon und Stefan Auer verfolgen Text für Text bis zu ihren Quellen und Fußnoten. Dabei decken sie unzählige Falschzitate, Irrtümer, Unterstellungen und wissenschaftlich nicht fundierte Annahmen auf. Immer wieder Falschheiten über Linguistik wiederholend stellt sich die sogenannte linguistische Wende als in ihrem Wesen fundamental anti-linguistisch heraus. Anschließend werden empirische Studien, Framing, Gendern und die Mechanismen der Wissenschaft beleuchtet, die jenen Fehlern vorbeugen hätten sollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ebook Edition
Cordula Simon Stefan Auer
Politische Korrektheit, Wunschdenken und Wissenschaft
Das Versagen der Universitäten im Diskurs um Sprache
Mit freundlicher Unterstützung des Verein Deutsche Sprache e. V.
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendacademics.com
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz:CC BY-NC-ND 4.0; weitere Informationen finden Sie unter:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Print-ISBN: 978-3-949925-18-4
E-Pub-ISBN 978-3-949925-19-1
https://doi.org/10.53291/9783949925191
© Westend Verlag GmbH, Neu-Isenburg 2024
Umschlaggestaltung: Westend Verlag, Neu-Isenburg
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Mag. phil. Cordula Simon, BA phil., Studium der deutschen und russischen Philologie und Gender Studies in Graz und Odessa. Lebt als freie Autorin, zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Wissenschaftliche Schwerpunkte: Medien, Linguistik, Propaganda, Fake News, Desinformation, Mediale Literarizität.
Mag. phil. Stefan Auer, Studium der Geschichte und Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz. Wissenschaftliche Schwerpunkte: Propaganda & Desinformation, politische Ideologien und Weltanschauungsanalyse.
Wir danken unseren guten Lehrern für all das, was wir nur von ihnen lernen konnten. Wir danken unseren schlechten Lehrern für all das, was wir nur von ihnen lernen konnten.
Inhalt
Cover
Einleitung
I | Slogans und Namen zur Verteidigung einer politisch korrekten Sprache
1.1. Sprache spiegelt die Welt, Sprache bildet Welt ab – vom Sichtbarmachen und Unsichtbarmachen in der Sprache
1.2. Hermann Paul und die Junggrammatiker – Neger, Schwarze, PoC?
1.3. Sprachliche Relativität oder: Ist unsere Welt oder unser Denken begrenzt durch Sprache?
1.4. Sprache ist Handeln – lies mal John Austin!
In Kürze
II | Sprache ist Macht – und die Franzosen sind Theoretiker
2.1. Über die Diskursmacht
2.2. Alles ist Text – oder vielleicht auch gar nichts?
2.3. Der Empfänger einer Nachricht entscheidet über die Bedeutung
2.4. Wer Macht hat, hat Sprache
In Kürze
III | Sprache ist Gewalt
3.1. Auf Theorie folgt Theorie
3.2. Konsequenzen im deutschsprachigen Raum
In Kürze
IV | Sprache und Denken – wir haben wissenschaftliche Ergebnisse
4.1. Framing und die empirische Wissenschaft
4.2. Framing und die weniger empirische Wissenschaft
4.3. Framing im medialen Gebrauch – soziologische Hintergründe statt linguistischer Fakten
4.3.1. Was wir aus dem Korpus lernen können – und was nicht
4.3.2. Das soziologische Rauschen im Hintergrund
In Kürze
V | Konfliktstoff Gender
5.1. Die leidigen grammatischen Hintergründe
5.2. Warum man dennoch an den Sexus im Genus glaubt
5.3. Die empirischen Ergebnisse zum Thema Gendern im Deutschen und die Wirklichkeit der Sprachen
In Kürze
VI | Das Versagen der Universitäten im Diskurs um Sprache
6.1. Wissenschaft im Konflikt – science wars
6.2. Das Versagen der Universitäten – millenial edition
6.2.1. Konstruktivistische Logik und ideologischer Zeitgeist in der Forschung
6.2.2. Pseudowissenschaft, Bias und der Kampf gegen Windmühlen
6.2.3. Sprachwissenschaften und Gender Studies – der deutschsprachige Raum im Spannungsfeld zwischen französischen und amerikanischen Theorien
6.3. Das Internet ist alles, was der Fall ist
In Kürze
Konklusion
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Autorenverzeichnis
Sachregister
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
But, oh, I‘m just a soul whose intentions are good Oh, Lord, please, don‘t let me be misunderstood
Nina Simone, Strophe aus dem LiedDon’t Let Me Be Misunderstood, 1964
Ein Linguistikprofessor erklärt den Studenten, dass es Sprachen gibt, in denen eine doppelte Verneinung die Verneinung verstärkt, wie zum Beispiel im Russischen oder im Französischen, aber ebenfalls Sprachen, in denen eine doppelte Verneinung eine Bejahung bedeutet, wie im Deutschen. Eines jedoch gebe es nirgends: In keiner bekannten Sprache sei eine doppelte Bejahung eine Verneinung. Aus der letzten Reihe meldet sich ein Student und sagt: »Ja, bestimmt.«
Haben Sie sich je gefragt, wie es denn sein kann, dass Sprache alles und das Gegenteil davon bedeuten kann? Dass Familienmitglieder und enge Freunde verstehen, was man meint, wenn man Ding sagt oder man sogar ganze Sätze aus Dings, dingsen und Dingen bilden kann? Haben Sie sich, wenn Sie darauf hingewiesen wurden, dass man bestimmte Wörter nicht mehr sagen solle, denn sie seien diskriminierend, gefragt, warum sie es zuvor nicht waren? Haben Sie gewagt zu fragen warum und dann vielleicht Antworten bekommen wie: »Sprache spiegelt die Welt«, »Sprache ist Macht«, »Sprache ist Handeln«, »Alles ist Text«, »Sprache konstruiert die Welt« oder auch »Sprache ist Gewalt«? Haben Sie daraufhin überlegt, wie genau das denn funktioniere, dieser Einfluss der Sprache, was denn der Mechanismus sei, der dahintersteckt?
Wir haben uns diese Fragen gestellt. Wir haben uns, festen Wunsches, den Heiligen Gral zu finden, umfassend auf diese Fragen eingelassen. Wir haben nach den Gründen gesucht, wie und warum eine sensible Sprache, eine »politisch korrekte Sprache«, wie man sie heute nennt, ihren positiven Einfluss in die Welt bringt. Denn wenn es eine Möglichkeit gibt, mit Worten Berge zu versetzen, dann ist dies doch die Erfüllung eines Wunschtraumes von uns und vermutlich von vielen anderen in der schreibenden Zunft, so dachten wir. Wie wundervoll wäre es, betteten wir unsere Wünsche in die Sprache und die Welt würde durch sie heil, könnten wir aus innerer Kraft heraus das Gute in die Natur hineinflüstern und zugleich Fakten schaffen.
An dieser Stelle müssen wir vorausschicken, dass dies kein Buch über Politik ist, sondern über Sprache und Wissenschaft. Wir haben dieses Werk nicht geschrieben, um weltanschauliche Missionierung oder Exorzismus zu betreiben. Wir diskutieren nicht darüber, welche Moral in politischen Debatten und Grabenkämpfen die richtige sein mag. Wir lassen uns nicht auf themenfremde Scheingefechte ein oder uns von vorgeblich moralischen Nebelkerzen ablenken. Wir bemühen uns stets, auf jene Grenzen hinzuweisen, an denen Wissen und Wissenschaft enden und Glaube beziehungsweise Weltanschauung beginnen – Grenzen, die teilweise bewusst oder unbewusst, wissentlich oder unwissentlich, von jenen Akteuren, über die wir in diesem Buch schreiben, obfuskiert werden. Dies ist unser Versuch, nach bestem Wissen und Gewissen auf wissenschaftlich-fachlicher Ebene anstatt auf moralisch-ideologischer an die Materie heranzutreten, die aus unserer Sicht eben gerade moralisch-ideologisch höchst kontroversiell ist. Daher haben wir versucht, kenntlich zu machen, wo in den von uns behandelten Texten die wissenschaftliche Argumentation endet und die moralische beginnt.
Wir haben natürlich selbst Wertvorstellungen und moralische Prämissen und wissen daher, wie schwierig es ist, nicht blind und taub für wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten zu werden sowie Uneindeutigkeiten und Dissonanzen in der eigenen Weltanschauung hinnehmen zu müssen. Wir können unserem Leser versichern, dass auch wir einiges an – nennen wir es – Wachstumsschmerzen zu erleiden hatten, als wir uns durch die Quellenlektüre kämpften.
Was verstehen wir in diesem Buch unter der titelgebenden politischen Korrektheit? Unter diesem – je nach Weltanschauung – teils höchst unterschiedlich konnotierten Begriff subsumieren wir all jene sprachlichen Veränderungen, die primär angetrieben werden durch einen moralischen Impetus. Sprachliche Veränderungen bedeutet hier, dass Worte wie zum Beispiel Zigeuner oder Indianer plötzlich aus moralischen Gründen als verpönt, als diskriminierend gelten und ersetzt werden sollen, zudem sprachliche Veränderungen der Grammatik, wie das Gendern, und damit die Beid- oder gar Vielfachnennung der Geschlechter, ebenso wie Veränderungen der Grammatik wie zum Beispiel beim Wort Flüchtlinge zu Geflüchtete oder Schutzsuchende. Moralisch bedeutet in diesem Zusammenhang den Wunsch, die Welt nach eigenen, bestimmten Wertvorstellungen zu verbessern, sie harmonischer, sensibler und oft gleichberechtigter sowie weniger diskriminierend zu machen, etablierte Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen, um weniger privilegierte Mitglieder der Gesellschaft zu schützen und zu fördern.
Unser oberstes Anliegen ist jedoch nicht die Moral oder die politische Position jener, die diese Forderungen nach Sprachnormierung forcieren – für uns ist von Interesse, mit welchen Argumenten sie üblicherweise (inhaltlich) begründet und verteidigt werden.
Ebenso befassen wir uns nicht mit Redefreiheit, juristischen Tatbeständen oder Grenzfällen der Beleidigung, Verhetzung oder Hasssprache im Netz. Wenn wir von Sprache schreiben, beziehen wir uns auf Alltagssprache der Sprachgemeinschaft, auf die sich politische Korrektheit zunehmend auswirkt: Die Annahme, dass Sprache die Welt in einer eindeutigen Art und Weise beeinflusse, kommt gerade aus dem universitären Umfeld und wir werden ihre Genese nachzeichnen. Eine Annahme, die von ihren stärksten Vertretern im Diskurs über die Beschaffenheit von Sprache als Forderung an Medien, Politik und Schulen gerichtet wird und so die Sprache aller Sprachteilnehmer gerechter machen soll. Gerade im Forschungsbereich zu Sprache gibt es jedoch eine starke Tendenz, wissenschaftliche Rigorosität zu vernachlässigen. Wir wollen außerdem vorausschicken, dass unser Text keineswegs behauptet, dass alle Universitäten und alle ihre Mitglieder versagt hätten – dies ist keinesfalls so. Wir sind jenen, die uns in den Genuss eines soliden, logisch-kausal erklärenden Unterrichts von Wissen und der wissenschaftlichen Methodik brachten, zu tiefstem Dank verpflichtet. Einige werden unzufrieden sein mit der verknappten Darstellung des Werkes mancher Autoren – wir haben uns gerade bei vielen Theoretikern darauf beschränkt, unseren Blick auf ihren Beitrag in Bezug auf den Diskurs um Sprache klar abzugrenzen. Die Fülle ihrer gesamten Theorien wiederzugeben hätte schlicht unseren Rahmen gesprengt und ist für unser sprachwissenschaftliches Thema nicht relevant.
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, Argumente zu sammeln, die Befürworter sprachlicher Maßnahmen vorbringen, und diese mit dem zu vergleichen, was wir über Sprache wissen, um sie in den universitären Diskurs einordnen zu können. Wissen steht hier im Kontrast zu Glauben, Hoffen, Wünschen – was wir nicht begründen konnten oder sich letztlich nur auf ideologische Grundannahmen stützte, musste kenntlich gemacht und hinterfragt werden. Wissen bedeutet hier ebenso nicht, was in diversen Medien gemeinhin als Wissen über Sprache präsentiert wird, sondern das, was nach wissenschaftlich rigorosen Maßstäben als gesichert gilt – zu dieser Unterscheidung werden wir detailliert im letzten Kapitel zurückkehren.
Anstatt Argumenten begegnen uns in Diskussionen häufig Slogans wie jene, die wir zu Beginn unserer Einleitung genannt haben. Diese Sätze mögen plakativ sein, enthalten jedoch keine schlüssigen Begründungen – sie können nicht für sich stehen, sie müssten erklärt werden und allzu oft machen sich Vertreter der politischen Korrektheit diese Mühe nicht. Daher haben wir sie zu unseren Fragestellungen gemacht: Ist Sprache ein Abbild der Welt? Ist Sprache Macht oder gar Gewalt? Wir folgen diesen Slogans bis zu ihrer Herkunft zurück, um sie auf den wissenschaftlich gesicherten Anteil ihres Wahrheitsgehaltes hin zu überprüfen.
Auch wenn Erklärungen für diese Slogans oft ausbleiben, waren uns viele von ihnen aus unserer eigenen universitären Erfahrung bekannt. Da sie in Diskussionen oft mit mehr oder weniger prominenten Namen in Verbindung gebracht werden, gab es weitere Hinweise auf ihre Herkunft: Nach dem Motto Educate yourself! solle man doch bitte selbst bei Austin, Bourdieu, Derrida oder anderen nachlesen, bevor man ungebildet Stellung bezieht.
Wir sind dieser Aufforderung nachgekommen, haben die Texte gelesen und sind den in vielen Fußnoten genannten Quellen bis hin zu ihren linguistischen Ursprüngen gefolgt – tief in den Kaninchenbau hinein. Wir untersuchen ebenso die Forschungsströmungen und Lehrmeinungen in den Akademien und betrachten Fallbeispiele. Schließlich werden wir uns mit dem Fragekomplex beschäftigen, was man nun mit all diesen Informationen anfangen kann.
Kommen Sie mit auf unsere Erkenntnisreise, die wir zum einfacheren Verständnis umgedreht haben: Bei den Argumenten, die der politischen Korrektheit zugrunde liegen, haben wir uns in der Historie ihrer Entwicklung im Krebsgang vorgearbeitet, um die Herkunft der in Texten übernommenen unerklärten Grundthesen sichtbar zu machen. Bei der Kapitelordnung hingegen – wenngleich nicht innerhalb der Kapitel – gehen wir chronologisch vor. Wir müssen daher unser Publikum bereits hier um Verzeihung bitten, denn das erste Kapitel ist mit Abstand am schwierigsten zu erfassen; wir bitten Sie, dennoch durchzuhalten. Wir versprechen, dass alle kommenden Kapitel mit dem in ihm erlangten Grundwissen wesentlich einfacher zu verstehen sind, denn dies ist das wissenschaftliche Fundament, zu dem uns die Recherche letztendlich geführt hat. Zur Vereinfachung haben wir jedem Kapitel am Ende eine prägnante Zusammenfassung unserer wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse hinzugefügt.
Im ersten Kapitel stellen wir die Frage: Ist Sprache ein Abbild der Welt? Spiegelt sie die Welt wider? Zu diesem Zweck begeben wir uns an den Beginn der modernen linguistischen Forschung, vollziehen in Grundzügen ihre Genese nach und suchen zugleich Antworten auf die Fragen: Was macht Sprache eigentlich aus? Was unterscheidet sprachliche Zeichen von anderen Zeichen? Auf welcher empirischen Grundlage ist dieses Wissen entstanden? Wir zeigen die logischen Schlüsse auf, die daraus gezogen wurden. Zudem zeichnen wir nach, welche philosophischen Annahmen über Sprache zur damaligen Zeit populär waren und ob Sprache das Denken lenkt – dies halten wir rudimentär, da hier eher philosophische als empirische Überprüfungen als Grundlage dienten. Abschließend beantworten wir die Fragen: Ist Sprache Handeln? Was macht sprachliche Äußerungen zu einer Handlung und was nicht?
Im zweiten Kapitel beschäftigen wir uns mit den Fragen, ob Sprache Macht ist. Ist alles Text? Hat, wer Sprache hat, zugleich automatisch Macht? Hat der Rezipient, der Empfänger einer Aussage, immer recht mit seiner Interpretation? Hier werden Erkenntnisse besprochen, die auf den vorangehenden linguistischen Untersuchungen aus dem ersten Kapitel fußen, auch wenn sie selbst weder von Empirie über Sprache geprägt sind, noch aus der Linguistik stammen. Sie sind eher in Philosophie, Literaturwissenschaft und Soziologie beheimatet. Wir klären, welche Fehlannahmen und Fehlschlüsse sich bereits hier finden lassen und wodurch diese entstanden sind.
Im dritten Kapitel fragen wir: Ist Sprache Gewalt? Die hier besprochenen Texte berufen sich wiederum auf jene im vorhergehenden Kapitel und wir werden sehen, welche Thesen übernommen wurden, welche wegfielen, welche Fehler, die bereits in Kapitel 2 auszumachen waren, übernommen wurden und wo neue begangen wurden. Auch hier haben wir es nicht mit an sprachlichen Tatsachen überprüftem Material, sondern mit Theorie zu tun. In der Folge unternehmen wir einen kurzen Abstecher zu Autoren aus Gewaltforschung und Psychologie, die sich mit der Frage, ob Sprache Gewalt sei, befasst haben, um die Theorien besser kontextualisieren zu können.
Im vierten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem medial gehypten Begriff Framing, definieren und ordnen ihn historisch im Rahmen der Propagandawissenschaft ein: Ist Framing Propaganda? Was sind die empirischen Hintergründe, woher kommen sie und wie gesichert ist das, was uns hier unterbreitet wird?
Im fünften Kapitel befassen wir uns mit Gendern als zweitem gesonderten Thema: grammatisch, historisch und im Rahmen dessen, was wir bereits über Sprache gelernt haben. Aufgrund welcher Annahmen werden welche Vorschläge und Forderungen gestellt?
Im sechsten Kapitel konkretisieren wir die Frage nach dem Versagen der Universitäten, wie wir es – zugegeben nicht ohne Polemik – in unseren Buchuntertitel schrieben. Viele Gesichtspunkte dieses Versagens zeigen wir bereits auszugsweise in den Kapiteln 1–5. Hier klären wir nun, auf welche Form von Wissenschaftlichkeit sich die nicht haltbaren Behauptungen stützen, wie ihre Mechanismen funktionieren und wie es zu diesem Versagen kommen konnte, um dann – mit einer Hilfestellung für unsere Leser – zu zeigen, wie Wissenschaft funktionieren sollte und welche kritischen Punkte bedacht werden müssen, wird man mit neuem Wissen über Sprache konfrontiert.
Was uns antreibt, ist nicht politischer Wille, sondern aufklärerisches Ethos. Wir wollen die Menschen in ihrem Bestreben, sich selbst Gedanken zu machen, stärken und zugleich dazu beitragen, den oft erhitzten Diskurs durch differenzierte, faktenbasierte Argumente wieder zu zivilisieren. Wir legen keinen Wert auf das blinde Vertrauen unserer Leser. Vertrauen Sie uns nicht! Glauben Sie nicht einfach, denn Glaube ist – wie wir merken werden – oftmals der Feind des Wissens. Erscheint Ihnen etwas nicht nachvollziehbar, laden wir Sie ein, Ihr genaues Augenmerk auf die Fußnoten zu legen, ihnen nachzugehen, die Texte zu lesen und wenn Sie dennoch unzufrieden sind, wiederum den Fußnoten dieser Texte zu folgen. Wir haben uns daher bemüht, im Urwald der vielen verschiedenen Quellen nicht nur eine erstbeste Quelle, sondern die relevanten Quellen dahinter anzugeben, wo wir endlich fündig wurden und zufrieden waren. Zwar gehen wir davon aus, dass unsere Thesen korrekt sind, doch wir sind vor Fehlern natürlich nicht gefeit und heißen daher Kritikpunkte Ihrerseits, sofern sie zur Sache beitragen, die wissenschaftliche Erkenntnis voranbringen und klar an unserem Text festzumachen sind, willkommen. Denn wir legen am Ende unserer Reise, wie wir feststellen mussten, mehr Wert auf wissenschaftliche als auf politische Korrektheit. Das Folgende erklärt warum.
I | Slogans und Namen zur Verteidigung einer politisch korrekten Sprache
Hey, I love black people, but I hate niggas, boy.
Chris Rock, Bring the Pain, 1996
1.1. Sprache spiegelt die Welt, Sprache bildet Welt ab – vom Sichtbarmachen und Unsichtbarmachen in der Sprache
Oft vernimmt man in Diskussionen und Beiträgen die Behauptung, dass Sprache die Welt widerspiegle oder sie abbilde. Unsere erste Fragestellung lautet also: Bildet Sprache die Welt ab? Gibt sie eins zu eins wieder, was in unserer Welt passiert?
Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir zurück zu den Ursprüngen der sogenannten modernen Linguistik (Sprachwissenschaft) und zu ihrem Urvater, dessen Antwort auf diese Frage uns immer wieder begegnen wird in der Welt der Theorien. Es handelt sich dabei um den Schweizer Linguisten Ferdinand de Saussure (1857–1913). Man verbindet ihn gemeinhin mit dem Ursprung der sogenannten linguistischen Wende (auch sprachkritische Wende): Dieser Begriff steht für einen Paradigmenwechsel, also den Wechsel von einer bestimmten allgemein verbreiteten wissenschaftlichen Ansicht zu einer anderen.1 So wie es sich bei der kopernikanischen Wende um eine Revolution des astronomischen Wissens handelte, soll es sich hierbei um eine Revolution der Kultur- und Sozialwissenschaften handeln,2 mit deren Folgen wir im Laufe des Buches noch unsere liebe Not haben werden. Saussures Frage war wesentlich schwieriger zu beantworten, als es unsere Frage nach der Bildhaftigkeit von Sprache heute ist: Was ist eigentlich Sprache? Was ist der Gegenstand, an dem die Linguistik forscht, und wodurch zeichnet er sich aus? Wie verhält sich die Welt zur sprachlichen Darstellung?
In der Nussschale: Der Gegenstand der Linguistik ist Sprache, ein sozial gebildetes System aus Zeichen, deren Verbindungen arbiträr, assoziativ und konventionell sind. Sie kann zu einem bestimmten Zeitpunkt, also synchron, als auch sprachhistorisch vergleichend, also diachron, betrachtet werden. Ihre Zeichen können nur definiert werden über die Beziehungen, die sie zu anderen Zeichen innerhalb des Systems haben.3 Das mag auf den ersten Blick etwas kompliziert wirken und tatsächlich scheint den frühesten Lesern all dies recht unverständlich gewesen zu sein. Dies hängt zum Teil wohl damit zusammen, dass Saussure leider früh starb und sein 1916 posthum veröffentlichter Cours de linguistique générale (im Folgenden sowohl im Fließtext als auch in den Fußnoten als CLG abgekürzt oder als Cours bezeichnet) – jenes umfassende sprachwissenschaftliche Werk, auf das sich in den folgenden Jahrzehnten so viele berufen werden – nicht von Saussure selbst verfasst und editiert wurde, sondern eine Rekonstruktion studentischer Mitschriften ist. Die Aufgabe, der sich die beiden Herausgeber Charles Bally (1865–1947) und Albert Sechehaye (1870–1946) dabei stellten, war gewiss keine einfache, jedoch trug ihre Aufbereitung von Saussures Gedanken und Ausführungen letztlich kaum zum besseren Verständnis bei – im Gegenteil.4 Auf einige der daraus resultierenden Fehlschlüsse werden wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen.
Um darzulegen, wie sich die Begriffe aus unserer Nussschale – arbiträr, assoziativ und konventionell – gegenseitig erklären, beginnen wir mit einem Dreh- und Angelpunkt der saussureschen Definition von Sprache: arbiträr/Arbitrarität. Gerade dieser Begriff wurde von späteren Autoren leider gerne missverstanden oder als Dogma wahrgenommen, da er im CLG zu Anfang wie eine unverrückbare Grundannahme wirkt. Der aufmerksame, wohlwollende Leser hätte viele logische Zusammenhänge, wie sie später in Saussures nachgelassenen Schriften erläutert werden, allerdings auch selbst finden können.5Arbiträr bedeutet hier nämlich nicht zufällig, wie im alltäglichen Sprachgebrauch. Was ist an der Sprache also genau arbiträr und warum? Die Verbindung des sprachlichen Zeichens zu dem, worauf es referiert, ist arbiträr, die Verbindung zwischen Form und Inhalt also. In der Folge werden wir hier von Referenzen oder Verweisen sprechen, die sprachliche Zeichen erst zu solchen machen. Ein sprachliches Zeichen setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Der eine Teil ist das Bezeichnende, die Form, die Laut- oder Schriftfolge, was bei Saussure signifiant genannt wird, der andere ist das Bezeichnete, die Referenz auf den Inhalt, die bei Saussure signifié heißen wird.6 Die Herausgeber des CLG verwenden hier häufig den ursprünglichen Ausdruck des akustischen Bildes anstatt des von Saussure in späteren Vorlesungen gebrauchten signifiant, denn es existieren Laute und Lautfolgen, die gar nichts bezeichnen, und damit sind sie keine sprachlichen Zeichen und demzufolge nicht Gegenstand der Sprachwissenschaft.7 Beide, Bezeichnendes und Bezeichnetes, gehören zum sprachlichen Zeichen, es handelt sich nicht um außersprachliche Elemente.8
Das sprachliche Zeichen besteht aus zwei Elementen: Die Form des Zeichens hat mit dem Referenzobjekt keine Ähnlichkeit. Die Referenz ist so ein eigener Bestandteil des Zeichens. Quelle: eigene, dem Original im CLG nachempfundene Illustration der Autoren (siehe Saussures Original: CLG, S. 99).
Verkürzt kann man sagen: Es gibt eine Form und einen Inhalt, wobei Inhalt ungenau ist, da es sich nicht um den Gegenstand handelt, auf den verwiesen wird, sondern um den Verweis selbst, um die Referenz. Nicht das sprachliche Zeichen an sich ist arbiträr, auch nicht die Referenz, sondern die Verbindung (!) zwischen diesen beiden. Das bedeutet, dass sie nicht aneinandergekettet sind. Oder anders: Das Wort für Baum sieht nicht aus wie ein Baum und /baum/ hört sich nicht an, wie sich ein Baum anhört. Sprache bildet die Welt in dieser Weise nicht ab. So wie René Magrittes Bild einer Pfeife verkündet: »Das ist keine Pfeife.« (»Ceci n’est pas une pipe.«), denn es ist eben keine Pfeife, sondern das Bild einer Pfeife.
Magritte: Das ist keine Pfeife. Es ist das Bild einer Pfeife. Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:MagrittePipe.jpg.
Es hat Ähnlichkeit mit einer Pfeife, aber ein sprachliches Zeichen hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was es angeblich abbilden soll. Oder anders: Wenn wir 17 000 Jahre alte Höhlenmalereien vor uns haben, erkennen wir zum Beispiel Huftiere. Diese mögen eine tiefere symbolische Bedeutung für jene, die sie gemalt haben, beinhalten, das Abbild selbst können auch wir noch Jahrtausende später einwandfrei erkennen. Wer sich dagegen einmal an althochdeutschen, gotischen oder gar indogermanischen Textelementen versucht hat, weiß, dass Sprache keine solch simplen Rückschlüsse zulässt.
Wendet nun jemand ein: Aber Lautmalereien wie Kikeriki bilden doch genau das ab, worauf sie verweisen, wie kann die Verbindung arbiträr sein? Ist denn das nicht ähnlich genug? Doch auch diese unterscheiden sich in unterschiedlichen Sprachen und der Verweis könnte ebenso gut mit Cock-a-doodle-doo erreicht werden. Die Arbitrarität zeigt sich also in der Fülle an Sprachen, die es um den Globus gibt. Sie sind austauschbar und zugleich ist ihre Form, ihr signifiant, abhängig von dem Sprachsystem, in dem sie sich befinden. Auf manche sprachlichen Zeichen trifft dies mehr zu als auf andere: Manche, wie unser Baum, sind es vollständig, Begriffe wie einundzwanzig, zweiundzwanzig jedoch sind nach einem Muster gebildet, daher verwendet Saussure die Formulierung »relativ arbiträr«.9Aufbäumen wäre relativ arbiträr, denn wir wissen, was es bedeutet: Baumhoch werden, weil wir wissen, was ein Baum ist. Auch wenn hier schnell klar wird, dass es sich bei der Arbitrarität um kein Dogma handelt, es nicht einfach ein simpler Glaubenssatz ist, dem Saussure sich kampflos unterwirft, wird erst verständlich, wie das ein Merkmal von Sprache sein kann, wenn wir uns ihren anderen Merkmalen zuwenden. Jenen, die dafür sorgen, dass wir einander trotz aller Arbitrarität verstehen können: Der Assoziation und der Konvention. Assoziation ist hier nicht als mäandern in möglichen Interpretationen zu sehen, sondern schlicht als Verknüpfung: Das Bezeichnende wird mit dem Bezeichneten durch Assoziation verbunden. Ein psychologischer Vorgang, wobei Psychologie bei Saussure in jenem breiten Rahmen verstanden werden muss, der vor etwa einhundert Jahren noch üblich war, nämlich als Bezeichnung für sämtliche Vorgänge im Kopf, und kaum jemand wird abstreiten, dass beim Verwenden und Verstehen von Sprache Vorgänge im Kopf beteiligt sind. Noch genauer wäre hier: Was assoziiert wird, erklärt sich durch den Kontrast zu anderen sprachlichen Zeichen, also zu dem, was ein Zeichen alles nicht bedeutet. Für unsere Zwecke reicht es jedoch, die Assoziation als Verknüpfung wahrzunehmen. Diese Assoziationen sind zudem geformt, erlernt, ein soziales Phänomen, nämlich durch Konvention, durch die Übereinkunft von Sprechern einer Sprachgemeinschaft.
Saussure war sich dessen bewusst, dass ein Begriff, der im Großen und Ganzen die gleiche Bedeutung trägt wie ein anderer, auf das Gleiche verweist, dennoch eine abweichende Bedeutung haben kann, ebenso wie gleiche Formen auf durch und durch Unterschiedliches verweisen können:10 Das Wort Gaul und das Wort Pferd verweisen auf denselben Inhalt und dennoch bedeuten sie nicht ganz das Gleiche. Wie wir sie verwenden und bewerten, hängt davon ab, wie sie zueinander stehen.11 Daher gehören beide Teile des Zeichens zur sprachlichen und nicht zur außersprachlichen Welt, denn nur durch ihre Bezüge zueinander können wir sie verstehen.
Diese Bezüge sind erlernt: Im Spracherwerbsprozess erlernen wir die Konventionen unserer jeweiligen Sprachgemeinschaft, also welches Zeichen mit welchem Verweis assoziiert ist. Wir erlernen Konnotationen, die Beigeschmäcker von Wörtern, kleine Abweichungen in der Bedeutung, welche Worte in unserem Sprachsystem analog zu welchen gebildet werden und vieles mehr, was Einfluss auf Form und Verweis haben kann. Es sind diese erlernten Konventionen, die selbstverständlich gesellschaftlicher Natur sind und die Saussure als »soziales Faktum« bezeichnet.12 Daher bedeutet arbiträr auch nicht zufällig, sondern nur, dass es zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem eben keine natürliche Verbindung gibt. Arbitrarität bedeutet also nicht, dass der Sprecher Beliebiges verknüpfen kann, denn nur weil etwas potenziell alles bedeuten kann, bedeutet es nicht Beliebiges. Ein Individuum hat nicht die Möglichkeit, eigenmächtig Zeichen zu verändern, sondern eine Assoziation, eine Verbindung, muss in der Sprachgemeinschaft etabliert sein.13 Die Verbindung des Zeichens ist also a priori arbiträr, aber nicht sobald eine Verbindung hergestellt ist.14 Ohne Kenntnisse der Konventionen können schlicht von einem Teil des Zeichens keine Rückschlüsse auf den anderen gemacht werden, und wäre dem nicht so, bliebe uns das Erlernen von Fremdsprachen wohl erspart, weil real existierende Bezugsobjekte in allen Sprachen gleich klingen müssten. All diese Dinge stecken also in dem winzigen abstrakten Satz darüber, dass Sprache ein sozial gebildetes System aus Zeichen ist, deren Verbindungen arbiträr, assoziativ und konventionell sind. Für Saussure ist auch klar, dass es ohne Bezeichnetes kein Bezeichnendes gibt und umgekehrt. Dies definiert er, um den Gegenstand der Linguistik einzuschränken: Eine Lautfolge, die auf nichts verweist, die nichts bezeichnet, ist keine Bezeichnung und damit kein sprachliches Zeichen. Und wie soll, wenn das Zeichen fehlt, ein Bezeichnetes gefunden werden? Sie sind nicht voneinander zu trennen.15 Erst Assoziation und Konvention machen sie zur Sprache. Das Bezeichnete alleine ist also nicht »irgendetwas da draußen«. Das Herz der Sprache ist nicht eine Beziehung zwischen etwas Physischem und bestimmten Lauten, sondern eine innere Beziehung zwischen Gegensätzen und Unterschieden in Klang und Bedeutung.16
Worauf referiert wird, befindet sich außerhalb des Zeichens. Quelle: Eigene Illustration der Autoren, angelehnt an Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R. Studienbuch Linguistik (5., erweiterte Auflage). Max Niemeyer Verlag (Tübingen 2004), S. 31.
Selbst wenn die Herkunft einzelner sprachlicher Elemente geklärt werden mag, so sind es im Rahmen der Konventionen viele Faktoren, die zu einem Sprachverständnis führen. In den meisten Sprachen dieser Erde klingen beispielsweise die Wörter für Mama und Papa recht ähnlich. Es stellt sich heraus, dass gerade /m/ und /a/ Laute sind, die, ausgehend von ihrer Bildung im Mundraum, unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Laut mit völlig geschlossenem und einer mit vollkommen geöffnetem Mund, der größtmögliche Gegensatz, den der kindliche Sprechapparat bilden kann, formt Unterschiede im Klang, die das kindliche Gehirn wahrnimmt.17 Arbiträr im saussureschen Verständnis wäre dies dennoch, denn erst wenn etwas damit assoziiert ist, die Lautfolge zur Bezeichnung wird, wir als Kleinkind eine unserer ersten Konventionen erlernen, wird es zu Sprache. Die Lautfolge könnte auch mit anderen Dingen in der Welt des Kindes assoziiert werden und nicht zwingend mit dem Konzept von Mutter oder Vater. Ebenso ist diese Verbindung dem Sprechapparat, also einem physiologischen Diktum, unterworfen. Hätte die Evolution es anders mit uns gemeint und wir verfügten über Kehlen wie Papageien, wäre die Lautfolge für unsere ersten Bezugspersonen wahrlich eine andere. Deshalb sind Bezeichnendes und Bezeichnetes ohne einander keine linguistischen Gegenstände.
Bevor wir jedoch das, was wir von unserem Baumbeispiel gelernt haben, nämlich dass tree, arbre und Baum eben nicht aussehen oder sich anhören wie Bäume und keine Abbildungen selbiger sind, einfach für alle weiteren sprachlichen Zeichen unkritisch übernehmen, untersuchen wir, woher Saussure diese Definitionen nahm. Schließlich ist es unsere Aufgabe, skeptisch zu sein, wenn etwas wie ein unhinterfragter und unhinterfragbarer Glaubenssatz wirkt. Tatsächlich ist Saussures Definition dessen, was ein sprachliches Zeichen ist, die Essenz dessen, was man über Sprache durch die Betrachtung von Sprache selbst bis zu diesem Zeitpunkt erforscht hatte. Seine Lehrsätze stehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind Abstraktionen all der großen historischen, also diachronen, sich wiederholenden Muster mit all ihrer Wandlungsfähigkeit.
Sprache wird geformt durch verschiedenste Einflüsse, durch Analogiebildungen, dadurch, dass Laute aufeinander abzufärben scheinen, sich Konnotate ein wenig hierhin und dorthin verschieben und vieles mehr. Arbitrarität ist es, die zulässt, dass es ein ewiges Ziehen und Zerren an Formen und Bedeutung in der Sprache gibt. Dass eine Bedeutung nur innerhalb des Sprachsystems, innerhalb der Struktur einer Sprache, klar werden kann, wird dieser Forschungsrichtung den Namen Strukturalismus einbringen – die Bedeutung eines Zeichens wird klar durch die Struktur und die Lehre von Zeichen wird zur Semiotik.
Einflüsse unterschiedlichster Forscher lassen sich in Saussures knappem Werk finden und er wurde oft geradezu reduziert auf einen bloßen Systematisierer.18 Er zog seine Lehren aus den Unmengen an Schriften und Konvoluten, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden waren, als gerade im deutschsprachigen Raum die historische Spracherforschung ihre Blütezeit hatte. Nachdem der deutsche Sprachforscher Johann Christoph Gottsched (1700–1766), der deutsche Dichter und Übersetzer Johann Gottfried Herder (1744–1803) und die deutschen Sprachwissenschaftler und Volkskundler Jacob (1785–1863) sowie Wilhelm (1786–1859) Grimm gewissermaßen die Germanistik aus der Taufe hoben, wurde die diachrone Sprachbetrachtung fruchtbar: Woher kommt denn eigentlich unsere Sprache? Vom Deutschen folgte man den Spuren zurück in das Mittelhochdeutsche, Althochdeutsche, Gotische, Germanische und sogar Indogermanische, aus dem einige Sprachfamilien hervorgegangen sind. Es waren die sogenannten Junggrammatiker, die mit ihrer akribischen Suche nach Regeln, nach dem, wie Sprache entsteht, einen Großteil jener Knochenarbeit verrichteten, auf die Saussure sich stützen konnte. Die Systematisierung half dabei, den Finger in jene Wunden zu legen, die mehr Glaube als Wissenschaft waren: Der Glaube, dass Sprache eine Abbildung der Welt war, hielt sich hartnäckig und findet sich unter anderem in der frühen Phase des österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889–1951).19 Eine Grundannahme, die der späte Wittgenstein übrigens in seinem sogenannten Blauen Buch stark kritisierte.20 Aber es existierte auch der Glaube, dass Sprache etwas Natürliches, geradezu Organisches sei, das verschiedene Phasen durchlaufen müsse, wie eine Pflanze oder ähnliche Organismen.21 Eine Zugangsweise, die bereits die Junggrammatiker ablehnten, denn es war nicht durch sprachliche Nachweise zu belegen und dies war, worum es ihnen ging:22 Sie nahmen eine Theorie ohne empirische Überprüfung schlicht nicht hin. Auch den Nomenklaturismus, die Aussicht, dass eben jedes »Ding da draußen« einen Namen habe, konnte man nicht am Verhalten sprachlicher Zeichen ablesen: Die Referenz, das signifié, ist eben nicht da draußen.23 Wenn dem so wäre, könnten sich doch die Konnotate, negative wie positive, ebenso wenig verändern wie ganze Wortbedeutungen.24 Bedauerlicherweise waren es gerade die Herausgeber des CLG, denen es schwerfiel, dies zu verstehen, und zwar in einem Ausmaß, dass jene, die im Gegensatz zu ihnen wirklich in den Vorlesungen saßen, über die Maßen enttäuscht waren.25 Die Herausgeber schienen eher Anhänger des Nomenklaturismus zu sein und präsentieren Arbitrarität so, dass der Begriff noch mit einem Glauben an den »Symbolismus von Sprachklang« vereinbar sein konnte, was später unter anderem vom französischen Philosophen Jacques Derrida (1930–2004) gerechtfertigterweise kritisiert wurde.26 Jene Punkte, auf die sich die Kritik an Saussure hauptsächlich bezieht, stammen nicht direkt aus seiner Feder: Sie lassen sich weder in seinen nachgelassenen Schriften noch in den Skripten seiner Studenten finden, sondern stammten von den Herausgebern und selbst bei seiner eigenen Inaugurationsrede sagte Bally, einer jener Herausgeber, dass für Saussure Sprache die Schöpfung einer kollektiven Intelligenz sei, ein intellektueller Organismus, was schlichtweg Unfug und bei Saussure nirgendwo zu finden ist.27 Saussure sagt uns zum Beispiel, dass man, um die genaue Bedeutung eines sprachlichen Zeichens benennen zu können, das Spannungsfeld, in dem es sich zu diesem einen Zeitpunkt befindet, betrachten müsse – eine synchrone anstatt einer diachronen Betrachtungsweise also. Denn nur weil wir wissen, was ein Begriff gestern hieß, wissen wir noch lange nicht, was er morgen bedeuten wird. Dies wurde von den Herausgebern ausgelegt, als hätte er behauptet, Sprache sei statisch,28 was er mitnichten tut, denn schließlich ist die Wandelbarkeit von Sprache der Ursprung ihrer Arbitrarität und mache sie, laut Saussure, »verwundbar«.29 Er geht in diesem Zusammenhang sogar so weit, die Sprache als »machtlos« zu bezeichnen gegenüber dieser Wandelbarkeit. Wie wir erkennen, ist dies all jenen entgangen, die Jahrzehnte später deklarieren werden »Sprache ist Macht«. Die meisten Kritikpunkte an Saussures Werk konnten ausgeräumt werden, als sein Nachlass wissenschaftlich profund aufgearbeitet wurde. Dabei stellte sich heraus, dass viele seiner vermeintlichen Fehler auf die Arbeit seiner Herausgeber zurückgeführt werden konnten.30 Einige Formen der polemischen Auseinandersetzung mit Saussures Denken sind allerdings wohl auch Resultat eines zwanghaften Reibens an den Traditionen der Vorgänger und weniger der ernsthaften inhaltlichen Lektüre.
1.2. Hermann Paul und die Junggrammatiker – Neger, Schwarze, PoC?
Anhand dessen, was wir bislang gelernt haben, wissen wir nun über Sprache, dass sie in ihren Bedeutungen und Formen beweglich ist. Es gehört zu den wenigen Aussagen über Sprache, die wir überprüfbar als korrekt bezeichnen können, und es ist der Kern dessen, was die Junggrammatiker im vorletzten Jahrhundert erforscht haben: Wie kann es sein, dass ein Wort wie Neger im deutschsprachigen Raum temporär neutral wirken kann, auch wenn es aus einem gewiss nicht neutralen Diskurs kam, es schlicht Menschen dunklerer Hautfarbe bezeichnete und plötzlich zu einem Schimpfwort wird? Ähnlich im Englischen, wo das Wort Negro erst vor wenigen Jahrzehnten als abwertende Bezeichnung zu gelten begann, während allerdings das eindeutig negativ konnotierte Wort Nigger stets parallel dazu existiert hat.31
Wie kann es sein, dass in beiden Sprachen Schwarze und Blacks einen negativen Beigeschmack bekommen, der dazu führt, dass auch diese Wörter plötzlich ihre Neutralität verlieren, ebenso wie Farbige und Colored? In jüngerer Vergangenheit haben die Anglizismen People of Color (PoC) beziehungsweise jüngst Black, Indigenous and People of Color (BIPoC) Einzug in die deutsche Sprachlandschaft gefunden.32 Menschen in der Sowjetunion verstanden durchaus, was es bedeutete, dass Weihnachtsbäume nun verboten waren, Neujahrsbäume aber gekauft werden konnten:33 gar nichts. Nicht einmal das sowjetische Regime wagte es, die religiöse Tradition ganz abzuschaffen, man täuschte mit der Formulierung darüber hinweg.
Den Mechanismus hinter diesem Phänomen nennt man neuerdings »Euphemismustretmühle«:34 Ein Begriff beginnt als verpönt zu gelten, also soll er nicht mehr verwendet werden; ein anderes, neues Wort nimmt daraufhin – mehr oder weniger erfolgreich – seinen Platz im Netzwerk der Sprache ein. Aber Achtung: Die Konnotate werden nicht durch die Form bestimmt, sondern durch eben diesen Platz. Man könnte sagen: Kontext ist eben wichtig. Nicht nur Bedeutungsverengungen, sondern ebenso Bedeutungserweiterungen können abfällige Begriffe ereilen, wie es zum Beispiel mit dem Begriff Nazi passiert ist, der in seiner heutigen inflationären Verwendung im öffentlichen Diskurs mit den Anhängern des Nationalsozialismus häufig nicht mehr viel zu tun hat.35 Dass es wohl kaum die Realität sein wird, die sich nach dem Worte biegt, sondern die Wortbedeutung, die sich nach ihrem Platz im Sprachsystem biegt, ist durchaus nichts Neues. Dass dies in unterschiedlichem Ausmaß passieren kann, wissen wir von dem, was am Verhalten von Sprache abzulesen ist, bereits seit 1880, als Die Prinzipien der Sprachgeschichte des deutschen Sprachwissenschaftlers und Lexikographen Hermann Otto Theodor Paul (1846–1921) erschien. Ein Buch, das für großen Aufruhr gesorgt hat, denn die Forscher in seinem Umkreis wollten nicht spekulieren, wohin die Sprache, als sei sie ein Organ, sich denn entwickle, sondern was die Regeln ihrer Entwicklung seien, die nicht mit der Idee von Sprache als naturgegebener Entität übereinstimmten – die Regeln des Sprachwandels also.36 Eine Wissenschaft der Prinzipien, wie Paul es nannte, die nicht eine philosophische Diskussion über die Beschaffenheit von Sprache sein solle, sondern eine empirische Beschreibung der Mechanismen des Sprachgebrauchs und -wandels. Erst davon ausgehend konnte Saussures Diskussion überhaupt Bestand haben, denn um etwas aus der Sprache abzuleiten, musste man sie erst kennen. Nur das, was unveränderbar an der Sprache ist, lässt Rückschlüsse auf ihre Beschaffenheit zu und alles an ihr ist veränderbar, außer ihre Mechanismen.37 Wie funktioniert dieser Wandel also? In Kapitel »Sprachwandel« geht Paul dem nach.38 Mit einer gewissen Lockerheit trennt er den Wandel von Lauten und den Wandel von Bedeutung geradezu im saussureschen Sinn: Wenn ein Begriff häufiger verwendet wird, wird er langsam seine ursprünglichen Konnotate verlieren. Ein aus gegenwärtiger Sicht besonders spannendes Beispiel ist das Wort für Frau. Ursprünglich bezeichnete frôwe nur adelige Frauen und Herrinnen. Es waren die Minnesänger, die auch die übrigen Frauen, denen frôwe vorenthalten war und die wîp genannt wurden, zu edlen Herrinnen erheben wollten. Und voilà: Eine Verwendung, die sich durchsetzte. Frau bezeichnete fürderhin alle Frauen und das Konnotat adelig ging verloren.39 Würden wir jenen, die im Munde führen, dass Sprache ein Abbild der Welt ist, Glauben schenken, dann hätte dieses bessere Wort Einfluss auf die Lebensumstände haben müssen, doch geschichtlich lässt sich keine umfassende, erfolgreiche mittelalterliche Frauenbewegung ausmachen. Die meisten Frauen waren nach wie vor Besitz.40 Wir werden uns der Verbindung zwischen Gender und Sprache, eben weil es gegenwärtig ein so brennendes Thema ist, das ganze Redaktionen und Universitätsinstitute beschäftigt, in einem eigenen Kapitel detaillierter zuwenden. Dieses Auswaschen von Bedeutung können wir heute daran sehen, dass Begriffe wie zum Beispiel queer im Englischen ihre Funktion als Beleidigung langsam abgelegt haben, da sie von Bürgerrechtlern geradezu ostentativ verwendet wurden – um ein negatives Konnotat abzuschütteln, ist eine möglichst häufige Verwendung dieser Form in positivem Kontext vonnöten. Wie häufig diese Verwendung sein muss, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, lässt sich jedoch kaum einschätzen.41 Wie wir am medialen Siegeszug des Grazer Tuntenballs und damit der positiven Verwendung des Begriffs Tunte nachvollziehen konnten, dürfte es schwierig sein, jemanden mit Worten zu beleidigen oder gar zu verletzen, der ebendiese Worte stolz wie eine Monstranz vor sich herträgt: Durch neuen Kontext kommt neue Bedeutung. Fällt ein Konnotat weg, erweitert sich eine Bedeutung. Ein neumodischer Anglizismus dafür lautet concept creep,42 wie zum Beispiel beim Konzept des Triggers als Auslöser bei einem posttraumatischen Stresssyndrom, dessen Verwendung mittlerweile ausgeweitet wurde auf Elemente, die jemanden bloß stören könnten, sei es in Filmen, Serien oder Klassenzimmern. Ein Phänomen, auf das wir in Kapitel 3 näher eingehen werden. Was geschieht jedoch, wenn ein Wort in der Sprachentwicklung verloren geht oder von politischen, religiösen oder gesellschaftlichen Instanzen verboten oder tabuisiert wird? Versuche, Sprache vonseiten der Machthaber zu verändern, gab es schon immer, das Phänomen ist also durchaus kein Novum. Geht hierbei die Bedeutung verloren? Wir wissen, dass Begriffe verloren gehen, wenn, was sie benannt haben, nicht weiter existiert, aber umgekehrt? Das Gegenteil ist der Fall: Das Konnotat wird einfach fröhlich auf die nächste Form aufspringen, die den Platz im Kontext einnimmt, in dem es verwendet wird wie das vorhergehende und dieses ist, wozu seine Bedeutung tendiert.
Absurd scheint es bei der absoluten Vermeidung von Begriffen zu werden, die aber – so wie sie sind – zum eigentlichen Thema werden: zum Beispiel M-Wort (Marginalisierte? Mohr?), N-Wort (Nazi? Neger?).43 Wer nicht weiß, welche Wörter mit M oder N beginnend gemieden werden sollen, kann bei einer Diskussion darüber ohnehin nur vor einem Rätsel stehen. Wir verweisen hier nur knapp auf die sprachlichen Ideale des englischen Sprachphilosophen Herbert Paul Grice (1913–1988),44 der nicht nur erkannte, dass der Mensch eben so präzise wie möglich sprechen muss, aber zugleich bequem ist und daher so viel wie möglich weglassen möchte, denn ein wenig maulfaul sind wir doch alle.45 Kurz gefasst kann man sagen, dass natürlicher Sprachwandel den Effekt von künstlichem Sprachwandel eliminiert und einige Blüten politisch korrekter Sprache untergräbt. Der Mensch hat beispielsweise eine Neigung, schlampig zu sprechen. So kann es oft passieren, dass Menschen, selbst wenn sie konsequent gendern, statt dem korrekten Plural »Die Leserinnen und Leser«, »Die Leserin und Leser« sagen, da Endsilben gerade im Deutschen oft untergehen, verschluckt werden und irgendwann aus dem Sprachgebrauch weichen. Wer denkt heute schon bei herrje an Herr Jesus oder bei ojemine an Jesu domine? Wir sagen auch fünf statt finfi.46 Wer sich die deutsche Sprache gerade erst aneignet und die Doppelnennung der Geschlechter zuvor nicht wahrgenommen hat, könnte glauben, dass es nur eine Leserin und viele Leser in einem Gebiet gibt – auch hier bildet Sprache die Welt nicht ab. Während Klang oft einzelne Laute beeinflusst und nicht ganze Bedeutungseinheiten, war für die Junggrammatiker klar, dass die Änderung der Form keine Änderung der Bedeutung nach sich ziehen kann.47 Diese beiden stehen, wie wir bei Paul bereits in der Einleitung sehen, in keinem ursächlichen Zusammenhang.48 Das Problem, das all die Prinzipien und Gesetze über Sprache stets haben, mit denen die Gegner der Junggrammatiker ihnen vor der Nase wedelten, waren jene Elemente, die sich nicht den allgemeinen Regeln beugten: Warum sind nicht immer alle ähnlichen Laute gleichermaßen betroffen? Warum scheinen manche Worte, wie unser Hahnenschrei im letzten Abschnitt, der außersprachlichen Welt so viel näher zu sein als andere? Warum bilden wir das eine Wort analog zu diesem und nicht wie alle anderen analog zu jenem? Die Junggrammatiker konnten keine Erklärung dazu liefern.49 Sie erkannten durchaus selbst, dass es sich bei sprachlichen Gesetzmäßigkeiten nicht um allgemein gültige Naturgesetze wie jene der Physik handelt, nannten aber dennoch ihre Gesetze des Sprachwandels »ausnahmslos«.50 Jedoch war diese »Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze« selbst für Paul zeitlich und örtlich begrenzt, weswegen diese linguistischen Regeln eben nicht im Rang eines Naturgesetzes stehen – ein weiteres Argument dafür, dass sprachliche Strukturen eben nichts Naturgegebenes sind.51 Dieses Problem löst Saussure für seine Vorgänger mit seinem Grundsatz der Arbitrarität. Diese Arbitrarität geht so weit, dass Worte, wie wir anhand unserer studentischen Eingangsanekdote gesehen haben, bereits das Gegenteil von dem bedeuten können, was sie ursprünglich bedeuteten – das Ergebnis nennen wir Ironie.52 Gerade im österreichischen Deutsch und speziell in Wien ist es verbreitet, das Wort Person als Schimpfwort zu gebrauchen. Ebenso ist eine Anekdote des Aché-Stammes in Paraguay überliefert, wo ein erkrankter Mann zurückgelassen wurde. Die Geier kreisten bereits über ihm – er überlebte allerdings, schaffte es, die Gruppe einzuholen, und wurde fortan liebevoll »Geierschiss« genannt.53 Einstweilen verwenden vermeintliche Spezialisten das Wort Person, anstatt von Mann oder Frau zu schreiben, um eventuelles unbeabsichtigtes Misgendern oder auch bei Transpersonen spezifisches deadnaming, also das falsche Einschätzen des Geschlechts, zu vermeiden.54 Manchmal bedeuten Worte im Kontext das Gegenteil von dem, was ihre Grundbedeutung, ihr Denotat ausmachen würde. In der Sowjetunion wurde knapp nach der Revolution von den neuen Machthabern der Begriff Aktivist im positiven Sinne eingeführt und stand für jemanden, der die proletarische Sache vorantreibt – innerhalb kürzester Zeit entwickelte er sich zu einem Schimpfwort.55 Gerade von oben herab eingeführte, vermeintlich positive Ausdrücke wandeln sich so zum Euphemismus, zur Beschönigung und schließlich zum abwertenden Kommentar. Wenn es etwas gibt, was wir aus Pauls Lehre mitnehmen können, dann ist es, dass Bedeutungswandel mit seiner Arbitrarität, wenn er erzwungen wird, oft nicht das gewünschte Ergebnis liefert. Wie wir heute an Begriffen wie neue Fachkräfte oder Kulturbereicherer, die durch das Internet geistern, erkennen werden, können sie sogar ins Gegenteil umschlagen.56
Ein Begriff im Netzwerk seiner Struktur wird durch seinen Platz in der Struktur und damit von anderen Begriffen/sprachlichen Zeichen bestimmt. Quelle: Eigene Illustrationen der Autoren.
Ein negativ aufgeladener Begriff gilt als verpönt oder wird verboten, darf nicht mehr ausgesprochen werden.
Ein neutraler Begriff nimmt seinen Platz ein.
Der neutrale Begriff übernimmt die abwertenden Konnotate des ursprünglichen Begriffes.
Der neutrale Begriff als solcher geht verloren und verbleibt als negativ konnotierter Begriff.
1.3. Sprachliche Relativität oder: Ist unsere Welt oder unser Denken begrenzt durch Sprache?
Während wir uns in den letzten Abschnitten mit den Ursprüngen der Linguistik selbst befasst haben, werfen wir nun einen Blick in eine Parallelwelt, um uns mit einem weiteren Glauben auseinanderzusetzen: Mit jenem Glauben, dass Sprache die Welt begrenze oder einschränke.
In vielen Sprachen gibt es Ausdrücke, die es im Deutschen nicht gibt. Zum Beispiel hat das Italienische ein Wort für den Flüssigkeitsring, den eine Tasse auf einer Oberfläche hinterlassen kann – culaccino57. Dass uns im Deutschen dieses Wort fehlt, ändert nichts daran, dass wir den Sachverhalt kennen und mit einem Stück Küchenrolle wegwischen müssen. Jedem Menschen, der solche Elemente in anderen Sprachen kennt, wird schnell klar werden, dass sprachliche Gegebenheiten keinen allzu großen Unterschied machen können, auch wenn die Idee, mit Sprache die Gedanken anderer formen zu können, noch so verführerisch klingen mag. Jemand, der bei solchen Überlegungen besonders hervorsticht, ist der US-Amerikaner Benjamin Lee Whorf (1897–1941), ein Zeitgenosse Wittgensteins – jedoch ohne erkennbare sprachwissenschaftliche Lernkurve.58 Er ging davon aus, dass eine Kultur, die einen Begriff nicht kennt, auch das nicht kennt, worauf der Begriff referiert. Diese Idee ist nicht in einem Vakuum entstanden, sondern reicht in ähnlicher Form zurück bis Wilhelm von Humboldt und errang an der Yale Universität in den 1930ern erneut Prominenz:59 Der US-amerikanische Ethnologe Edward Sapir (1884–1939) entwickelte die Theorie, dass die Muttersprache die Wahrnehmung steuere, und meinte gar, dass dies eine Tyrannei der sprachlichen Form über unsere Orientierung in der Welt sei. Zu dem Schluss kam er, weil es für das englische Verb to fall kein Äquivalent in der Sprache der Nootka-Indianer (eigentlich Nuu-chah-nulth) gibt – man würde dort frei übersetzt, anstatt zu sagen »ein Stein fällt«, die Formulierung »es steint hinunter« gebrauchen. Daraus zu schließen, dass jemand, der die Sprache der Nootka spricht, einen fallenden Stein anders wahrnimmt als wir, ist jedoch zu weit gegriffen. Gleiches kann unterschiedlichen Ausdruck finden, das ist auch bei Saussure klar – eine unumstößliche Gewissheit über den Einfluss der Sprache auf das Denken ist jedoch nicht wissenschaftlich ableitbar. Zumindest hatten exotische Sprachen nun das Interesse der Forschung geweckt oder zumindest das Interesse eines Studenten: Sapir wollte zwar einen Einfluss der Sprache auf das Denken ableiten, welchen genau vermochte er jedoch nicht zu sagen, während Whorf diesbezüglich weniger Vorsicht an den Tag legte.60 Whorf warf mit großen Behauptungen um sich, wie dass die Muttersprache unsere Gedanken, Wahrnehmungen und sogar Physik und Kosmos beeinflusse. Man fragt sich, ob es zu seiner Zeit in Yale keine Physiker gab, mit denen er das hätte ausfechten können, aber vermutlich lag dies nicht in seinem Interesse – was allerdings darin lag, war, sich einen prominenten Platz in der Forschungslandschaft zu schaffen, indem er zum Beispiel über Hopi (Sprache der Hopituh Shinumu) schrieb, dass es keine Terminologie für Zeit kenne.61 Wie bedauerlich, dass sich seine Studien darauf beschränkten, nur einen einzigen Sprecher der Hopi, der zufällig in New York lebte, dazu zu befragen.62Der deutsch-amerikanische Linguist Ekkehart Malotki (geboren 1938), der Hopi tatsächlich erforschte, hat den whorfschen Sprachmodellanhängern dafür Jahrzehnte später die Hopi-Zeit auf nahezu 700 Seiten um die Ohren geschlagen.63 Die bekannte Annahme, dass Inuit-Sprachen Hunderte Wörter für Schnee hätten, hat sich ebenso als schlicht unhaltbar herausgestellt – es handelt sich eher um zwei bis vier Wurzeln, aus denen sich alles andere, wenngleich recht komplex, ableitet.64 Heute ist klar, dass viele von Whorfs Forschungen eher Erfindungen und an den Haaren herbeigezogene Mystifizierungen sind.65 Der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1930–2002), dessen sprachwissenschaftliche Forschung wir später genauer untersuchen, nimmt die whorfschen Schriften für bare Münze und meint, Sprache sei nach Whorf ein Instrument, um die Welt der Objekte zu kennen und zu konstruieren.66 Die australische Anglistin Dale Spender (1943–2023) geht 1980 in ihrem Buch Man Made Language schlichtweg davon aus, dass Whorf richtig liege.67 Die britische Linguistin Deborah Cameron (geboren 1958) zitiert noch in den 1990ern in Feminism and Linguistic Theory Whorf und Saussure im gleichen Atemzug und schließt unkritisch, dass die beiden wohl kaum einer Meinung gewesen wären, ohne tiefer auf die existierenden Widersprüche einzugehen. Dass Saussures Forschung auf Sprachbeobachtung, Empirie und Fakten basiert, wohingegen Whorfs Schriften zum größten Teil Erfindungen, Wunschdenken und Überinterpretationen beinhalten, scheint sie nicht weiter zu stören.68 Wiederum andere Autoren behaupten einfach, dass die Linguistik ihr Interesse daran verloren hätte, dieses Thema zu erforschen.69 Man könnte fast glauben, eine der größten Scharlatanerien der Wissenschaftsgeschichte sei einfach vergessen, obwohl kaum eine Behauptung Whorfs der kritischen Überprüfung standgehalten hat, sei es über Pirahã oder Hopi, Tzeltal oder andere Sprachen.70 Sprache mit Denken einfach gleichzusetzen erscheint ein zu verführerisch wohlig warmes Nest zu sein, das die wenigsten freiwillig verlassen wollen. Viele Verteidiger politischer Korrektheit hängen diesem Glauben an, der in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen auftreten kann: Wer sich nicht an Whorf festhält, klammert sich oft an Philosophen, die weit weg von empirischer Forschung so manch einen Postkartenspruch geliefert haben mögen: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt«. So simpel, wie dieser Satz es glauben machen möchte, war Wittgensteins Zugang nicht, wie wir oben bereits bemerkt haben. Vielmehr versuchte er im Tractatus logico-philosophicus eine Art mathematische Formel von Sprache und Welt zu erschaffen.71 Vom deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) stammt der markante Satz »Es ist in Namen, daß wir denken«.72 Dass sowohl Wittgenstein als auch Hegel, wie große Denker es zu tun pflegen, sich von derlei Falschannahmen in ihren späteren Werken befreiten, Wittgenstein im sogenannten Blauen Buch73 und Hegel in seinen Notizen, die erst posthum veröffentlicht wurden,74 lässt jene, die sich gerne auf ihre früheren Werke stützen, offenbar kalt, so sie überhaupt mehr Kenntnis von ihnen haben als wohlklingende Slogans. Ebenso scheint es jene, die eine englische Übersetzung Friedrich Nietzsches (1844–1900) heranziehen, nicht zu stören, dass er nicht, wie dort nahegelegt, schrieb »Wir müssen aufhören zu denken, wenn wir es nicht in dem Gefängnis der Sprache tun wollen«, sondern »Wir hören auf zu denken, wenn wir es nicht in dem sprachlichen Zwange thun wollen«.75