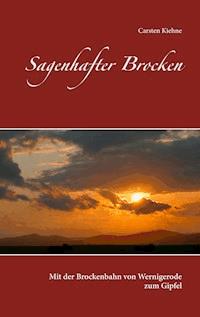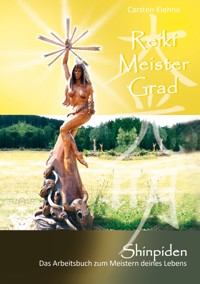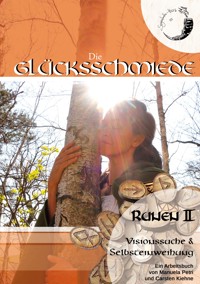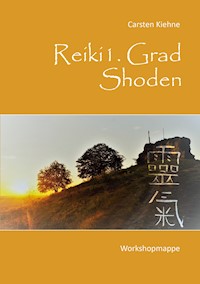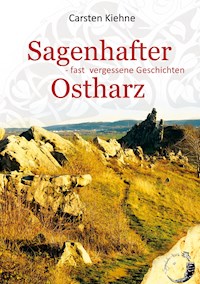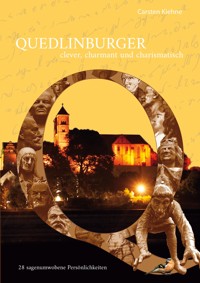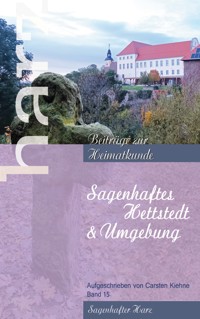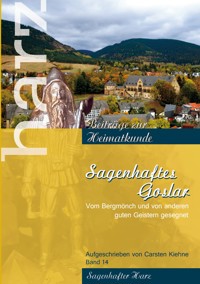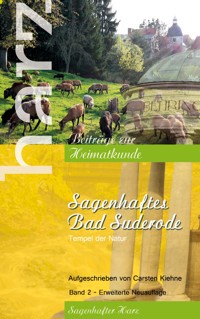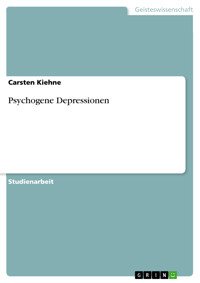Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
An den Erfolg von "Die schönsten Sagen aus unserem Quedlinburg" knüpft nun endlich die Sammlung der Anekdoten an, die hauptsächlich aus den vergangenen 250 Jahren unserer Welterbestadt erzählen. In den Histörchen sprechen sowohl die ganz großen Quedlinburger zu uns, als auch die kleinen Leute, die für ihre Stadt, ihre Rechte und ihre Ansichten das "Quedlinburger Platt" ergreifen. Gleichermaßen berichten die Anekdoten von weltgeschichtlichen Ereignissen - geschrieben in unseren heimeligen Fachwerhäusern und engen Pflastersteinstraßen - sowie von skurilen Momenten, die uns zum Nachdenken und Schmunzeln einladen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Quellenborjer Mundart
Wie Heinrich und Otto die Ungarn besiegten
Wie der Alkohol in den Harz kam
Wie die Orte zu ihren Namen kamen
Engelchen & Teufelchen
Der Grabhügel über der Bode
Die Wahrheit von Hänsel & Gretel
Die Erfindung der Gabel
Warum man gerne Steuern zahlte
Die „Geelbeine“
Wie der Bärlauch in den Brühl kam!
Mönch und Nonnen
Bassist Bendeler als Geburtshelfer
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Friedrich Gottlieb Klopstock
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Johann August Ephraim Goeze
Goezes Bärenjagd
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Johann Christoph Friedrich GutsMuths
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Carl Ritter
Die Schöne und das … Dichtergenie
Der eingeschnappte Dichterfürst
Von der Friedensbrücke
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Heinrich Hauer
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Julius Wolff
Spuk am Rabenberg
Welchen Weg man wählen soll
Wundervoller Stubenberg
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Dorothea Christiane Erxleben
Eine hübsche Dilettantin
Der Quacksalber von Quedlinburg
Merkwürdige Sauhatz im Ramberg
Die Erfindung der Blumenkästen
Die Sache mit dem Punkt
Zigeuner im Ramberg
Die Buttersteine
Winnich unn Trübe
Münzenberger haben „Leichen im Keller“
Die Wilderer
Die längste Straße der Welt
Das Taubenei
Ein einmaliges Weihnachtsgeschenk
Beinahe eine Kaiserkrönung
Die Goldstraße und die „Goldene Frau“
Quedlinburgs Hühnerdiebe
Das verfluchte Sühnekreuz
Das Haus der drei Löcher
Eine Nachtwächtertragödie
Derbe Späße mit dem Nachtwächter
Wenn die Welt sich um dich dreht
Der beflissene Türmer
Wie man sich kugelfest macht
Teufelslöcher & Elfenherzen
Bodehochwasser
Wenn die Geister dich rufen
Zur gefälligen Ansicht
Der Nasenkönig
Lass dir keinen Schmarrn andrehen
Leidvolle Aufgabe
Von der kleinen Wohltat
Das Quedlinburger Küchenlatein
Wie man den Regen nach Quedlinburg holt
Ein Angriff auf Führer & Staat
Der Dank des Vaterlandes ist gewiss
Vielleicht das Bernsteinzimmer
Der Schatz auf der Elfenwiese
Kriegsende in Quedlinburg
Zwischen Besatzung & Befriedung
„Der Jahrhundertraub“ Der verschwundene Stiftsschatz
Ein weiteres alliiertes Gaunerstück
Das Feininger-Erbe
Tausche Kartoffelkäfer gegen ...
Tragikkomödie am Lehof
Quedlinburgs bedeutende Töchter & Söhne: Christian Amling
Quedlinburger Höflichkeit
QLB im Nummernschild
Schneewittchen macht den Führerschein
Hollywood liegt doch im Harz
Was hat’s mit dem Froschkönig auf sich
Quedlinburg soll Hauptstadt werden
Altes Schloss gefunden
Hexe sein in heutiger Zeit
Zum Teufel mit den Rekorden
Jerusalem & Suderode
Schilderwahn in Bad Suderode
Und doch ein Schatz
Was der Zoll im alten Zollhaus findet
Sagenhafter „Gesichtsstein“
Der Satanshimmel
Abschlussgedanken
Einleitung
Eben 1100 Jahre ist es her, da soll dem Sachsenherzog Heinrich am Finkenherd die Königskrone angetragen worden sein. Freilich war unsere Welterbestadt dazumal nicht mehr als ein mit einem Wall umfriedeter Wirtschaftshof, mit kleiner Burg und Kapelle, in welchem die Reisekönige auf ihrem Weg durch die deutschen Lande Halt machten. Während diesem Jahrtausend ist viel passiert: Weltgeschichte wurde in Quedlinburg geschrieben! Geschichten, die das Leben schrieb, sind aus Sagen erwachsen, die wir uns noch heute erzählen. In den „Schönsten Sagen aus unserem Quedlinburg“, „Sagenhaftes Gernrode“ und „Märchen, Sagen und Geschichten um Bad Suderode“, habe ich sie niedergeschrieben.
Doch auch vorvorgestern erlebten unsere Großeltern (und heute wir selbst), kuriose, humorvolle oder atemberaubende Momente, die wichtig genug sind, weitererzählt und damit nicht vergessen zu werden. Einige dieser Momente habe ich von alteingesessenen Quedlinburgern erlauscht.
Jene Anekdoten sollen einen kurzweiligen Einblick in das Zeitgeschehen der letzten 250 Jahre unserer Fachwerkstatt und ihren Menschen geben. Hierbei möchte ich allerdings erwähnen, dass ich keine Garantie dafür übernehme, dass es sich tatsächlich eins zu eins so zugetragen hat. Die Geschichten sind von mir im besten Wissen richtig erinnert, originalgetreu weitererzählt und in Ansätzen auch geschichtlich recherchiert worden und haben dennoch weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf 100%ige Wahrhaftigkeit. Mögen die Anekdoten den Einheimischen und allen Besuchern gleichermaßen zur fantasievollen Erinnerung und kurzweiligen Unterhaltung dienen, auf dass wir erkennen:
„Es ist ein Traum, wie man hier wohnt. Es steht noch Fachwerkhaus neben Fachwerkhaus – ein Gang durch die Vergangenheit, Geschichte wohin man auch schaut, du siehst die Schätze. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt und für die Augen ist’s ein Fest. Die Quedlinburger sind schlau, denn sie wussten schon früher, was >schöner Wohnen< heißt!“ (Rudi Carell – Das Beste aus Rudis Urlaubs Show)
Harz’liche Grüße,
Euer Sagen- & Märchenerzähler Carsten Kiehne
Die Quellenborjer Mundart
Als „Zujeraster“, wenn man also nicht mindestens 90% seiner Lebenszeit im Umfeld der Stadt verbrachte, muss man sich den Titel „oller Quellenborjer“, der mit dem Ritterschlag vergleichbar ist, erst einmal verdienen. Um bei den „Aanhaamischen“ Anerkennung zu finden, sollte man tunlichst versuchen, sich mindestens ebenso verhaltensoriginell zu benehmen, sich das Hochdeutsch abzugewöhnen und sich rasch zumindest Grundzüge „vom Quellenborjer Platt anzujewehn“.
Das „g“ wird zum „j“, also „Ach, uns jeht‘s doch jut!
Das „ei wird ein „a“, wobei man achtgeben muss, wenn man den Einheimischen („Aanhaamischen“) bittet, das Badezimmer zu heizen, denn womöglich „haazt er baade Zimmer!“
Das „a“ sprich man „o“, was man akzeptieren muss, wenn man sich hier beheimatet („behaamotet“) fühlen will.
„e“ und „i“ anstelle von „ö“ und „ü“: „Waaste net, was sek jehert? Behite Jott dek vorre Narretei!“ („Weißt du nicht, was sich gehört? Behüte Gott dich vor dem Unfug!“)
Nimmt man dann noch die „jans aajentimlek zujemauschelten Sprochboppels“ – „und“ wird „unn“, „dich und mich“ wird wie oben „dek und mek“, den gesprochenen Doppelkonsonanten unnunnunn …, wobei man „fraalisch nüscht veralljemaanern“ darf – dann „kannste dek >Jott saa Dank< verschtändjen.“ So nun „aan klaanes Jespräch“:
Quellenborjer:
„Jefellt et daaner Jemohlin in Quellenborch?“ (Gefällt es deiner Gemahlin in Quedlinburg?)
Ek:
„Freilich, einer ausdrucksstarken frohgemuten Frau, wie sie eine ist, gefällt es hier so gut, als wäre es schon immer ihre Heimat gewesen!“
Quellenborjer
(antwortet wie immer wortgewandt und ausdruckstark) „Häh?“
Ek:
„Ek men, maan frojemutes Waab mokn Horz, ols wär‘s de Haamot.“
Sei’s drum: Den Touristen will ich nur sagen, dass ich nach „aanijen empirischen Lankzaatstudien unn braatjefächerter Ewaluation aane Aansicht jefunnen happ“ nämlich, dass wir kein zänkiges Bergvolk (kaan zänksches Barchvolk), sondern allesamt „aajentimliche Quellenborjer Perseenlichkaaten mit aanem anjebornen Jaast zur Klorhaat und Wohrhaat“ sind!
Wie Heinrich und Otto die Ungarn besiegten
Unser erster deutscher König Heinrich I. hätte sich nach seiner Ernennung zum Monarchen im Jahre 919 unseres Herrn bei den einst als unbesiegbar geltenden Ungarn gänzlich unbeliebt gemacht, sagt man, indem er ihnen den vereinbarten Tribut nicht mehr zollte und somit den bezahlten Frieden aufkündigte. Das tat er freilich nicht, ohne sein Land auf den großen Krieg vorbereitet zu haben.
Jahre zuvor hatte er seine Landsmänner und Lehensträger in der „Burgenverordnung“ angewiesen, steinerne Festen (wie einen Burgenmantel um den Harz) zu errichten, um sich bei den nächsten Überfällen erwehren zu können. Zudem soll er im Ritteranger Quedlinburgs, abgelegen von den einst herkömmlichen Machtzentren, heimlich ein stehendes Reiterheer aufgebaut haben.
Als die Ungarn dann kamen und Heinrichs Thronsaal betraten, die jährlichen Abgaben zu fordern, ließ der König ihnen anstatt dem Golde einen „räudigen Hund“ vorwerfen. Das freilich verstanden die Ungarn als Aufkündigung des neunjährigen Waffenstillstandes, griffen an und wurden 933 erstmalig besiegt, wenn auch nicht unterworfen. Der Hund jener selbstsicheren Lossagung aus aller Unterwerfung wäre der heutige Quedel, stolz und wehrfähig im Stadtwappen Quedlinburg sitzend.
Was der Vater begann, beendete der Sohn. Otto aber hatte andere Strategien, der Feinde Herr zu werden, zumindest, wenn man dem Gedicht „Der Herr von Prunzelschütz“ des Quedlinburger Dichters Fritz Grasshoff, wohl eine Persiflage von Kaiser Ottos Schlachten, Glauben schenkt.
Da sitzt nämlich Otto auf dem Königssitz, „mit Mannen und Gesinde inmitten seiner Winde. Die strichen, wo er ging und stand, vom Hosenleder übers Land und tönten wie Gewitter. So konnte es der Ritter!“ So manches Turnier gewann er wohl, falsch herum auf seinem stolzen Ross sitzend, die Gegner vom Pferde furzend und verdiente sich recht brav so manche Ehre.
– Jene belustigende und romantisierte Zurschaustellung eines solch schwerwiegenden Zweikampfes durch Giftgas, die heute bei beheimateten Frischluftfanatikern und Besuchern der in Quedlinburg zwangseingemeindeten Luftkurorte nur auf wenig Verständnis stößt, kann freilich nur in Hinblick der einstigen Notlage der deutschen Bevölkerung verstanden und entschuldigt werden. –
„Da kam ein Bote kreidebleich, und meldete: „Ungarn im Reich! Unser Heer läuft um sein Leben. Wir müssen uns ergeben.“ „Pah“, denkt da Otto und „ritt 955 zum Lechfeld heran, lupft seinen Harnisch hinten an und lässt aus der Retorte der Winde schlimmster Sorte. Das dröhnte, donnerte und pfiff, so dass der Feind die Flucht ergriff. Da schrie das Volk und wollte, dass er regieren sollte.“
Nach diesem rigorosen Sieg, der die Invasion der Ungarn ein für alle Mal zunichtemachte, schwiegen selbst die Gegner in den eigenen Reihen (waren sie doch vermutlich voll und ganz damit beschäftigt, sich den Gerüchen zu erwehren). Auch die Slawen konnten den im selben Jahre aufkommenden Winden Otto I. nichts entgegensetzen. So baute der Kaiser seine Vormachtstellung aus und ward zum Retter der Christenheit ernannt. „Deum benedicite flatibus – Gott schütze seine Blähungen!“ (dem Volke & Fritz Grasshoff abgelauscht & aufgeschrieben)
Wie der Alkohol in den Harz kam
Ursprünglich ist der Alkohol (arabisch „al khol“, was „Etwas Feines“ bedeutet) wohl seit der Mittelsteinzeit, also 10.000 v. Chr., bekannt und wurde im Harz eher zufällig entdeckt: Ich möchte mir vorstellen, wie ein Stamm unserer wilden, fellbedeckten und behaarteren Vorfahren durch den Harzer Urwald strich und sich am Honig gütig tat. Da gerade Hochsommer war und die Hitze den Honig ganz vergoren hatte, lernten die Wilden die Vorzüge des ersten Vollrauschs durch den Met kennen. Ganz nebenbei ward hier sicher auch das Jodeln erfunden! Und weil von den tüchtig Alkoholisierten niemand mehr im Stande war zu laufen oder zu stehen, sie bestenfalls noch gerade sitzen konnten, wurden sie eben sesshaft. Warum auch nicht? Nicht nur besoffen und nicht nur damals, fühlt sich im Harz manch einer wie im Paradies.
Die Sesshaften jedenfalls rodeten einen Teil des Waldes und begründeten erste Siedlungen – brauchte man doch vor allem im Winter warme Hütten, um den Suff auszuschlafen – wovon alle Orte mit der Endung …-rode ihren Namen haben.
Als man die ersten Äcker bestellte, sie aber dummerweise (wegen des reichlichen Met-Genusses) verpasste abzuernten – der römische Historiker Tacitus beschreibt in der Germania die ausschweifenden Gelage der Germanen – ward wiederum zufällig der Alkohol in gegorenen, also überreifen (Feld-)Früchten entdeckt. Das Bier wurde damit zu einem der ersten alkoholische Getränke aller Bevölkerungsschichten und Grundnahrungsmittel bis weit ins 19. Jahrhundert. Gesund zu frühstücken hieß damals, für Erwachsene wie für Kinder, eine warme Biersuppe zu genießen, für die natürlich Dünnbier mit einem Alkoholgehalt von weniger als 2 % verwendet wurde. In Preußen war das Quatschbier beliebt: Zerquetschte Äpfel, die mit allerhand Gewürzen und freilich einem guten Maß Bier zu einem schmackhaften Brei verquirlt wurden. Ja, Bier galt als nahrhaftes und stärkendes Lebensmittel, das man trinken müsse, um gesund zu bleiben. Vom Wasser aus den Flüssen sollte man nämlich die Finger lassen, schwamm darin doch damals schon allerhand Unrat herum, weshalb bald in jeder Stadt Ausrufer durch die Gassen gingen und verlauten ließen: „Heute wird bekannt gemaket, dass keiner in die Bäche kacket. Morgen wird gebraut!“
Viel hilft viel!“, denkt manch einer noch heute und verfällt dem Trugschluss, dass wenn ein Getränk mit geringem Alkoholgehalt schon gut tut, eines mit reichlich Prozentpunkten noch besser für die Gesundheit sein müsse. Hierauf stellten die Harzer Klöster im 13. und 14. Jahrhundert Branntwein als Arzneimittel her und verkauften diesen teuer an Apotheken als „magisches Heilmittel“. Gut, dass Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Kartoffel eine Ära der billigen Branntweinherstellung begann.
Vom preußischen König Friedrich II. ward per „Kartoffelbefehl“ der Kartoffelanbau eingeführt, um eine „Wunderwaffe“ gegen Hungersnöte vorhalten zu können. „Wat der Buer net kennt, frät er aber net!“, heißt es. Doch die Kartoffel war nun einmal da. „Wenn net jefräten, dann jesopen!“ war die logische Konsequenz und es erfreute den Harzer, dass nach nur zehn Jahren überall Kartoffelbrennereien aus dem Boden sprossen. Eine neuartige Destillations- und Brenntechnik sorgte zudem dafür, dass man aus Kartoffelmaische Getränke mit bis zu 80 Umdrehungen (pro Minute um die eigene Körperachse) gewinnen konnte.
Kommen wir aber noch einmal vom Alkohol als schlichte Nahrungsergänzung des einfachen Volkes im 19. Jahrhundert dahin zurück, wo alles begann: Als sich die Sintflut zurückzog, nachdem sie alle sündigen Menschen ertränkte, war es (glaubt man‘s dem Alten Testament) Noahs erste Amtstat, auf dem wiedergewonnenen Festland einen Weinberg anzulegen. Wein ist das Getränk der Götter, wusste man bereits seit undenklicher Zeit und doch haben die Reben erst sehr spät in den Harz gefunden. Wohl im 10. Jahrhundert rodete man ein Flecken südlich von Quedlinburg, später „Suderode“ genannt, weil die Äbtissinnen auf den Kalkbergen Messwein anbauen wollten. Sogar eine steinerne Kirche setzte man an Gottes Hintern an den Harzrand, um die Reben in Flurumgängen zu segnen. Einige Orte entstanden demnach tatsächlich aufgrund von Alkoholismus der Kirchenoberen. Unnötig zu erwähnen, dass eine so ehrwürdige Tradition, wie die des Sich-Für-Gott-Besaufens, bis heute in jedem Heimatverein zelebriert wird.
Tatsächlich verwendete man Alkohol bereits seit tausenden von Jahren als Narkotikum und Stimulans bei religiösen Zeremonien. Seneca beschreibt solche Trunkenheit als „freiwilligen Wahnsinn“, als eine „Krankheit“, die auftritt, wenn die „übermenschliche Kraft des Weines von der frommen Seele Besitz ergreift“! Wer aber meint, nur die Heiden hätten inbrünstige Exzesse gefeiert, der irrt gewaltig. Auch ein kirchliches Fest galt gemeinhin erst als gelungen, wenn alle geladenen Gäste am Ende berauscht unter den Bänken lagen. In heutigen Zeiten allerdings, in denen das Trinken vom gelegentlichen Genuss zum tolerierten Volkssport mutiert – denken wir nur an die starbesetzen Oktoberfeste oder die gerade stattfindenden Glühwein-Gipfel im Bundestag (oder hieß es „Weihnachtsmarkt“) – muss darüber nachgesonnen werden, ob das Verdünnen alkoholischer Essenzen mehr in Mode kommen sollte!? Wir sind ja nicht mehr bei den frühen Heiden, von denen Tacitus schrieb, sie würden sich wie Barbaren benehmen, weil sie ihren Met mit Stechapfelsamen und Bilsenkraut panschten. Bierpanscher werden auch nicht mehr so übel bestraft wie einst, wo man Panscher in ihren Fässern ertränkte oder sie so lange mit ihrer eigenen Brühe vollgoss, bis sie daran erstickten. Die Deutschen, allen voran die Harzer, sind ein einfaches, aber feingeistiges Volk. Nicht umsonst durchwanderte Goethe mehrmals unsere Berge, der das Weinpanschen mit Vehemenz vertrat: „Wasser allein macht stumm, das zeigen im Bach die Fische. Wein allein macht dumm, siehe die Herrn dort am Tische. Da ich keins von beiden will sein, trink ich Wasser mit Wein.“
Doch gar kein Alkohol ist auch keine Lösung, liebe Leser, heißt es doch bei uns zu Recht: „Gibt’s Leben dir ‘nen Klaps, genieß‘ Gernröder Schnaps. Für jeden tiefen Fall, trink‘ Lüddes Pup-Arsch-Knall. Doch willst du wirklich selig sein, schenk Westerhäuser Wein dir ein – denn was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen!“
Wie die Orte zu ihren Namen kamen
Der Deubel, das weißt Du doch noch, hat mit dem lieben Gott einen Pakt geschlossen, er sollte die Berge haben und Gott das flache Land.
Er fühlte sich aber betrogen, denn all die vielen guten Seelen, die wohnten ja unten im Tal und nicht droben in den düsteren Wäldern. „Ek komm schlecht weg beim Handel!“, sagte er zu sich selbst und entschied sich höhnisch lachend für einen Spitzbubenstreich: „Ek nehm den juten riesijen Sack, straach heut Nacht durchs Land und mopse mek die Dörper.“ Und tatsächlich: Ein Dorf nach dem anderen packte er ein, bis der Sack randvoll war. Gott sollte doch sehen, über wen er jetzt noch gebieten würde.
Ein Dörflein aber, dass hatte einen spitzen Kirchturm, so spitz war er, dass er ein Loch in den Sack stach, das größer und immer größer wurde, bis das ganze Dorf wieder hinausfiel und an der Bode liegenblieb. „Ach, det is furt!“, sagte der Deubel und daraufhin nannten es die Bewohner Ditfurt. Er ging drei Riesenschritte weiter, aber wieder fiel eines hinaus, er wetterte so ungehalten, dass man dies Örtchen später „Weddersleben“ nannte. Plumps, mit lautem Krachen landete ein weiteres an der Bode. „Naan, naan, naan - so kann det net waaterjahn!“, brummte er kopfschüttelnd. Das Dörflein aber heißt heute noch „Neinstedt“.
Jetzt hielt er das Loch endlich zu, aber es half nichts, immer größer wurde es. Und mit einem kräftigen „Padong“, fiel das nächste Nest an den Wurmbach. Er steckte es wieder in den Sack, doch es fiel wieder hinaus, er steckte es hinein, aber „Krach“, lag es wieder unten. Ein drittes Mal, ein letzter Versuch, schwor er es sich, steckte es in seinen Sack, aber es wollte und wollte nicht darin stecken bleiben. „Ach dann scher dek doch zum Deibel und blaab baam lieben Jott, wennde willst!“ Dieses verschlafene Dorf ist Stecklenberg.
„Argh“, schrie der Teufel plötzlich, blitzte doch dort im Osten die Morgenröte dem Teufel in die Augen, der Hahn eines jeden Hofes krähte und die Hunde Quedlinburgs bellten. Da wusste der Teufel, dass er wieder einmal das Spiel verloren hatte. Die Ortschaft, über der die Sonne aufging, heißt heute noch Morgenrot.
Unsere schöne Welterbestadt, das weiß wohl jedes Kind, hat ihren Namen vom Hündlein Quedl, das einst die Stadt vor den Ungarn rettete. Die vielen felligen Nachkommen Quedls verbellen noch heute den Teufel, sollte dieser wieder ver-suchen, seinen Bocksfuß auf unser Straßenpflaster zu setzen.
Engelchen & Teufelchen
In Quedlinburg ging einst ein armes Mägdelein, zugegeben, es war gar lieblich anzusehen, über die Steinbrücke in die Altstadt. Da sah sie im unten im Graben ein ledernes Täschlein liegen. So etwas Schönes hatte sie selbst nicht im Besitz und irgendjemand war so reich, diese Tasche achtlos fortzuwerfen. Das könne nicht angehen, meinte sie, zog fix ihre Schühchen aus und kletterte behände von der Brücke ins knietiefe, eiskalte Wasser. Wie sie das Täschlein an sich zog und öffnete, da konnte sie ihr Glück kaum fassen: Hunderte von Silbertalern waren darin. Nicht weggeschmissen wurde es, verloren gegangen musste es sein. Was sollte sie tun?
Sie arbeitete für zwei und doch hatte sie noch nie einen solchen Silbertaler besessen. Kurzerhand kletterte sie aus der Bode, verstaute das Täschlein tief unten in ihrer Kiepe und breitete oben auf die frisch gepflückten Äpfel aus. Als sie sich ängstlich umblickte, zerbissen ihre Zähne ihre Lippen. Hatte sie jemand bemerkt? Es schien nicht so, sie war allein auf der Brücke. Schnellen Schrittes ging sie nach Hause, das Geld zu zählen. Ihre Augen wurden groß und größer und ihre Hände versteckten ihren weit geöffneten hübschen Mund: 300 Taler lagen aufgetürmt vor ihr!
Behalten oder abgeben, war jetzt die Frage. „Behalten, ja – auf jeden Fall behalten. Nein, nicht doch – auf Stehlen steht das Handabschlagen. Ich geb‘ das Geld lieber ab und bekomme vielleicht einen Finderlohn!“, sagte sie zu sich selbst. – „Ach dumme Trine, behalte das ganze Geld!“, sagte der Dämon auf ihrer Schulter. „Bist du des Teufels?“, fragte der Engel gegenüber.
Und so stritten sich Engelchen und Teufelchen drei Tage lang, bis es die Magd vollkommen übernächtigt nicht mehr aushielt und das Geld im Rathaus übergab. Dort waren die 300 verloren gegangenen Taler eines fremden Kaufmanns schon in aller Munde. Auch, dass der ehrliche Finder 30 Silbermünzen als rechten Lohn bekommen sollte! Als die Magd das Geld aber überreichte, da schrie der Kaufmann: „Betrug, sie hat sich vom Gelde schon genommen!“ Er entgegnete, in der Tasche wären 330 Taler gewesen. Der Quedlinburger Amtsschöffe hörte das Mägdelein an, sie schwor auf den lieben Gott und ihr gutes Mütterlein, sie hätte nichts herausgenommen. Der Kaufmann versicherte aber dem Amtmann, es wären wirklich 330 Taler gewesen, die er verloren hätte und fragte den Schöffen, wem man bitte Glauben schenken wolle.
Der Richter sah vom gut gekleideten Kaufmann zum dreckigen Mägdelein und zurück, kratzte sich am Kinn, wiegte den schweren Kopf hin und her und dann überzog ein Lächeln sein faltiges Gesicht: „Kaufmann, ihr seid euch sicher? Ihr habt 330 Taler verloren?“ „Ja!“, sagte dieser und schlug mit der Faust auf den Tisch. „Und du Magd“, fuhr der Amtsschöffe fort, „gibst mir den Eid auf Gott, dass du nichts entnommen? Dass du nur 300 Taler gefunden?“ „Ja mein Herr, ich schwör’s, bei allem was mir heilig ist!“, sagte die Dirn. - „Dann ist es ganz einfach!“, lachte der Richter, „Kaufmann, warte du weiter, bis jemand kommt der deine 330 Taler gefunden hat. Und du Magd, behalte die 300 Silbermünzen, sie scheinen Niemanden zu gehören!“ … und damit ist das Märchen aus, die Arme kaufte sich ein Haus, darinnen tanzen Katz und Maus, zieh‘ jeder sich sein Lehrstück raus! (dem Volke abgelauscht)
Der Grabhügel über der Bode
Ein alter Bauer stand eines Tages in seinem Hof und besah seinen Reichtum. Das Korn auf den Feldereien wuchs prächtig heran, die Obstbäume hingen voller Früchte, das Getreide des letzten Jahres war lange noch nicht aufgeraucht und in den Ställen standen fette Ochsen und schönste Pferde. Und wie er in die gute Stube ging, um wie jeden Tag sein Geld zu zählen, da klopfte es gehörig an. Nein, es war niemand an der Tür, es klopfte in seinem Herzen: „Was habe ich mit all meinem Gut jemals Gutes getan?", fragte er sich. „Habe ich eines armen Mannes Not gelindert? Habe ich liebe Menschen, denen ich vollen Herzens gegeben habe oder geben kann? Ach, da bin ich im Alter doch ärmer als der Bettler mit seinen sieben Kindern unten an der Bode.