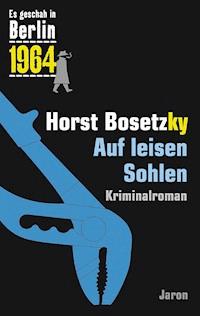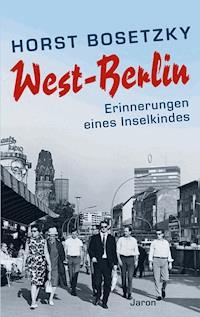3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
›Quetschkartoffeln und Karriere‹ schildert höchst vergnüglich die Abenteuer des Manfred Matuschewski in den siebziger Jahren. Nachdem es ihn nach Ende des Studiums nach Bremen verschlagen hat, will Manfred trotz Mauer und Grenzschikanen zurück in sein geliebtes Berlin, wo bei ›Brennholz für Kartoffelschalen‹ – Bosetzkys großem Bestseller – alles angefangen hat ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 823
Ähnliche
Horst Bosetzky
Quetschkartoffeln und Karriere
FISCHER E-Books
Inhalt
Du suchst den Anfang, suchst zurück:
So schön, so schön war es, daß du nun glaubst,
Es sei der Sinn, den du aufs neue dir belaubst.
Und es ersteht dir Stück um Stück
Das Einst, das Glück.
Hermann Broch
Ein Berliner in Bremen
»Eine Bürokratie ist eine Institution zur Vernichtung von Motivation«, sagte Dr. Manfred Matuschewski und lauschte dem Klang seiner Worte. »Und darum brauchen wir hier in Bremen nichts notwendiger als eine umfassende Verwaltungsreform.«
Er saß allein in seinem kleinen Büro und war damit befaßt, für den Bürgermeister der Freien Hansestadt eine Rede zu entwerfen. Und dies schon seit sieben Wochen. Eine andere Arbeit hatte sich für ihn nicht finden lassen. Er überlegte mit gezücktem Kugelschreiber. Vielleicht war es besser, Hans Koschnick »Einrichtung« statt »Institution« sagen zu lassen, denn der Mann an der Spitze des kleinsten aller Bundesländer war bekannt dafür, das sogenannte Soziologenchinesisch zu hassen. Auch »Bürokratie« würde vielleicht zu abwertend klingen – was wußten denn die Zuhörer in der Industrie- und Handelskammer von Max Webers wertfreiem Idealtypus der Bürokratie? – und Motivation zu sehr nach 68er Psychologie und linkem Weltverbesserertum. Nun gut, versuchte er es eben mit der Version 27 a: »Die öffentliche Verwaltung ist eine Einrichtung zur Vernichtung von Arbeitseifer.« Nein, das klang zu laienhaft, und wahrscheinlich stieß sich Koschnick an dem Wort »Vernichtung«. Vernichtung gleich Vernichtungslager und KZ, und wie leicht kam er da in den Geruch, aus dem Wörterbuch des Unmenschen zu zitieren.
Wieder verfiel Manfred in tiefes Nachdenken, fühlte auch den Zwang, für das viele Geld, das er bekam, etwas tun zu müssen. Doch ihm wollte und wollte nichts Originelles einfallen … außer einem alten Spruch seines Vaters: Mit Gewalt läßt sich kein Bulle melken. Nicht nur seine geistige Impotenz, sondern auch das monotone Plopp-plopp der defekten Neonröhre oben an der Decke ging ihm auf die Nerven. Und das Gedicht, das ihm sein alter Freund Moshe Bleibaum geschickt hatte, war auch nicht gerade hilfreich: »An der trüben gelben Weser/Ach! Wie wird mir öd’ und öder,/Selbst in stillen Mondscheinnächten/Späh’ mein Geist umsonst nach Köder.« Es hieß »An der Weser« und war von einem Satiriker namens Albert H. Post im Jahre 1872 verfaßt worden. Gott, ja, Bremen …
Immer größer wurde die Versuchung, einfach zur Personalstelle zu gehen und um die Auflösung des Arbeitsvertrages zu bitten. Tut mir leid, ich bin auf dem falschen Dampfer gelandet. Aber Renate wegen ging das nicht, die fühlte sich ganz wohl in Bremen und hatte in einer Firma für Marketing und Werbung einen schönen Job gefunden. Außerdem war es nicht so toll, als Verlierer heimzukehren. Manfred dachte nach. Nicht über Koschnicks Rede, sondern über sich.
Nach einer mehrmonatigen Probezeit, die es an sich nur auf dem Papier gegeben hatte, war er vom 1. Januar 1970 an offiziell wissenschaftlicher Mitarbeiter beim AmfVi, besoldet nach BAT IIa, was eine Menge Geld bedeutete. Jetzt war es Mitte Februar, gerade hatte er seinen 32. Geburtstag gefeiert, »unrasiert und fern der Heimat«, und den Umzug von der Spree an die Weser noch immer nicht verkraftet. Als eingeborener Berliner nach Bremen zu gehen, schien so einfach zu sein, doch er tat sich unheimlich schwer damit. Wenn er beschreiben sollte, wie ihm zumute war, wählte Manfred meist den Umweg über einen Witz, den man über Ingenieure riß: »Gestern wußte ich nicht, wie man Inschenör schreibt, heute bin ich einer.« Denn bis gestern hatte er eigentlich gar nicht recht gewußt, daß es Bremen gab, heute lebte er in Bremen. Es war für andere dennoch kaum verständlich, was er damit meinte. Er müsse doch von der Existenz Bremens gewußt haben, zumal bei seinen außergewöhnlichen Kenntnissen in Politik, Geographie und vor allem Fußball, siehe die Hanse und den Roland, siehe Wilhelm Kaisen, vor allem aber Werder Bremen, den deutschen Meister des Jahres 67/68.
Trotzdem: Bremen war eine bloße Fiktion für ihn gewesen, zumal er bis dahin nie in der Stadt gewesen war, hatte sogar etwas Märchenhaftes – wohl wegen der Bremer Stadtmusikanten. Manchmal faltete er die Landkarte auseinander, um sich zu vergewissern, daß am Unterlauf der Weser tatsächlich ein schwarzer Punkt eingezeichnet war, neben dem dick das Wort »Bremen« stand. Und nicht nur eine Stadt war es ja, sondern gleich ein ganzes Bundesland. Mit Bremerhaven zusammen, 60 Kilometer weiter nördlich gelegen und mit viel Niedersachsen dazwischen. Bremens Hafen, der gleich hinter der Martinikirche begann, hatte also nichts mit Bremerhaven zu tun. Das alles lernte Manfred schnell, ohne aber vom Gefühl her Bremer zu werden. Er fühlte sich wie eine Art Ausländer, wie ein Fremdkörper, nur geduldet, immer argwöhnisch beäugt. Dabei waren alle freundlich zu ihm. Manchmal, wenn Renate und er mit den Rädern unterwegs waren, kam er sich vor wie im Urlaub … und morgen würde es nach Berlin zurückgehen: Ku’damm, Gedächtniskirche, Zoo, Grunewald, Neukölln, die Eltern, Schmöckwitz, sein Boot …
Er riß sich los von seinen Bildern und suchte nach einem ersten Satz, von dem alle sagen würden, daß er genial zu nennen sei. Nicht schlecht war vielleicht der Einstieg über den Paragraphen 54 des Bundesbeamtengesetzes – »Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen« –, um dann damit fortzufahren, daß es ausgerechnet die bürokratischen Strukturen seien, die einen daran hinderten.
»Aus diesem Grunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir hier in Bremen das AmfVi geschaffen, das Amt für Verwaltungsinnovation, um die Verwaltung zu erneuern, denn Innovation heißt ja nichts anderes als Erneuerung.«
In diesem Moment klopfte es kurz an der Tür, und dann stand auch schon Lienhoop auf der Schwelle, sein Chef. Bläulichrot war er angelaufen und schien kurz vor einem Infarkt zu stehen.
»Was ist denn?« fragte Manfred, auf seinem Drehstuhl herumfahrend, sehr erschrocken über Lienhoops Aussehen.
»Das AmfVi soll aufgelöst werden.«
Manfred brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, was das bedeutete. Eigentlich hätte er froh sein müssen über diese Nachricht, doch er war genauso betroffen wie Lienhoop selber.
»Und was nun?«
»Krisensitzung. Wir müssen erst mal sehen, was dahintersteckt.«
Lienhoop war ein alter Fuchs und mit allen Wassern gewaschen. 63 Jahre war er alt, und seit seinem fünfzehnten Geburtstag hatte er im Staatsdienst gestanden, angefangen mit seiner Zeit als Supernumerar, als »Überzähliger«, in Weißensee, einem der Berliner Bezirke, wie sie zu Beginn der Weimarer Republik entstanden waren. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war er, von Norwegen kommend, in Bremen hängengeblieben, hatte hier geheiratet und war in der bremischen Verwaltung Stufe um Stufe nach oben geklettert, bis zum Posten des Regierungsrats. Zwar hieß es, man habe ihm das AmfVi nur gegeben, um ihn im Wege der »Sozialbeförderung« demnächst als Oberregierungsrat in Pension schicken zu können – nachdem er eine echte Reform der Verwaltung stets kunstvoll hintertrieben hatte –, doch das war übler Klatsch und Tratsch, denn Karl-Hermann Lienhoop war durchaus gewillt, sich mit dem AmfVi ein Denkmal zu setzen. Den guten Bremer Bieren voll erlegen, schleppte er viel zu viele Pfunde mit sich herum, und eines seiner Enkelkinder hatte ihn sehr treffend als Osterei mit Beinen charakterisiert. Jovial und konziliant war er, immer auf Ausgleich und Versöhnung bedacht, und damit genau der richtige Mann, wenn es darum ging, Hierarchien abzubauen und die Leute dazu zu bringen, schnell und unbürokratisch zu handeln, bürgernah und teambetont. Jetzt allerdings wurde der sonst so gemütliche Mann zum Choleriker.
»Das darf doch nicht wahr sein!« tobte er los, als sie unten im Sitzungssaal Platz genommen hatten. »Da steckt doch ganz sicher dieser Hüring dahinter, dieser halbe Hahn.«
»Bist du dir da wirklich ganz sicher, Karl-Hermann?«
Der das fragte, war Kemmi, Karl-Heinz Kemena, ihr »Amtsschrat«, wie sie über ihn als Amtsrat immer spotteten, ein kleiner kugelrunder Mann mit kupferfarbenem Haar, der wie die Karikatur eines typischen Upper-class-Briten aussah. Er kam fast immer zu spät. Manfred mochte Kemmi, zumal der so verschmitzt lächeln konnte wie sein Vater.
»Natürlich!« rief Lienhoop. »Wer denn sonst?«
»Weiß ich nicht, aber wir haben doch nicht nur einen Feind beim Innensenator … oder?« meinte Henning Wannowski, der Dritte im Bunde.
Wannowski war leicht griesgrämig, wie immer. Das hatte viele Gründe. Sein Sohn ließ ihn nachts nicht schlafen, mit seiner Frau, die Friederike hieß, gab es täglich Krach, und mit seiner Mutter, die im selben Haus wohnte, kam er erst recht nicht aus, weil die ihn noch immer wie ein kleines Kind behandelte. Ebenso verquer stand er mit seiner Schwester Hermine, denn die war Anthroposophin und spielte ständig innige Lieder auf der Harfe, pling-pling. Lienhoop war ein rotes Tuch für ihn, hielt er ihn doch als AmfVi-Leiter für eine totale Fehlbesetzung. »Den Kerl haben sie bloß hierhergesetzt, um jede Verwaltungsreform zu verhindern«, hatte er Manfred schon beim ersten Besäufnis zugeflüstert. Wannowski hatte als einziger von den drei Bremer Kollegen Abitur, und das auch noch von einem renommierten Gymnasium, was zur Folge hatte, daß er mit Manfred öfter eine Allianz der Intellektuellen einging und ihn bald zu sich nach Hause einlud. »Mit Lienhoop ist das schon schlimm, und Kemmi, der weiß doch noch nicht mal, wie Innovation geschrieben wird.« Großgewachsen und hager war er, ein hübscher Kerl, in allem – auch in seiner Kleidung – ein wenig englisch. Manfred fand, daß er dem britischen Außenminister Owens zum Verwechseln ähnlich sah.
Nun war Manfred an der Reihe, und von ihm, dem Dr. rer. pol. und Diplomsoziologen aus der Schule von Renate Mayntz, erwarteten alle drei eine Analyse von hohem wissenschaftlichem Wert. Das überforderte ihn ganz und gar. Zu wenig kannte er die Bremer Interna. Also mußten Fremdworte her, Begriffe, die sich nach etwas anhörten, zumindest auf Englisch.
»Ja, das ist das alte Problem: overcoming resistance to change. Und wenn wir Chin & Benne als Ausgangspunkt nehmen, dann müssen wir uns ganz ehrlich die Frage stellen, ob wir den wichtigsten Punkt des organizational development wirklich beachtet haben: die rechtzeitige Einbindung der Betroffenen, wenn es zu Veränderungen kommt. Hüring wird Angst haben, daß wir ihn mit seiner Arbeitsgruppe V F II wegrationalisieren wollen, siehe die ›Aktion Heldenklau‹, von der sie immer reden, und darum rennt er nun seinem Senator die Bude ein, daß der uns abschießt, bevor wir ihm gefährlich werden können. Aber wissen Sie denn ganz genau, daß Hüring wirklich …?«
Lienhoop schüttelte den Kopf. Er hatte es, wie bei Gerüchten wie diesem so üblich, vom Freund eines Freundes gehört. »Die Frage ist, ob da wirklich ein Senator dahintersteckt oder Hüring das nur ausgestreut hat, um uns zu ärgern und zu schaden. Und ob er vielleicht sogar Rückendeckung von Hans Koschnick hat …?«
»Dann rufen Sie ihn doch einmal an und fragen ihn ganz direkt danach«, meinte Wannowski.
Lienhoop faßte sich an den Kopf. »Da wird er mir gerade die Wahrheit sagen. Nein, das muß man anders machen.« Und nun schlug er seinen drei Mitarbeitern etwas vor, das Manfred später die ›Trinkerstafette‹ nannte. »Also … paßt mal auf: Günther Hüring geht nach’m Dienst immer einen trinken, meistens in seine Stammkneipe, den ›Alten Senator‹, Fedelhören. Und wenn er viel getrunken hat, dann erzählt er einem alles.«
Kemena lachte. »Bevor du den untern Tisch gesoffen hast, liegst du auf’m Osterholzer Friedhof … soviel verträgst du auf deine alten Tage nicht mehr, Karl-Hermann.«
Lienhoop grinste. »Darum sollt ihr mir ja helfen. Erst geht ihr beide in die Kneipe und stellt euch neben ihn an den Tresen …« – er zeigte auf die beiden Sachbearbeiter – »… und schmeißt eine Lage nach der anderen. Immer abwechselnd. Sagen wir: von sechs bis sieben. Und dann kommt unser Doktor hier ganz zufällig vorbei und löst euch ab.«
Manfred machte sich klein. »Ich … ich bin eigentlich süchtiger Nichttrinker und vertrag’ nicht viel.«
»Damit kommen Sie nicht weit im Leben und in Bremen schon gar nicht.« Lienhoop sah ihn ebenso mitleidig wie tadelnd an. »Und in diesem Fall muß es sein. Eine Stunde nur … Da schaffen Sie nicht mehr als drei Bier und sechs Klare, und die kann jeder ab.«
»Na schön …« Manfred hatte sehr schnell begriffen, daß er immer ein Außenseiter bleiben würde, wenn er sich weigerte, beim Unternehmen Hüring mitzumachen.
Lienhoop nickte. »Ich wußte, daß Sie mich nicht im Stich lassen. Und wenn Hüring reif zum Abschuß ist, dann komme ich mit meiner Frau … und der Sack wird zugebunden. Dann erzählt er uns ganz sicher, was da im Busche ist.«
»Und wann soll das sein?« fragte Wannowski.
»Na, heute abend gleich.«
Kemena hatte einen Einwand. »Morgen mittag kriegst du doch deine Urkunde … Und wenn du da noch …?«
Lienhoop sollte zum Oberregierungsrat befördert werden, und für 12 Uhr hatte sich Senatsdirektor Kupfer in der Charlottenstraße angesagt, um ihm die Urkunde feierlich und mit den passenden Worten in die Hand zu drücken. Erst damit war die Beförderung rechtlich einwandfrei erfolgt, und er hatte jeden Monat zwei- bis dreihundert Mark mehr auf dem Konto.
»Bis dahin bin ich wieder nüchtern.«
Im AmfVi herrschte ein eisernes Gesetz: Soviel man auch trank, so besoffen man auch war, so spät man sich ins Bett gewälzt hatte, am nächsten Morgen um halb 8 hatte man einsatzbereit am Arbeitsplatz zu sein.
Kemena sah auf die Uhr. »Drei Stunden noch. Ich geh’ erst mal zu Puls, einkaufen. Räucheraale satt, damit ich ’ne vernünftige Grundlage habe.«
Da alle das wollten, wurde Frau Winterberg losgeschickt, Räucheraale zu holen. Puls war das kleine Kaufhaus am Goetheplatz, gegenüber dem Theater. Was satt bedeutete, hatte Manfred schon gelernt: daß man im Restaurant einen Festpreis für eine Speise bezahlte – Aale beispielsweise – und dann soviel davon essen konnte, bis einem das Zeug aus den Ohren herauskam.
Sie präparierten sich also, und dann zogen die beiden Kollegen aus, um Hüring aufzulauern und ihn zu animieren, sich vollaufen zu lassen. Manfred wußte nicht genau, was er davon halten sollte. Einerseits war das des Lebens ganze Fülle, andererseits aber war es eigentlich unter dem Niveau eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, sich auf so etwas einzulassen. Vor allem haßte er nichts mehr als saufende Männerbünde. Doch: Wer A sagt, muß auch B sagen. Er rief zu Hause an und teilte seiner maulenden Renate mit, daß er noch zu einer dienstlichen Besprechung müsse.
»So hatte ich mir unser Leben in Bremen nicht vorgestellt.«
»Ich auch nicht.«
»Und von einem Alkoholiker wünsche ich mir kein Kind.«
»Als wenn ich jeden Abend betrunken wäre.«
»Nein, nur jeden zweiten.«
Er kam nicht umhin, ihr recht zu geben, denn man trank im AmfVi wirklich sehr viel, was unter anderem daran lag, daß sie in der Charlottenstraße weit weg vom Schuß waren, das heißt, weit weg vom Rathaus, und jeder, der im Dienst gern einmal ein Gläschen leerte, zu ihnen eingeritten kam, um das ungestört tun zu können. Lienhoop fand das hervorragend und förderte es, wo und wann immer es ging, denn dadurch kam er in den Genuß vieler wertvoller Informationen, an die er sonst niemals herangekommen wäre. Nur Hüring hatte sich nie ins AmfVi verirrt …
Frau Winterberg wurde von ihrem Mann abgeholt und in eine Isabella verladen, die sie als stolze Bremer fuhren, obwohl es Borgward längst nicht mehr gab. Lienhoop ging nach Hause, um vorher eine Mütze Schlaf zu nehmen. Kemena und Wannowski zogen los, um Hüring mit der ersten Ladung Korn und Frischbier zu traktieren. Manfred blieb als einziger zurück und schloß alles ab, denn nach Feierabend war es im AmfVi ziemlich unheimlich, zumal im Winter und bei Dunkelheit. Nachdem er sich an Lienhoops Playboy erfreut und Wannowskis konkret überflogen hatte, setzte er sich an seinen Schreibtisch und versuchte, für einen Artikel im Verwaltungsarchiv ein paar gehaltvolle Sätze zu finden, doch wieder einmal fiel ihm nichts ein. Kein Wunder, denn er war ständig übermüdet, und sein Schlafdefizit wurde immer größer. Der Grund war einfach genug: Renate war ein Nachtmensch und kam nie vor Mitternacht ins Bett, auch wenn um fünf Uhr morgens Wecken war. Er wollte über Phänomene wie Lienhoops Trinkerstafette schreiben. Waren sie funktional, dienten sie also der Zielerreichung des Gesamtsystems, oder waren sie dysfunktional, also erfolgsmindernd? Beides wohl in einem, und so schrieb er denn: Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die These von der Ambivalenz informeller Riten, Sitten, Bräuche und Verhaltensstandards. Dann ließ er den Kugelschreiber sinken und schloß die Augen.
Als er wieder zu sich kam, war es kurz vor 19 Uhr, und er schlüpfte schnell in seinen Mantel, um die beiden Kollegen rechtzeitig abzulösen. Hürings Stammkneipe war nur ein paar Straßenzüge entfernt, und obwohl ihm Bremen noch immer wie ein Labyrinth vorkam, verlief er sich nur unwesentlich. Rutenstraße, Kohlhökerstraße, Präsident-Kennedy-Platz, am Staatsarchiv vorbei. Eine Stadt mit einem Staatsarchiv. Manches in Bremen wirkte etwas hochstaplerisch auf ihn, auch das traditionelle Selbstbewußtsein der Einwohner. Immer wieder hörte er: »In Bremen ist alles anders«, und: »Dreimal ist Bremer Recht.«
Da war die schmale Straße, die den Namen Fedelhören trug. Er ging sie in Richtung Rembertiring hinauf. Als er das kleine Restaurant betrat, sah er seine beiden AmfVi-Kollegen in der Tat mit Hüring an einem Dreiertisch in der Nähe der Theke. Langsam ging er auf sie zu, tat aber so, als bemerkte er sie gar nicht, sondern suchte jemanden. Sie waren sehr ins Plattdeutsche gefallen, hatten also schon ganz schön was intus. Aber von der Verwaltung im allgemeinen und der Auflösung des AmfVi war nicht die Rede. Ums Wetter schien es zu gehen.
»Bei diesem gräsigen Nebel hast du deine Frau, eh daß de dich versiehst, ausse Augen verlor’n«, sagte Hüring.
»Bei uns in Horn an’ne Bahn«, fügte Kemena hinzu, »is dascha bald so dick wie inne Waschanstalt gewesen. Ich weiß nich, ich kann mir ga kein Begriff von machen, von wo der Nebel einklich alle herkommt.«
Wannowski lachte. »Das is die Luft, die die Leute aus’n Hals puhsten, und die wird bei son mieseliges Wetter, wie das diese Tage is, eben dick. Prost, trinken wir auf den nächsten Sommer.«
Sie leerten ihre Gläser mit dem doppelten Korn, schüttelten sich und spülten den Schnaps mit einem Schluck Sprudel hinunter. Es ging die Sage, daß sich der Alkohol auf diese Weise verdünnen ließe. Und ganz zufällig wurde Manfred nun von Henning Wannowski entdeckt.
»Hallo, Herr Kollege, suchen Sie wen?«
»Ja, meine Frau. Die wollte sich hier mit mir treffen.«
»Dann setzen Sie sich mal und warten, bis sie kommt.« Kemena erhob sich. »Ich muß sowieso nach Hause. Vorstandssitzung bei uns in’er Abteilung.«
Auch Wannowski stand auf. »Ich komm’ gleich mit: Ich muß meinen Sohn ins Bett bringen, Friederike hat heute ihren Gymnastikabend. Wir lassen Ihnen dafür unseren Doktor hier … Herrn Dr. Matuschewski kennen Sie ja …«
»Mal kurz vom Sehen im Rathaus …« Hüring streckte Manfred die Hand hin. Es war eine Pranke, wie sie sonst nur Handballspieler hatten.
»Angenehm …« Intelligenteres als die alte Floskel wollte Manfred so schnell nicht einfallen. Und damit der andere ja nicht auf die Idee kam, daß dieses Spiel abgekartet war, fügte er schnell hinzu: »Ah, und Sie sind der Herr Hinterthür von der Senatskommission für das Personalwesen …?«
»Nein, Hinterthür, das ist einer unserer Senatsdirektoren«, lachte Kemena. »Das hier ist der Günther Hüring vom Senator für Innereien … äh: für Inneres.«
»Oh, Entschuldigung.«
»Macht nichts, auch wenn ich nicht der mit dem Hintern in der Tür bin, so ehrt es mich doch.« Hüring lachte so dröhnend, daß der Kupferteller an der Wand zu vibrieren begann. Manfred betrachtete den Mann mit wachsender Neugierde. Natürlich hatte er sich vorher kundig gemacht, das heißt, Frau Winterberg eingehend nach Hüring befragt. So wußte er, daß sein Gegenüber 44 Jahre alt war und sich vom mittleren Dienst hochgearbeitet hatte, ebenso durch Kompetenz und Cleverneß wie durch seine Kontakte zu Partei und Gewerkschaft und die Freundschaft mit diesem und jenem der Entscheidungsträger in der bremischen Verwaltung. Von seiner Körpergröße her war er einer, den der Soldatenkönig in Potsdam sofort in die Garde seiner »Langen Kerls« eingereiht hätte, nur stand es mit seiner Kondition nicht zum Besten. Vor kurzem erst hatte er einen Herzinfarkt überstanden und mußte ein Mittel schlucken, das sein Blut an der Pfropfenbildung hinderte. Zwar rauchte er nicht mehr, dafür aber aß und trank er weiterhin viel zuviel. Seine Umrisse ähnelten denen einer großen Zuckerrübe auf zwei Beinen, mit dem dicken Ende nach unten. Hüring war immer fröhlich und zu Scherzen aufgelegt, wenn seine Feinde auch meinten, er führe sich wie ein Bauer auf. Wie auch immer, Manfred mochte diesen Typ Mensch, obwohl er wußte, daß dieser Mann gegen Leute, die auf seiner Abschußliste standen, keine Gnade kannte. Kein Wunder, daß Hüring von vielen gefürchtet wurde.
Doch als die beiden AmfVi-Kollegen gegangen waren und Manfred mit ihm allein dasaß und weitertrank, war es so, als hätten sich zwei alte Freunde nach Jahren wiedergetroffen. Sie hatten beide Spaß an einer Art Situationskomik, die zwanzig Jahre später in Serien wie Eine schrecklich nette Familie Mode werden sollte. So konnte sich Hüring gar nicht mehr einkriegen, als Manfred dem Ekel hinter ihnen, das sie wegen ihrer Lautstärke angeblafft hatte, heimlich die Ketchupflasche aufdrehte. Als der Mann sein Zigeunerschnitzel nachwürzen wollte, da … Sie kamen sich bei einem Klaren nach dem anderen so nahe, daß Manfred fast seinen »Kampfauftrag« vergaß.
Der erste Korn schmeckte fürchterlich. Manfred ekelte sich und verfluchte den Tag, an dem er auf die Idee gekommen war, nach Bremen zu gehen. Eine Welle von Selbstmitleid trug ihn davon. Manfred Matuschewski, wie tief bist du gesunken. Bald aber, nach dem vierten Klaren, überkam ihn gute Laune. Die Welt außerhalb des Restaurant existierte nicht mehr, er hatte sie hinter sich gelassen, war durch ein Schwarzes Loch hindurchgerast und auf einem paradiesischen Planeten gelandet, wo es keinen Schmerz mehr gab und keinen Frust.
»Was für das Pferd der Führring, ist für die Verwaltung der Herr Hüring«, reimte er schließlich.
»Was is’n ’n Führring?«
»Da werden die Pferde vor dem Rennen drin geführt, damit die Besucher sehen können, wie sie gebaut sind, bevor sie ihr Geld setzen.«
»Also, wie so ’ne Art Kontakthof bei uns in der Helenenstraße …?«
»Ja …«
»Prost, Herr Matuschewski!«
»Prost, Herr Hüring!«
»Und … Sie fühlen sich wohl hier bei uns in Bremen …?«
»Ja, aber wenn ich länger hierbleiben will, ist das AmfVi ja nicht das Richtige – oder …?« Manfred hätte den anderen gerne morgen beim Frühstück erzählt, was man beim Innensenator gegen sie im Schilde führte. Das war er schon dem Ruf der Berliner schuldig, besonders pfiffig zu sein.
Hüring entging souverän der Gefahr, den Köder aufzuschnappen. »Sie gehen doch eh zur Uni, wenn die gegründet wird, und werden da Professor.«
»Und wenn ich nun Karriere in der Verwaltung machen will … In der SPD bin ich ja drin.«
»Da sind Sie nicht der einzige, der drin ist und Karriere machen will«, lachte Hüring.
Manfred ließ nicht locker. »Als ich nach Bremen gekommen bin, hat man mir gesagt, daß das AmfVi ewig existieren soll, nun aber heißt es, daß es schon im Sommer wieder aufgelöst werden soll … Was ist denn so dran an diesem Gerücht?«
Hüring wich ihm abermals aus. »Sie haben doch sicherlich einen Arbeitsvertrag, der über drei Jahre geht …?«
»Ja … aber dann lande ich nachher bei Ihnen, und Sie sollen ja mächtig was gegen das AmfVi haben …?«
»Ach was! Ich hoffe ja immer noch, daß bei euch in der Charlottenstraße ein neues Amphibienfahrzeug erfunden wird, extra für die Verwaltung, oder Ihr ein Amphitheater aufmacht, in dem Ihr dann Amphitryon spielt … mit Lienhoop als König.«
Manfred war enttäuscht. »Ja … Herr Ober, bitte noch zwei Doppelte für uns.«
Aber auch die wollten Hürings Zunge nicht lockern. Immerhin ließ er durchblicken, daß er mit »einigen hohen Herren« über Sinn und Unsinn des AmfVi gesprochen habe. »Die Presse war nicht sehr begeistert davon, daß man die Verwaltung erst einmal aufblähen muß, um sie später besser schrumpfen lassen zu können.«
»Systemimmanenten Veränderungsimpulsen sind wir in der öffentlichen Verwaltung bisher noch nicht begegnet. Zu deutsch: Von allein passiert da nichts … oder: Von nichts kommt nichts.« Und Manfred fügte, um Hüring endlich aus der Reserve zu locken, hinzu: »Erst recht nicht in der Innenverwaltung.«
Hüring lachte. »Immerhin ist es auf unserem Mist gewachsen, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter aus Berlin nach Bremen zu holen.«
Manfred prostete dem Referatsleiter zu. »Herzlichen Dank! Und komme ich dann zu Ihnen, wenn das AmfVi zugemacht wird?«
»Warten wir’s ab …«
»Schön, daß wir uns mal kennengelernt haben, Herr Hüring. Leute mit Ihrer Verwaltungserfahrung sind für einen Verwaltungswissenschaftler wirklich Gold wert … Als Sie angefangen haben, da war doch Wilhelm Kaisen noch König von Bremen …?«
»Dja …« Hüring hatte mittlerweile ganz kleine und gerötete Augen, lallte immer hörbarer und mußte sich mitunter an der Tischplatte festhalten, so sehr schwankte er. »Das war noch einer … Im März 33 kommt er in Schutzhaft, als SPD-Senator. Als letzte Regierung im Reich weicht Bremen Hitler, der SA und der SS. Nach dem 20. Juli 1944 wollen sie Wilhelm Kaisen wieder verhaften, draußen auf seinem Bauernhof in Katrepel. Da schnauzt er die Nazis an: Wenn sie ihn vom Acker wegholten, dann sei das Sabotage an der Erzeugungspflicht der deutschen Landwirtschaft, und sie kämen ins KZ dafür.«
»Und?«
»Da haben sie ihn laufen lassen.«
Manfred sah unauffällig auf die Uhr über dem Tresen. »Einen noch, dann muß ich wirklich … nach Hause. Meine Frau kommt wohl nicht mehr, ich glaube, die ist gleich nach … nach …« Gott, er wußte nicht mehr, wo er wohnte. Und in welche Straßenbahn mußte er klettern …? Du bist ja besoffen, Mann! Er haßte diesen Zustand, insbesondere, daß man nicht per Knopfdruck nüchtern werden konnte. »Moment mal, bitte …« Er stemmte sich hoch und schwankte zur Toilette. Der Ehrgeiz packte ihn, auszurechnen, wieviel 25 x 25 war. Er schaffte es nicht, wußte aber immerhin, daß 550 nicht stimmen konnte. Als er am Becken stand, mußte er sich mit beiden Händen gegen die weißen Kacheln stemmen. Am liebsten wäre er in sich zusammengesunken und liegengeblieben, gleich hier. Wenn er richtig mitgezählt hatte, hatten sie sieben Klare gekippt. Doppelte. Und das in einer knappen Stunde. Er schleppte sich in die nächstgelegene Kabine und ließ sich auf den Klodeckel fallen. Das Ende war so plötzlich gekommen, er hatte gedacht, eine weitere Stunde durchhalten zu können. Nun aber … Renate … Ich kann nicht mehr. Im Dahindämmern sah er vor sich, wie Onkel Helmut einmal auf einem Kohlenkasten gesessen und gejammert hatte: »Mutter, ich sterbe.« Davon war er, so schien es ihm, nicht weit entfernt.
Er kam erst wieder zu sich, als Lienhoop vor ihm stand und ihm aufhalf.
»In treuer Pflichterfüllung …«, lallte Manfred. »Bis zur letzten Kugel standgehalten! Bitte, abtreten zu dürfen …«
»Und … Haben Sie was rausbekommen?«
»Sie haben ihn verhaften wollen, aber da hat er gesagt, daß das Sabotage ist … und da durfte er wieder auf seinen Bauernhof zurück.«
»Wer, Hüring …?«
»Nein, Wilhelm Kaisen.«
Lienhoop griff ihm unter die Arme und führte ihn zum Tresen, wo Hüring dazukam, um ihn zu stützen.
»Durch Berlin fließt immer noch die Spree«, sang Manfred. »Dicht dabei liegt auch der Müggelsee …«
Sie verfrachteten ihn in eine schnell herbeigerufene Taxe und sagten dem Fahrer, daß er »den Doktor« nach Osterholz in die Armsener Straße bringen möge. Auf der Fahrt versuchte Manfred krampfhaft, wach zu bleiben. Andere können in deinem Zustand noch große Reden halten und Gedichte schreiben. Er konnte nicht mal mehr die Haustür aufschließen, und den Klingelknopf zu treffen, war fast genauso schwierig. Als sich daraufhin nichts tat, drückte er alle Knöpfe auf einmal. Sieben waren es. Die Nachbarn stürzten nach unten, und inmitten der kleinen Hausversammlung, die nun entstand, überkam ihn ein langanhaltender Brechanfall. Als er in seine Wohnung torkelte, stürzte er über Renates Stiefel, die mitten im Korridor lagen, und riß, als er sich an ihrem Mantel festhalten wollte, die ganze Flurgarderobe vom Haken. Begraben unter Schneeanzügen, Jacken und Mänteln blieb er liegen. Und dies bis morgens um fünf, als der Wecker klingelte.
Um halb 8 saß er am Schreibtisch, obwohl er fürchterliche Kopfschmerzen hatte und ihm jeder Knochen einzeln weh tat. Die Sisalplatten auf dem Flur … Der einzige Trost war, daß es Lienhoop, Wannowski und Kemena nicht besser ging. Frau Winterberg bewunderte ihre drei Helden, als wären sie gerade aus dem Trojanischen Krieg oder anderen großen Schlachten heimgekehrt und versorgte sie mit Aspirin.
»Nichts haben wir herausbekommen«, stöhnte Lienhoop. »Und das Schlimmste ist, Hüring sitzt bei sich im Referat und feixt sich eins. Ich habe gerade mit seiner Sekretärin gesprochen. Blendend geht es ihm.«
»Laß den Ärger sausen, Karl-Hermann«, riet ihm Kemena, sein alter Kumpel aus Verwaltungsschultagen, »und freu dich auf deine Beförderung nachher!«
»Mir geht’s schlecht.«
»In vier Stunden bist du Oberregierungsrat … und da geht’s dir wieder besser. Trink ’n Bier, das hilft.«
Lienhoop tat es, und pünktlich 11 Uhr 50 standen sie im Sitzungssaal, um auf Senatsdirektor Kupfer zu warten, der die Ernennungsurkunde mitbringen und sie dem AmfVi-Leiter nach einer kleinen Rede in die Hand drücken würde. Als er vorfuhr, sagte Lienhoop, daß ihm ein wenig mulmig sei und er sich setzen müsse.
Kupfer tänzelte über die Straße und freute sich offensichtlich seiner gut erhaltenen Geschmeidigkeit und Eleganz. Er kam aus dem schwäbischen Ludwigsburg und hatte mehrfach an den Deutschen Meisterschaften im Formationstanz teilgenommen. Daß er immer so beschwingt war, lag aber vornehmlich daran, daß er seine Ausbildung zum Erzieher und Sozialpädagogen weithin in kirchlichen Jugendbünden absolviert hatte, in denen alles auf das tägliche Tandaradei ausgerichtet war.
Alle eilten auf den Flur, um ihren obersten Vorgesetzten gebührend zu empfangen. Frau Winterberg zupfte noch einmal ihr kleines Schwarzes zurecht. Als Manfred Senatsdirektor Kupfer die Hand schüttelte, gab es drinnen im Sitzungssaal ein dumpfes Geräusch. Sie fuhren herum und sahen, daß Karl-Hermann Lienhoop vom Stuhl gefallen war. Wannowski, der seinen Wehrdienst in einer Sanitätskompanie abgeleistet hatte, kniete als erster neben ihm.
»Herzschlag«, rief er. »Der ist tot, der wird nicht mehr.«
Sekunden standen sie reglos da, konnten nichts denken und nichts fühlen. Der Tod des anderen hatte auch ihre Lebensfunktionen vorübergehend zum Stillstand gebracht. Erst dann brach Panik aus, das Schreien, das Schluchzen.
»Schnell, die Feuerwehr!«
»Das bringt doch nichts mehr.«
»Trotzdem. Und die Polizei auch gleich.« Wannowski stürzte zum Telefon.
»Das war zuviel für ihn, gestern abend«, stellte Manfred fest und dachte an seinen Vater in Berlin. Ob der eines Tages auch einmal so daliegen würde, bei sich im Büro?
»Mein Gott!« Frau Winterberg rang die Hände. »Nun ist er nicht als Oberregierungsrat heimgerufen worden. So kurz vor der Beförderung … Und was seine Witwe nun alles weniger an Pension bekommen wird.«
Kemena sah den Senatsdirektor an. »Wenn er nun erst gestorben ist, nachdem Sie ihm die Urkunde ausgehändigt haben?«
Kupfer fuhr zurück. »Das geht doch nicht.«
»Doch. Wir klemmen sie ihm zwischen die Finger … Und das mit der Unterschrift, das ist doch kein Problem.«
Wannowski kam mit einer Tischdecke, um sie über den Toten zu breiten. Manfred warf einen letzten Blick auf Lienhoops Buddhagesicht, das er in der kurzen Zeit recht liebgewonnen hatte. Was sie da vorhatten, kam ihm vor wie absurdes Theater. Doch was sprach dagegen? Bremen war ein reiches Land, und wenn Lienhoops Frau zwei-, dreitausend Mark pro anno mehr bekam, ging die Welt nicht unter. Und außerdem hatte sich Lienhoop nichts sehnlicher gewünscht, als noch einmal befördert zu werden. Nun war er ins Jenseits befördert worden.
Der Senatsdirektor hatte einen Entschluß gefaßt. Er wischte das Tischtuch beiseite und legte Lienhoop die Urkunde auf die Brust.
»Sie haben es verdient. Der Herr nehme sich unseres Bruders an, des Oberregierungsrates Karl-Hermann Lienhoop. Amen.« Und dann drehte er sich abrupt zur AmfVi-Mannschaft um. »Wenn einer von euch etwas durchsickern läßt, dann fahrt ihr alle ärschlings in die Hölle, um es mit Martin Luther zu sagen.«
Statt zur Beförderung kamen sie alle zur Trauerfeier zusammen, zehn Tage später draußen auf dem Osterholzer Friedhof. Und auch das war für Manfred eine irritierende Sache, denn während sie Lienhoop das letzte Geleit gaben und sich der lange Trauerzug von der Kapelle zur Grabstelle schlängelte, drehten unten auf den zugefrorenen Entwässerungsgräben die Schlittschuhläufer fröhlich ihre Runden. Und der Friedhofsgärtner hieß Hans Todt. In Bremen war wirklich alles anders.
»Wer wird denn nun neuer AmfVi-Leiter?« fragte Manfred Günther Hüring, der neben ihm ging.
»Wer wohl?« war die Antwort. »Ich natürlich.«
Manfred Matuschewski ging durch das altehrwürdige Bremer Rathaus und fühlte sich so klein und unbedeutend, daß er sich am liebsten in eine Ecke gehockt und still vor sich hingeweint hätte. Ich bin nichts, ich habe nichts, ich werde es nie zu etwas bringen. Wie das Wissen um eine schwere Krankheit drückte es ihn nieder. Soziologe war er … und damit unnütz. Und das »Dr. rer. pol.«, das er jetzt vor seinen Namen stellen durfte, war nicht mehr wert als das »von« eines kleinen Bankkassierers. Wann ist ein Mensch etwas, fragte Manfred sich, und die Antwort war einfach: wenn er in der Zeitung stand, wenn Hörfunk und Fernsehen von ihm Kenntnis nahmen. Da aber hatte sich in seinem Fall nicht das Geringste getan, als er beim Amt für Verwaltungsinnovation (AmfVi) begonnen hatte, er, ein Schüler von Renate Mayntz, die immerhin als die führende Organisationssoziologin Europas galt. Wenn aber die alten Herren von TuS Arthritis Osterholz-Tenever gegen den TSV Grauer Star aus Vegesack 1:0 gewannen, dann war das dem Weser-Kurier oder den Bremer Nachrichten gleich eine halbe Seite wert.
Erst als ihm der Inhalt seiner grünen Umlaufmappe herunterfiel und er sich bückte, um den Brief aufzuheben, den er für Hüring bei Staatsrat Kähler abzugeben hatte, wurde ihm bewußt, daß er nicht als Tourist hier war, sondern als Mitarbeiter der bremischen Verwaltung. Manfred Matuschewski als Rädchen im Getriebe … Das hätte er auch bei Siemens sein können, mit mehr Gehalt und größeren Karrierechancen. Offensichtlich war es sein Schicksal, immer auf dem falschen Dampfer zu sein … Er hastete weiter. Niemand kannte ihn, niemand grüßte ihn.
Als er den Flur erreichte, wo hinter edlen Hölzern die Bürosuiten des Staatsrates und des Bürgermeisters der Freien Hansestadt Bremen lagen, blieb er benommen stehen. Eine Szene aus den Buddenbrooks kam ihm in den Sinn, wo ein einfacher Mann vor den Herrn Senator tritt, den Hut in den Händen, und die Krempe durch die Finger laufen läßt, als wär’s ein Rosenkranz: »Herr, sei gnädig mit mir, denn siehe, klein und demütig steh’ ich vor dir.« Es war die Aura der Macht, die ihn niederdrückte wie ein tonnenschwerer Stein. Sicher, er war ein freier Mann in dem Sinne, daß diese Herren ihn nicht foltern und nicht einfach so einsperren durften, aber wenn er im Leben mehr sein wollte als der »kleine Mann auf der Straße«, dann kam er nicht umhin, sich ihnen als Gehilfe anzudienen. Bei Siemens hatte er es nicht über sich gebracht, sein Leben der Firma zu verkaufen und als Gegenleistung von ihr alles zu bekommen, was er sich ersehnte: Geld, Macht und Prestige. Als freischwebender Intellektueller fühlte er sich auch nicht wohl. Was tun …? Manfred Matuschewski in der Zirkuskuppel … ratlos.
In diesem Moment ging eine der Türen auf, und der Bürgermeister kam heraus. Ihre Blicke trafen sich für eine Zehntelsekunde, und gebannt blieb Manfred stehen. Schon war Hans Koschnick zur Treppe geeilt. Manfred war zu sehr mit dem Werk Max Webers vertraut, um nicht zu wissen, daß man dieses Phänomen, das er da eben an sich wahrgenommen hatte, Charisma nennt. Worauf Koschnicks Charisma beruhte, war schwer zu sagen, wahrscheinlich auf seiner unwahrscheinlichen Dynamik, dem unbedingten Vertrauen darin, daß er jedes Ziel, das er sich setzte, erreichen würde, und nicht zuletzt, wie er sprach: unglaublich schnell und immer leicht vernuschelt. Wenn man sich in die Herde einreihte, als deren Leithammel er vorneweg lief, hatte man ganz einfach die größten Chancen, selber zu überleben und ans Ziel zu kommen. Manfred erschrak, denn das war nun wahrlich ein Fingerzeig des Himmels, wie er deutlicher nicht sein konnte: Reih dich in Koschnicks Seilschaft ein … und du machst mit ihm Karriere. Der Bürgermeister wurde als Willy Brandts Kronprinz gehandelt, und in der SPD war Manfred seit Jahren. Mit Hans Koschnick nach Bonn, Bremen als Sprungbrett … das war es! Wie es Hochspringer taten, die es über die Latte geschafft hatten, so riß er beide Arme hoch. Jetzt galt es nur, in den nächsten Monaten so gut zu arbeiten, daß er Koschnick ins Auge stach. Das mußte doch zu schaffen sein!
Es war Freitag nachmittag, und er konnte, nachdem er seine Umlaufmappe an der richtigen Stelle abgegeben hatte, gleich nach Hause fahren. Er tat es mit einem rauschhaften Hochgefühl. Mit der 2 ging es nach Sebaldsbrück hinaus, in Richtung Osten also, Rothenburg und Hamburg. Straßenbahn, endlich konnte er wieder Straßenbahn fahren. In Westberlin gab es seit 1967 keine mehr. Er genoß es. An der Endstation war umzusteigen in den Bus der Linie 37 in Richtung Kuhkamp, und das war ein »Schlenki«. Manfred kannte das nicht, und es riß ihn fast auseinander, als sie in die erste Kurve gingen.
Wo er in Osterholz auszusteigen hatte, dehnten sich schon die Felder. Es war schwer gewesen, in Bremen eine Wohnung zu finden, und so hatte er sich schließlich mit einem dreistöckigen Block in der Armsener Straße zufriedengeben müssen, der sehr nach sozialem Wohnungsbau aussah, obwohl unter den Nachbarn Schiffsingenieure, Architekten, Manager, Kameramänner und dergleichen waren. Der Boden zwischen den Häusern war lehmig, und die vielen Kinder verschmierten alles. Die Armsener Straße, benannt nach einem Dorf in Niedersachsen, war wie ein Hufeisen angelegt, mündete also zweimal in den Oewerweg und zeigte mit ihrer Rundung zur Osterholzer Heerstraße hin, so daß Manfred, wenn er auf dem Balkon stand, dort die Autos flitzen sah. An der Außenseite gab es liebliche Reihenhäuser aus rotem Backstein und dahinter den grauen Betonklotz einer Kirche, für die sich sicher auch der gütigste Gott kaum erwärmen konnte. Die Wohnung lag im erhöhten Parterre und bestand aus Flur, Küche, Bad und 2 ½ Zimmern. Es war seine erste eigene Wohnung. Manfred konnte es nicht fassen, daß er erwachsen genug war, selber einen Mietvertrag unterschrieben zu haben. Von seinem Gefühl her ging er noch immer zur Schule und wurde von Meph zusammengestaucht, weil er die Kohlenwasserstoffderivate nicht fehlerfrei herunterleiern konnte.
»Guten Tag, Herr Dr. Matuschewski.«
Fast hätte er sich umgedreht, um zu sehen, wen der grüßende Nachbar da wohl meinte. Gleichzeitig hörte er die Stimme eines Psychiaters: Manfred Matuschewski hat auch mit 32 Jahren noch immer keine ausreichende Ich-Identität ausbilden können, was daran liegen mag, daß ihn seine Mutter immer klein gehalten hat. Auch daß er eine Frau abbekommen hatte, wollte Manfred so recht nicht glauben.
»Ich hab’ Quetschkartoffeln mit sauren Eiern gemacht«, sagte Renate, als er aufgeschlossen und sie begrüßt hatte.
Seit sie in Bremen lebten, aßen sie einmal in der Woche Quetschkartoffeln. Wenn sie die auf ihrem Teller zu einem Nest geformt hatten und die beiden sauren Eier darin schwammen, dann war es ihnen, als wären sie nach Berlin zurückgekehrt, heim zu ihren Eltern in die Neuköllner Mietskasernen. Sie waren ja, wenn auch nicht bis zum Abitur, in dieselbe Schule gegangen, und vor ihrer ersten Liebesnacht in Renates Zimmer in der Reuterstraße hatte es Quetschkartoffeln mit sauren Eiern gegeben. »Ei gibt wieder Ei«, hatte Manfred gelacht und dabei ein wenig mit seiner Bildung geprahlt, denn dies stammte aus einem Theaterstück, das er im Schiller-Theater gesehen hatte, Dylan Thomas’ Unter dem Milchwald. Wenn sich andere Berliner, die es in die weite Welt verschlagen hatte, Bären oder Doppeldeckerbusse auf die Anrichte stellten, dann waren es bei ihnen die Quetschkartoffeln, die ihr Heimweh verbildlichten. Als Manfred im AmfVi den Kollegen erklärte, daß Quetschkartoffeln gleichsam ihre Wurzeln symbolisierten, da konnten die sich vor Lachen gar nicht mehr einkriegen, denn Wurzeln, das waren in Bremen die Mohrrüben, auch Möhren genannt. Noch stärker aber wurde ihre Heiterkeit, wenn er wiederholte, was alle Berliner mit Stolz erfüllte, Kennedys Ausspruch: »Ich bin ein Berliner«, denn ein Berliner war für die Bremer nichts weiter als ein Pfannkuchen.
In Bremen war es Brauch, daß die Mieter freitags ihre Treppenhäuser säuberten, immer reihum. Hauswartsfrauen gab es nicht. Und so hatten Manfred und Renate nach dem Quetschkartoffelessen mit Besen, Aufwischeimer und Scheuerlappen, in Bremen Feudel genannt, vom Keller bis zum zweiten Stock für Sauberkeit zu sorgen, und in der Hansestadt hieß das weitaus mehr als anderswo. Jeder Quadratzentimeter des Fußbodens hatte so zu glänzen, daß man ohne weiteres von ihm essen konnte, wie die Bremer, so schien es ihnen jedenfalls, auch jeden Grashalm in ihren Vorgärten einzeln hegten und pflegten und auf die vorgeschriebene Länge stutzten.
Der Dr. rer. pol. Manfred Matuschewski lag also auf den Knien, schrubbte mit einer Wurzelbürste Hundekot vom Fußabtreter hinter der Eingangstür und kämpfte mit einer Vielzahl widerstrebender Gefühle. Irgendwie gedemütigt und entehrt fühlte er sich. Er, der Akademiker, hatte anderer Leute Dreck wegzumachen. Zugleich schämte er sich dieser elitären Arroganz, denn vor Gott und von Geburt aus waren alle Menschen gleich, und er war auch nichts Besseres. Da kam das sozialistische Denken seiner Ahnen zum Vorschein. Andererseits war es Unsinn, daß er hier die Drecksarbeit machte, während andere, die dies gern für ein paar Mark getan hätten, arbeitslos zu Hause saßen. Außerdem war er nicht gerade Putz-Profi.
Im zweiten Stock ging eine Tür auf. Bruder Hermandung beklagte sich von oben herunter.
»Wenn ich Sie bitten dürfte, auch das Treppengeländer abzuwischen, das war noch völlig mit Honig vollgeschmiert, als Sie vor sechs Wochen dran gewesen sind.«
Manfred, der nach wie vor auf den Knien herumrutschte, sah auf. »Das war einer von den kleinen Böcken … nachdem wir fertig gewesen sind.«
Die Familie Bock, die das gesamte Obergeschoß bewohnte, war überaus kinderreich, und sie hatten trotz wissenschaftlich angelegter Zählversuche nicht herausbekommen, wie viele Söhne und Töchter es waren, die da herumwuselten: Renate war für sieben, er selber glaubte an nicht mehr als fünf und hielt die anderen für Gastkinder, die zufällig anwesend waren. Gerüchte, daß die Bocks selber nicht mehr wüßten, wer zu ihrem Wurf gehörte und wer nicht, hielt er für übertrieben.
Bruder Hermandung, ein Fleischberg mit einem kindlich kleinen Kopf, gab sich versöhnlich. »Ich glaube, das alles sollten wir einmal bei einer schönen Kanne Tee besprechen … und nicht hier im Treppenhaus.«
Manfred zuckte zusammen, denn Renate hatte längst mitbekommen, daß Bruder Hermandung derselben sektenähnlichen Glaubensgemeinschaft angehörte wie ihre Mutter, der Gemeinschaft der Bußfertigen, und höchstwahrscheinlich von Berlin aus gebeten worden war, alles zu tun, um die verlorene Tochter in den Schoß der kleinen Kirche zurückzuholen.
Manfred hatte eine Heidenangst vor Bruder Hermandung und rief von unten herauf, daß er in der nächsten Zeit oft Überstunden machen müsse.
»Nun gut«, sagte der Diakon, bevor er sich wieder in seine Wohnung zurückzog. »Man soll die Dinge reifen lassen.«
Manfred hoffte, daß sie mit dem Fegen und Wischen fertig sein würden, bevor weitere Mieter nach Hause kamen. Er hatte Angst vor Leuten und vor dem Small talk über das Wetter und die Sonderangebote der Woche. Dazu fehlte ihm jede Begabung, und er stotterte so herum, daß er sich regelrecht debil vorkam. Beispielsweise jetzt, als die Pfortes erschienen. Er, Hans-Peter, war ein kleiner knochentrockener Bauingenieur, und sie, Petra, eine vitale Grundschullehrerin, kugelrund und sexy-hexy. Ihr Sohn, knapp über zwei, hieß Torsten und hatte nur ein Thema: den Autounfall seines Vaters.
»Papa in der Kurve … tuuut … fällt um.«
Das war zwar schon im März auf dem letzten Glatteis des Winters passiert, aber noch immer spielte er es nach.
»Ein Trauma«, stellte Petra Pforte fest.
»Ick trau ma gar nich mehr, Auto zu fahr’n«, fügte Herr Pforte hinzu. Er stammte aus Hemmoor, was in der Nähe von Stade lag, hatte aber eine Weile in Berlin studiert und berlinerte gerne.
Seine Frau sah ihn an. »Morgen früh fahren wir aber trotzdem zu seinen Eltern nach Hause.«
»Zu Ihren Hämorrhoiden also«, lachte Manfred.
»Wie …?« Herr Pforte sah ihn ebenso pikiert wie verständnislos an. »Ich habe keine …«
»Ich dachte, die Einwohner von Hemmoor, das sind die Hämorrhoiden.«
»In Bremen hat man doch einen anderen Humor.«
Petra Pforte konnte sich darüber scheckig lachen. »Der Dr. Manfred in der Kurve … tuuut … fällt um.«
Manfred stellte fest, daß er völlig weg war von ihr. Immer, wenn er sie sah, erlebte er die Welt wie im Champagnerrausch, und er ertappte sich bei dem Gedanken, sie eines Tages … Sekt statt Selters.
Als hätte sie geahnt, woran er dachte, erzählte sie ihm, daß Wein und Sekt bei Kafu ganz besonders preiswert seien. Manfred gestand ihr, nicht zu wissen, wo das sei.
»Was …? Sie kaufen nicht bei Kafu …?«
Das kam mit einem solch abgrundtiefen Erstaunen, als hätte er nicht gewußt, daß Bremen ein deutsches Bundesland sei, und Manfred begriff, daß es zum »Nationalcharakter« der Bremer gehörte, immer gnadenlos ß-parsam einzukaufen. Er hatte sich nur die Werbung eines kleinen Ladens gemerkt: »Osterholzer kaufen gern bei Melnik.«
So kam natürlich kein gepflegter Informationsaustausch über die optimalsten Einkaufsgelegenheiten zustande, und die Pfortes zogen sich in ihre Wohnung zurück. Man konnte ungestört weiter putzen. Fünf Parteien waren sie im Mietshaus in der Armsener Straße – Bock, Hermandung, Pforte, Wätjen und Matuschewski –, und Manfred meinte, daß man nicht so viel Aufhebens darum machen sollte, alle fünf Wochen einmal das Treppenhaus reinigen zu müssen.
»Nein«, murmelte Renate, »das ist ja derselbe Rhythmus, in dem wir miteinander schlafen.«
Wumm, das hatte gesessen. Manfred registrierte es wie in einem Comic. Sie hatte recht, ihr Liebesleben war nicht das Gelbe vom Ei. Vordergründig war die Sache klar: Er war abends immer müde und wäre am liebsten um neun ins Bett gegangen, sie aber drehte erst gegen elf so richtig auf, da aber war er total abgeschlafft und wäre auch von Aphrodite selber zu nichts mehr zu bewegen gewesen, geschweige denn von ihr, die in der Gemeinschaft der Bußfertigen gelernt hatte, daß Fleischeslust geradewegs in die Hölle führte. Als sie sich kennenlernten, hatte sich das nicht so bemerkbar gemacht, da waren Trieb und Gier, Neugierde und Zwang, es machen zu müssen, stärker gewesen, nun aber wurde es immer mehr zu ihrem großen Problem. Doch sie redeten nicht groß darüber, und er gab sich mit dem zufrieden, was der Playboy bot … oder seine Phantasie im Hinblick auf die eine oder andere Nachbarin. Nur … auf diese Weise ließ sich weder sein noch Renates Kinderwunsch erfüllen.
»Gehen wir doch essen heute abend, eine Flasche Wein trinken und dann …« Er nahm sie in die Arme.
»Der Eimer!« schrie sie auf. Der kippte um … und ihr Nachbar Jens-Uwe Wätjen stand bis zu den Knöcheln im Wasser.
»Der ist Kapitän«, sagte Manfred, »dem macht das nichts aus.«
Und in der Tat nahm Wätjen es sehr gelassen hin, zumal er soeben die Nachricht erhalten hatte, daß es mit seiner »Landstelle« in Bremerhaven vielleicht doch noch klappen könne. Obwohl keine vierzig Jahre alt, fuhr er gar nicht mehr gerne zur See, seit die Liegezeiten in den Häfen immer knapper wurden. Auch quälte ihn die Trennung von seiner Frau immer mehr. Er war ein Schrank von Mann mit einem Riesenrauschebart und hieß bei Manfred und Renate immer nur »Clarence«… nach dem schielenden Löwen in der Fernsehserie Daktari. Wie er bei seinem Silberblick eine Hafeneinfahrt finden konnte, schien ihnen schwer verständlich. Vielleicht hatte er des öfteren, so lästerten sie gern, in Rotterdam statt in Bremen festgemacht und war deswegen von seiner Gesellschaft nicht mehr ganz so nett behandelt worden, siehe seine Sehnsucht nach einer Stelle an Land, beim Hafen- und Schifffahrtsamt.
Nach der Putzaktion waren sie zu müde, um noch mal anzuspannen und in die Stadt zu fahren, und statt der Flasche Rotwein reichte es nur zu einem Sherry der Marke Sandemann. Doch dann wurde geduscht und die Aktion Joscha in Angriff genommen. Schon zu Renates DDR-Zeiten war der Wunsch in ihr herangereift, einen Sohn zu haben und ihm einen russisch klingenden Vornamen zu geben. Kolja, Kostja, Joscha, Jewgenij und Juri hatten zur Auswahl gestanden, und Joscha war schließlich Sieger geworden. Bei einem Mädchen hatten sie sich von vornherein auf Larissa geeinigt. Hier war Manfred die Zustimmung leichter gefallen, denn im Verlauf einer unvergeßlichen Griechenlandreise, mit seinem Freund Moshe Bleibaum im Sommer 1962 unternommen, hatten sie in Athen des öfteren auf dem Larissa-Bahnhof gestanden.
»Heute könnte es klappen.« Renates Messungen hatten ergeben, daß der Eisprung gerade erfolgt sein mußte.
»Okay …«
Manfreds Begeisterung hielt sich in Grenzen. Er war müde und hätte lieber vor dem Fernseher gedöst. Aber das war nur vordergründig. In Wahrheit hatte er Angst davor, Vater zu werden, Vater zu sein. Nein, Kinder hätte er schon gern gehabt, aber … Er hatte keine feste Arbeit, und den meisten Leuten schien der Beruf des Soziologen ebenso notwendig wie ein Kropf zu sein, jedenfalls hatte er diesen nicht gerade originellen Vergleich oft genug gehört. Also hieß Joscha im Klartext: zurück zu Siemens. Und das war eine Art von Prostitution für ihn. Sich nur des Geldes wegen hingeben. Außerdem, das hatte er bei vielen Freunden und Verwandten erlebt, würde er Renate verlieren: Schon nach dem positiven Ergebnis des Schwangerschaftstests würde sich alles nur noch um Joscha oder Larissa drehen.
All das ging ihm im Kopf herum und sorgte dafür, daß sich jener Effekt nicht einstellen wollte, der die Mindestvoraussetzung für den Zeugungsvorgang ist. Da war nichts von Zärtlichkeit oder gar Ekstase, nur die Sterilität einer Klinik, in der er als Zuchtbulle das Kommando »Nun mal ran!« vernommen hatte.
»Moment mal …« Er flüchtete sich in einen Hustenanfall. In der Nase gekribbelt hatte es schon den ganzen Nachmittag über. Er suchte nach einem Tempotaschentuch. Dann schmiegte er sich an Renates Rücken und dachte daran, wie er sie bei ihrer Klassenreise begehrt hatte. Auch Joscha stellte er sich vor. Wie er mit ihm durch die Gegend fuhr, vorn im Körbchen auf dem Rad, und später zum Fußball ins Weser-Stadion ging.
Doch als er Renate küßte und seine Hand dem Menschenpflanzholz, wie es in alten Büchern hieß, bei ihr den Weg bereiten wollte, bekam er einen mächtigen Nies- und Hustenanfall. Wäßriger Schleim quoll aus seiner Nase. Atemnot stellte sich ein. Um jedes Quentchen Luft mußte er kämpfen. Es war eine Art Keuchhusten, wie damals, als man sie im Frühjahr 1944 evakuiert hatte und der Zug zwischen Berlin und Coswig von Tieffliegern beschossen worden war. Der Lokführer hatte abrupt gehalten. »Alle raus … und unter die Wagen legen!« Die Mutter hatte ihm die Hand vor den Mund gehalten, aus Angst, daß die Piloten oben das Gehuste hörten und gezielter feuerten. Jetzt dagegen … Glück war die Summe des Unglücks, dem man entgangen war.
»Soll ich nicht doch die Feuerwehr …?« Renate hielt schon den Hörer in der Hand. »Oder dich schnell mit dem Wagen ins St.-Jürgen-Krankenhaus bringen …?«
»Laß man, ist doch nur Tbc …« Manfred würgte sich die Lunge aus dem Hals. »Ich geh’ mal auf den Balkon.«
Dort wurde es eher schlimmer, und Petra Pforte, die mit ihrem Mann oben beim Schach gesessen hatte, kam nach unten geeilt, um ihre Hilfe anzubieten.
»Da ist nicht viel zu machen …«, röchelte Manfred.
»Der hustet sich ja tot.«
»Er will nicht ins Krankenhaus«, klagte Renate.
»Hier nebenan wohnt ein Arzt, den hol’ ich mal.«
Petra Pforte stürzte los und kam fünf Minuten später mit einem älteren Mediziner zurück. Der horchte Manfred ab, konstatierte eine schwere Bronchitis und verschrieb ihm einen Hustensaft, den Renate schnell aus einer Nacht-Apotheke in Hemelingen holen mußte. Manfred nahm ihn ein, ohne daß es spürbar half. Erst vier Stunden später hatte das Rasseln und Pfeifen in seinen Lungen so weit nachgelassen, daß er einschlafen konnte. Als er am Sonnabend vormittag gegen zehn Uhr erwachte, war von der ganzen schweren Bronchitis nichts mehr zu merken, und es ging ihm wieder blendend.
»Komisch …« Er war reichlich verunsichert.
Als Renate die Vorhänge aufzog, sah sie gegenüber, wo ein Weg mit dem Namen Kükenmoor von der Armsener Straße abging, zwei kleine Mädchen aus einem Reihenhaus kommen.
»Wie niedlich!« rief sie. »Wie süß. Guck mal, die beiden Puttelkinder wieder.« Und ihr Kinderwunsch erwachte von neuem. Diesmal sollte es ein Mädchen werden. »Elena oder Jekaterina, nein: Larissa.«
Nach dem rätselhaften Anfall fühlte sich Manfred wie neugeboren, und als er an sich hinuntersah, fiel ihm sogleich ein Lieblingsspruch seines Schulfreundes Dirk Kollmannsperger ein: »Hart ist der Zahn der Bisamratte, doch härter ist die Morgenlatte.«
Renate, sonst prüde und sittenstreng, was Sauereien dieser Art betraf, überhörte es und nahm ihn in die Arme. Doch bevor Entscheidendes passieren konnte, klirrte es nebenan im Wohnzimmer ohrenbetäubend, und sie fuhren auseinander.
»Einbrecher!« schrie Renate, die von Anfang an gegen eine Parterrewohnung gewesen war.
Sie stürzten hin, fanden aber keinen Eindringling vor, sondern nur einen grün-weißen Werder-Bremen-Ball, den Torsten Pforte beim Spiel mit dem Sohn von Bruder Hermandung in ihre Scheibe gehämmert hatte. Pfortes entschuldigten sich und luden sie zum Frühstück ein. Dann mußte auf den Glaser gewartet und für den Sonntag eingekauft werden. Jedenfalls ergab sich keine Gelegenheit, wieder in Stimmung zu kommen und die Aktion Joscha neu zu starten.
»Ich weiß was …«, sagte Renate.
Manfred sah sie an. »Wir adoptieren ein Kind …?«
»Quatsch! Wir setzen uns auf die Räder, fahren nach Fischerhude rüber und suchen uns da ein romantisches Plätzchen im Wald.«
»Dann müssen wir Joscha aber auch Waldemar nennen.«
»Wieso …?«
»Na, kennst du das nicht mehr: ›Er hieß Waldemar, weil es im Wald geschah.‹« Er erzählte ihr einige Geschichten von Waldemar Blöhmer, einem alten Freund seines Vaters. Wie der sich bei der Einsegnung 1953 so furchtbar um seine teure Leica gehabt hatte … und dann nicht ein einziges seiner Bilder etwas geworden war.
Sie hatten sich zwei Klappräder gekauft, rot und orange, und nutzten sie nach Kräften. Entweder starteten sie von der Armsener Straße aus, oder sie packten die Räder auf den Rücksitz ihres Käfers und fuhren nach Worpswede hinaus oder zu den Badenschen Bergen hinüber. Heute wollten sie direkt zur Wümme und nahmen Kurs auf den Lachmundsdamm. Manfred vorneweg, obwohl er kein guter Radfahrer war. Am Oewerweg wohnte ihr Zahnarzt, vor dem sie beide ein wenig Angst hatten. Er war Flieger und drehte des öfteren vom idyllischen Flugplatz in Ganderkesee aus seine Runden. Nicht das war es, was ihnen Furcht einflößte, sondern seine Bemerkung, daß er eines seiner Funkgeräte jüngst umgebaut hätte. »Da kann ich jetzt wunderbar Ihren Zahnstein mit wegmachen, kommen Sie nächste Woche mal vorbei. Ohne Schein, kostenlos, ich will das nur mal ausprobieren.«
Unter der Autobahn hindurch kamen sie zum Hodenberger Deich und zu einer ausgedehnten Niederung, durch die sich die beiden großen und die vielen schmalen Wümme-Arme zogen. Es war alles so flach und grün, daß Manfred den Ausspruch tat, hier sei sicher Gottes Billardtisch. Die Deichkrone war asphaltiert, und man fühlte sich wie Gott in Frankreich, wenn man so dahinrollte. Rechter Hand lag der südliche Wümme-Arm. Er hatte in etwa die Breite des Gosener Grabens, war aber, da er nicht mäanderte, sondern sich grade wie ein Lineal in Richtung Borgfeld zog, um ein Vielfaches langweiliger. Und dennoch sah sich Manfred im Faltboot flußaufwärts paddeln, bis zur Mündung der Wümme in die Hamme und dann weiter zur Weser. Vielleicht hatte er nächstes Jahr wieder ein Boot. Was ihn noch mehr faszinierte, war der Bahndamm, der als dunkler Strich die weite Ebene ein wenig gliederte. Es war die Strecke Bremen–Hamburg, und wenn einer der neuen TEE-Züge lautlos dahinglitt, war das Modelleisenbahn pur, und weil er nicht genug davon bekommen konnte, hoffte er immer, die Schranke würde unten sein. War sie aber nicht. Enttäuscht fuhr er weiter zu einer grünen Holzbude, wo Mutter Köhn Eis und allerlei Getränke vorrätig hatte. Doch dort stieg dicker Qualm in die Luft, es schien zu brennen.
Sofort begann es bei Manfred zu rattern, und ein alter Reim seines Vaters kam ihm in den Sinn:«Das ganze Kackhaus steht in Flammen,/der nackte Arsch ist in Gefahr./Da komm’n die Männer mit den Schläuchen …/Hurra, die Feuerwehr ist da.«
»Soll das witzig sein?« fragte Renate.
»Ja, denn Schläuche sind in der Umgangssprache nichts anderes als …«
»Ich weiß.«
»Woher? Ach so, ja, dein Zahnarzt, deine zweitgrößte Liebe. Wenn der mit seinem Bohrer …«
Sie hielt und funkelte ihn an. »Manfred!«
»Renate.« Er gab sich harmlos. »Meine Damen und Herren, nicht der Bohrer ist gemeint, sondern die Bohra: Katharina von Bohra, die Geliebte Martin Luthers, über die sich schon viele Puritaner geärgert haben, siehe auch die große Szene beim Fontane im Schach von Wuthenow.« Er küßte sie. »Nun, hab’ ich meinen großen Fauxpas durch dieses Übermaß an Bildung wieder ausgeglichen?«
»Ich hab’ mir meinen Mann nicht so albern vorgestellt.«
»Hoffentlich liegt’s nicht in den Genen.«
»Joscha wird ganz anders werden.« Sie stieg wieder auf.
»Entschuldige, aber eine kleine Hommage an meinen Vater darf ich mir wohl hin und wieder gönnen … und er war nun mal der Mann, der vornehmlich aus Sprüchen bestand, nicht immer stubenreinen Sprüchen.«
»Lassen wir’s!«
Manfred folgte ihr und fragte sich, wie und wo das alles enden sollte. Er folgte seiner Frau im Zuckeltrab. Sie kauften sich zwei Tüten Eis und setzten sich auf eine Bank, von der man einen traumhaften Blick hinüber nach Fischerhude hatte. Manfred genoß ihn ebenso wie die Knie und Schenkel der Frauen, die vorüberradelten. Es machte ihm auf alle Fälle wieder Appetit.
»Ist der Mai warm und trocken, kann man auch im Freien bocken«, lachte er.
Renate verzog von neuem das Gesicht. Von frömmelndprüden Eltern erzogen, hatte sie an solchen Sprüchen partout keinen Spaß und merkte nur an, daß man bereits Juni habe. »Mann, kannst du denn wirklich nicht anders!?«
War es kindlicher Trotz bei Manfred, war es sein Selbstbehauptungswille, war es seine Unfähigkeit, ernst im Sinne eines Bildungsbürgers zu sein, war es der Einfluß von Freunden wie Moshe Bleibaum und Dirk Kollmannsperger, er wußte es nicht, jedenfalls kam es sofort, reflexhaft aus ihm: »Keiner kann aus seiner Vor-… äh: seiner Haut heraus.«
Daraufhin schwieg Renate. Sie schmollte. Manfred begriff, daß er einen Fehler gemacht hatte, daß er ihr seine Art nicht aufzwingen konnte und durfte. Sie wollte ihn als ehrbaren Dr. rer. pol. und nicht als Witzbold. Wollte er blödeln, mußte er zu seinen Freunden gehen. Okay.
»Entschuldige bitte …« Er rückte zu ihr hin und nahm sie in die Arme. Nach ein paar Minuten heißen Bemühens gab sie nach und schien den Gedanken, Joscha hier in Gottes freier Natur zu empfangen, ganz reizvoll zu finden. Jedenfalls mahnte sie zum Aufbruch und sah sich beim Fahren ganz offenbar nach einem Liebesnest um. Am Deichschart überquerten sie den Wümmearm und nahmen Kurs auf Fischerhude. Manfred hatte zu Hause im Reiseführer geblättert und dabei genug behalten, um den Originalton zu treffen: »Fischerhude wurde zu Beginn des Jahrhunderts von Worpsweder Künstlern entdeckt – allen voran Otto Modersohn, der Mann von Paula Modersohn-Becker – und entwickelte sich zu einer Künstlerkolonie, ohne dabei freilich seinen bäuerlichen Charakter einzubüßen. Das Otto-Modersohn-Museum ist nur samstags und sonntags geöffnet. Dort erfahren Sie auch, wo sein Sohn heute modert …«
Sie verfuhren sich etwas und kamen in ein Gebiet, in das sich kaum Wanderer und Radfahrer verirren mochten. Renate stoppte abrupt. »Ich hab’ keine Luft mehr im Reifen, vorne, ich glaub’, du mußt den mal aufpumpen.« Sie schob das Rad in eine kleine Kuhle und ließ es fallen.
Manfred klemmte seine Luftpumpe vom Rad und machte sich ans Werk. Das Gleichmaß der Bewegung und der Anblick der Mechanik, wie sich da der gummibewehrte Kolben in einer Höhlung hin und her bewegte, ließ ihn automatisch daran denken, warum sich Renate hier ins Gras geworfen hatte: einzig und allein, um Joscha zu empfangen. Der familienhistorische Augenblick der Zeugung des Sohnes war also gekommen. Das Schicksal betätigte die Klappe: Joscha Matuschewski – die erste. Unwillkürlich griff er in die Tasche, um nach einem Kondom zu suchen. Quatsch!
Er legte sich neben Renate. Sie hatte die Augen geschlossen. Er küßte sie.
»Ich liebe dich wie damals in der Schule …«, flüsterte sie.
»Ich dich auch.«
»Damals hab’ ich schon an Joscha gedacht.«
»Ich nur an das, was zu Joscha führt.«
So feierlich sie es angehen ließen, so störend war es nun, daß der Reißverschluß ihrer Jeans gewaltig klemmte und Manfred es nicht schaffte, ihn zu öffnen. Und als Renate die Augen aufschlug, um es selber zu versuchen, schrie sie auf.
»Was ist denn?«
»Da oben an der Pappel steht ein Mann mit einem Fernglas und beobachtet uns.«
Manfred richtete sich ebenfalls auf. Es stimmte. »Ein Voyeur. Die Sau, die!«
Renate stand auf und griff sich ihr Rad. »Tut mir leid, wenn einer zusieht, kann ich nicht …«
Manfred stimmte ihr zu, und mit grimmiger Miene fuhren sie weiter. Der Mann mit dem Fernglas winkte ihnen nach. Ein paar hundert Meter weiter sahen sie zwei andere Männer mit noch größeren Gläsern.
»Das scheint ein Dorado deutscher Spanner zu sein«, vermutete Manfred. »Klar, bei den vielen Liebespaaren, die es hier in den Wiesen treiben wollen …«
Als er am übernächsten Morgen im AmfVi von diesem Erlebnis erzählte, wollten sich alle halbtot lachen, was Manfred nun gar nicht verstand. Und sie ließen ihn noch eine Weile zappeln. Diese weltfremden Berliner, mein Gott.
»Die Wümmewiesen«, klärte ihn Wannowski schließlich auf, »sind der Treffpunkt aller Ornithologen zwischen Harz und Nordsee.«
»Was ist ein Ornithologe?« wollte Frau Winterberg wissen.
»Einer mit Spaß an allem, was mit Vögeln zu tun hat.«
»Dann bin ich auch ein großer Ornithologe«, lachte Hüring.