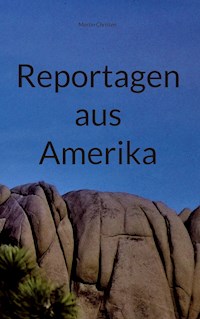
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reportagen aus Amerika Der Autor bereiste im Rahmen eines Bildungsprojekts im Jahr 2000 mit Sohn und Partnerin während zehn Wochen in einem Mobilhome die USA respektive Kalifornien und hielt seine Eindrücke in Form von 27 literarischen "Reportagen" fest. Dieser leicht ironische, unverstellte und oft überraschende Blick auf ein Amerika, "wie es wirklich war", kontrastiert stark mit dem Bild der heutigen, tief gespaltenen, bürgerkriegsähnlichen Ex-Trump-Nation, wie die vier "Update"-Ergänzungen am Schluss eindrücklich zeigen. Highlights: "Big Tree","Baseball", "Jogging", "Arbeitsbedingun-gen", "Post", "Election Day", "Bingo" u.a. Lesenswert!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor Martin Christen vor einem «Big Tree».
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einstieg
Luft
Restrooms
Big Tree
Oregon
Wohnmobil
Baseball
Moneymoney
Jogging
Arbeitsbedingungen
San Francisco
Master Card
Shopping
Laguna del Sol
Post
Litter
Election Day
Death Valley
Trinkwasser
Las Vegas
Stimmen zählen
Ghost Town
At the Dentist
Thanksgivings Day
Swiss Cheese
Bingo
Disneyland
Traffic
Nachwort
1
2
3
4
Anhang Route
Winzig das Wohnmobilchen – gewaltig die Giant Trees im Sequoia National Park
1 Vorwort
Von Oktober bis Dezember 2000 bereiste ich im Rahmen eines Fortbildungsprojekts während nicht ganz drei Monaten Kalifornien. Mit dabei waren meine damalige Partnerin und unser zweieinhalbjähriges Söhnchen.
Unsere Eindrücke und Erfahrungen hielt ich – als Teil des Projektauftrags – in Form von «Reportagen» fest, die ich jedoch nie publizierte.
Nun, nachdem seither über zwanzig Jahre verflossen und die USA auf dem Weg sind, den Kreis der demokratischen Staaten zu verlassen, ist vermutlich der richtige Zeitpunkt für die Publikation meiner damaligen Texte gekommen:
Im Jahr zweitausend, ein Jahr vor Nine Eleven, war in den USA noch vieles, jedoch längst nicht alles, in Ordnung, und es liess sich gut leben, wenigstens vorübergehend, denn es gab weder eine Spaltung des amerikanischen Volkes noch ein vergiftetes zwischenmenschliches Klima.
Klar, die Mehrheit der Menschen war entweder für die eine oder für die andere Partei, doch von abgrundtiefem Hass, von offen zur Schau getragener Feind- und Gewaltbereitschaft, einer bürgerkriegsähnlichen Stimmung war nichts zu spüren.
Im Gegenteil: Beide Seiten waren in der Lage, sich zu
arrangieren, aufeinander zuzugehen, einander respektvoll zu begegnen, und Al Gore gestand seine Wahlniederlage – die in Wirklichkeit keine war – unumwunden, grossmütig, fair und staatsmännisch ein.
Die vorliegenden kritisch-ironischen Erlebnis- und Erfahrungsberichte eines nichtamerikanischen Schweizers entführen uns in ein vortrumpsches Amerika, wie es sich heute alle noch einigermassen bei Verstand Gebliebenen – in den USA oder sonstwo auf der Welt – wohl sehnlichst herbeiwünschen.
Denn in den heutigen USA ist nichts mehr, wie es einmal war.
Martin Christen
Switzerland, 2022
Unser Wohnmobil unterwegs - hier im Lassen National Park, USA.
2 Einstieg
Zehn Wochen in Kalifornien im Herbst 2000:
Unterwegs in einem Mobilhome mit 4 Rädern, 4 Sitzen, 3 Schubladen, 2 Tischen, 2 Betten, 2 Schränken, 2 Sitzbänken, 2 Kästchen, 1 Küche, 1 Steuerrad, 1 Motor, 1 Zündschlüssel, 1 Frau, 1 Mann, 1 Kind.
Da wird einiges erlebt, be-, ver- und erfahren.
Die folgende Textsammlung, meist spontan und nachts entstanden, zeigt exemplarisch, subjektiv, unvollständig, tiefschürfend und einseitig:
Amerika.
Wie es wirklich war.
In unveränderter Reihenfolge.
Februar 2022
Martin Christen
Mit dabei: Begleiterin Corinne F. und Söhnchen Elia.
3 Luft
Die Luft.
Sie ist viel besser hier als anderswo.
Vor allem innen.
Denn hier wird nicht geraucht.
Nur selten siehst du Menschen, die an diesen kleinen, papierenen Röhrchen hängen, und wenn, dann nur im Freien oder in ihrem eigenen Auto.
Und nie siehst du rauchende Kinder oder rauchende Jugendliche.
Rauchen ist out, total.
Natürlich in erster Linie, weil’s überall verboten ist.
Weil hier die Nichtnikotinkonsumierenden vor den Immissionen der Raucherinnen und Raucher geschützt werden.
Was ja sinnvoll, vernünftig und nichts als recht ist.
Du kannst in jedes Restaurant, in jede Bar, in jede Imbissstube eintreten, einfach so, ohne dass du von einer stinkenden und giftigen Rauchwolke empfangen wirst.
Auch in den Bahnhöfen, in den Postämtern, an den Bushaltestellen, am Strand, in den Kinoeingängen: Nirgendwo wirst du belästigt von rücksichtslosen Pafferinnen und Paffern.
Wunderbar, genial, fantastisch.
Du fühlst dich frei, überallhin zu gehen, wo immer du möchtest – auch mit deinem zweieinhalbjährigen Sohn.
Deine Lungen und jene deines Kindes werden hier respektiert, geschätzt und geschützt.
Hier gilt, was überall gelten sollte:
Das Recht auf saubere Luft gilt mehr als das Recht, die Luft verschmutzen zu dürfen: Saubere Luft ist hier ein wertvolles, zu schützendes Gut, saubere Luft hat hier einen Wert.
Es ist hier untersagt, andere Menschen mit Tabakrauch zu belästigen und zum Mitrauchen zu zwingen.
Weil die Freiheit derjeniger, die saubere Luft inhalieren möchten, höher eingestuft wird als die Freiheit derer, die die reine Luft verpesten und diejenigen, die nicht rauchen, zum Mitrauchen zwingen.
Arme Schweiz, wo die Innenluft noch immer mit Füssen getreten, von den Raucherinnen und Rauchern vollgequalmt, verpestet, vergiftet wird.
Wo die Süchtigen noch immer das Recht auf ihrer Seite haben, wo sie noch immer die Mächtigen, die Herrscher:innen über die Innenluft sind.
Wo Anstand, Rücksichtnahme, Respekt noch immer keine Selbstverständlichkeit sind.
16. Oktober 2000
Autor und Sohn an der frischen Luft in Big Bear Lake, Kalifornien.
4 Restrooms
Mit den sanitären Einrichtungen ist es in Kalifornien so eine Sache:
1. heissen sie «Restrooms», um jeglichen Gedanken an Toiletten, Stuhlgang oder Urin zu verdrängen,
2. sind sie von so unterschiedlicher Qualität wie in jedem anderen einigermassen zivilisierten Land, und
3. verfügen sie über Eigenheiten, die es den an schweizerische Toiletten-Standards Gewöhnten nicht leicht machen, solche Anlagen zu benützen.
Der Deckel
Nur ganz selten – in guten Hotels oder guten Restaurants oder teuren Campinggrounds – weisen die Klosetts Deckel zum Zudecken der Schüssel auf. Üblicherweise besteht die Sitzfläche aus einem weissen, vorne offenen Kunststoffring, so dass von einer «Brille» – wie bei uns – nicht gesprochen werden kann.
Der ins Auge springende Vorteil: Du siehst auf den ersten Blick, ob die Toilette benutzbar ist oder nicht, also sauber, einigermassen sauber oder mehr oder weniger ekelerregend.
Was die Männer-Klos so abstossend macht: Offensichtlich gibt’s auch hier viele Männer, die die Toiletten als Pissoirs missbrauchen, im Stehen pinkeln, die WC-Schüssel nicht treffen und nichts aufwischen...
Der Sitzschutz
Zu einem US-Standard-WC gehört ein Behälter mit dünnem, knisterndem Sitzschutzpapier, das du auf den trockenen Kunststoffring legen kannst, so dass weder dein Gesäss noch deine Oberschenkel mit dem Sitzreifen in Berührung kommen, was sehr praktisch ist:
Du brauchst nicht mehr minutenlang mühsam die Oberschenkel anzuspannen, um den Direktkontakt mit dem unhygienischen Plastiksitzring zu vermeiden oder diesen umständlich mit WC-Papier abzudecken, bevor du dich hinsetzt.
Die Spülung
Diese ist viel effizienter, als wir es uns gewohnt sind. Wie es funktioniert, weiss ich zwar nicht, doch ist die hier verbreitete druckvolle Spültechnik ziemlich genial: Mit sehr wenig Wasser wird der Schüsselinhalt innerhalb einer halben Sekunde mit grossem Getöse kraftvoll in die Tiefe gesogen, so dass nichts zurückbleibt und auch nichts verstopft.
Der Nachteil: Die Schüssel ist immer halb mit Wasser gefüllt, was ein geräuschvolles Plumpsen und empfindliche Spritzer verursacht.
Die Toilettenwände
Nicht nachvollziehbar ist, warum die meisten Toilettenkojen kaum voneinander abgetrennt sind. Wenn in den USA sonst, wie wir sie aus den Medien kennen, üblicherweise wahnsinnig viel Wert auf Prüderie und Privatsphäre gelegt wird, dann ist das hier Vorgefundene das pure Gegenteil davon:
Denn wenn du einen «Restroom» betrittst, siehst du auf den ersten Blick, welche Toiletten besetzt sind und welche nicht, was für Schuhe, Socken, Hosen und Unterhosen die Leute, die gerade auf einem Thron sitzen, tragen, ob deren Beine behaart oder glatt, weiss, braun oder dunkelfarbig sind, dick oder dünn, muskulös oder nicht. Und bist du grösser als eins-achtzig, dann kannst du auch bequem die Haarfarbe, die Glatze, die Stirn, einen Teil der hellen, roten, braunen, schwarzen, sauberen oder weniger sauberen Ohren erkennen, so schmal respektive niedrig sind die Trennwändchen.
Aber klar doch: Im Wilden Westen hatten sie damals ähnliche Saloon-Pforten: Vierzig Zentimeter über dem Erdboden begann die Schwingtüre, in einer Höhe von eins-sechzig hörte sie wieder auf...
Ein Meter zwanzig für die Privatsphäre, für das private Geschäft, für die Bedeckung des amerikanischen Normkörpers zwischen Knie und Augenbrauen müssen genügen – heute, zu Beginn des dritten Jahrtausends.
Die Pissoirs
Kein Wort über diese grässlichen Urin-Spritz-Becken, die auch hier in Hülle vorhanden und überall anzutreffen sind. Und die auch hier von unzivilisierten, kulturlosen Hygiene-Analphabeten benutzt werden, die es als unnötig erachten, zu versuchen, wenigstens halbwegs zu treffen, zu spülen, die entstandene Urinlache aufzuwischen oder nachher die Hände zu waschen.
Pfui.
Was heisst:
Die kalifornischen Restrooms sind keineswegs zum Verweilen gedacht, so dass du, wenn’s pressiert, wirklich pressierst.
Um so schnell wie möglich wieder herauszukommen.
17. Oktober 2000
Campground in in einem National Park in California – mit Restrooms, die stark mit der schönen Landschaft kontrastieren.
5 Big Tree
Wir befinden uns in den Redwood National and State Parks im Norden Kaliforniens, dort, wo die Riesenbäume zu bewundern sind, Bäume, die über hundertzehn Meter hoch werden können und damit zu den grössten Lebewesen der Erde gehören.
Über 96 Prozent all dieser Wälder sind Ende des neunzehnten und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zerstört worden: Vor allem Eisenbahn- und Holzfirmen fällten diese imposanten tausend bis zweitausend Jahre alten Zeugen vergangener Zeiten gleich hektaren- und quadratkilometerweise. Dem Einsatz engagierter Natur- und Umweltschützer:innen ist es zu verdanken, dass einige tausend dieser Giganten heute noch zu bestaunen sind.
Einer davon ist der «Big Tree», ein unglaublich mächtiger, majestätisch in den Himmel ragender, erhabener Riesenbaum mit knorriger, rund dreissig Zentimeter dicker Rinde: Mit fast hundert Metern Höhe, über sieben Metern Durchmesser und über zweiundzwanzig Metern Umfang gehört er zu den Grössten der Grossen.
Doch vom Hauch der Ewigkeit, der ihn einst umgab, ist heute nichts mehr zu spüren: Die Ruhe fehlt, die Abgeschiedenheit, die ursprüngliche Wildnis. Denn heute steht er wenige Meter neben einem grossen, geteerten Parkplatz, neben einem viel besuchten Toilettenhäuschen, neben einer viel befahrenen Strasse.
Und heute pflanzen sich täglich Hunderte von Touristinnen und Touristen vor ihm auf, lachen in die Kameras, benutzen den wunderschönen, gewaltigen Baumstamm als Hintergrund für ihr eigenes Konterfei. Seht: Hier war ich auch noch!
Und weg sind sie, bei der nächsten Attraktion: Beim «Drive Thru Tree», durch den die Leute mit ihrem Auto hindurch fahren, ein Erinnerungsfoto schiessen und weiterrasen, beim «Chimney Tree», beim «Immortal Tree», beim «Tree House», beim «One Log House», bei der «Avenue of Giants».
Die einen konsumieren die sensationelle Grösse dieser Bäume auf ihrem Surf- und Lebenstrip wie ein Fastfoodhäppchen, und die anderen machen damit ihr Geschäft: Wenn der Verkauf des Blicks auf den Baumriesen mehr einbringt als der Verkauf des Holzes, dann lässt man ihn eben stehen...
Der «Big Tree» hat Glück gehabt: Er lebt wenigstens noch. Und dank ihrer ungewöhnlichen Grösse, die sogar Menschen beeindruckt, die auf der obersten Oberfläche des Seins herumirren, haben einige Hektaren dieser einstigen Göttinnen- und Götterwälder überlebt.
Viele andere Tier- und Pflanzenarten haben dieses Glück nicht: Sie sind zu unscheinbar, zu uninteressant, zu unattraktiv, zu unwirtschaftlich, zu langweilig, zu wenig geil, zu wenig sensationell.
Gewesen.
Waren zum Totschlagen der menschlichen Lebenszeit nicht geeignet. Also überflüssig, das heisst wert- und sinnlos.
Also zum Ausgestorbenwerden prädestiniert.
Anders als «The Big Tree».
18. Oktober 2000
Im Redwood National Park: Vater und Sohn bewundern die gigantischen Riesenbäume.
6 Oregon
Wenn man von Kalifornien in Oregon einfährt, dann ist das so, als ob man von Frankreich oder Deutschland herkommend die Schweiz betritt:
Plötzlich ist alles voller Häuser, Autos und Strassen. Und all die – in Oregon auffallend hässlichen – Gebäude stehen überall, weit verstreut, an den Strassen, an den Abhängen, mitten in noch nicht gerodeten Waldstückchen.
Und die Zahl der gigantischen Werbetafeln und überdimensionierten Schriftschildern am Strassenrand ist noch grösser als in Kalifornien, viele Hügel sind kahl, öd, abgeholzt.
Ich bekomme das Gefühl, die Natur habe hier nichts zu suchen, habe keinen Platz zwischen all dem Zivilisationsbrei.
Und so ist auch von den einstigen Redwood-Riesenbäumen in Oregon nichts mehr zu sehen: Hier haben sie ganze Arbeit geleistet und nicht nur 96,5 wie in Kalifornien, sondern hundert Komma null Prozent der tausend- und mehrjährigen Kolosse umgelegt und zu irgendetwas verarbeitet. Denn hier galt offenbar der Wert des Holzes unendlich viel mehr als das Wunder, das dieses Holz erst möglich gemacht hatte.
Und natürlich werden sie hier in diesem Bundesstaat, anders als in Kalifornien, Bush und nicht Al Gore wählen, Bush, den Konservativen, der nicht etwa die Natur, das Wertvolle und Kostbare, konservieren, erhalten will, sondern die Macht der Mächtigen und Reichen, die Strukturen, die es den cleveren Rowdies weiterhin erlauben, auf Kosten der Ohnmächtigen materielle Güter anzuhäufen.
Dieser Mentalitätsunterschied ist auch auf den State-Park-Campgrounds zu spüren: In Oregon sollen die Leute auf nichts verzichten müssen, weder auf Strom noch auf Waschmaschinen – dort stehen der Mensch und dessen Bequemlichkeit im Mittelpunkt. Nicht wie in den sehr einfach und zweckmässig eingerichteten kalifornischen State Parks, wo kein Blümchen gepflückt, kein Papierchen weggeworfen, kein Tierchen gefüttert werden darf.
Am deutlichsten und krassesten zeigt sich dieser Gegensatz, wenn man von Oregon zurück nach Kalifornien fährt: Plötzlich hat’s da einen Zoll, man wird angehalten und befragt, unter Umständen auch kontrolliert und untersucht, als ob man aus dem Ausland käme, als ob Oregon nicht mehr zu den USA gehörte. Und gefragt wird nach Naturprodukten, nach Früchten, Gemüse, Lebensmitteln, die sich eventuell im Auto befinden könnten. Und obwohl unser im Wohnmobil eingebauter Küchenschrank vollgestopft ist mit Äpfeln, Orangen, Kartoffeln, Salat, Brot, Teigwaren, Reis etc., antworte ich mit «No!»
Und ehrlich: Ich habe nicht gelogen, denn unser ganzer Foodvorrat stammt aus kalifornischen Supermärkten: Alles Essbare haben wir nach Oregon im- und einen Tag später wieder aus Oregon heraus exportiert, da wir das gleiche Misstrauen gegen die oregonschen Lebensmittel hegen wie offenbar der Staat Kalifornien.
Denn wenn schon die Land- und Ortschaften so ungesund und kaputt aussehen, werden auch die angebotenen Esswaren nicht besser sein.
Logisch, dass ich, ohne kontrolliert zu werden, den Zoll passieren konnte:
Mein Englisch hat keinen Oregon-Akzent.
20. Oktober 2000
Aussichtspunkt in der Nähe des Yosemite National Parks mit atemberaubendem Rundblick.
7 Wohnmobil
Im Gegensatz zu einem Love- hat’s in unserem Wohnmobil – wenn auch beschränkt – Platz zum Stehen, Sitzen und Liegen. Es ist auch kürzer und weniger laut, dafür wesentlich schneller, nämlich bis zu fünfundsechzig «m» pro Stunde – Meilen, nicht Meter.
Hier wohnen wir seit drei und auch noch für die nächsten sieben Wochen. Wahrscheinlich kommt’s uns deshalb so eng vor: Unsere «Parade» dauert halt etwas länger.
Wie in einem richtigen Haus stehen wir jeweils am Morgen auf, machen das Frühstück, frühstücken, waschen ab und fahren los. Allerdings ist hier alles viel umständlicher:
Zuerst muss das eine Bett in einen Tisch und zwei Sitzbänke, das andere in eine Ablagekoje verwandelt werden, bevor mit dem Tischdecken begonnen werden kann. Und noch vorher ist vielleicht schon das WC oder die Dusche aufgesucht worden, die sich hundert oder mehr Meter vom Wohnmobil entfernt befinden. Und noch davor haben wir zuerst einmal unsere Schuhe gesucht, das Toilettentäschchen, das Frottiertuch, die Kleider zum Anziehen, da es da, wo’s eng ist, keinen Platz für nichts hat, so dass alles immer überall und nirgendwo herumliegt, einfach nicht dort, wo es sein sollte, wenn es dafür einen Platz gäbe.





























