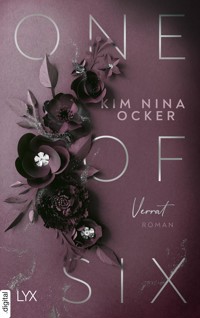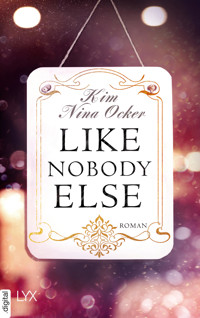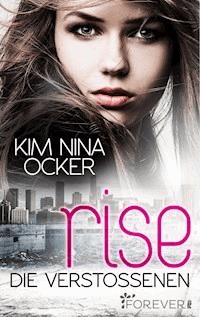
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rise
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Freya und Duncan kommen aus verschiedenen Welten: Sie verbrachte ihr Leben bisher abgeschottet in einer scheinbar perfekten Welt in den sicheren Silos unter Tage, während er unter den Wilden an der rauen Oberfläche aufwuchs. Eigentlich sollten sie sich nie begegnen, doch als Freya in Gefahr gerät, verhilft Duncan ihr zur Flucht und die beiden verlieben sich. Alles scheint sich zum Guten zu wenden, bis sie plötzlich getrennt werden und sich nun einzeln durch die Wildnis schlagen müssen. Für Duncan kein Problem, Freya jedoch steht vor der Herausforderung ihres Lebens. Sie muss Duncan wieder finden. Und sie muss herausfinden, was mit ihrer Familie geschehen ist. Freya und Duncan sind bereit für ihre Liebe und gegen das unterdrückende System zu kämpfen. Doch sie haben einen schier übermächtigen Feind. Von Kim Nina Ocker sind bei Forever erschienen: Dark Smile - Lächle, Mona Lisa Rise - Die Ankündigung (Band 1) Rise - Die Verstoßenen (Band 2) Eliza will Fahrrad fahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die AutorinKim Nina Ocker, aufgewachsen im beschaulichen Büren in Nordrhein-Westfalen, zeigte schon früh ein großes Interesse am Schreiben. Ihr erstes literarisches Meisterwerk bestand aus einer beinahe wortgetreuen Abschrift von Magdalen Nabbs Zauberpferd, bei der sie lediglich die Protagonistin in Kim umbenannte. Leider war die Welt noch nicht bereit für diese Sternstunde der Kreativität, und so musste der große schriftstellerische Durchbruch noch ein wenig warten. Letztendlich schaffte Cornelia Funke den Durchbruch und holte sie ganz und gar in die Welt der Buchstaben. Heute lebt sie zusammen mit ihrer Familie in Wennigsen.
Das BuchFreya und Duncan kommen aus verschiedenen Welten: Sie verbrachte ihr Leben bisher abgeschottet in einer scheinbar perfekten Welt in den sicheren Silos unter Tage, während er unter den Wilden an der rauen Oberfläche aufwuchs. Eigentlich sollten sie sich nie begegnen, doch als Freya in Gefahr gerät, verhilft Duncan ihr zur Flucht und die beiden verlieben sich. Alles scheint sich zum Guten zu wenden, bis sie plötzlich getrennt werden und sich nun einzeln durch die Wildnis schlagen müssen. Für Duncan kein Problem, Freya jedoch steht vor der Herausforderung ihres Lebens. Sie muss Duncan wieder finden. Und sie muss herausfinden, was mit ihrer Familie geschehen ist. Freya und Duncan sind bereit für ihre Liebe und gegen das unterdrückende System zu kämpfen. Doch sie haben einen schier übermächtigen Feind. Von Kim Nina Ocker sind bisher bei Forever erschienen: Dark Smile - Lächle, Mona Lisa Rise - Die Ankündigung Rise - Die Verstoßenen
Kim Nina Ocker
Rise - Die Verstoßenen
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Originalausgabe bei Forever. Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juni 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-113-7 Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Es war einmal – Duncan
Als ich auf der Wasseroberfläche aufschlug, hatte ich das Gefühl, auf Beton zu krachen. Das Wasser war eiskalt und presste mir sämtliche Luft aus der Lunge. Ich kämpfte mich zurück an die Oberfläche und hustete gefühlt einen Liter Flüssigkeit aus.
Sobald ich mich gesammelt hatte, suchten meine Augen nach dem Zug, der sich mehr und mehr entfernte. Dem verdammten Zug, aus dem die Wachen mich geworfen hatten wie Abfall. Und in dem Freya immer noch gefangen gehalten wurde, vom Magistrat und seinen Männern.
»Freya!«, schrie ich und musste augenblicklich wieder röcheln.
Ich spürte die Panik in mir aufsteigen, doch sosehr ich mich auch dagegen wehrte, sie überwältigte mich innerhalb von Sekunden. Ich hatte das Oberhaupt der Siedler zuvor niemals kennengelernt, doch die Tatsache, dass Freya allein mit ihm in diesem Zug war, ließ mich würgen. Am liebsten wäre ich geschwommen, bis ich sie eingeholt hatte, doch es hatte keinen Sinn. Der Zug verschwand, und mit ihm das einzige Mädchen, das je mein Herz berührt hatte.
Meine Faust krachte mit einem wütenden Klatschen auf die Wasseroberfläche. Ein paar Sekunden starrte ich auf die Schienen, dann zwang ich mein Hirn zur Ordnung und schwamm Richtung Ufer.
Wenn ich Freya wiedersah, würde ich sie dafür erwürgen, dass sich mich dazu gebracht hatte, diesen dämlichen Einbruch mit ihr zusammen durchzuziehen. Ich hatte bereits befürchtet, dass es in einer Katastrophe enden würde, und jetzt hatten wir den Salat. Was hatten wir uns nur gedacht? Den Zug zu kapern, in der vagen Hoffnung, dort irgendwelche Informationen über ihre Familie zu bekommen? Wir mussten verrückt gewesen sein.
Ich wrang meine nassen Kleider aus und sah mich um. Ich wusste, wo ich war, das verbuchte ich spontan als Pluspunkt. Wir waren nicht weit gefahren, doch das bedeutete auch, dass Freya und ihre Weggefährten viele Möglichkeiten hatten, um zu verschwinden. Wenn sie in einer der Einheiten verschwanden, hatte ich kaum noch Chancen, sie zu finden.
Als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, spürte ich, dass ich zitterte. Zum einen lag es mit Sicherheit an der Eiseskälte, die sich allmählich in meine Knochen fraß. Doch zum anderen war es die Angst um Freya, die mich lähmte. Die Wut auf all die Menschen, die sich uns in den Weg stellten. Und vor allem der Frust darüber, dass ich sie nicht hatte retten können. Ich war aus einem fahrenden Zug geworfen worden, trotzdem fühlte ich mich schuldig, dass sie allein in diesem verdammten Waggon war. Wenn ich zuließ, dass mein überfordertes Gehirn sich all die Dinge ausmalte, die dort mit ihr passieren konnten, würde ich durchdrehen.
Und das würde keinem von uns etwas bringen. Weder mir noch Freya.
Ich versuchte Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Ich musste mich umziehen, ansonsten würde ich spätestens heute Nacht erfrieren. Und dann brauchte ich einen Plan. Ich wusste nicht, wohin der Zug unterwegs war, also musste ich versuchen, ihn auf der Strecke zu erwischen. Selbst wenn Freya nicht mehr an Bord sein würde, könnten die Wachhunde mir mit Sicherheit weiterhelfen.
Auch wenn es mir gegen den Strich ging, drehte ich mich um und lief in Richtung Wald, weg von den Schienen. Ich rief mein Herz zur Ordnung, das mich anschrie und mich aufforderte, ihnen zu folgen. Meine Haut brannte von der Kälte, und ich spürte, wie meine Kleidung mit jedem Schritt steifer und schwerer wurde, als würde sie meine düsteren Gedanken aufsaugen wie ein Schwamm. Ich war mir nicht sicher, ob man Freya das Messer abgenommen hatte. Mit eigenen Augen hatte ich gesehen, dass sie mit dieser Waffe umgehen konnte, wenn es sein musste. Wenn die Wachhunde sie nicht durchsucht hatten, war sie vielleicht entkommen. Gegen meinen Willen fragte ich mich, was wohl passieren würde, wenn ihr die Flucht tatsächlich gelang. Die letzten Wochen und vor allem die letzten paar Tage waren wir ein Team geworden. Ich war mir sicher gewesen, dass sie zu mir stand und sich entschieden hatte, dass unser Weg, zumindest vorläufig, zum selben Ziel führte. Doch was, wenn man sie zurück in ihre alte Heimat brachte? Wenn sie wieder in ihrem warmen Bett liegen würde und ihre Familie und Freunde um sich herum hätte? Wahrscheinlich würde sie hin und wieder an mich denken, doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie all das gegen das Leben hier draußen eintauschen würde. Wenn ich nicht befürchten würde, dass der Alte andere Pläne mit ihr hatte, hätte ich sie vielleicht in Ruhe gelassen. Immerhin war es meine Schuld, dass sie in dieses ganze Chaos hineingezogen worden war. Ohne meine eifrige Hilfe wäre sie inzwischen vermutlich glücklich verheiratet und würde in irgendeiner Einheit ihr perfektes Leben planen. Sie würde sich an nichts von alldem erinnern und unwissend sterben, genau wie all die anderen blinden Erdratten.
Doch sosehr ich mich auch bemühte – ich bedauerte keinen einzigen Schritt der letzten Tage. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde alles ganz genauso noch einmal machen. Na gut, abgesehen natürlich von den vergangenen Ereignissen.
Ich hatte das Gefühl, Stunden gelaufen zu sein, als ich den Weg erreichte, der zum nächstgelegenen Dorf führte. Ich sah mich gerne als einsamen Wolf, doch mir wurde klar, dass ich in dieser Sache Hilfe brauchen würde. So wie die Dinge im Moment standen, war ich auf dem Weg in einen Krieg – einen Krieg gegen einen Gegner, der, wie ich zugeben musste, um einiges stärker war als ich. Mir war nicht klar, was der Magistrat von Freya wollte und warum sie etwas Besonderes für die Einheiten war. Auch wenn sie zurzeit meine ganze Welt auf den Kopf stellte, war sie im großen Plan des Lebens doch eben nur ein Mädchen, das durch Zufall vom richtigen Weg abgekommen war. Mir wollte nicht einleuchten, warum das Oberhaupt der Erdlöcher so viel Energie dafür aufbrachte, diesen einen verirrten Siedler zurück nach Hause zu bringen.
In einem weit entfernten Land – Freya
Meine Kleider hingen wie nasses Fell von meinen Schultern, und ich war mir ziemlich sicher, dass sie auch genauso rochen. Meine Hände und Füße wurden allmählich taub vor Kälte, und mein Herz wollte jedes Mal aus meiner Brust springen, wenn ich an Rachel oder Duncan dachte. Die Gesichter der beiden tauchten abwechselnd in meinem Kopf auf, und jedes Mal übermannte mich eine Welle Schuldgefühle. Ich hatte das Gefühl, für das Schicksal der beiden verantwortlich zu sein, und wollte beide einfach nach Hause bringen. Wo genau dieses Zuhause sein würde, wusste ich selbst nicht.
Ebenso wenig wusste ich, wo ich selbst gerade hingehörte. Ein kleiner, sehr kleiner Teil von mir hatte losheulen wollen, als sich der Zug immer weiter entfernte und außer Reichweite verschwand. Ich hatte so viele Stunden damit verbracht, mir auszumalen, wie es wäre, nach Hause zu kommen und meine Familie wiederzusehen. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich das ganze Chaos hinter mir lassen können, die vergangenen Wochen aus meinem Gedächtnis streichen und ein normales Leben führen können. Doch jetzt, da ich wusste, dass meine einstigen Helden, die Regierung der Einheiten, keine Heiligen waren, konnte ich unmöglich zu ihnen zurückkehren und das Leben wiederaufnehmen wie bisher. Der Gedanke an meine Brüder und meine Mutter ließ mein Herz einen Moment aussetzen, doch ich war mir zumindest für den Moment sicher, dass es ihnen gutging. Sosehr der Magistrat mich zurzeit auch hassen mochte, meine Familie hatte damit nichts zu tun. Sie waren genauso unwissend, wie ich es selbst vor kurzem noch gewesen war. Was Duncan anging, so war ich überzeugt, dass er in größerer Gefahr schwebte als jemals zuvor. Sowohl meine als auch seine Leute wussten, dass er mit mir gemeinsame Sache machte, und ich war mir sicher, dass keine der beiden Seiten erfreut darüber war. Duncans und mein Name standen in Leuchtbuchstaben auf einer Abschussliste, und ich war es ihm schuldig, dass ich ihn in Sicherheit brachte. Auch wenn ich mir durchaus im Klaren darüber war, dass er sehr gut ohne mich zurechtkam.
Ich konnte nicht fassen, dass sie ihn einfach aus dem fahrenden Zug geworfen hatten. Und ebenso wenig konnte ich glauben, dass ich selbst so leicht entkommen war. Klar, den Magistrat so schwer zu verletzen, dass er mir nicht folgen konnte, war ziemlich kreativ gewesen. Doch die Tatsache, dass ich weder Rachel vor dem Magistrat hatte retten noch brauchbare Informationen über meine Mutter oder meine Brüder hatte beschaffen können, überschattete die Freude über meinen Kampfgeist. Dennoch war ich mir ziemlich sicher, dass Duncan stolz auf mich wäre, wenn er hörte, dass ich mich eigenständig befreit hatte. Ich war schon lange keine hilflose Siedlerin mehr. Die vergangenen Wochen hatten mich verändert. Seit ich damals von Duncan aus diesem Käfig gerettet worden war, in den er und seine Leute mich gesteckt hatten, war ich nicht mehr dieselbe. Er hatte mich quasi in seine Welt hineingeschubst. Doch anstatt mich wie am Anfang ängstlich zu ducken und mich zu verstecken, war ich nun bereit zu kämpfen. Ich würde um Duncan kämpfen, um Rachel, um uns. Und um mich selbst. Möglicherweise war ich nicht ganz freiwillig in die ganze Sache hineingeraten – immerhin war ich von durchgeknallten Irren entführt worden –, doch ich würde freiwillig weitermachen und Duncan suchen. Dem Magistrat hoffentlich irgendwann einen Denkzettel verpassen für alles, was er den Leuten in den Einheiten antat. Irgendwann würde er sterben, und dann würde die Welt ein wenig leichter werden, weil sie die Last eines Monsters nicht mehr tragen würde. Und egal, welches Szenario ich mir in meiner Zukunft vorstellte, Duncan war immer konstant an meiner Seite. Ich musste ihn suchen.
Jedes Mal, wenn meine Gedanken zu Duncan abschweiften, hörte ich, wie er meinen Namen gerufen hatte, kurz bevor die Abteiltüren hinter ihm zugeschlagen waren und das Donnern des Zuges sämtliche Geräusche verschluckt hatte. Es war, als würde ich ein und denselben Albtraum immer und immer wieder träumen und jedes Mal wach werden, bevor die Dunkelheit zurückgedrängt werden konnte.
Ich fragte mich, wo Duncan jetzt gerade war. Mein Herz versicherte mir, dass er am Leben war und genauso nach mir suchte wie ich nach ihm. Doch mein Verstand erinnerte mich daran, dass er mich hatte loswerden wollen und dass ich ihm bislang nichts als Ärger eingebracht hatte. Ich würde es ihm kaum verdenken können, wenn er diese unfreiwillige Trennung nutzte und sich aus dem Staub machte. Sich in Sicherheit brachte, so wie ich es tun sollte.
Ich schüttelte den Kopf, um die düsteren Gedanken aus meinem Kopf zu vertreiben. Es brachte mich nicht weiter, wenn ich mir ausmalte, wie Duncan sein Leben fortsetzte, während ich mich auf der Suche nach ihm durch die Wildnis schlug. Ich würde ihn suchen, und sollte sich tatsächlich herausstellen, dass er mit mir abgeschlossen hatte, würde ich mir später Gedanken darüber machen.
Mit meinen Sorgen kämpfend, lief ich weiter, weg von den Bahnschienen und in eine Zukunft, die ich mir lieber nicht ausmalen wollte. Ich versuchte, nicht daran zu denken, dass ich keinerlei Ahnung hatte, wo genau ich hinlief. Der Weg, den Duncan und ich die letzten Tage verfolgt hatten, musste Meilen entfernt liegen, und ich machte mir keinerlei Hoffnungen, dass ich an der nächsten Kreuzung auf einen Wegweiser stoßen würde. Mein Vorhaben war, vor dem Abend den Wald zu erreichen und dort zu bleiben, bis ich meine Gedanken organisiert und einen Plan gefasst hatte. Denn aus irgendeinem Grund verspürte ich bei der Erinnerung an die kargen Baumstämme um mich herum ein Gefühl von Sicherheit.
Stunden später war jeglicher Anflug von Mut verschwunden. Hatte sich verkrochen wie ein scheues Reh und mich mit meiner Angst und Unsicherheit allein gelassen.
Ich hatte das Gefühl, die Nacht sei heute schwärzer als sonst, bedrohlicher; wie ein Untier, das sich im Dunkeln verbirgt. Mir wurde klar, dass es die erste Nacht war, die ich allein hier draußen verbrachte, ohne Duncan, ja selbst ohne Dwight oder den Totenschädel. Das und die Tatsache, dass es von Minute zu Minute kälter zu werden schien, ließ mich zittern wie ein kleines Kind in einer Gewitternacht.
Die letzten Stunden war ich gelaufen, bis meine Füße bluteten, und hatte versucht, mich parallel zu den Schienen zu halten, in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Bei genauerem Überlegen würde nichts bringen, wenn ich kopflos in den Wald marschierte und auf das weiße Kaninchen wartete, das mir den Weg zeigte. Allein würde ich nach zwei Stunden die Orientierung verloren haben. Wenn ich zurück zu der Stelle fand, an dem die Schienen unter der Kuppel verschwanden, würde ich Duncans Weg zurückverfolgen können. Ein Teil von mir hoffte, dass Duncan denselben Weg verfolgte.
Als die Sonne allmählich hinter den ersten Baumwipfeln verschwand, hatte ich mir ein Lager in einer kleinen Felsnische, die mich vor Wind und Regen schützen würde, eingerichtet. Sie hatte mich an die Stelle erinnert, an der Duncan und ich in unserer ersten Nacht gerastet hatten, und einen kurzen Moment wollte ich mich einfach nur zusammenkauern und mich in den Schlaf weinen. Ich fühlte mich allein und hatte rasende Angst, von einem Bären oder so etwas in der Art gefressen zu werden, doch ich riss mich zusammen. Ich sammelte Holz, machte ein kleines Feuer und fand ein paar der Beeren, die Duncan mir gezeigt hatte. Ich war stolz auf mich, als ich meine Hände über die tänzelnden Flammen hielt, und einen kurzen Moment lang musste ich grinsen, als ich mir vorstellte, wie er bei diesem Anblick anerkennend durch die Zähne pfeifen würde.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, hier zu sitzen und an ihn zu denken. Es fühlte sich falsch an, mich ohne ihn in seiner Welt zu bewegen. Es war, als hätte ich ohne Erlaubnis ein fremdes Zimmer betreten und würde in privaten Sachen herumschnüffeln. Der Gedanke, dass Duncan bislang fast immer allein durch die Gegend gewandert war, ließ mich erschaudern.
Ich schob mir die letzte Beere in den Mund und schlang meine Arme um die Knie. Meine Kleider hatte ich nacheinander über dem kleinen Feuer getrocknet, so dass sie jetzt nur noch klamm auf meiner Haut lagen. Mir war nicht gerade warm, doch ich hatte auch keine Angst mehr zu erfrieren. Das Licht der Flammen verdrängte die Schatten so weit wie möglich zwischen die Bäume, doch das Gefühl, von allen Seiten beobachtet zu werden, konnte ich nicht abschütteln. Ich erinnerte mich an früher, als ich ein Kind war und meine Mutter nachts ein kleines Licht in meinem Zimmer anlassen musste, damit die Dunkelheit keine Geister heraufbeschwören konnte. Damals hatte sie mir gesagt, dass das, wovor ich Angst hatte, nicht existierte und die Welt nicht so dunkel und böse war, wie ich sie mir ausmalte. Jetzt wurde mir klar, dass sie mich entweder belogen oder tatsächlich keine Ahnung von all dem Schrecken hatte, der um sie herum lauerte. Sie und all die anderen Menschen, die in den Einheiten lebten in einer wunderschönen Seifenblase voll Harmonie und Märchen, von der ich befürchtete, dass ich selbst sie bald zum Platzen bringen würde.
Wenn ich später an diesen Abend zurückdachte, kam mir die Zeit, in der ich dasaß und in die Flammen starrte, wie Stunden vor. Tatsächlich war ich mir aber sicher, dass es lediglich Minuten dauerte, bis mir die Augen zufielen und ich mich am Fuße des Felsens zusammenrollte.
Alles auf eine Karte – Duncan
Der erste Morgen nach meinem Sturz aus dem Zug fühlte sich an, als wäre ich von einem Panzer überrollt und zusätzlich von einem Preisboxer verdroschen worden. Jeder Knochen in meinem Körper schmerzte, und meine Haut brannte von der Kälte und dem dreckigen Seewasser. Als sich der Nebel aus meinem Kopf verzog und ich all das registrierte, wäre ich am liebsten ohnmächtig geworden und erst wieder aufgewacht, wenn dieses ganze Chaos sich gelegt hätte. Ich konnte einfach nicht fassen, wie sehr sich mein Leben innerhalb der letzten Wochen verändert hatte. Sosehr ich mich auch anstrengte, ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie es gewesen war, als meine größte Sorge noch die Suche nach einem Lager für die Nacht war. Wenn ich an mein Leben vor Freya zurückdachte, hatte ich das Gefühl, in einem Märchenland gelebt zu haben. Ich hatte den Siedlern in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, ignorant und selbstherrlich zu sein. Jetzt, nach allem, was ich in den letzten Wochen erlebt hatte, fragte ich mich unwillkürlich, ob ich ihnen unrecht getan hatte. Natürlich, die Regierung der Einheiten ließ die Menschen hier draußen buchstäblich im Regen stehen, doch galt das auch für die Bewohner? Freya hatte mir mit ihrer Geschichte gezeigt, dass sie genauso schnell auf der Abschussliste landen konnten wie wir hier draußen. Und das wünschte ich wirklich keinem.
Ein kalter Windhauch strich über meine nackten Arme und riss mich aus meinen düsteren Gedanken. Ich schweifte ab, und das konnte ich mir nicht leisten. Mit den Dramen dieser Welt konnte ich mich beschäftigen, wenn Freya wieder wohlbehalten an meiner Seite war. Denn auch wenn ich versuchte, meine Panik fürs Erste von mir wegzuschieben, spürte ich, wie sie sich hin und wieder in meinen Kopf schlich und mein Denken lähmte. Ich versuchte, mir nicht auszumalen, was mit Freya geschehen sein könnte, versuchte alles auszublenden, was nichts mit dem Plan zu tun hatte.
In den letzten Stunden hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, was als Nächstes zu tun war. Mein erster Impuls war gewesen, den Schienen zu folgen und die nächstgelegene Einheit zu suchen, in die man sie gebracht haben könnte. Nach wie vor war ich der Meinung, dass es die einzige Möglichkeit war, Freya zu finden, doch ich war zu dem Schluss gekommen, dass dieses Ziel nicht allein zu erreichten war. Selbst wenn ich die unsichtbare Kuppel fand, konnte ich nicht einfach an die Tür klopfen und fragen, ob Freya zum Spielen rauskommen konnte. Meine einzige Chance, unbemerkt in die Einheit zu gelangen, war, einen der Züge zu erwischen und mit ihm zusammen durch das Loch im Boden zu verschwinden. Und es wäre einfach nur Wahnsinn, bei dieser Sache einen Alleingang zu wagen.
Ich hatte nur einen Versuch.
Während ich mein karges Hab und Gut zusammenraffte, versuchte ich meine Gedanken unter Kontrolle zu halten. Immer und immer wieder drifteten sie zu roten Locken ab und wollten sich in ihnen verlieren. Ich bereute, die wenige Zeit mit Freya damit verschwendet zu haben, über ihre Herkunft nachzudenken. Sie für etwas zu verurteilen, für das sie nichts konnte. Sie wurde in den Kreis der Siedler hineingeboren, doch als es darauf ankam, war sie eine waschechte Wilde gewesen.
Der Wald schien sich meiner Stimmung angepasst zu haben und wirkte düsterer als sonst. Ungewohnt vorsichtig bahnte ich mir meinen Weg durch die Baumstämme und hatte mit jedem Schritt mehr das Gefühl, die kargen Äste würden ihre Finger nach mir ausstrecken. Würden nach mir greifen und versuchen, mich von dem fernzuhalten, von dem ich selbst nicht wusste, wo es mich hinführen würde. In der Vergangenheit hatte ich mich von diesen Vorahnungen leiten lassen. Ich hatte auf die Natur um mich herum gehört, hatte das Wetter und die Stimmung der Tiere aufgefangen, um mein Leben zu gestalten. Ich war in mehr als einer Hinsicht ein einsamer Wolf gewesen, doch wenn ich nun daran zurückdachte, kam mir dieses Leben trauriger vor, als ich es mir eingestehen wollte. Ich war einsam gewesen, und es war kein Geheimnis, wer für diese Einsicht verantwortlich war.
Der Wind rauschte durch das trockene Laub. Mir fiel auf, dass ich öfter als gewöhnlich über die Schulter sah, immer in der Erwartung, eine Horde aufgebrachter Siedler hinter mir durch den Wald stürmen zu sehen. Ich war mir nicht sicher, ob sie sich tatsächlich für mich interessierten, doch das war mir egal. Sie interessierten sich für mein Mädchen, und das genügte mir.
Nach einer Weile kreuzte mein Weg einen kleinen Trampelpfad, und meine Nervosität stieg. Berwick war noch etwa einen Tagesmarsch entfernt, und dennoch spürte ich allein bei dem Gedanken an die sich aneinanderdrängenden Häuser ein Kribbeln in den Knochen, das ich jedes Mal verspürte, wenn ich in die Nähe eines Dorfes kam. Ich fühlte mich dann wie ein eingesperrtes Tier, das aber nicht vergessen konnte, wie es war, in der Freiheit zu leben.
Meine Füße trugen mich mehr automatisch als von mir gesteuert, und mit jedem Schritt bekam ich mehr Bauchschmerzen. Ich wollte Helena um Hilfe bitten, und mir war klar, dass das kein leichtes Gespräch werden würde. Sie würde sich weigern, aber ich betete, dass tief unter ihrer harten Fassade noch ein Mensch steckte, der sich daran erinnerte, wie es war, auf der Flucht zu sein. Man kannte Helena wie einen bunten Hund, in der Vergangenheit hatte ich sie gemieden. Auch wenn sie eine Flüchtige aus den Einheiten war, war sie für mich dennoch immer eine von ihnen gewesen. Der Wolf im Schafspelz, der uns eine rührende Geschichte über eine Familie erzählte, die sich gegen sie gestellt hatte. Doch jetzt brauchte ich ihre Hilfe, und wenn das eine längere Diskussion bedeutete, dann würde ich sie in Kauf nehmen.
Im Vorbeigehen bemerkte ich einen Strauch mit Beeren. Den gleichen Beeren, die ich Freya gezeigt hatte. Ich blieb stehen und starrte auf die kleinen Früchte, steckte die Hand aus und riss eine ab. Ich zerdrückte sie zwischen den Fingern, und als der Saft die Kuppen rot färbte, breitete sich eine ganz neue Sorge in meinem Inneren aus. Selbst wenn Freya dem Magistrat und seinen Wachhunden entkommen war, würde sie zurechtkommen? In unserer kurzen gemeinsamen Zeit habe ich nicht gerade sonderlich viel Energie darauf verwendet, sie auf das Leben hier draußen vorzubereiten. Und es würde bald schneien, die wenigen Wege würden unter dem Schnee verschwinden und die Tiere sich in den dichteren Wald zurückziehen.
Ich legte den Kopf in den Nacken und warf einen flehenden Blick hinauf in den grauen Himmel. Ich musste sie finden, bevor die menschlichen Feinde nicht mehr das Einzige waren, über das ich mir Sorgen machen musste.
Es gibt keine Monster … von wegen! – Freya
Ich lief durch diesen verdammten Wald und betete mit jedem Schritt, dass ich auf etwas treffen würde, das mir bekannt vorkam. Mein Zeitgefühl war irgendwann zwischen Baum siebenundzwanzig und Baum dreiundachtzig verlorengegangen, also versuchte ich mich an der Sonne zu orientieren, die unaufhaltsam über den Himmel wanderte. Graue Wolken schoben sich immer wieder davor, was die Sache auch nicht unbedingt einfacher machte. Das Wetter verwirrte mich. Zu Hause wäre es jetzt vermutlich warm und behaglich, vielleicht würde ein kühles Lüftchen wehen, doch nichts, worüber man sich Gedanken machen würde. Hier draußen hatte ich das Gefühl, meine Zehen hätten sich in Eiszapfen verwandelt. Ich war es nicht gewohnt, und selbst wenn mir mittlerweile klar war, dass die Horrorgeschichten der Magistrate nichts als erfunden waren, machte ich mir Sorgen um mich. Wie lange konnte eine Siedlerin wie ich hier draußen überleben? Allein und dieser Welt vollkommen ausgeliefert.
Irgendwann, gefühlt nach Stunden, gelangte ich an einen Weg, der tatsächlich aussah, als sei er von Menschen angelegt worden. Während meines Marsches hatte ich mehrere zerstörte Gebäude gesehen, und jedes Mal verspürte ich ein unangenehmes Ziehen in der Magengegend. Wir hatten in der Schule Bilder gezeigt bekommen, damit wir uns eine Vorstellung von der Verwüstung machen konnten. Doch diese Bilder kratzten nicht einmal an der Realität, wie mir jetzt bewusst wurde. Die alten Gemäuer, verfallen und verlassen, erinnerten mich an mich selbst. Und selbst mir fiel auf, wie melancholisch das klang.
Unschlüssig blieb ich am Wegesrand stehen und sah abwechselnd in beide Richtungen. Für mich sah hier draußen immer noch alles gleich aus, dennoch meinte ich auf der einen Seite etwas wiederzuerkennen. Leider war ich mir überhaupt nicht sicher, ob dies tatsächlich eine Erinnerung war oder die bloße Verzweiflung.
Gerade als ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen wollte, hörte ich Schritte. Entweder ich hatte sie bis gerade nicht gehört oder nicht wahrgenommen, doch plötzlich klangen sie erschreckend nah, und ich wich schnell in die Büsche hinter mir zurück. Sie klangen schwerfällig und langsam, als sei der Mensch an den Füßen sich nicht sicher, wohin sie ihn tragen sollten.
Ich zog mich weiter in die Büsche zurück, bis die Blätter mich umschlossen wie eine schützende Decke. Ich beobachtete den Mann, der vor mir den Weg entlangschlurfte. Er sah nicht gefährlich aus, nicht einmal bedrohlich. Dennoch kauerte ich mich zusammen wie ein verschrecktes Reh und traute mich kaum zu atmen, bis ich die schlurfenden Schritte des Kerls nicht mehr hören konnte. Es war seltsam, dass ich derartige Gefühle für Duncan hatte, jedoch keinem anderen Wilden über den Weg traute. Trotz der dreckigen Kleider und einer Frisur, die wahrscheinlich kaum noch als eine solche zu erkennen war, hatte ich das Gefühl, als wäre ein leuchtender Pfeil auf mein Gesicht gerichtet und würde ›Siedlerin!‹ schreien. Ich hatte Angst erkannt und zurück in die Einheiten verfrachtet zu werden, sobald ich jemandem unter die Augen trat. Am liebsten wäre ich in diesem Busch sitzen geblieben, bis das ganze Elend vorbei war. Am liebsten wäre ich wieder das feige und unwissende Mädchen von früher, das sich einfach Augen und Ohren zuhielt und Kinderlieder sang.
Ich wartete noch ein paar Herzschläge lang, dann richtete ich mich auf. Gerade als ich auf den Weg zurückkehren wollte, spürte ich einen stechenden Schmerz in der Wade. Als ich herumwirbelte, sah ich noch das geschuppte Ende einer Schlange im hohen Gras verschwinden.
Panisch schrie ich auf, nicht sicher, was mich mehr schockierte: der Schmerz oder der Schreck darüber, dass ein wahres, lebendiges Monster mich attackiert hatte! Nach ein paar Sekunden entschied ich mich für den Schmerz, als das Brennen sich allmählich durch den Unterschenkel in die Hüfte ausbreitete.
Natürlich war ich noch nie zuvor von einer Schlange gebissen worden und hatte dementsprechend auch keine Ahnung, was man in so einer Situation tun musste. In meinem ersten Jahr in der Schule hatte mir irgendein wahnsinniger Junge Geschichten darüber erzählt, dass man das Gift aus Pfeilen mit dem Mund heraussaugen musste. Ob das auch für Schlangenbisse galt? Doch selbst wenn, wagte ich zu bezweifeln, dass ich meinen unsportlichen Körper zu so einer Meisterleistung würde zwingen können.
Mein Hirn wurde immer benebelter, während ich auf den Weg zurückstolperte und panisch versuchte, mir einen Plan auszudenken. Die beste Lösung wäre wahrscheinlich gewesen, mich irgendwo ins hohe Gras zu legen und zu hoffen, nicht zu sterben, bis ich mich wieder einigermaßen erholt hatte. Doch auf der anderen Seite waren inzwischen auch bunte Punkte am Rande meines Blickfeldes aufgetaucht, so dass ich mir nicht sicher war, wie weit ich meinem Kopf noch trauen konnte.
Der Schmerz intensivierte sich und zwang mich in die Knie. Der letzte bewusste Teil meines Denkens schrie mich an, dass ich schleunigst außer Sichtweite verschwinden musste. Ich würde unmöglich wegrennen können, also musste ich zumindest versuchen, mich zu verstecken.
Meine Gedanken wanderten zu Duncan. Wenn ich jetzt starb, würde er nie erfahren, dass ich nach ihm gesucht hatte. Meine dramatische Phantasie malte sich Szenen aus, in denen ich von Wölfen aufgefressen wurde und er meine kläglichen Überreste fand. Vielleicht würde er ja ein schönes Begräbnis organisieren.
Ich schloss die Augen und versuchte den Schmerz durch bloße Willenskraft zu vertreiben. Gegen meinen Willen sackte ich mehr und mehr zusammen, bis ich rauen Kies unter meiner Wange spürte. Die Kälte fraß sich in die Haut meines Gesichtes, während ich das Gefühl hatte, mein Bein würde in Flammen stehen.
Gerade als ich mich meinem Schicksal ergeben und einfach sterben wollte, drang erneut das Geräusch von Schritten an meine Ohren. Ich traute mich nicht, die Augen zu öffnen, lag einfach nur da und betete, dass der Klang von schweren Stiefeln auf nassen Steinen lediglich meiner Phantasie entsprang.
Doch so viel Glück hätte ich offensichtlich nicht. Während ich mit rasendem Herzen dalag und mir kalter Schweiß auf der Stirn ausbrach, spürte ich die Erschütterung unter meiner Wange. Jemand kam auf mich zu, und ich konnte nichts weiter tun, als wie ein Fisch auf dem Trockenen zu liegen und darauf zu warten, dass man mir den Kopf abschlug oder Ähnliches.
Und dramatisch wurde ich auch noch.
Ich meinte Worte zu hören, doch wenn es stimmte, sprachen sie nicht meine Sprache. Eine Stimme in meinem Hinterkopf wollte mich an irgendetwas in diesem Zusammenhang erinnern, doch ich kam nicht drauf. Ich lag einfach da, lauschte den Geräuschen und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Es gelang mir nicht. Die Bilder in meinem Kopf entwischten mir, bevor ich sie klar sehen konnte.
»Was haben wir denn da?«, erklang dann eine tiefe Stimme irgendwo über mir. Ich wollte die Augen öffnen, doch mein Körper versagte mir jeglichen Dienst. Der brennende Schmerz nahm all mein Denken ein.
Ich meinte zu spüren, dass sich jemand neben mich setzte, wieder gefolgt von einer Reihe Wörter, die ich nicht verstand.
Dann: »He, Mädchen, kannst du aufstehen?«
War das sein Ernst? Dachte er, ich läge hier aus Spaß auf dem nassen Boden herum? In meinem Kopf stritten sich Angst und Hoffnung, wobei Letztere lediglich von der Tatsache herrührte, dass ich noch keine Klinge im Rücken spürte.
Ich versuchte etwas zu sagen, doch das Einzige, was ich herausbekam, war ein undeutliches Gurgeln. Trotz des Schmerzes und der Benommenheit, die sich allmählich über mein Denken legte, war mir nun doch aufgefallen, dass dieser Jemand meine Sprache beherrschte. Ich verschwendete keine Energie, indem ich mir darüber Gedanken machte, wie er mich erkannt hatte. Eher fragte ich mich, was er mit mir vorhatte. Die Tatsache, dass er mich als Siedlerin identifiziert hatte, konnte sowohl positive als auch negative Auswirkungen für mich haben. Wenn dieser Mensch einer von den Guten war, würde er mir helfen können, mich zu verstecken. War er einer von den Bösen, würde ich entweder sterben oder wachte morgen auf einer Pritsche in der Registrierung auf.
Während ich noch betete, einmal in diesen Wochen Glück zu haben, spürte ich große Hände, die sich um meine Oberarme legten. Ich wollte protestieren oder mich wehren, doch im nächsten Moment verzog mein Gehirn sich in einen dichten Nebel, und ich versank im Dunkeln.
Mögen die Spiele beginnen. Und mögen sich alle an die Regeln halten – Duncan
Berwick war vielleicht noch eine Stunde Fußmarsch entfernt, und ich bekam das Gefühl, mich allmählich entscheiden zu müssen. Der Plan stand, die Einzelheiten jedoch entglitten meinen Gedanken, sobald ich sie mir zurechtlegen wollte. Ich schweifte immer wieder ab und landete bei Freya, was ich mir in diesem Moment einfach nicht erlauben konnte.
Vermutlich würde Helena mir einfach die Tür vor der Nase zuknallen und alle weiteren Überlegungen damit beenden. Ich hasste es, von einer anderen Person abhängig zu sein. Der Gedanke, mein Vorhaben nur mit der Hilfe dieser ehemaligen Siedlerin durchführen zu können, ging mir gehörig gegen den Strich. Würde Freyas Leben nicht davon abhängen, würde ich diese Sache nicht einmal in Erwägung ziehen! In den letzten Stunden war mir allerdings klargeworden, dass ich ohnehin ein Dorf aufsuchen musste. Der Großteil meines Besitzes war von unserer Zuginvasion und meinem darauffolgenden Rausschmiss zerstört worden oder verlorengegangen. Für gewöhnlich trug ich ein recht gut ausgestattetes Überlebenspaket mit mir herum. Wie auch immer die nächsten Tage aussehen mochten, ich musste sowohl Kraftreserven als auch Proviant auffüllen.
Ich hing immer noch meinen Gedanken nach, als die ersten Gebäude von Berwick vor mir auftauchten. Ich hatte Dörfer schon immer gehasst. Das enge Zusammenwohnen und die gedrungenen Häuser erinnerten mich an Käfige für Tiere. Und seit Dwight Freya hierhin verschleppt hat, verspürte ich außerdem eine persönliche Abneigung gegen diese Stadt.
Während ich durch die winzigen Gassen lief, versuchte ich die irritierten Blicke der Menschen zu ignorieren. Es war nicht so, dass sie noch nie einen dreckigen Landstreicher gesehen hätten. Allerdings konnte man meinen Auftritt inzwischen nicht mehr nur als ›dreckig‹ bezeichnen. Vermutlich standen mir die Strapazen ins Gesicht geschrieben. Wenn die Dörfler auch nur einen Funken Verstand besaßen, würden sie sich von mir fernhalten. Ich konnte nur hoffen, dass Helena diesen Selbsterhaltungstrieb nicht auch an den Tag legen würde.
Ich hatte mich entschlossen, nicht direkt zu ihrem Haus zu gehen. Mein Plan war nicht annähernd genug durchdacht, um in einer Diskussion mit ihr bestehen zu können. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass ich bei ihr mit einem bloßen Appell an ihre Nächstenliebe nicht weit kommen würde. Und das konnte ich ihr nicht einmal verübeln. Immerhin hatte ihr damals auch niemand geholfen, als sie gezwungen gewesen war, sich ein Messer in den Unterleib zu rammen. Damals hatte sie keinen anderen Ausweg gesehen, als sich auf diese verstörende Art und Weise für die Registrierung uninteressant zu machen. Die Regierung der Einheiten suchte nach körperlich einwandfreien Versuchskaninchen, was bedeutete, dass diese Selbstverstümmelung Helena vermutlich das Leben gerettet hatte. Ich respektierte sie für diesen Schritt, dennoch würde ich nicht zulassen, dass Freya zu etwas Ähnlichem gezwungen sein würde. Nur über meine Leiche.
Mein erster Weg führte mich in eine kleine Seitengasse, von der ich wusste, dass sie zu einem Schwarzmarkt führte. Wobei diese Bezeichnung vermutlich ein wenig veraltet war. Die ersten Händler tauchten vor mir auf. Niemand hier war so dämlich, sein Zeug offen auszustellen. Wenn man etwas haben wollte, ging man zu dem entsprechenden Mann und folgte ihm ins Hinterzimmer. Wenn man viel Pech hatte, wurde man ausgeraubt, doch das hatte ich in der Vergangenheit immer verhindern können. Da ich in diesem Moment aber kaum etwas an Waffen am Leibe trug, steuerte ich einen bekannten Händler an, bei dem ich zuvor schon gekauft hatte. Ich konnte nur hoffen, dass er sich an mich erinnerte und mir Kredit gewähren würde. Ich hatte keinerlei Gold bei mir oder irgendwas, was ich zum Tausch hätte anbieten können.
»Was willst du?«, brummte er gelangweilt, als ich mich näherte. Diese drei Worte genügten schon, um eine beeindruckende Wolke Mundgeruch in der ganzen Gasse zu verteilen. Er war ein untersetzter kleiner Mann, dessen Haare an den Seiten schon dünn wurden. Er war ein typischer Schwarzhändler, was mich wieder einmal daran erinnerte, warum ich die Zusammenarbeit mit diesen Kerlen so hasste.
»Hast du Klingen?«, fragte ich geradeheraus. Bei Männern wie ihm machte es wenig Sinn, um den heißen Brei herumzureden. Man verschwendete nur Zeit, und die war gerade kostbar.
Er nickte und bedeutete mir mit einer Handbewegung, ihm zu folgen. Ich zog den Kopf ein, um durch die kleinen Steinbögen zu passen, und betrat einen schmuddeligen Innenhof. Hier standen verschieden große Holzkisten herum, wo der Händler seine Waren ausgelegt hatte. Messer, Pfeile und Lanzen reihten sich aneinander und erweckten den Eindruck eines schaurigen Museums. Viele die Gegenstände waren gebraucht, so dass an manchen sogar noch Blut und andere Reste klebten. Normalerweise würde ich nicht einmal in Betracht ziehen, mir derlei auch nur anzusehen, doch in meiner Situation konnte ich es mir nicht leisten, wählerisch zu sein.
Nach einigem Hin und Her entschied ich mich für einen Dolch mit doppelter Klinge und zwei Wurfsterne, die klein genug waren, um in meine Hosentasche zu passen. Ich überzeugte den Händler davon, anschreiben zu lassen, und machte mich aus dem Staub. Ich war nicht unbedingt scharf auf Aufmerksamkeit und wollte möglichst wenig Leute wissen lassen, dass ich in der Stadt war. Ich hatte keine Ahnung, ob und wie sehr die Gerüchteküche über mich und Freya brodelte. Wenn bekannt war, dass ich einen von uns für ein Siedlermädchen hatte sterben lassen, würde ich mir keine Freunde machen, wenn ich hier auftauchte. Und Feinde hatte ich inzwischen genug.
Genau wie Freya. Als ich sie vor Wochen aus dem Käfig befreit hatte, hatte ich angenommen, dass sie sich die größten Sorgen um meinesgleichen würde machen müssen. Dass die schlimmste Bedrohung aus ihren eigenen Reihen kam, war selbst für mich überraschend. Natürlich wusste ich schon lange, dass die Erdratten gehörig Dreck am Stecken hatten. Das war nichts Neues. Doch ich war immer irgendwie davon ausgegangen, dass es dabei um Feindschaft gegenüber den Wilden ging. Um die Abhebung zu uns und die Demonstration von Überlegenheit. Ich dachte, es ging darum, sich die verwöhnten Ärsche in der Sonne zu bräunen, ohne sich von uns stören zu lassen. Unter sich zu bleiben.
Doch offensichtlich gab es da noch ein, zwei Dinge, die weder ich noch Freya wussten. Und ich konnte mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was das für Freya bedeuten mochte. Die vergangenen Wochen mussten hart genug für sie gewesen sein, auch ohne dass ihre eigene Sippe ihr ein Messer in den Rücken rammte.
Sorgsam verstaute ich meine neuen Habseligkeiten in meinen Taschen und machte mich auf den Weg zu Helenas Haus. Sie würde mir zuhören müssen. Immerhin war sie die Einzige, die sowohl Freyas als auch meine Welt kannte. Und da ich wusste, dass sie mit Informationen nicht gerade offenherzig herausrückte, konnte ich nicht ausschließen, dass sie mehr wusste, als sie Freya gesagt hatte.
Sie würde mir einfach zuhören müssen.
Zwanzig Minuten später stand ich in der schmalen Gasse vor ihrem Haus und starrte die fleckige Fassade an. Dennoch kam es mir wie Stunden vor, in denen ich hier herumstand und nichts weiter tat als meine Gedanken hin und her zu wälzen.
Ich hatte nur einen Versuch.
Wenn ich das hier versaute, wusste ich nicht, wie es weitergehen sollte. Natürlich konnte ich allein losziehen und hoffen, dass irgendeine Erleuchtung mich überkam, doch es würde einen gewaltigen Rückschlag für meine ohnehin angeschlagenen Ambitionen bedeuten. Ich war mir ziemlich sicher, dass Helena eine Gegenleistung verlangen würde. Und das Einzige, was mir dazu einfiel, war ihre Rache. Ich würde ihr ein Versprechen geben, das ich vermutlich nicht würde halten können. Doch damit würde ich mich später auseinandersetzen.
Allein Freya zählte in diesem Moment.
Halbwegs entschlossen hob ich die Hand und klopfte an die schäbige Holztür.
Augenblicklich wurde sie aufgerissen, so dass ich beinahe frontal mit Helena zusammenstieß, die sich mit verschränkten Armen in der Tür aufbaute. Ihre Haare waren zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt, sie trug ein blassgrünes Kleid und eine fleckige Schürze. Sie hätte wie eine normale Hausfrau aussehen können, wäre da nicht der mörderische Ausdruck in ihren Augen gewesen.
»Ich beobachte dich seit Ewigkeiten, wie du vor meiner Tür herumlungerst, Freundchen«, zischte sie fuchsteufelswild. »Und dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns einig waren, dass du dich niemals wieder hier blicken lässt.«
Ich hatte nicht wirklich mit einer herzlichen Begrüßung gerechnet, doch diese Anfuhr brachte mich zugegebenermaßen ein wenig aus dem Konzept. »Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber würdest du mich hereinlassen?«
Sie schnaubte abfällig, warf aber einen prüfenden Blick durch die Gasse. »Wo ist dein Siedlermädchen?«
Die Frage traf mich härter als erwartet. Meine Augen verengten sich. »Sie haben sie, Helena.«
Eine geschlagene Minute lang starrte sie mich an, dann verdrehte sie die Augen, trat einen Schritt zur Seite und ließ mich herein. Als ich den Fuß über die Türschwelle setzte, atmete ich erleichtert auf. Ich war drin. So weit, so gut. In der kleinen Küche setzte ich mich auf einen der Stühle und wartete, dass sie ebenfalls Platz nahm, doch sie lehnte sich lediglich gegen den Herd und sah mich auffordernd an. Ihr herablassendes Gehabe ging mir auf die Nerven, doch ich wollte sie auch nicht reizen. Immerhin war ich derjenige, der etwas von ihr wollte. Wieder einmal.
»Also, was willst du?«, fragte sie und ließ mich für keine Sekunde aus den Augen. Was dachte sie? Dass ich ihr einen Topf klauen wollte?
Ich richtete mich ein wenig auf und erwiderte ihren Blick. »Ich brauche deine Hilfe.«
»Das habe ich mir schon gedacht.«
Nur mit Mühe konnte ich ein Stöhnen unterdrücken. »Freya und ich wurden getrennt.«
Einer ihrer Mundwinkel zuckte, doch es war keineswegs ein freundliches Lächeln. »Und was springt für dich dabei raus, Duncan?«
»Was?«
»Du kommst hierher und willst offensichtlich, dass ich dir in irgendeiner Form bei der Befreiung der Siedlerin helfe«, stellte sie mit kühler Stimme fest. »Warum? Was hast du davon?«
Ihre Frage verwirrte mich. »Ich will sie retten, Helena«, stellte ich klar. »Sie ist ein guter Mensch, der einfach in etwas reingeraten ist. Was auch immer diese Arschlöcher mit ihr vorhaben, sie hat es nicht verdient.«