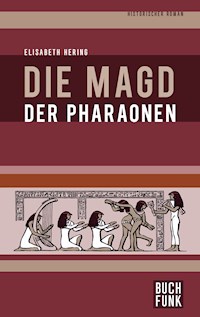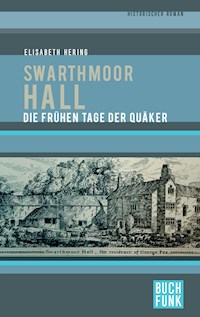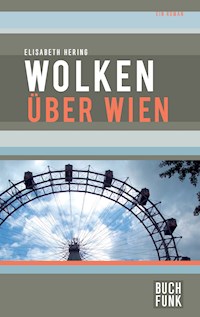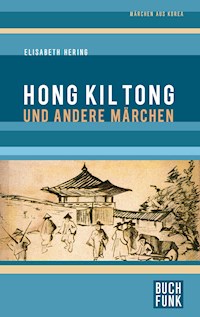Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BUCHFUNK Hörbuchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Romanhandlung führt nach Samarkand zu Anfang des 15. Jahrhunderts, einem damaligen Zentrum der islamischen Welt. György Köváry, Sohn eines in Gefangenschaft geratenen ungarischen Adligen, wächst als Achmad Ben Kükülli am Hofe Timurs auf, den die Muslime "Schatten Gottes auf Erden" nennen. György lernt aber nicht nur den Koran, sondern von seiner georgischen Mutter auch die Glaubenssätze des Christentums. Er wird dadurch auf den Weg der Toleranz und des Verständnisses anderer Überzeugungen und Lebenshaltungen gewiesen, muss jedoch später im "christlichen Abendland", der Heimat seines Vaters, bittere Erfahrungen mit religiöser und geistiger Intoleranz, Gewinnsucht und Korruption sammeln. Er kehrt zurück nach Samarkand an den Hof von Ulug Beg. Der Sohn und Nachfolger Timurs war selbst als Astronom ein bedeutender Gelehrter. Bei ihm findet Köváry eine Lebensaufgabe, die seinen gelehrten Neigungen und Fähigkeiten entgegenkommt. Aber mit dem gewaltsamen Tod des Herrschers (1449) wird György Köváry wieder ein Heimatloser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELISABETH HERING
Schatten Gottes auf Erden
HISTORISCHER ROMAN
Ich schreibe dieses Buch für Köváry György, den Sohn, der meinen Namen trägt, in dessen Adern mein Blut fließt und der mich nicht kennt – so wenig, wie ich ihn kenne.
Er wächst auf in der Obhut seiner Mutter und ihrer Verwandten, und sie werden ihm wenig von mir erzählen. Doch was sie ihm sagen, wird mich in ein falsches Licht setzen. Ich mache seiner Mutter deswegen keine Vorwürfe, denn auch sie kannte mich nicht – aber daran war kein anderer schuld als ich selber.
Ich hätte Margit nicht heiraten dürfen, denn ich liebte sie nicht. Doch die, die ich liebte – was hatte sie mir angetan! Nicht, dass sie meine Liebe nicht erwidert hätte, das wäre zu ertragen gewesen. Einer, der sich an eine Frau verliert, die nichts von ihm wissen will, ist in meinen Augen kein Mann. Aber dass sie im entscheidenden Augenblick versagte, unsere Liebe verriet und mit Füßen trat, ließ das schöne Bild, das ich von ihr im Herzen trug, in Stücke springen wie eine Statue, auf die ein Felsblock fällt: Man hatte gedacht, sie wäre aus Marmor und ein Stoß könnte sie wohl umstürzen, doch nicht zertrümmern – aber sieh da, sie war nur aus Gips gewesen und lag nun, ein Zerrbild ihrer selbst, im Sande. Nein, Etelka, du Tochter des Grafen Losonczy und Nichte des Woiwoden von Siebenbürgen, du warst es nicht wert, die Frau von Köváry Istváns Bastard zu werden!
Und dann Margit. War es eine Sünde, dass ich sie zu mir nahm, weil ich vergessen wollte? Eine Sünde, dass ich das Mitleid, das ich mit ihr empfand, für Liebe hielt? Mit der Rute züchtigte ihr jähzorniger Vater sie aus dem geringfügigsten Anlass, obwohl sie schon über siebzehn war, und ich sah sie nach einer solchen Strafe, zitternd in ohnmächtiger Empörung, in der Scheune stehn, wohin sie sich verkrochen hatte, um sich auszuweinen. Sollte ich sie da nicht in die Arme schließen?
Sie wurde mir natürlich nicht verweigert, war ihr Vater doch nur ein Pächter auf einem der vielen Güter Hunyadis und ich in seinen Augen ein »Herr«.
Aber ich bereute bald, was ich getan hatte, denn nachdem ich keinen Grund mehr hatte, Margit zu bemitleiden, fühlte ich, wie wenig sie mir bedeutete. Nein, ich schlug sie nicht. Warum auch? Gab sie sich nicht alle Mühe, mir zu Gefallen zu sein? Aber ich beachtete sie wenig und immer weniger, denn sie konnte sich in ihre neue Umgebung nicht hineinfinden.
Was für einen Gesprächsstoff gab es zwischen ihr und mir, zwischen ihr und meinen Bekannten?
Doch je mehr ich sie vernachlässigte und je mehr sie darunter litt, desto mehr versuchte sie, meine Beachtung zu erzwingen, und dazu verfiel sie auf das unklügste Mittel, das sie hätte finden können: Immer lag sie mir wegen irgendwelcher Nichtigkeiten in den Ohren, beklagte sich über alles und jedes, und ihr Jammern nahm kein Ende. Das wurde mir mit der Zeit so lästig, dass ich sie schließlich verließ. Ja, ich habe mich ihr gegenüber schuldig gemacht, und das bedrückt mich noch heute. Denn im Grunde ihres Herzens war sie ein guter Mensch. Nie ging ein Bettler unbeköstigt aus unserem Hause, nie versäumte sie, in Not geratene Verwandte zu unterstützen, lieber versagte sie sich selber etwas, als einen noch so entfernten Vetter oder eine betagte Muhme im Stich zu lassen. Und ihren Vater, der bald darauf bettlägerig wurde, nahm sie zu sich und pflegte den mürrischen, launischen, ständig aufbrausenden alten Mann mit rührender Geduld. Und, was ich am meisten an ihr schätzte: Nie habe ich sie sich an einem Weibertratsch, an übler Nachrede beteiligen hören.
Sie wird auch über mich kein schlechtes Wort verlieren. Eher mich verteidigen, wenn andere mich angreifen. Aber was kann sie schon vorbringen, um meinen Neidern und Feinden den Mund zu stopfen?
Am meisten schuldig gemacht aber habe ich mich gegenüber meinem Sohn. Er saß auf meinen Knien, als er noch nicht sprechen konnte, und jauchzte, wenn ich ihm Schaukellieder sang. Doch als er jemanden brauchte, der seinen Geist weckte, der ihn einführte in den Irrgarten dieser Welt und ihn lehrte, die in allen Farben prangenden Giftgewächse von den unscheinbaren Heilpflanzen zu unterscheiden, da ließ ich ihn im Stich.
Ich schreibe dieses Buch aber nicht, um zu beschönigen, was ich tat. Die echten Töne lassen sich immer von den unechten unterscheiden, wenn man ein feines Gehör dafür hat. Und das, so hoffe ich, hat mein Sohn von mir geerbt. Nein, ich hinterlasse ihm diese Blätter, in denen meine Kindheitserinnerungen ebenso getreu und wahrheitsgemäß verzeichnet sein sollen, wie ich mit meinen Taten und Unterlassungen zu Gericht gehn und meine Gedanken und Urteile über Menschen und Ereignisse festhalten will, weil ich hoffe, ihm damit etwas von dem abstatten zu können, was ich ihm schuldig geblieben bin.
Erster Teil
Die ersten Bilder, die sich mir in der Kindheit eingeprägt haben, stammen aus Samarkand. Es ist ein weiter Weg von dem Gutshof der Kövárys, der zwischen den beiden Kokeln in dem schönen Lande Siebenbürgen gelegen ist, bis zu dieser Stadt, deren Namen in Ungarn kaum jemand kennt – ein weiter, heißer und gefährlicher Weg, und mein Vater ist ihn nicht freiwillig gegangen. Aus eigenem Willen freilich und sehr gegen den seines Vaters eilte er den Fahnen des Königs Sigismund zu, als dieser ein Kreuzfahrerheer gegen die Türken ins Feld führte, denn der alte Köváry war der Meinung, der ungarische Adel sei dem König nicht dienstpflichtig, wenn außerhalb des Vaterlandes gefochten werde, und das Leben seines einzigen Sohnes zu schade, um für ein königliches Abenteuer aufs Spiel gesetzt zu werden.
Das aber war die Ansicht meines Vaters nicht. Hatte nicht der Türke Serbien, Bulgarien und Mazedonien erobert? Sollte man warten, bis er die Donau überschritt und seinen Halbmond auf der Ofener Burg aufpflanzte?
Siebzehn Jahre alt war mein Vater damals, kräftig, ein Draufgänger, in allen Pferdesätteln zu Hause. Mit einigen Burschen, die ihm an Verwegenheit nicht nachstanden, Hörigen seines Vaters, die mitzunehmen er sich berechtigt fühlte, machte er sich bei Nacht und Nebel auf den Weg und traf in der Königsburg ein, gerade als Sigismund seine Scharen beisammen hatte.
Ich weiß nicht, wodurch mein Vater die Aufmerksamkeit des Königs auf sich lenkte: durch die gute Figur, die er zu Pferde machte, durch seine Gewandtheit im Fechten oder durch eine der schlagfertigen Antworten, wie er sie auf jede Frage zu geben wusste – genug, es dauerte nicht lange, da reihte Sigismund ihn in seine Leibgarde ein.
Und mein Vater war es dann auch, der ihm in der unglücklichen Schlacht bei Nikopolis das Leben rettete. Denn als der König sich schon zur Flucht gewandt hatte und einer der türkischen Reiter die Verfolgung aufnehmen wollte, preschte er vor und versperrte mit seinem Pferd dem Türken den Weg. So geriet er in Gefangenschaft, aber der König entkam.
Das war die erste Etappe meines Vaters auf seinem Wege nach Samarkand. Vielleicht die Gefährlichste. Denn Bajazids Wut über die Verluste, die das christliche Heer dem seinen zugefügt hatte, war so groß, dass er befahl, am nächsten Morgen alle überlebenden Feinde vor ihn zu bringen. Und jeder Mann aus dem türkischen Heer, der Gefangene gemacht hatte, musste sie fesseln und vorführen und ihnen vor den Augen des Sultans den Kopf abschlagen.
So wurde auch mein Vater, zusammen mit drei anderen, an Stricken zum Hinrichtungsplatz geführt. Doch als die Reihe an ihn kam, hob er wie in einer Trotzgebärde den Kopf und sah den Sultan an. Da machte der eine Handbewegung, und der Akindschi, der den Säbel schon aus der Scheide gezogen hatte, steckte ihn zurück: Bajazid ließ keinen töten, der noch nicht zwanzig Jahre alt war, und mein Vater war erst siebzehn – das stand ihm im Gesicht geschrieben.
Man brachte die wenigen christlichen Gefangenen, die dem furchtbaren Blutbad entronnen waren, in die Stadt Gallipoli, warf sie in einen Turm und hielt sie dort zwei Monate in Gewahrsam. Dann lud man sie auf ein Schiff, schaffte sie nach Anatolien und reihte sie dem türkischen Heere ein. So wurde aus Köváry István der Janitschare Kükülli.
Er lernte das Türkische schnell. Und auch das, was man sonst von ihm verlangte, fiel ihm nicht allzu schwer. Seine Kameraden zeigten ihm, wie er sich bei den täglichen Gebetsübungen zu verhalten hatte: wann er die Arme heben, wann er sich verbeugen, wann sich zu Boden werfen musste. Erst machte er ihnen alles blindlings nach, wenn sie sich zum Gebet wie in einer Schlachtordnung aufgestellt hatten, dann aber gingen ihm die mit militärischer Genauigkeit ausgeführten Bewegungen so in Fleisch und Blut über, dass er sich selbst im Traum darin ganz sicher fühlte. Sogar die Worte, die der Vorbeter halb singend sprach und die man ebenso zu wiederholen hatte, wurden ihm vertraut, obwohl er sie nicht verstand (denn arabisch muss ja der Koran rezitiert werden!), aber hatte er je den Sinn der lateinischen Worte verstanden, wenn in Ungarn die Pfaffen ihre Litaneien sangen? Und kam es überhaupt darauf an, dass man verstand? Und nicht vielmehr darauf, dass man sich einreihte – hineinwuchs in eine Ordnung, die dadurch Gültigkeit hatte, dass sie eine Gemeinschaft zusammenfügte?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!