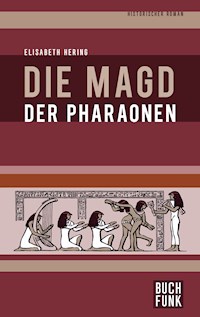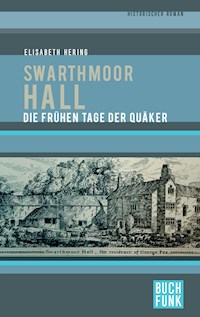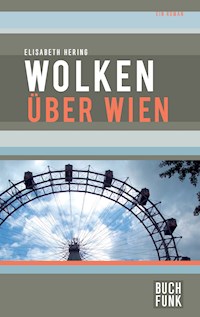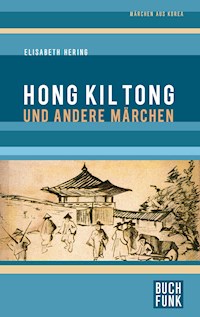Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BUCHFUNK Hörbuchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In "Versunkene Welt" erzählt die Autorin Elisabeth Hering von ihrer Kindheit in Siebenbürgen. 1909 geboren, erlebte sie dort als junges Mädchen den Ersten Weltkrieg und danach den Anschluss ihrer Heimat an Rumänien. Sehr persönlich schildert Hering in dem Buch ihre Erinnerungen bis zum Ende ihrer Schulzeit in Schäßburg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Hering
Versunkene Welt
Erinnerungen an eine Kindheit in Siebenbürgen
Meinen Kindern gewidmet,
die auch veranlasst haben,
dieses Buch zu schreiben.
Ich bin die älteste Tochter der einzigen Tochter der ältesten Tochter. Und auch die älteste Tochter des ältesten Sohnes der ältesten Tochter. Und alle diese meine Vorfahren heirateten jung. So gab es eine dichte Geschlechterfolge und es lebten, als ich geboren wurde, noch alle meine Großeltern und von den acht Urgroßeltern, die den Menschen zustehen, noch fünf. Erinnern kann ich mich an vier von ihnen.
Meine aller früheste Erinnerung überhaupt knüpft sich an meine Bacon-Urgroßmutter. Und zwar ist sie derart, dass eine Verwechslung mit einer mir möglicherweise später erzählten Begebenheit undenkbar ist. Denn es ist keine erzählbare Begebenheit, vielmehr ein Bild.
Ich sitze oder hocke in der unteren Veranda unseres Hauses, einem Raum, der bis in den Herbst hinein als Wohnraum diente, da er nach allen Seiten geschlossen war, dem Hof zu mit einer Glaswand, durch die man den ganzen Hof überblicken konnte. Hier wurden in der warmen Jahreszeit die Mahlzeiten eingenommen, und wenn sich Gäste unerwartet einstellten, was besonders zur Jause, dem Nachmittagskaffee, sehr häufig vorkam, lag das Gedeck für sie bereit, noch ehe sich die Türen auftaten.
Hier also saß ich, und zwar im Vorderteil, wo keine Möbel standen, und baute einen Turm aus Kukuruzgrotzen, aus diesen Maiskolbenstrünken, aus denen die Maiskörner schon "abgerebbelt" waren, herausgelöst waren, so dass mir dieses prächtige Baumaterial, das ich offenbar dem gekauften Ankersteinbaukasten vorzog, zur Verfügung stand. Es muss also Herbst gewesen sein.
Da tat sich die Türe des Eingangs mit dem ihr eigentümlichen Gequietsche auf, und meine Urgroßmutter trat herein — eine nicht sehr große, dunkel gekleidete, etwas vornübergebeugte Gestalt, die eine schwarze Barbe auf dem Kopf trug, ging an mir vorüber.
Sie starb im Februar des Jahres 1911. Ich bin im Januar 1909 geboren. Ihr Bild muss sich also im Herbst 1910 in mein Gedächtnis eingegraben haben. Und zwar in doppelter Variante: Ich sehe mich auf dem Rande des marmornen Springbrunnenbeckens sitzen und die Goldfischchen beobachten, die dort herumschwammen, als meine Urgroßmutter (wieder in Schwarz mit Barbe, nur trug sie diesmal auch einen Regenschirm in der Hand) auf mich zustürzte, um mich mit dem Ruf: "Lieschen, du fällst ins Wasser!" vom Brunnenrand zu ziehen.
Meine Mutter bestätigte mir später die Richtigkeit des Bildes, das ich mir von meiner Urgroßmutter bewahrt habe. Sie war damals schon über achtzig Jahre alt, trug immer schwarze Kleider und eine Barbe, wie sie für alte Damen sehr kleidsam ist (ich wollte, sie wäre heute noch in Mode), und ging selten ohne Regenschirm aus dem Haus. Auch soll sie sehr ängstlich gewesen sein.
Ich war das einzige Urenkelkind, das sie erlebt hat. Sie muss mir sehr zugetan gewesen sein, denn sie soll geäußert haben: "Ich möchte so lange leben, bis ich sehe, was aus diesem Kind einmal wird."
Und da meine früheste Kindheitserinnerung auf sie zurückgeht, will ich den Reigen der Gestalten, den ich hier an euch vorüberziehen lassen werde, auch mit ihr beginnen.
Therese Bacon geborene Wenrich, geboren am 27.6.1824, gestorben am 3.2.1911. Ihr Vater war Webermeister und wurde Bürgermeister von Schäßburg. Ihr Elternhaus stand auf der Burg nicht weit vom Stammhaus der Bacons entfernt, in dem ich aufgewachsen bin. Ein großes, stattliches Eckhaus mit Eingängen von der Schulgasse und vom Burgplatz, eines dieser wundervollen alten Schäßburger Häuser, die so fest gebaut sind, dass ein Spaßvogel von ihnen sagte, sie sähen aus, als ob sie massiv gebaut und nachträglich ausgehöhlt worden wären. (Ja, sie werden vermutlich noch stehen, wenn die heutigen modernen Hochhäuser längst zusammengerumpelt sind.) Man nannte dieses Haus auch das Haus zum Hirschen, weil in der Zeit, ehe es Hausnummern gab, ein steinerner Hirschkopf an seiner Wand angebracht worden war.
Außer jenem Haus besaß der Bürgermeister Wenrich Gärten und Felder, die er von Tagelöhnern bestellen ließ. Und seine Liebe zur Landwirtschaft hat er seiner Tochter Therese und deren Sohn Joseph weitervererbt. Meine Urgroßmutter soll in der Rohrau ein Grundstück besessen und mit Hopfenbau gute Einnahmen erzielt haben, und mein Großvater ließ seine beiden Baumgärten am Siechhofberg und am Knopf von einem Meirer bewirtschaften. Doch ihm wurde nachgesagt, es sei ein Verlustgeschäft gewesen.
Und auch die Ängstlichkeit muss Therese von ihrem Vater geerbt haben, denn folgende Anekdote ist bis zu mir gedrungen:
Der alte Wenrich hatte außer dieser Tochter noch mehrere Söhne, deren einer Universitätsprofessor in Wien wurde und ein anderer Offizier. Als der Letztere, bereits im Hauptmannsrang, einst zu Besuch im Elternhaus weilte und sich am Mittagstisch ein Stück Brot schneiden wollte, rief sein Vater entsetzt: "Niet dem Kängd det Messer aus der Hand!" Nehmt dem Kind das Messer aus der Hand!
Auch eine andere Eigenschaft von ihm, die sich fortgeerbt hat, wird berichtet: Er sei mit den Hühnern schlafen gegangen und mit den Hühnern aufgestanden. Und wenn seine Frau im Sommer nach der Jause noch mit ihrer Familie in den Garten habe gehen wollen, habe er sie gefragt: "Wor giehst te nea schi wedder mät de Kängden ken de Nocht?" Wohin gehst du nun schon wieder mit den Kindern der Nacht entgegen? Nun, auch sein Enkel (mein Großvater) pflegte sich gegen acht Uhr abends schon niederzulegen, stand vom Abendessen auf, sagte: "Ich Überschlag mich jetzt!" Und ging dann am Morgen, wenn alles noch schlief, an die Arbeit. "Du könntest doch die Mägde wecken, Tat", sagte seine Frau, die selber bis spät in die Nacht herumwirtschaftete und dann am Morgen nicht vor neun Uhr aus den Federn fand. "Fällt mir ein”, antwortete er, "ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe."
Nun schweifte ich ab, und das wird mir noch oft passieren. Denn es ist wahrscheinlich ein Irrtum zu meinen, das Leben wäre ein ununterbrochener Entwicklungsstrom, fließend von der Quelle zur Mündung, da dieser Strom doch von so vielen Zuflüssen gespeist wird, dass man gar nicht recht weiß, wo eigentlich seine Quelle ist, und man sich, wenn man seinen Ursprüngen nachgeht, in einem seltsamen Netzwerk gefangen sieht, dessen Fäden wohl ebenso wenig leicht auseinanderzufitzen sind wie die beiden Erinnerungsbilder, die mir hier ineinander übergehen.
Kehren wir also zurück zu Therese Wenrich. Sie muss ein sehr begabtes Kind gewesen sein — aber "leider" nur ein Mädchen, dem dazumal kaum eine Schulbildung offen stand. Unglaublich, was man mir erzählte: Die Mädchenschule habe nur zwei Klassen gehabt, und als Thesi (wie sie in der Familie genannt wurde) diese absolviert hatte und man sie so früh nicht aus der Schule nehmen wollte, habe sie noch einmal dem Unterricht von vorne beigewohnt. Doch dann, nach vierjähriger Schulzeit also, war damit endgültig Schluß. Es gab noch Privatunterricht in französischer Sprache, es gab eine Reise zu Verwandten nach Hermannstadt, den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten wird wohl ihre Mutter ihr erteilt haben (darin erlangte sie große Fertigkeit), und dann gab es eben die Bücher, in denen zu lesen sie nicht müde wurde.
Mit einem Onkel wettete sie, in drei Monaten sämtliche Gedichte von Schiller auswendig zu lernen. Diese Wette gewann sie und damit als Preis Schillers sämtliche Werke.
Man schilderte mir folgendes Bild von ihr: Sie saß und strickte, auf dem Schoß hielt sie dabei ein Buch, in dem sie las, mit dem Fuß schaukelte sie die Wiege ihres jüngsten Geschwisterchens, und ab und zu biss sie in einen Apfel, der vor ihr auf dem Tisch lag.
Im Stricken wurde sie eine große Meisterin. Die Frauen trugen damals weiße Strümpfe, die bis zum Knie gingen, dort mit einem Strumpfband festgehalten wurden und oben einen mindestens zehn Zentimeter langen gemusterten Teil aufwiesen, ehe sie dann glatt hinunter gestrickt wurden. Und einen solchen Strumpf aus feinem Baumwollgarn konnte sie mit dünnen Nadeln an einem Tag zustande bringen.
Ich besitze einen Streifen solch kunstvoll gestrickter Muster von ihr — ein wahres Museumsstück. Und auch gestickt hat sie bis in ihr hohes Alter — immer mit rotem Garn auf weißes Leinen, Kreuzstich, Flachstich und dazwischen Kalötaszeger Durchbrucharbeiten — (Kalötaszeg ist eine Landschaft in Siebenbürgen, westlich von Klausenburg, die durch ihre Handarbeiten berühmt ist). So ein Tischtuch besitze ich.
Und natürlich lernte sie in ihrem Elternhaus von der Hauswirtschaft so viel, wie die Tochter ehrsamer sächsischer Bürgersleute verstehen musste, ehe man sie verheiratete. (Und das war nicht wenig! Wurde damals doch im Hause Brot gebacken, Seife gekocht, Kraut in Fässer eingelegt und dergleichen mehr.) Und sie muss auch darin sehr gelehrig gewesen sein, denn man verheiratete sie schon mit vierzehn Jahren.
Der Mann, dem man sie zur Frau gab, war doppelt so alt wie sie. Was er von Beruf gewesen ist, weiß ich nicht.
Er muss ein sehr gutmütiger Mensch gewesen sein, der sie sehr lieb hatte. Es wird erzählt, dass er einmal als er nach Hause kam, sie im Hof antraf mit Kindern spielend, sie auf den Arm nahm, ins Haus trug und sagte: "Thesi, te meßt nea kochen.” Thesi, du musst jetzt kochen. Und als sie sich nach etwa achtjähriger Ehe von ihm scheiden lassen wollte, sagte er: "Wißt te wat, Thesi, ich kiefen der nea noch ein Klied." Weißt du was, Thesi, ich kaufe dir jetzt noch ein Kleid.
Warum aber ließ sie sich dann überhaupt scheiden und eröffnete damit diese Familientradition, die sich bis zu meinen Söhnen fortgesetzt hat? Als Grund wird angegeben, dass sie keine Kinder bekamen, die sich die junge Frau doch so sehr wünschte. Und Hauptgrund dürfte wohl der Landesadvokat Dr. Joseph Bacon gewesen sein, der in ihr Blickfeld geriet.
Sie sind "im Guten" auseinandergegangen, wie ein Brief von ihr beweist, den sie ihrem geschiedenen Mann geschrieben hat, und den ich in ihren nachgelassenen Papieren vorfand. Und auch er hat wieder geheiratet und das Erstaunliche ist zu verzeichnen, dass sie beide noch von den anderen Ehegatten Kinder hatten: er zwei und sie neun!
Von ihren neun Kindern starben ihr fünf. Das Älteste bald nach der Geburt, zwei Töchter als Kinder an Diphterie und der Zwillingsbruder ihrer jüngsten Tochter ebenfalls als Säugling, ein sechzehnjähriger hochbegabter Sohn, Alexander an Hirnhautentzündung. Großgezogen hat sie also vier Kinder: Marie, Joseph, Cornelia und Therese.
Ihr zweiter Mann, mein Urgroßvater Joseph Bacon, stammte aus einer eingewanderten Familie. Drei Brüder Bacon waren als Wundärzte des österreichischen Heeres nach Siebenbürgen gekommen und hatten sich hier niedergelassen. Die Familie war, wie schon der Name besagt, englischen Ursprungs. Die Familiensage berichtet Folgendes: Der Urahn, ein Katholik, hatte während der Katholikenverfolgungen England verlassen und war in die Pfalz ausgewandert. Und hier wurden seine Nachkommen zu Deutschen — aus den Bacons (sprich Beekens) wurden Bacons (sprich Backons). Wie die drei Brüder dazu kamen in österreichische Dienste zu treten, ist nicht überliefert. Jedenfalls kamen sie auf diese Weise nach Siebenbürgen, zwei von ihnen heirateten hier sächsische Frauen, blieben aber katholisch, und der Vater meines Urgroßvaters ist auf dem katholischen Friedhof in Schäßburg begraben worden. Seinen Grabstein habe ich als Kind noch gesehen. Sein Sohn ist nach dem alten siebenbürgischen Rechtsgrundsatz, nach dem die Söhne in der Religion ihres Vaters, die Töchter in der ihrer Mutter erzogen wurden, katholisch getauft worden, trat aber, als er die Tochter des Schäßburger Bürgermeisters heiratete, zum evangelischen Glauben über. Das war eine völlig normale Erscheinung.
Von meinen vier Urgroßvätern waren drei gebürtige Katholiken: Thullner wanderte aus Wieselburg ein, das an der Grenze Ungarns zu Österreich liegt und dessen Einwohner, auch die Deutschen unter ihnen, katholisch waren, Leicht kam aus dem katholischen Bayern. Thullner ließ sich in Birthälm nieder, heiratete eine Sächsin und wurde evangelisch, Leicht ließ sich in Csíkszereda nieder, wurde dort zwar nicht evangelisch, obwohl auch er eine Sächsin geheiratet hatte, sein Sohn jedoch, der die Birthälmerin heiratete, vollzog mit der Eheschließung auch den Übertritt zur evangelischen Kirche. Denn in Siebenbürgen galt seit der Reformation der Begriff "sächsisch" und "evangelisch" nahezu als Synonym, "ried evandjelesch" red evangelisch!" — sagt man zu jemandem, wenn man will, dass er nicht hochdeutsch, sondern in unserer Mundart sprechen soll, und ein "evangelisches" Hendel wird nach sächsischer Art mit Speck und Zwiebel gefüllt, gebraten, während das "katholische" eine Semmelfälle erhält (nach österreichischem Rezept).
Mein Urgroßvater Bacon war Jurist (Landesadvokat).
Was es mit diesem Titel auf sich hat, weiß ich nicht.
Nach dem sogenannten "Ausgleich" zwischen Österreich und Ungarn kam er als Abgeordneter in den ungarischen Reichstag. Er gehörte der Partei der "Jungsachsen" an, die sich nach der Zerschlagung des "Königsbodens" gebildet hatte (1876) und für ein gutes Verhältnis zum Madjarentum eintrat. Ich komme auf diese geschichtlichen Hintergründe später noch zu sprechen. Er muss ein durchaus "liberaler" Mann gewesen sein, der nicht nur für die Madjaren, sondern auch für die Rumänien Verständnis zeigte und ihr Fürsprecher wurde, als sie auf der Burg eine rumänische Schule gründen wollten, was ihnen dann durch seine Vermittlung auch gestattet wurde.
Ich habe diese Tatsache einer Schrift entnommen, die im orthodoxen Pfarramt in Schäßburg aufbewahrt wird. Der dortige Pfarrer zeigte sie mir.
Auch in einer anderen Hinsicht bewies mein Urgroßvater, dass er über die Vorurteile seiner Zeitgenossen erhaben war. Seine älteste Tochter Marie — ein selten schönes und begabtes Mädchen — hatte die Schäßburger Mädchenschule mit Glanz bestanden, und obwohl diese Schule nun um etliche Klassen mehr aufzuweisen hatte, als zu den Zeiten ihrer Mutter, meinte er doch, dass es seiner begabten Tochter zustehe, ein größeres Wissen zu erwerben, als sie vermitteln konnte. Er ging deshalb zum Direktor des Knabengymnasiums und bat ihn, Marie in diese Schule aufzunehmen. Unerhört! Ein Mädchen im Knabengymnasium! Matura machen und womöglich gar studieren — in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts! Es wurde dann auch glatt abgeschlagen. So etwas konnte selbst ein Abgeordneter für seine Tochter nicht erreichen.
Marie blieb also schön artig zu Hause und lernte der Mutter deren weibliche Künste ab. Doch diese Mutter sorgte für die Weiterbildung ihrer Töchter nicht nur, indem sie ihnen das Kochen und Stricken beibrachte, es fehlte ihrer Bibliothek nicht an Büchern (Schillers sämtliche Werke hatte sie ja schon mit in die Ehe gebracht und seither sicherlich um so manche Werke vermehrt), aber es genügte nicht, die Dramen der Klassiker nur zu lesen — sie wollten doch gespielt sein! Und so veranstaltete Therese Bacon mit ihren heranwachsenden Kindern und deren Altersgenossen Aufführungen, die sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuten. Kein Wunder, dass in Marie der Wunsch aufstieg, Schauspielerin zu werden.
Schauspielerin! Die Tochter eines Abgeordneten, die Enkelin eines Bürgermeisters Schauspielerin! Das verstieß denn doch noch mehr gegen alle guten Sitten als der Wunsch eines Mädchens, Matura zu machen.
Hier war sogar der Vater dagegen. Zwar verbot er Marie nicht geradezu, diese Laufbahn zu ergreifen, doch versagte er ihr jede weitere materielle Unterstützung.
Und es war der Großvater, der alte Bürgermeister Wenrich, der es der Enkelin ermöglichte, in Wien eine Schauspielschule zu besuchen.
Ganz sicher hätte sie Aussicht gehabt, Karriere zu machen. Sie soll schon bei ihrem ersten Engagement in Karlsruhe als Naive schöne Erfolge erzielt haben. Da aber verliebte sie sich in den stattlichen, berühmten Wagnersänger Albert Stritt, heiratete ihn, hatte zwei Kinder und gab ihren Beruf auf.
Unterdessen starb ihr Vater, noch nicht sechzig Jahre alt, an einem Schlagfluss. Und damit nahm auch das Leben seiner Frau, meiner Urgroßmutter, eine andere Wendung.
Ihr Sohn Joseph war unterdessen Arzt und als Stadtphysikus in Schäßburg angestellt worden. Er hatte die Tochter des Bäckermeisters Michael Reinhardt geheiratet, einen eigenen Haushalt gegründet und das Haus, das seinem Vater gehört hatte, übernommen. (Über dieses Haus wird später noch manches zu sagen sein). Seine Mutter bezog ihr Elternhaus, das ihr als Erbe zugefallen war, zusammen mit ihrer Tochter Therese, der einzigen, die beim Tode des Vaters unverheiratet war und es auch blieb. Die Mittlere, Cornelia oder Nelly, wie sie in der Familie hieß, hatte einen reichen Kaufmann. Joseph Kaunz geheiratet, der, obgleich ebenfalls einer Schäßburger Familie entstammend, in Klausenburg lebte, wo er eine Agentur hatte. Mit dieser Heirat verknüpfte sich ein Familiendrama.
Nelly, nicht weniger schön als Marie, nur nicht mit ebenso viel geistigen Gaben ausgestattet, stiller und zurückgezogener, war verlobt mit einem anderen Mann, ebenfalls aus gutbürgerlicher Schäßburger Familie, und dieser wandte sich von ihr ab und heiratete ihre Cousine, die Tochter von der Schwester ihres Vaters. Das konnte mein Urgroßvater nicht verzeihen. Er brach jeden Verkehr mit der Familie seiner Schwester ab und hat bis an sein Lebensende kein Wort mehr mit ihnen gesprochen. Doch scheint dieser Familienzwist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen zu sein, denn so klein Schäßburg auch war, wusste doch sein "Gegenvater" Reinhardt nichts davon, als er die Hochzeit seiner Tochter Lisi mit dem Stadtphysikus Dr. Joseph Bacon ausrichtete. (Die Siebenbürger Sachsen nennen die Schwiegereltern ihrer Kinder "Gegeneltern"); Er lud natürlich die Baconische Verwandtschaft dazu ein, also auch diese Schwester des Landesadvokaten mit Tochter und Schwiegersohn. Sie müssen die Einladung angenommen haben, waren wohl froh, dass sich hier eine Gelegenheit zur Versöhnung bot. Aber der Alte blieb unerbittlich, und der arme Brautvater musste den schweren Gang tun und diese Gäste wieder ausladen. Meine Großmutter hat mir erzählt, wie peinlich das ihrem Vater gewesen ist.
Um nun der armen Nelly über die Enttäuschung hinwegzuhelfen, die ihr die Untreue ihres Bräutigams verursacht hatte, unternahm ihr Vater mit ihr eine längere Reise. Und bei der Gelegenheit kreuzte Joseph Kaunz ihren Weg und verliebte sich leidenschaftlich in das schöne Mädchen. Sie wies seine Werbung nicht ab, obwohl sie seine Leidenschaft wohl nicht erwiderte. Vermutlich wollte sie dem Untreuen zeigen, dass sie ihm nicht nachtrauerte. Und Kaunz verwöhnte sie auf alle Art, bewahrte ihr bis zu seinem Tode seine Verliebtheit und bot ihr mit seinem Reichtum ein angenehmes, mit allem Komfort ausgestattetes Leben.
Sie hatten einen einzigen Sohn. (Da sich bei seiner Geburt eine Eklampsie eingestellt hatte, verzichteten sie auf weitere Kinder). Er erhielt den Namen seines Vaters, wurde in der Familie Joschka genannt und wurde später mein Patenonkel.
Ich erinnere mich noch gut an die Atmosphäre, die im Kaunzischen Hause herrschte: an die bunten Fensterscheiben, mit denen die Eingangstüre geschmückt war, an die schön eingerichteten Räume, an die Beflissenheit, mit der Kaunzonkel seiner Frau Aufmerksamkeiten erwies und an die freundliche Zurückhaltung, mit der sie diese entgegennahm.
Später erzählte mir ihr Enkel, den man ebenfalls Joseph getauft hatte, den wir aber bis an sein Lebensende Öcsi nannten (weil er der jüngere Bruder seiner Schwester Cornelia war, die wir Pusi nannten), später also erzählte mir Öcsi, dass seine Großmutter, wenn ihr Mann und ihr Sohn eine schöne Sommerreise machen wollten, sich daran nicht beteiligte, sondern ihr größtes Vergnügen darin fand, allein in ihrem Hause zu bleiben. Sie gab ihren Dienstboten Urlaub, ließ die Jalousien der nach der Straße zu gelegenen Fenster hinunter, damit alle Welt denken solle, Kaunzens wären verreist, und lebte so still für sich hin, ohne einen Menschen zu sehen, bis ihre Männer zurückkamen. Was muss sie für ein reiches und tiefes Innenleben entwickelt und wie mag sich die vielleicht doch etwas zu aufdringliche Art der Liebe ihres Mannes auf sie ausgewirkt haben, dass sich ein so ungewöhnliches Bedürfnis bei ihr einstellte?
Ihr Ende war tragisch. Sie starb (wie übrigens alle ihre Geschwister) an einem Schlagfluss, nur dass der sie nicht gleich tötete, sondern einseitig lähmte. Sieben Jahre lang — sieben lange Jahre — saß sie tagsüber in einem Rollstuhl, betreut von einer Pflegerin und Gesellschafterin, die sogleich von Kaunzonkel dazu angestellt wurde. Ihr Geist hatte nicht gelitten. Sie konnte sprechen und zuhören, man konnte ihr vorlesen und sich mit ihr unterhalten. Ich sehe sie noch vor mir, in ihrem Rollstuhl sitzend, ihr noch im Alter schönes Gesicht, das fein geschnittene Profil, den freundlichen Ausdruck ihrer Augen — dieses Bild hat sich tiefer in mich eingeprägt als das ihrer gesunden Jahre. Und wie erschüttert war ich, als ich bei meinem letzten Besuch in Klausenburg ihre Enkeltochter Pusi, gleichermaßen durch eine tödliche Krankheit an einen Stuhl gefesselt, sitzen sah und mir aus ihren Zügen die ihrer Großmutter ganz unverkennbar entgegentraten.
Die Familie Kaunz war eine der letzten Klausenburger sächsischen Familien, und ihre Nachkommen sind madjarisiert. Nellytantes Sohn Joschka heiratete zwar die Tochter eines Zipser Sachsen, des Arztes Dr. Engel, aber in deren Familie wurde schon mehr madjarisch als deutsch gesprochen, so dass ich vermute, dass auch Ellatante mit ihren Kindern madjarisch sprach. Jedenfalls wuchsen Pusi und Öcsi zweisprachig auf, ja, mehrsprachig, denn rumänisch musste nach 1918 in dieser Stadt jeder lernen und französisch und englisch wurde ihnen von in ihrem Hause zu diesem Zweck angestellten Mademoiselles bzw. Misses beigebracht. Beide studierten in Österreich und Deutschland, vervollkommneten dort ihren deutschen Stil. Ich habe es immer bedauert, dass ich meinen Kindern die Chancen, Sprachen zu lernen, was den Menschen in ihrer Kindheit ja mühelos gelingt, nicht bieten konnte, und dass auch meine Eltern nichts dazu getan haben, mich wenigstens unsere Landessprache, madjarisch und rumänisch, bis zur Perfektion haben lernen lassen.
Öcsi heiratete dann eine madjarische Pianistin und seine Tochter Marianne ist eine bekannte Cellospielerin geworden. Pusi heiratete einen Szekler Adligen, Mikó Imre, führte eine außergewöhnlich gute Ehe, sie hatten zwei Söhne und zwei Töchter, aber leider keine Möglichkeit, ihren Kindern die deutsche Sprache perfekt beizubringen. Denn nach 1945 gingen natürlich auch die Reste des Kaunzischen und Mikóischen Vermögens zu Ende. Die Eltern mussten berufstätig sein, und die Zeiten der Mademoiselles und Misses waren endgültig vorbei.
Mein Patenonkel Joschka hat bald nach dem Krieg ein trauriges Schicksal gehabt. Er war während der Hitlerzeit deutscher Konsul gewesen und kam dann zur Zwangsarbeit an den Donaukanal, wo er zugrunde gegangen ist. Ellatante durfte mit Öcsi im Kaunzischen Haus bleiben, überlebte aber ihren Mann nur um einige Jahre. Ich habe sie dort noch vorgefunden, als ich zum ersten Mal nach Kriegsende (1955) nach Siebenbürgen fuhr: Die bunten Glasfenster in der Eingangstür waren noch vorhanden, von der großen Wohnung nur wenige Zimmer. Und auch die Mikós behielten im ehemalig eigenen Haus nur eine sehr beengte Wohnung. Was sie aber alles nicht hinderte, ihren Verwandten, selbst wenn die mit mehreren Kindern ankamen, die herzlichste Aufnahme zu bieten.
Pusi und Öcsi mussten sich mühsam durchschlagen. Wenn ich mich recht erinnere, nahm Pusi eine Anstellung als Dolmetscherin an, während Öcsi in einem Reisebüro arbeitete. Imre aber war Mitarbeiter eines Verlages. Er schrieb auch selbst Bücher, mit denen er sich einen Namen gemacht hat (nur schade, dass mein Madjarisch nicht zureicht, sie lesen zu können).
Jedes Mal, wenn wir nach dem Krieg nach Siebenbürgen fuhren, haben wir in Klausenburg die Reise unterbrochen, um diese Verwandten zu besuchen, die nach hiesigen, "reichsdeutschen" Begriffen ja wohl gar nicht mehr zur Verwandtschaft gezählt würden, nach unseren dortigen aber, die mir von Kindesbeinen an selbstverständlich waren und sind, zu den Menschen gerechnet werden, mit denen man möglichst enge Beziehungen aufrecht zu erhalten hat. Und auch von ihrer Seite ist das niemals anders empfunden worden.
Nun sind beide schon lange tot. Öcsi starb zuerst, an einem Nierenleiden, dem auch seine Mutter erlag und das wohl eine Erbkrankheit ihrer Familie ist. Pusi, die am gleichen Leiden schon eine Zeit lang krankte, musste erleben, dass auch ihr Imre vor ihr starb, folgte ihm aber bald darauf. Beide waren sie erheblich jünger als ich, können also nicht älter als Ende fünfzig geworden sein.
Nun bin ich in der Familiengeschichte ziemlich weit vorgeprescht, will aber zu meiner Urgroßmutter zurückkehren.
Sie war also früh verwitwet, ihre Kinder waren erwachsen, Marie lebte in Deutschland und die Mutter besuchte sie. Und hier nun lernte Therese Bacon eine Zeitströmung kennen, von der man in ihrer Heimat noch kaum etwas vernommen hatte: die Frauenbewegung.
Ob sie persönlich mit Luise Otto-Peters zusammengetroffen ist oder deren Bestrebung um bessere Bildungsmöglichkeiten der Frauen nur aus Veröffentlichungen kannte, weiß ich nicht. Wie dem aber auch sei: Jedenfalls begeisterte sie sich für diese Ideen, fühlte sie doch schmerzlich, wie viel ihr in Kindheit und Jugend durch die Kürze der Schulzeit und die viel zu frühe Ehe vorenthalten worden war. Und so war sie entschlossen, sich in Siebenbürgen für die Frauenbewegung einzusetzen.
Sonderbarerweise fand sie bei ihrer Tochter Marie, die sie ebenfalls für diese Bewegung zu gewinnen suchte, vorerst kein Verständnis. Die ehemalige Schauspielerin, jung verheiratet, fühlte sich so wohl in der Rolle als Gattin eines gefeierten Sängers und Mutter zweier kleiner Kinder, dass ihr die Welt, wie sie war, bestens eingerichtet zu sein schien.
Sie hatte eine Tochter, Friederike, an die ich mich sehr gut erinnere, und einen Sohn, Walter, dem ich nur zweimal in meinem Leben begegnet bin. Als ich ein Kind war, besuchte er mit seiner Frau die Heimat seiner Mutter, und als ich 1929 zum ersten Mal in Deutschland war, besuchte ich ihn in Chemnitz, wo er Arzt war. Tante Friedei aber kam öfters nach Siebenbürgen. Sie war Vortragskünstlerin, ging durch unsere Städte "auf Tournee" und machte nicht nur auf mich großen Eindruck. Als ich dann 1944 endgültig in Deutschland gelandet war, lebte sie noch. Ich besuchte sie, kümmerte mich um sie, schickte ihr von Rieth aus Pakete mit Lebensmitteln (Kartoffeln und Gemüse vor allem) ja, wusch sogar ihre Wäsche (sie ging ebenfalls in Paketen hin und her), war aber bass erstaunt, als ich nach ihrem Tode vom Notariat die Nachricht erhielt, dass sie mich zur Universalerbin eingesetzt hatte. Denn mit den Kindern ihres Bruders hatte sie sich völlig überworfen und sie ausdrücklich enterbt. So gelangte ich nun in den Besitz ihrer Kleider, ihrer Möbel, ihrer Bibliothek, was für uns, die wir ja völlig abgebrannt in Deutschland angekommen waren (mit vier Kindern und acht Koffern) eine große Hilfe bedeutete. Aber damit nicht genug, ich "erbte” auch zwei ihrer Freundinnen, Helene Judeich und Ilse Köhnke, denen sie Legate vermacht hatte. Ich suchte sie auf, lernte sie kennen und freundete mich ebenfalls mit ihnen an.
Und wieder habe ich den Faden zu weit ausgesponnen und muss ihn zurückführen zu dem Zeitpunkt, wo Friederike und Walter Stritt noch kleine Kinder waren und ihre Mutter Marie weit davon entfernt war, sich mit der Frauenbewegung einzulassen. Es bedurfte dann großer Enttäuschungen in ihrem weiteren Leben, vor allem wohl in ihrer Ehe, bis sie in die Bahn ihrer Mutter einlenkte, dann aber als eine der Führerinnen in der deutschen Frauenbewegung viel Anerkennung fand und große Bedeutung erlangte. (1894 gründete sie den ersten Rechtsschutzverein für Frauen in Dresden. 1899-1910 hatte sie den Vorsitz im Bund deutscher Frauenvereine und 1911-1919 den im Verband für Frauenstimmrecht. 1919-1922 war sie Stadträtin in Dresden und gab 1899-1922 die Zeitschrift "Die Frauenfrage" heraus. Diese Angaben habe ich aus dem "Großen Brockhaus" von 1930).
Damals freilich konnte Therese Bacon das nicht voraussehen — sie wird ziemlich enttäuscht darüber sein, bei dieser Tochter keine Zustimmung für die Ideen Q gefunden zu haben, die fortan den Mittelpunkt all ihrer eigenen Bemühungen bilden sollten.
In der Heimat prallte sie damit freilich erst einmal auf große Widerstände, vor allem in kirchlichen Kreisen, ließ sich jedoch nicht entmutigen, gründete den Frauenbildungsverein und setzte sich für eine Berufsausbildung der Mädchen ein. Und sie hatte die große Freude, es noch zu erleben, dass in Schäßburg ein Lehrerinnenseminar errichtet und damit wenigstens der Lehrberuf den Mädchen zugänglich gemacht wurde.
Nachfolgerin im Vorsitz des Frauenbildungsvereins wurde ihre Tochter Therese. Diese, von uns Tante Resi genannt, war unverheiratet geblieben, doch hatte die Mutter dafür gesorgt, dass sie nicht das Los so vieler Schäßburger "alten Jungfern" teilen musste, die nach dem Tod ihrer Eltern von mehr oder weniger reichlichen Einnahmen aus deren Erbe ein zumeist sehr bescheidenes Dasein fristeten und sich nur noch als "Maserntanten" in den Familien ihrer Geschwister nützlich machen konnten.
Tante Resi hatte Englisch und Französisch gelernt und war Sprachlehrerin geworden. Erst hatte sie eine Zeit lang eine Stellung als Erzieherin in einer ungarischen Magnatenfamilie (ich glaube der Kemenys) bekleidet, sich dann aber in Schäßburg als Privatlehrerin niedergelassen. Sie muss damit recht gut verdient haben, denn nach dem Tod ihrer Mutter übernahm sie das Wenrichische Haus und zahlte die übrigen Erben aus.
Ihre reich verheiratete Schwester Nelly half ihr allerdings dabei, und Resi dankte ihr das mit besonderer Zuneigung, die sich auch darin bekundete, dass sie zu jedem Weihnachtsfest nach Klausenburg fuhr, um es im Kreise der Kaunzischen Familie zu feiern.
Auch ich habe drei Jahre lang bei ihr englischen und französischen Unterricht genossen (gratis natürlich, denn innerhalb der Familie hätte bei uns nie jemand Bezahlung für derartige Dienste angenommen). Und ich bin ihr dankbar dafür bis zum heutigen Tag, denn wenn ich mich auch kaum in diesen Sprachen ausdrücken kann, so bin ich doch imstande, sie zu lesen, besonders englisch, was mir das Quellenstudium zu meinen eigenen Büchern sehr erleichtert hat.
Tante Resi bewohnte das Haus ihrer Ahnen bis zu ihrem Tode. Ihre eigene Wohnung darin war bescheiden, aber mit alten Möbeln schön eingerichtet: ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche. Die übrigen Räume des stattlichen Gebäudes vermietete sie, was ihr zu den Einkünften aus ihrer Tätigkeit einen erwünschten Zuschuss brachte.
Ich besuchte sie oft und gerne. Ja, habe sogar eine Zeit lang bei ihr gewohnt. Sie räumte mir ihr Schlafzimmer ein und war sichtlich froh, etwas Gesellschaft in ihrem Junggesellinnenleben zu haben.
Ein großer Anziehungspunkt neben ihrem freundlichen Wesen war für mich das Lexikon, das in ihrem Bücherschrank stand. Ja, sie besaß als Einzige in meiner Umwelt den "Großen Brockhaus", der um die Jahrhundertwende erschienen ist und aus dem ich z. B. das Wissen bezogen habe, was es mit Zeugung und Geburt der Kinder auf sich hat. Nein — aufgeklärt wurden wir von unseren Erziehungsberechtigten nicht. Selbst die Menstruation überraschte mich völlig unvorbereitet. Als ich wahrnahm, dass ich blutete, war ich zu Tode erschrocken und schrie so entsetzt zu Hilfe, dass Mutter und Großmutter gelaufen kamen um zu sehen, was mir zugestoßen sei. Sie beruhigten mich natürlich, sagten, das sei etwas ganz Natürliches, völlig Ungefährliches, nur ein Beweis dafür, das ich kein Kind mehr sei, sondern nun ein großes junges Mädchen. (Mehr erfuhr ich von ihnen allerdings nicht). Meine Mutter selbst hat wohl auch keine vorzeitige Aufklärung erfahren, was aus dem Tagebuch hervorging, das sie als junges Mädchen geführt hat. Dort schrieb sie, dass sie und ihre Kränzchenfreundinnen einen Bund schlossen, in dem der Paragraf 1 lautete: "Wer von uns als Erste heiratet, hat die Anderen in die Geheimnisse der Ehe einzuweihen".
Und ich muss wohl die Erste unter meinen gleichaltrigen Freundinnen gewesen sein, die der Eintritt der Menstruation ereilte, worüber es dann natürlich in unserem Kreise die lebhaftesten Erörterungen gab. Nur so richtig Bescheid über die eigentliche Ursache dieses rätselhaften Ereignisses wusste niemand, und aus den Erwachsenen war auf die Frage danach nichts anderes herauszubekommen, als ein verlegenes "das verstehst du noch nicht".
Da konnte nur eines helfen: Tante Resis Lexikon.
Von Menstruation zur Schwangerschaft — also damit, hatte es etwas zu tun? (Nun, dass die Kinder nicht vom Storch gebracht wurden, sondern sich im Bauch der Mutter entwickelten, davon hatten wir auch schon gehört. Aber wie kamen sie da hinein?) Von Schwangerschaft zur Zeugung, von Zeugung zu Geschlechtsorganen (siehe Tafel: Eingeweide des Menschen) und so weiter und so fort. Es wurde ein aufreibendes Studium. Doch am Ende meiner wissenschaftlichen Arbeit stand eine völlig nüchterne, sachliche Aufklärung dieser geheimnisvollen Zusammenhänge und gleichzeitig die Einsicht, wie nützlich und brauchbar ein Lexikon ist.
Die gute Tante war froh ein solches Lockmittel für ihr Nichtchen zu besitzen, und sie störte mich nicht, wenn ich mich darin vertiefte. Was allerdings dieses Interesse in mir erweckt hatte, erfuhr sie nie. Ich blätterte stets schleunigst um, wenn sie in meine Nähe kam und betrachtete die prächtigen farbigen Tafeln etwa der "Enten" oder der "Edelsteine" wenn ich mich mit dem Artikel "Embryo" befasste, dem ich mich erst wieder widmete, wenn sie sich entfernt hatte.
Es gab aber auch noch andere Anziehungspunkte bei ihr, die es bewirkten, dass ich sie oft und gerne besuchte. Sie hatte "die Welt" gesehen, war in Deutschland gewesen, wo sie Englisch, in der Schweiz, wo sie Französisch gelernt hatte. Wieso denn in Deutschland Englisch? Nun, in Karlsruhe, wo ihre Schwester Marie damals lebte, gab es ein Mädchenpensionat, das von vielen Engländerinnen, die dort Deutsch lernen wollten, besucht wurde. Sie sprachen natürlich untereinander Englisch und haben von der deutschen Sprache sicherlich wenig über den Kanal zurückgebracht! Meine Tante Resi aber gab sich ihnen gegenüber als Ungarin aus, die nur mangelhaft Deutsch verstehe, und veranlasste so die Engländerinnen mit ihr in deren Muttersprache zu sprechen. Die Anfangsgründe in Englisch hatte sie sich durch Privatunterricht schon in Schäßburg angeeignet. Und somit erreichte sie, was sie bezweckte: kam hinein in eine fließende Beherrschung dieser Sprache und konnte sie dann an ihre Schüler weitergeben. Freilich war es wohl das "beautiful old Queens-English", das sie dort lernte, sicherlich waren diese Internatsinsassinnen höhere Töchter aus besten Häusern, die sich einer vornehmen Aussprache bedienten, und meine Kinder lachen mich aus, wenn ich but wie böt ausspreche und much wie mötsch. Doch das stört mich wenig.
Und dann ging Tante Resi auch gern auf meine kindischen Spiele ein. Eines dieser Spiele ging so: Ich sagte: "Tante, ich zieh dich um"
"Das kannst du nicht!"
"Doch, das kann ich."
"Na, dann versuch's doch mal!"
Worauf ich ihre Hand fasste und so lange zog, bis sie am Boden lag (Dass sie sich selber fallen ließ, merkte ich natürlich, stieß aber dennoch ein Triumphgeheul aus, um sie nicht merken zu lassen, dass ich es gemerkt hatte).
Eine Schwäche hatte sie: Angst vor Mäusen. Wenn sie irgendwo eine rascheln hörte, stieg sie schreiend auf einen Stuhl. Nun hatte ich einmal ein graues Spielmäuschen bekommen, das auf Rädern lief. Und als Tante Resi uns besuchte, ließ ich es über den Fußboden laufen.
Da schrie sie auf, sprang auf den Stuhl, von dort auf den Tisch, konnte sich nicht beruhigen.
"Aber Tantchen" sagte ich. "komm doch herunter, das ist ja gar keine richtige Maus, nur eine Spielmaus, vor der brauchst du doch keine Angst zu haben".
"Ich habe ja auch keine Angst vor den Mäusen, aber ich ekle mich vor ihnen". Und sie stieg erst herunter, als ich die Spielmaus weggepackt hatte.
Diese Schwäche brachte mir die Tante noch näher. Nichts ist einem Kind ja angenehmer, schmeichelt seinem Selbstbewusstsein mehr, als wenn es sich den sonst immer so grenzenlos überlegenen Erwachsenen an einer Stelle selbst überlegen fühlt Aber ich habe sie geschont und die Spielmaus nie wieder in ihrer Gegenwart hervorgeholt.
In ihrem ganzen Leben ist sie nie krank gewesen. Darüber war sie aber als Kind gar nicht glücklich. Sie erzählte mir, dass sie ihre kränkliche Schwester Nelly immer beneidet habe, wenn die einmal im Bett liegen musste, von den Verwandten besucht wurde und von allen Seiten Geschenke bekam, während sich um sie, die gesunde Resi, kein Mensch kümmerte. Da habe sie einmal Nellys sämtliche Medizinfläschchen ausgetrunken — aber ohne den geringsten Erfolg.
Auch Tante Resi nahm ein trauriges Ende, wenn auch ein nicht ganz so trauriges wie ihre Schwester Nelly. Einige Jahre vor ihrem Tod verlor sie ihr Gedächtnis.
Es fing damit an, dass sie eines Tages, als sie nach Klausenburg fahren wollte, meine Mutter, die sie zur Bahn brachte, fragte: "Sag einmal, Lieschen, wohin will ich eigentlich fahren?" Meine Mutter war maßlos erschrocken. Wusste nicht, ob sie die Tante nicht lieber veranlassen sollte umzukehren. Entschloss sich schließlich dennoch, sie fahren zu lassen, da sie wusste, wie sehr Tante Resi an den Nachkommen ihrer verstorbenen Schwester hing.
Es war die letzte Reise der armen Tante. Ihr Zustand verschlimmerte sich immer mehr. Oft kam sie zu uns herüber und sagte: "Besucht mich doch! Seit die arme Nelly gestorben ist, fühle ich mich so einsam." — "Aber Tante", sagte ich einmal, "ich war doch vor einer Stunde bei dir!" — "Ja? Das weiß ich nicht" antwortete sie. Und eines morgens geschah es, dass sie im Unterrock und Nachtjacke auf die Straße ging, sich vor ihrem Haus aufstellte, die Taschenlampe anknipste und die Vorübergehenden fragte: "Wem gehört dieses Haus?" Ja selbst in einer Sitzung des Frauenbildungsvereins, dessen Vorsitzende sie war, soll sie einmal im Unterrock erschienen sein.
Schließlich fanden sich zwei Frauen, die sich in ihrer Betreuung abwechselten, so dass sie in ihrer Wohnung bleiben konnte. Auch die hat sie oft des Nachts geweckt mit den Worten: "Sie müssen aufstehn! Es ist schon spät!" Worauf sie dann nicht selten zur Antwort bekam: "Aber Fräulein Resi, es ist ja erst um zwei Uhr!"
Ein Schlagfluss hat dann ihrem Leben ein Ende gemacht. Sie ist sechsundsiebzig Jahre alt geworden.
So viel zu den Eltern und Geschwistern meines Bacongroßvaters. Und nun zu den Eltern und Geschwistern meiner Großmutter Elise Bacon geborene Reinhardt. Hier kommen wir in eine andere Welt.
Mein Urgroßvater Michael Reinhardt war Bäckermeister. Sein Haus stand in der Baiergasse unweit des kleinen Gässchens, dass keinen offiziellen Namen hat, aber im Volksmund "der Suezkanal" heißt. Es ist nur ein ganz schmaler Durchschlupf zwischen Mühlgasse und Baiergasse und spielt im Leben dieses meines Urgroßvaters insoweit eine Rolle, als es den Schauplatz für die bekannteste Anekdote bildet, die von ihm erzählt wird. Und es werden viele von ihm erzählt, denn er war ein Mann, der voller Späße und schnurriger Einfälle steckte, beseelt von echtem Schäßburger Humor. Dieser Humor hat seine Eigenart. Der "Schäßburger Gruß" ist im ganzen Sachsenland löblich bekannt. (Man kann ihn aber auch im "Götz von Berlichingen" nachlesen).
Also: Der alte Reinhardt kommt eines späten Abends heim (vermutlich aus dem Letjef, dem Gasthaus, doch das ist nicht überliefert) und da er ein menschliches Rühren spürt und nicht noch durch den dunklen Hof seines Hauses bis zum Schämpes, dem Plumpsklo, Vordringen will, das seiner Anrüchigkeit wegen in der äußersten hinteren Ecke seines Anwesens angebracht ist, wie in allen Bürgerhäusern Schäßburgs und auch sonst wo — stellt er sich also in besagtem Suezkanal an eine Häuserwand und lässt es tschorlen. Da legte sich ihm von hinten eine Hand auf die Schulter und eine Stimme sagt: "Herr Reinhardt, dat kost en Gälden!" Das kostet einen Güldener dreht sich um, sieht einen der Polizisten, die nachts durch die Straßen schlendern, um für Ruhe und Ordnung in dem schlafenden Städtchen zu sorgen und hoch erfreut sind, wenn sie endlich einmal jemanden bei einer verbotenen Handlung erwischen, weil sie ihn dann vorschriftsmäßig bestrafen und so die Nützlichkeit ihrer Existenz nachweisen können.
Doch damit bringt er den alten Reinhardt noch lange nicht aus der Fassung. Der gewinnt gelassen sein Budjilar (Geldbörse) aus der Tasche, zieht nicht nur einen blanken Gulden daraus hervor, sondern dazu noch ein Pizullchen (Groschen), drückt beide Geldstücke dem Ordnungshüter in die Hand und sagt: "Ich hun uch ene fohre lossen." Ich habe auch einen fahren lassen.
Auch so manchen Spaß erlaubte er sich. So z. B. hatten die Gräserischen in den letzten Dezembertagen ein Spanferkel gekauft, das sie als den traditionellen Neujahrsbraten am ersten Januar auf den Tisch bringen wollten, schön knusprig gebacken und mit einer Nuss im Maul, versteht sich. Das Ferkel wurde geschlachtet und in der Kammer an den Haken gehängt.