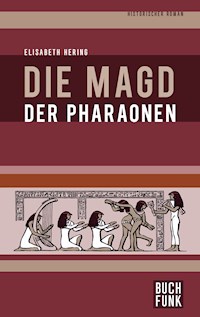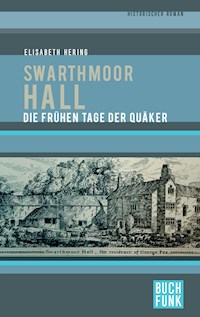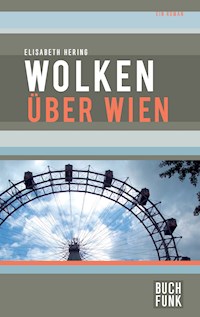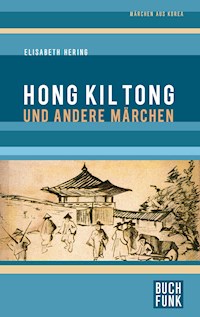Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BUCHFUNK Hörbuchverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Sammlung von 61 Volksmärchen schöpft aus dem reichen und fast schon vergessenen Fundus des deutschen Märchenschatzes, vereint besinnliche und heitere Stücke, Schabernack und Phantasie. Die Märchen sind voller Neugier auf das Leben und breiten vor uns einen ganzen Kosmos an Reichtum und Erfahrung aus. Das Böse ist niemals so böse, dass der Wille zum Guten und zur Gerechtigkeit es nicht überwältigen kann. Die Märchen öffnen Gestaltungsräume, sie zeigen, dass es möglich ist, Klugheit an die Stelle der Dummheit, Aufrichtigkeit an die Stelle der Lüge, Gutes an die Stelle des Bösen zu setzen. Sie sind natürlich, frisch und unmittelbar erzählt, voll echtem Gefühl und schlichter Schönheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 792
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
ELISABETH HERING
Kostbarkeiten aus dem deutschen Märchenschatz
Mit Illustrationen von Ingeborg Friebel
Elisabeth Hering wurde 1909 in Klausenburg, Siebenbürgen, geboren und wuchs in Schäßburg auf. 1943 musste die Autorin ihre Heimat verlassen und ließ sich nach mehreren Zwischenstationen in Leipzig nieder. Hering veröffentlichte 24 Bücher – darunter zahlreiche kulturhistorische Romane, populärwissenschaftliche Bücher und Erzählungen für Kinder.
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer schriftstellerischen Arbeit waren Nacherzählungen von Märchen, Sagen und Schwänken. Elisabeth Hering starb 1999 in Leipzig.
Die vorliegende Märchensammlung schöpft aus dem reichen und fast schon vergessenen Fundus des deutschen Märchenschatzes, vereint besinnliche und heitere Stücke, Schabernack und Fantasie. Sie ist voller Neugier auf das Leben und breitet vor uns einen ganzen Kosmos an Reichtum und Erfahrung aus. Das Böse ist niemals so böse, dass der Wille zum Guten und zur Gerechtigkeit es nicht überwältigen kann. Die Märchen öffnen Gestaltungsräume, sie zeigen, dass es möglich ist, Klugheit an die Stelle der Dummheit, Aufrichtigkeit an die Stelle der Lüge, Gutes an die Stelle des Bösen zu setzen. Sie sind natürlich, frisch und unmittelbar erzählt, voll echtem Gefühl und schlichter Schönheit. Es wird in ihnen eine Poesie vernehmbar, die Alt und Jung innerlich berührt und anrührt.
Das goldene Königreich
Ein reicher Mann hatte einen einzigen Sohn, den er so sehr liebte, dass er ihm keinen Wunsch abschlagen konnte. Eines Tages nun sagte der Jüngling zu seinem Vater: »Lieber Vater, mich leidet es nicht mehr zu Hause, ich habe Lust, mir die Welt zu besehen — lasst mich in die Fremde ziehen!«
Der Vater erschrak über diese Worte, denn es wurde ihm schwer, sich von seinem Sohn zu trennen. Als er aber sah, wie sehr dessen Augen vor Abenteuerlust brannten, erinnerte er sich an seine eigene Jugend — mit welcher Freude hatte er selbst doch dereinst die Welt durchzogen! —, und er gab seine Einwilligung, wenn auch traurigen Herzens. Zum Abschied schenke er seinem Sohn einen prächtigen Wagen mit zwei guten Pferden davor und einen Sack voll Goldstücke. Auch gab er ihm seinen treuesten Diener mit auf den Weg, der ihm versprochen hatte, seinen Herrn in keiner Gefahr zu verlassen.
So fuhr der Jüngling in die Welt hinaus.
Er hatte schon manches Land durchzogen und sich schon manche Stadt angesehen, als er eines Abends an einen großen Wald kam. Die Sonne ging unter, und es wurde dunkel und immer dunkler, sodass der Diener, der die Pferde lenkte, vom Wege abkam. Zum Glück erblickten sie in der Ferne ein schwaches Licht, auf das fuhren sie zu und kamen schließlich zu einem kleinen Häuschen, an dessen Türe sie pochten.
Eine alte Frau öffnete ihnen und ließ sie eintreten.
»Können wir bei Euch zur Nacht bleiben?« fragte der Jüngling, und die Frau antwortete freundlich: »Herzlich gern! Setzt Euch an meinen Tisch und lasst es Euch schmecken, ich werde Euch unterdessen ein Lager zurechtmachen.«
Die Frau brachte Speise und Trank herbei, und die beiden langten zu, denn sie waren tüchtig hungrig, und als sie gegessen und getrunken hatten, bekam jeder von ihnen ein gutes Bett, und sie waren auch so müde, dass sie sofort einschliefen.
Am nächsten Morgen stand die Sonne schon hoch am Himmel, als der Jüngling die Augen aufschlug. Er wusste nicht gleich, wo er war, aber als er aufstand und einen Blick durchs Fenster tat, sah er, wie sich die Waldbäume im leichten Winde bewegten, hörte ihre Blätter rauschen, hörte die Vögel in ihren Zweigen singen, und bald zog vor seinen Augen ein Rudel Rehe vorbei. Da ging ihm das Herz auf, und er beschloss, den schönen Wald so bald nicht wieder zu verlassen.
Die alte Frau tischte ihnen ein Frühstück auf, und der Jüngling brachte seinen Wunsch vor. »Der Wald gehört mir«, antwortete sie, »und Ihr könnt bleiben, solange Ihr wollt!«
»Oh«, rief er, »ich danke Euch sehr! Es soll auch, solange wie wir hier sind, Eurer Küche niemals an Wildbret mangeln. Ich kenne kein größeres Vergnügen, als auf die Jagd zu gehen.«
»Das mögt Ihr tun«, antwortete die Alte ernst, »doch rate ich Euch nicht dazu. Es hat schon mancher in diesem Walde einem Wild nachgestellt und den Weg zurück nicht wiedergefunden!« Aber der Jüngling ließ sich nicht abschrecken, ergriff seine Büchse und ging hinaus.
Da winkte die Frau den Diener heran und sagte: »Wenn dir das Leben deines Herrn lieb ist, so eile ihm nach! Denn nicht weit von hier ist eine Waldwiese, und wenn er die erreicht hat, werden drei schöne braune Hirsche vor ihm aufspringen. Sorge dafür, dass keine Kugel sie trifft, es wäre sein Verderben. Alles übrige Wild des Waldes mag er erlegen, nur keines dieser Tiere. Doch darfst du ihm nicht sagen, dass ich dich gewarnt habe, sonst ist es dein Tod.«
Der treue Diener dankte der alten Frau für ihren Rat und eilte hinter seinem Herrn her, so schnell ihn seine Füße trugen. Als er auf die Waldwiese kam, hielt der Jüngling das Gewehr bereits im Anschlag, und die drei Hirsche setzten eben nicht weit vor ihm über einen klaren Bach, der lustig über weiße Kiesel hüpfte. Da fiel der Diener seinem Herrn in den Arm, die Kugel fuhr in einen Baum, und die Tiere entsprangen.
Voll Zorn schrie der Jüngling: »Du Tollpatsch, was fällt dir ein? Noch nie sah ich Hirsche mit so prächtigem Geweih! Nun sind sie mir entkommen!«
»Ich stolperte über eine Baumwurzel!«, entschuldigte sich der Diener.
Sie gingen kreuz und quer durch den Wald, und der Jüngling erlegte noch manches Stück Wild. Aber Freude an der Jagd empfand er nicht mehr, denn die schönen Hirsche ließen sich nicht wieder blicken.
Als sie nach Hause kamen, war die alte Frau sehr froh, dass alles so gut abgelaufen war. Sie lobte heimlich den Diener, er habe seinem Herrn das Leben gerettet. Und sie brachte vom Besten zu essen und zu trinken.
Am nächsten Morgen griff der Jüngling wieder nach seinem Gewehr, um zur Jagd zu gehen. Da winkte die Alte dem Diener und raunte ihm zu: »An derselben Stelle werden heute drei schwarze Hirsche aufspringen und vor deinem Herrn herlaufen; sorge dafür, dass keine Kugel sie trifft, wenn dir sein Leben lieb ist — und verrate nicht, dass ich dich gewarnt habe, sonst bist du des Todes!«
Vergebens versuchte der Diener, seinen Herrn dazu zu bewegen, einen andern Weg einzuschlagen. Der Jüngling hatte nur die schönen Hirsche im Sinn und ließ sich nicht überreden, nach rechts oder nach links abzubiegen. So hatten sie die Waldwiese bald wieder erreicht, wo der klare Bach über die Kiesel sprang und die Vögel um die Wette ihre Lieder schmetterten. Und kaum standen sie an derselben Stelle, als es auch schon im Gebüsch raschelte und drei prächtige Hirsche — schwarz, wie der Nachthimmel — vor ihnen aufsprangen.
Der Jüngling hob das Gewehr und zielte. Aber in dem Augenblick, als sein Finger den Abzugshahn berührte, gab ihm der Diener von hinten einen Stoß, und die Kugel pfiff in die Luft.
»Kerl«, schrie der Jüngling, »was unterstehst du dich!« — »Herr«, entschuldigte sich der Diener, »eine Biene hat mich in die Hand gestochen, darüber bin ich vor Schreck aufgefahren.«
Der Jüngling war außer sich, dass ihm auch diese Tiere entsprungen waren, denn er hatte ihresgleichen in seinem Leben noch nicht gesehen. »Wenn so etwas noch ein einziges Mal vorkommt«, fuhr er den Diener an, »so gnade dir Gott. Denn dann wird meine nächste Kugel dich treffen -das kannst du mir glauben!«
Ohne Beute kehrte er diesmal aus dem Wald zurück, denn die Freude an der Jagd war ihm gründlich verdorben.
Aber die alte Frau war noch vergnügter und aufgeräumter, setzte den beiden das beste Essen und die köstlichsten Weine vor und sagte heimlich dem Diener, er habe seine Sache gut gemacht und seinem Herrn stehe ein großes Glück bevor.
Am nächsten Morgen konnte der Jüngling es kaum erwarten, auf die Jagd zu gehen; im ersten Dämmerlicht schon nahm er die Büchse von der Wand.
»Heute ist der gefährlichste Tag«, flüsterte die alte Frau dem Diener zu. »Wenn dein Herr einen der weißen Hirsche schießt, die vor ihm aufspringen werden, so ist er des Todes. Du aber verrate nicht, dass ich dich gewarnt habe, wenn dir dein Leben lieb ist.«
Voll Angst und Bangen begleitete der Diener seinen Herrn.
Er freute sich nicht am Gesang der Vögel, nicht am Morgenrot, das durch die Bäume schimmerte, denn eine trübe Ahnung beklemmte sein Herz. Umsonst versuchte er, den Jüngling vom Wege zur Waldwiese abzubringen — der hatte nur seine drei Hirsche im Sinn und ließ sich nicht beirren.
Und er hatte sich in seiner Hoffnung auch nicht ge-täuscht. Kaum hatte er die Wiese erreicht, kaum stand er am Ufer des Baches, als auch schon drei prächtige Hirsche vor ihm über das Wasser setzten. Und nicht braun waren sie, nicht schwarz, sondern weiß — strahlend weiß wie der helle Tag. Er hob die Büchse und schoss. Doch im selben Augenblick, wie der Schuss sich löste, erhielt er abermals von seinem Diener einen Stoß, dass die Kugel ins Blaue fuhr und die Tiere entsprangen.
»Nichtswürdiger!« schrie er außer sich vor Zorn. »Das sollst du mir büßen!«
Der Diener fiel auf die Knie und flehte um sein Leben. Umsonst. Die Wut raubte dem Jüngling die Besinnung — er zielte und schoss, und der treue Diener sank tot zu Boden.
Als der Jüngling sich aber seiner Tat bewusst wurde, als er den Menschen entseelt vor sich liegen sah, der ihn von Ort zu Ort begleitet und ihm unzählige Dienste geleistet hatte — da erfasste ihn eine wilde Verzweiflung. Er stürzte fort von der Stelle der grausigen Tat und eilte zu dem Waldhäuschen zurück, denn er hoffte, bei der freundlichen alten Frau Trost zu finden — vielleicht sogar Hilfe. Aber das Haus war leer. Niemand ließ sich darin blicken, soviel er auch rief. Da sattelte er eines seiner Pferde und sprengte davon, ohne auf Weg und Steg zu achten.
Der Wald wurde dichter und dichter, der Tag ging zur Neige, und er begegnete keiner menschlichen Seele. Er ritt bei Sternenlicht weiter und dachte nicht an Schlaf, achtete auch nicht dessen, dass Hunger und Durst ihn quälten.
Endlich, im Morgengrauen, lichtete sich der Wald, und er kam zu einer Wiese, wo er eine Quelle rauschen hörte. ›Hier kann ich wenigstens meinen Durst stillen‹, dachte er und stieg vom Pferd, beugte sich über das Wasser, fing es in der hohlen Hand und trank.
Als er sich wieder aufrichtete, fiel sein Blick auf drei Mädchen, die plötzlich, wie aus der Erde gewachsen, vor ihm standen. Eine war schöner als die andere, aber ihre Augen funkelten zornig.
»Du hättest uns erlösen können!« riefen sie ihm zu wie aus einem Munde, »dann wärest du jetzt mit uns im goldenen Königreich! Aber durch deine unselige Tat hast du alles verdorben, und wir müssen zurück in das verzauberte Schloss, und die Stunde unserer Befreiung ist ferner als je!«
Da fiel der Jüngling vor ihnen auf die Knie. »Oh, sagt mir, was ich tun kann, um meine Schuld zu sühnen! Gern will ich dann alles erdulden, alles erleiden, was über mich verhängt wird!«
»Dir zu sagen, was du tun sollst, ist uns nicht erlaubt«, antworteten sie traurig. »Selbst musst du den Weg suchen, selbst die Tat finden, die uns Erlösung bringt. Doch wollen wir dir beistehen, so gut wir es vermögen.«
Die Älteste gab ihm ein scharfes Schwert, dem nichts widerstehen konnte, die Mittlere einen Geldbeutel, der nie leer wurde, die Jüngste aber, die die Schönste war, reichte ihm einen goldenen Ring und lächelte ihm zu. Da erfasste ihn eine tiefe Liebe, und er schwor sich, Blut und Leben dran zu wagen, sie zu erwerben. Im nächsten Augenblick aber waren die Schwestern verschwunden.
Trotzdem beseelte ein frischer Mut sein Herz. Von Neuem schwang er sich auf sein Ross und galoppierte davon — selbst seinen Hunger hatte er vergessen.
Er war noch nicht lange geritten, als er vor sich ein fürchterliches Brüllen hörte. Und als er näher kam, gewahrte er einen Löwen, der mit einem gräulichen Lindwurm im Kampfe lag. Der Wurm hatte sich um den Leib des Löwen geschlungen und fauchte ihn mit seinem giftigen Atem an, dass dem Löwen all seine Kraft nichts half, da er schon fast die Besinnung verloren hatte.
Bei dem furchtbaren Anblick blieb des Jünglings Pferd stehen, seine Flanken zitterten, und es wollte keinen Schritt mehr vorwärts tun. Da sprang er ab, trat an den Lindwurm heran und tat einen gewaltigen Hieb, der dem Ungeheuer den Schweif vom Rumpfe trennte. Das abgehauene Stück fuhr mit solcher Gewalt in die Äste einer Eiche, dass sie absplitterten, wie wenn ein Knabe eine Gerte knickt. Der Jüngling aber holte zum zweiten Schlag aus und hieb dem Lindwurm den Kopf ab.
Nun schüttelte sich der Löwe und befreite sich aus der furchtbaren Umklammerung. Und er bezeigte dem Jüngling seinen Dank auf seine Art — machte gewaltige Freudensprünge, legte dann seinen Mähnenkopf an des Jünglings Beine und folgte ihm schließlich auf Schritt und Tritt wie ein großer treuer Hund.
Da sah der Jüngling, dass er sich auf sein Schwert verlassen konnte, und die Zuversicht wuchs in seinem Herzen. Gestärkt setzte er seinen Weg fort.
Manchen Tag, manche Woche ritt er fürbass, bis er schließlich an ein großes Wasser kam, das sich endlos vor seinen Augen ausbreitete. Das Ufer war öde und trostlos. Lange musste er suchen, bis er eine menschliche Behausung fand.
Es war die Hütte eines Schiffers, die er endlich erblickte. Er ließ seine Tiere draußen und trat ein. Der Schiffer war zu Hause und aß seine Abendsuppe.
»Was ist dies für ein Wasser?« fragte der Jüngling, »und wie komme ich zum goldenen Königreich?«
»Ihr seid am Meer Irrewellen«, antwortete der Schiffer. »Wer Euch aber geraten hat, das goldene Königreich zu suchen, der hat Euch einen argen Dienst erwiesen. Denn dieses liegt jenseits dreier Meere und jenseits dreier öder, unwegsamer Länder. Und selbst wenn Ihr gut über die Meere kämet, von denen eines immer wilder und gefährlicher ist als das andere, wie wollt Ihr die Länder durchqueren? Sie sind von Riesen bewohnt — von bärenstarken Ungeheuern, die von jedem, der durch ihr Land will, einen Fuß oder eine Hand als Zoll verlangen. Darum rate ich Euch, kehret um, ehe es zu spät ist!«
»Vor den Riesen ist mir nicht bange«, antwortete der Jüngling. »Aber übers Meer hinüber müsstet Ihr mich bringen, denn ich habe kein Schiff!«
»Nun, wenn Ihr es nicht anders wollt«, erwiderte der Schiffer, »so werde ich die Fahrt mit Euch machen. Erst aber stärkt Euch an Speise und Trank und bleibt bei mir zur Nacht.«
Das ließ sich der Jüngling nicht zweimal sagen, denn er hatte seit Wochen keine gekochte Speise mehr genossen und in keinem Bett mehr geschlafen.
Am nächsten Morgen betrat der Jüngling mit seinem Pferd und seinem Löwen das Schiff. Sie stießen vom Ufer ab, und der Wind blies in die weißen Segel, dass der Bug die Wellen durchschnitt und sie auf dem Wasser dahinschossen wie ein Pfeil, der von der Sehne schnellt.
Das Fahren machte den Jüngling fröhlich, er stimmte ein Lied an. Aber bald erstarben ihm die Töne auf den Lippen, denn der Himmel verfinsterte sich, und der Wind wurde heftiger und heftiger. Er schwoll zum Sturme an und warf das Schiff hin und her. Trotzdem ließ der Jüngling den Mut nicht sinken, und nach einiger Zeit erhellte sich der Himmel wieder, und sie erreichten das jenseitige Gestade bei freundlichstem Sonnenschein.
Da dankte der Jüngling dem Schiffer und gab ihm reichlichen Lohn. Dann stieg er mit seinen Tieren an Land.
Er hatte sich aber noch nicht aufs Pferd geschwungen, als sich in der Ferne ein fürchterlicher Lärm erhob, der näher und näher kam. Drei Riesen verursachten ihn. Mit langen Schritten liefen sie auf ihn zu, erhoben drohend ihre schweren Eisenkeulen und schrien, da er ihr Land betreten habe, müsse er ihnen seine linke Hand als Zoll lassen.
»Nur immer sachte«, gab der Jüngling zurück. »Das letzte Wort zwischen uns ist noch nicht gesprochen!« Und er zog sein Schwert und schlug mit einem einzigen Hieb zweien von ihnen den Kopf ab, und auf den Dritten stürzte sich der Löwe und verschlang ihn mit Haut und Haar.
So konnten sie ungehindert durch der Riesen Land ziehn. Der Weg führte sie durch dunkle Wälder und über öde Heiden, und sie begegneten keiner lebenden Seele. Deshalb freute sich der Jüngling, als er am Abend des dritten Tages wieder an das Ufer eines Meeres kam und nach langem Suchen endlich die Hütte eines Schiffers fand. Dieser hatte das Pferdegetrappel schon von Weitem gehört, stand vor der Türe, begrüßte freundlich den Reiter und lud ihn zum Essen ein. Das nahm der Jüngling mit Dank an, denn er hatte auf dem ganzen Weg durch der Riesen Land keine andere Nahrung gefunden als Wurzeln, Kräuter und Beeren.
Als sie bei Tisch saßen, fragte der Jüngling, wie denn das große Wasser heiße und wo das goldene Königreich zu finden sei. »Dieses Wasser ist das Meer Grausam«, antwortete der Schiffer, »und wer Euch ins goldene Königreich geschickt hat, wollte Euer Bestes wahrhaftig nicht! Denn Ihr müsst noch über zwei Meere fahren und zwei Länder durchqueren, und wenn die Wellen Euch nicht verschlingen, so werden die Riesen, die diese Länder bewohnen, Euch Hände und Füße abhauen. Das ist der Zoll, den sie von jedermann verlangen, der ihr Land betritt.«
»Vor den Riesen ist mir nicht bange«, antwortete der Jüngling, »wenn Ihr mir nur übers Wasser helfen wollt!« — »Das ist keine Kleinigkeit«, erwiderte der Schiffer, »denn das Meer ist, wie sein Name sagt, grausam und wild und sucht alles zu verschlingen, was auf ihm schwimmt und schwebt. Ich habe es nur ein einziges Mal überquert, und dabei hätte ich beinahe Schiffbruch erlitten. Doch wenn Ihr keine Angst habt, will ich es wohl ein zweites Mal wagen.«
So bestieg denn der Jüngling mit seinen Tieren am nächsten Morgen das Schiff, die Segel schwellten sich im Winde, und sie glitten über die Wellen, als flögen sie dahin.
Doch der Wind wurde heftig und immer heftiger, er wuchs an zum Sturm, schwarze Wolken zogen am Himmel auf, Blitze zuckten und schlugen ins Wasser ein, Donner grollte, und haushoch gingen die Wogen. Sie packten das Schiff wie mit weißen Fäusten und warfen es herum, dass dem Schiffer Hören und Sehen verging. Doch als er verzagen wollte, nahm ihm der Jüngling das Steuer aus der Hand, trotzte dem Sturm und den Wellen und führte das Schiff sicher und gewandt, als sei er sein Leben lang zur See gefahren. Da hellte sich der Himmel wieder auf, der Sturm legte sich, und sie kamen ans andere Ufer.
Hier gab der Jüngling dem Schiffer reichlichen Lohn, und der kehrte um. Kaum aber war er abgefahren, als sich auch schon ein Geschrei erhob und sechs riesige Kerle mit schweren Eisenkeulen auf den Jüngling losstürmten. »Deine Hand!« schrien sie, »deine rechte Hand wollen wir als Zoll dafür, dass du unser Land betreten hast!«
»Holla!« sagte der Jüngling, »das sind mir ja gastfreundliche Sitten! Aber kommt nur her, ihr sollt haben, was euch gebührt!« Und sein Schwert sauste aus der Scheide, und vier Köpfe rollten in den Sand. Auf die beiden letzten Riesen aber stürzte sich der Löwe und fraß sie auf mit Haut und Haaren. So hatten sie auch durch das zweite Riesenland freien Durchzug, und sie trabten über Heiden und durch Wälder, bis sie am Abend des sechsten Tages wieder am Ufer eines Meeres standen.
Auch fanden sie das Haus eines Schiffers, der sie gastfreundlich aufnahm und bewirtete. »Was ist dies für ein Meer?« wollte der Jüngling wissen, »und wie komme ich zum goldenen Königreich?« — »Das Meer heißt Das Allerschlimmste, und noch kein Schiff hat es bezwungen, denn die Stürme, die darauf toben, sind gar zu arg. Und dahinter liegt das Land der Riesen, die niemanden durchlassen, es sei denn, sie schlügen ihm erst Hände oder Füße ab. Und erst wenn Ihr das Land der Riesen durchquert habt, kommt Ihr zum goldenen Königreich - wahrhaftig, wer Euch geraten hat, es zu suchen, hatte Übles mit Euch im Sinn!«
»Vor den Riesen furchte ich mich nicht«, sagte der Jüngling, »wenn Ihr mich nur übers Wasser bringen wolltet!« — »Dazu ist mir mein Schiff und mein Leben zu lieb«, erwiderte der Schiffer.
Aber der Jüngling bat und bettelte, und als er sah, dass schöne Worte allein nicht halfen, zählte er aus dem Beutel, der niemals leer wurde, ein Goldstück nach dem anderen auf. Dem Schiffer gingen die Augen über. Noch nie hatte er einen solchen Haufen Geldes beisammen gesehen! So willigte er schließlich ein, die Fahrt zu wagen. Er machte sein Schiff flott, der Jüngling bestieg es mit seinen Tieren, und sie fuhren bei gutem Wind ab.
Als sie aber auf hoher See waren, erhob sich plötzlich ein Orkan, als ob die Welt untergehen wolle. Turmhohe Wellen stürzten über dem Schiff zusammen, um es zu begraben, Blitze fuhren in seine Masten und zersplitterten sie, der Sturm fetzte die Segel entzwei, und das Fahrzeug war dem Wüten der Naturgewalten schutzlos preisgegeben.
Der Schiffer sah schon sein letztes Stündlein gekommen, er bebte und jammerte und fluchte und wusste sich nicht zu helfen. Aber der Jüngling verlor selbst in dieser höchsten Gefahr seinen Mut nicht. Er nahm das Steuer in die Hand und stand aufrecht und trotzte dem Sturm und den Wellen, und siehe da, ebenso plötzlich, wie sich der Orkan erhoben hatte, legte er sich wieder, und das Schiff erreichte bei strahlendem Sonnenschein das jenseitige Ufer. Hier gab der Jüngling dem Schiffer noch reichlicheren Lohn und riet ihm, an Land zu gehen und erst seine Masten und Segel wieder in Ordnung zu bringen, ehe er die Heimreise wage. Doch der meinte, immer noch lieber wolle er in einem beschädigten Schiff dem Toben der Stürme ausgeliefert sein — als den Unholden, denen das Land gehöre. Und er setzte ein Notsegel und fuhr zurück.
Das Schiff aber hatte sich noch keinen Steinwurf weit vom Ufer entfernt, als auch schon neun Riesen mit großem Geschrei auf den Jüngling zustürmten. Sie fuchtelten mit ihren Eisenkeulen herum und brüllten: »Deine Füße, Erdenwurm, deine Füße musst du uns lassen als Zoll, weil du es wagtest, in unser Land einzudringen!«
»Wenn ihr meine Füße haben wollt«, rief der Jüngling, »so müsst ihr näher herankommen!« Und er zog sein Schwert.
Die Kerle erhoben ein Wutgeheul, als sie sahen, dass er ihnen zu trotzen wagte—aber es dauerte nicht lange, da waren sie verstummt. Sieben von ihnen hatte er die Köpfe abgeschlagen, und mit den beiden Letzten hatte der Löwe seinen Hunger gestillt.
Und nun ging der Weg weiter über Heide und Moor, durch Wald und Dickicht. Er schien kein Ende nehmen zu wollen.
Aber als der Jüngling neun Tage geritten war, ohne einer lebenden Seele zu begegnen, und schon ganz matt war, da er nichts anderes fand, seinen Hunger zu stillen, als Wurzeln und Kräuter und Beeren, sah er endlich von ferne die Zinnen und Mauern einer Stadt aufragen, und sie blitzten und blinkten im Sonnenlicht wie lauteres Gold. Da gab er seinem Pferde die Sporen, und in kurzer Zeit hatte er die Stadt erreicht. Im ersten Wirtshaus, das ihm am Wege lag, kehrte er ein, und als er sich an Speise und Trank erlabt hatte, fragte er den Wirt, ob er hier wohl im goldenen Königreich sei. Der Wirt bejahte seine Frage, und der Jüngling rief: »O wie glücklich müsst Ihr doch sein, in einem so herrlichen Lande zu leben!«
»Ja«, antwortete der Wirt ernst, »es hat eine Zeit gegeben, da waren wir alle hier sehr glücklich, denn unser König regierte mild und weise über das Land, und seine Frau und die drei schönen Prinzessinnen waren nicht stolz und hoffärtig, sondern hatten selbst für den ärmsten Bettler ein freundliches Wort. Doch als der König starb, wollte ein böser Zauberer seine Witwe heiraten, und als die sich weigerte, verwünschte er das Schloss mit allen seinen Bewohnern — niemand vermag seine Tore zu öffnen, und wer darinnen ist, liegt stumm und starr und kann sich nicht regen noch bewegen.«
»Und ist keine Rettung möglich?«
»Doch, sie ist möglich! Alle sieben Jahre einmal dürfen Königin und Prinzessinnen das Schloss verlassen und nach einem Erlöser Ausschau halten. Niemals jedoch ist es einem Sterblichen gelungen, die Prüfungen zu bestehen, die ihm auferlegt werden.«
Tief bewegt fragte der Jüngling: »Aber wenn einer, der bei der ersten Prüfung versagte, sich nicht entmutigen lässt und hierherkommt über Land und Meer ...« — »Ja, dann«, gab der Wirt zurück, »wenn der Jüngling kommt, dem die jüngste Prinzessin ihren Ring geschenkt hat, und wenn er mit dem rechten Wagen und mit den rechten Pferden zum Schlosse fährt — dann wird sich das Tor vor ihm auftun und der Zauber gebrochen sein!«
Laut schlug das Herz des Jünglings vor Freude, und atemlos fragte er: »Und der rechte Wagen, die rechten Pferde — wie sollen sie aussehen?« — »Das kann Euch niemand sagen«, erwiderte der Wirt, »weil niemand es weiß.«
Am nächsten Morgen ging der Jüngling in die Stadt und kaufte einen schönen braunen Wagen, dazu zwei feurige braune Hengste, dingte sich Diener, die er in braune Livreen steckte, kleidete auch sich selbst vom Scheitel bis zur Sohle in braunes Tuch und fuhr zu dem verzauberten Schloss. Hier öffnete sich vor ihm das Tor, und er gelangte in den Schlosshof. Doch der war öde und verlassen, keine lebende Seele ließ sich darin erblicken, und alle Türen und Fenster des Schlosses waren und blieben versperrt.
Endlich entdeckte der Jüngling ein zweites Tor, das ebenfalls offenstand, und er dachte, dort müsse der Eingang zu einem zweiten Hofe sein. Deshalb befahl er dem Kutscher hindurchzufahren. Aber kaum hatte der Wagen das Tor passiert, als es mit lautem Knall zuschlug und sie sich wieder alle außerhalb der Schlossmauer befanden.
Da wusste der Jüngling, dass er nicht mit dem rechten Wagen und den rechten Pferden gefahren war.
Deshalb kaufte er am nächsten Tag einen Wagen, so schwarz wie der Nachthimmel, und spannte vier Rappenhengste davor, an denen auch nicht ein einziges helles Haar zu finden war. Und seinen Dienern ließ er schwarze Livreen anmessen und kleidete auch sich selbst vom Scheitel bis zur Sohle in schwarzen Samt. Und in diesem Aufzug fuhr er zum Schloss.
Wieder öffnete sich vor ihm das Tor und ließ ihn in den Schlosshof einfahren, und die Fenster des Schlosses standen alle offen. Aber keine lebende Seele zeigte sich, und auch die Türen blieben geschlossen. So fuhren sie durch das zweite Tor wieder hinaus, und seine Flügel schlugen krachend hinter ihnen zusammen.
›Also habe ich den rechten Wagen immer noch nicht gefunden‹, dachte der Jüngling, ›und auch nicht die rechten Pferde!‹
Am nächsten Tag kaufte er eine Kutsche, die war schneeschloßenweiß, dazu sechs Schimmel, deren Fell glänzte wie der helle Tag, und war kein dunkles Haar an ihnen zu finden. Und seine Diener steckte er in weiße Livreen, und auch sich selbst kleidete er vom Scheitel bis zur Sohle in schimmernde weiße Seide.
Als er sich nun dem Schloss näherte, sprangen alle Tore und Türen und Fenster vor ihm auf, und aus den Kanonen bollerten Freudenschüsse, und an den Masten flatterten bunte Fahnen, und aus den Fenstern lehnten sich Menschen und warfen ihm Blumen entgegen. Und im Schlosshof stand die Königin — keine andere war es als die freundliche alte Frau aus dem Waldhäuschen - mit ihren drei Töchtern, von denen eine immer schöner war als die andere.
Die Königin trat auf ihn zu und reichte ihm die Hand. »Du hast uns erlöst«, sagte sie, »nun darfst du dir eine der Prinzessinnen wählen und mit ihr Hochzeit halten und König sein in diesem Reich.«
»Da nahm er die jüngste Prinzessin bei der Hand und sagte: »Die mir ihren Ring gab, der gehört mein Herz! Aber«, setzte er hinzu, »Hochzeit werde ich nicht eher feiern, als bis ich meine unselige Tat gesühnt habe! Erst muss mein treuer Diener, den ich im Zorn getötet habe, wieder zum Leben erweckt werden, denn vorher kann ich nicht glücklich sein.«
Da leuchteten die Augen der jüngsten Prinzessin auf, und sie sprach: »Wenn du das nicht gesagt hättest, so hätte ich dich niemals lieb haben können. Nun aber will ich mit dir gehen und dir helfen, das Wasser des Lebens zu suchen, damit wir den Treuen vom langen Todesschlaf wecken.«
»Da braucht ihr nicht weit zu suchen«, sagte die alte Königin. »Der Brunnen mit dem Wasser des Lebens steht hier im Schlosshof. Er war versiegt während unserer langen Verzauberung, aber nun füllt er sich wieder. Nur den Leichnam des Dieners musst du herbeischaffen!«
Da hob der Löwe, der unterdessen still zu seines Herrn Füßen gelegen hatte, den Kopf und sah den Jüngling mit so sprechenden Augen an, als wolle er sagen: »Ich hole ihn!« und er sprang auf und lief in mächtigen Sätzen davon.
Wie er über die drei Meere kam — ob er einen Schiffer fand, der ihn hinüberbrachte, oder ob er sie durchschwamm —, das weiß ich nicht zu sagen. Genug, nach einer Zeit kehrte er zurück und brachte des Dieners Leichnam, und der Jüngling schöpfte vom Wasser des Lebens und besprengte ihn, sodass der treue Diener wieder zu atmen anfing und die Augen aufschlug. Da umarmte ihn der Jüngling voller Freude, und er bat ihn mit Tränen in den Augen um Verzeihung.
Dann streichelte er des Löwen Fell. »Wie soll ich dir danken, du braves Tier?« fragte er. »Mein Lebtag hätte ich nicht froh und glücklich sein können mit dieser Blutschuld auf dem Gewissen!«
»Wenn du mir danken willst«, antwortete zum Staunen aller der Löwe mit menschlicher Stimme, »so ziehe dein Schwert und schlage mir den Kopf ab.« — »Um Gottes willen!« rief der Jüngling entsetzt. »Soll ich noch einmal treue Dienste mit Undank lohnen? Nie mehr im Leben will ich dergleichen tun!«
Aber die alte Königin legte sich ins Mittel. »Erfülle getrost seine Bitte«, sagte sie, »du wirst es nicht bereuen.«
Da zog der Jüngling das Schwert aus der Scheide und schlug dem Tier das Haupt ab.
Und ein Donnerschlag erscholl, und ein stattlicher junger Mann stand statt des Löwen vor dem erstaunten Jüngling. »Auch ich war verzaubert«, sagte er, »und auch mich hast du erlöst!«
Und der Löwenjüngling freite die mittlere Prinzessin und der vom Tode errettete Diener die älteste. Und die dreifache Hochzeit, zu der auch der alte Vater des Jünglings herbeigeholt wurde, dauerte viele Tage. Als aber der Jubel und Trubel schließlich ein Ende genommen hatte, zog die älteste Prinzessin mit ihrem Gatten in das Land der drei Riesen und die mittlere mit dem ihren in das Land der sechs Riesen und viel Volks mit ihnen. Und die Meere, über die sie fahren mussten, hatten ihren Schrecken verloren und trugen geduldig die vielen Schiffe von einem Ufer zum andern.
Da wurden die öden Heiden fruchtbar gemacht, und anstelle wilder Wälder erhoben sich bald schmucke Städte und Dörfer.
Der Jüngling aber blieb mit der schönsten und jüngsten Prinzessin im goldenen Königreich, und er regierte weise und gerecht auch über das Land der neun Riesen und machte sich keine Feinde, sodass er sein Schwert nicht mehr zu ziehen brauchte. Und wenn das Wasser im Brunnen des Lebens nicht versiegt ist, so regiert er heute noch, und nur das Schwert wird, weil es nicht mehr benutzt wurde, im Laufe der Zeit verrostet und zerfallen sein.
Wer ist am pfiffigsten?
Ein reicher Kaufmann hatte einen einzigen Sohn, an dem er von ganzem Herzen hing, und er kannte nur eine Sorge, nämlich wie er das Glück und den Reichtum seines Kindes für alle Zukunft sichern könne.
Als der Sohn erwachsen war, schickte ihn der Vater nach London. Denn dort, so meinte er, seien die reichsten Kaufleute der Welt beisammen, die ihn lehren könnten, Schätze anzuhäufen und ein prunkvolles Leben zu führen. Und unter ihren Töchtern solle er sich eine Braut suchen, die ihm an Mitgift wenigstens so viel einbringe, wie er selbst schon besitze. Er gab ihm auch Empfehlungen an seine Geschäftsfreunde mit, die dem Sohn eines vermögenden Vaters mit Freuden ihre Häuser öffnen würden.
Nun wollte es aber das Schicksal, dass der Jüngling sich nicht in eine der reichen Erbtöchter verliebte, sondern in ein ganz armes Mädchen, das ihm eines Tages auf der Straße begegnete. Sie trug schlichte Arbeitskleidung und schleppte sich ab mit einem Bündel Holz, ihr Gesicht aber war so lieblich, dass der junge Kaufmannssohn meinte, ein schöneres habe er all sein Lebtag nicht gesehen. Er folgte ihr nach durch Straßen und Gassen, bis sie in eines der düsteren Vorstadthäuser eintrat.
Durch das Fenster konnte er beobachten, wie sie Feuer anschürte, und als ihr Gesicht von der roten Flamme angeleuchtet wurde, kam es ihm noch schöner vor.
Dann wandte sie sich einer alten Frau zu, die in einem Winkel des Zimmers auf einem Strohsack lag, strich ihr liebevoll über die kraftlosen Hände, beugte sich dann über sie und flößte ihr Medizin ein. Und der Kaufmannssohn konnte nicht an sich halten, trat in die Stube und machte sich mit ihr bekannt.
Nicht lange dauerte es, da wusste er, dass er sie und keine andere zur Frau nehmen wollte. Als er aber um sie anhielt, sagte sie: »Ich kann meine alte kranke Mutter nicht verlassen!« — »Oh, das soll kein Hindernis sein«, meinte er eifrig, »deine Mutter soll mit uns in meine Heimat kommen und es so gut bei uns haben wie meine eigene!« — »Ich kann es ihr nicht zumuten«, antwortete sie, »diese Stadt zu verlassen, in der sie jung gewesen und alt geworden ist. Du weißt, dass sich ein alter Baum nicht mehr verpflanzen lässt!«
Da versprach er ihr, in London ein Haus zu kaufen.
Sein Vater war freilich wenig erbaut davon, dass der Sohn eine Braut erwählt hatte, die ihm keinen roten Heller Mitgift zubrachte, und noch weniger davon, dass er ihr zuliebe nicht in die Heimat zurückkehren wollte. Er machte ihm daher Vorhaltungen aller Art, aber der Jüngling ließ sich nicht zum Nachgeben bewegen, sodass der Vater schließlich doch einwilligen musste.
Die Londoner Kaufleute spotteten über diese Heirat, und das um so mehr, als es sie wurmte, dass der Kaufmannssohn dieses arme Ding ihren reichen, stolzen Töchtern vorgezogen hatte. Am meisten jedoch ärgerte es sie, dass mit der jungen Frau das Glück in des Jünglings Haus eingezogen war, denn sie war ebenso gütig, wie sie schön, und ebenso treu, wie sie gütig war, sodass seine Liebe zu ihr nicht erkaltete, sondern sich im Gegenteil von Jahr zu Jahr nur noch steigerte. Unter den reichen Kaufleuten nun, die bei ihrer Brautschau mehr auf die Höhe der Mitgift als auf die Herzenseigenschaften ihrer zukünftigen Gattinnen gesehen hatten, gab es manchen, der unter den Launen eines hässlichen Zankteufels zu leiden hatte und den Jüngling um seine schöne, liebenswürdige Frau beneidete.
Besonders einer war da, dessen Habgier so groß gewesen war, dass er mit hunderttausend goldenen Dukaten ein schieläugiges ältliches Weib in Kauf genommen hatte, und der nun nicht genug über das junge Ehepaar lästern konnte.
»Diese hübschen Weiberchen«, sagte er eines Tages höhnisch. »Man kennt das ja! Erst spiegeln sie dem Mann, den sie umgarnen wollen, ihre Tugend in den leuchtendsten Farben vor, und wenn sie den Gimpel dann endlich zum Traualtar geschleppt haben, können sie die Gelegenheit nicht erwarten, ihn zu betrügen.« — »Was du da sagst«, gab der junge Mann ruhig zurück, »mag auf die Frauen passen, mit denen du dich abgegeben hast — auf meine passt es nicht! Für ihre Treue lege ich die Hand ins Feuer!«
»Nur nicht zu schnell - du könntest dich verbrennen! Ich setze mein Vermögen gegen das deine, dass ich sie herumkriege, wenn du sie auch nur für vier Tage allein lässt!« — »Topp, es gilt!« rief der Ehemann. »Nicht für vier Tage — für acht werde ich sie verlassen. Und du wirst sehen, dass sie mir auf diese Weise durch ihre Tugend so viel einbringen wird, wie es dir gelungen ist, durch Geiz und Habgier in einem Leben zusammenzuraffen.«
Mit dieser Abmachung trennten sie sich, und der junge Kaufmann eilte nach Hause und erzählte alles gleich seiner Frau. Der stieg die Zornröte ins Gesicht, als sie von dieser unverschämten Herausforderung hörte, und sie sagte: »Du kannst ruhig verreisen, Lieber, ob du vier oder acht Tage ausbleibst oder vier oder acht Jahre, ich werde dir treu sein, solange ich lebe!« — »Ich weiß es!« antwortete er.
Der alte Heimtücker aber hatte sich eine List ausgedacht. Er ging zu der Frau eines Hafenarbeiters, die vor ihrer Verheiratung eine Zeit lang im Hause des Ehepaares gedient und sich das Vertrauen ihrer Herrin erworben hatte, und sagte: »Willst du dir tausend Gulden verdienen?«
Tausend Gulden! Das war so viel Geld, wie die ehemalige Dienstmagd es sich gar nicht auf einem Haufen vorstellen konnte. Dennoch sagte die Frau, die ein durch und durch redlicher Mensch war: »Ich will es — aber nur, wenn es auf ehrliche Weise geschehen kann!«
»Auf durchaus ehrliche Weise«, gab der Kaufmann scheinheilig zurück. »Ich habe eine Truhe, die ich gerne für eine Nacht im Schlafzimmer meines Freundes unterstellen möchte. Es geht um eine Wette, weißt du, die wir abschlössen, als wir bei Laune waren. Sage deiner ehemaligen Herrin, du müssest kurz verreisen, und bitte sie, eine Truhe, in der du deine Ersparnisse eingeschlossen habest, von einem Tag zum andern aufzubewahren. Ich stelle dir dann zwei Männer zur Verfügung, die diese Truhe hinbringen und wieder abholen werden.«
Nachdem der reiche Mann die tausend Gulden in blanken Goldstücken vor ihren Augen ausgebreitet und ihr ein ums andere Mal versichert hatte, es handle sich nur um einen Scherz und es werde weder dem jungen Herrn noch seiner Frau auch nur ein Haar gekrümmt, ließ sich die Arglose überreden, und es geschah alles so, wie der Heimtücker es geplant hatte.
Die junge Frau mochte ihrer ehemaligen Magd die geringfügige Gefälligkeit nicht ausschlagen. Wusste sie doch, wie schwer es war, Ersparnisse zu machen für einen Menschen, der von seiner Hände Arbeit leben musste.
So ließ sie die Truhe in ihr Schlafzimmer stellen und riegelte, ehe sie zu Bett ging, sorgfältig alle Türen zu.
In der Truhe aber war nichts anderes drinnen als der böse reiche Mann selbst. Er wartete eine Weile, bis er sicher war, dass alles im Hause schlief, dann sperrte er den Truhendeckel von innen auf und stieg langsam, jedes Geräusch vermeidend, heraus. Da der Mond ins Zimmer schien, war es hell genug, dass er sein Vorhaben ausführen konnte.
Die Lieblichkeit der schlafenden Frau rührte ihn nicht. Er betrachtete ihren Körper nur, um zu sehen, ob er nicht irgendwo ein Erkennungszeichen entdecken könne, und richtig, er fand ein braunes, sichelförmiges Mal auf ihrer rechten Schulter und sah, dass ihre linke kleine Zehe etwas schief stand. Dann ließ er seine Blicke im Zimmer umherschweifen und erspähte auf ihrem Nachttisch mehrere Ringe, die sie sich vor dem Schlafengehen vom Finger gestreift hatte. Einen davon nahm er an sich und stieg in die Truhe zurück. Am nächsten Morgen kamen seine Diener und holten die Truhe wieder ab. Die Frau hatte kein Arg — selbst den Verlust ihres Ringes bemerkte sie nicht.
Als der junge Kaufmann nach einigen Tagen zurückkehrte, kam seine Frau ihm heiter entgegen und sagte, noch ehe er eine Frage tat: »Der Kerl hat es nicht einmal gewagt, sich auch nur bei mir sehen zu lassen!« Und ein Blick in ihre Augen genügte ihm, um zu wissen, dass sie die Wahrheit sprach. So ging er in bester Laune hinüber zum Hause des Mannes, der ihm die Wette angeboten hatte.
Der saß an einer langen Tafel und schmauste und trank mit einer ganzen Anzahl geladener Gäste.
»Nun könnte ich dich von Haus und Hof vertreiben!« rief der junge Mann ihm mit blitzenden Augen entgegen. »Hast du dich doch nicht einmal getraut, meiner Frau unter die Augen zu treten! Doch wenn du zugibst, dass du nicht erlangen konntest, wessen du dich so frech gebrüstet hast, will ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen!« — »Gemach, gemach«, sagte der niederträchtige Mensch und streifte den vor ihm Stehenden mit einem schrägen Blick. »Hat nicht deine Frau ein braunes sichelförmiges Mal auf ihrer rechten Schulter, und steht nicht die kleine Zehe ihres linken Fußes etwas schief?«
Der junge Ehemann wurde bleich wie eine Wand, und es war ihm, als wanke der Boden unter seinen Füßen. »Das«, stotterte er mit rauer Stimme, »das hat dir der Teufel gesagt.« — »Derselbe Teufel«, lachte der alte Heimtücker, »der mir auch diesen Ring hier zum Andenken schenkte, nachdem wir eine halbe Nacht lang miteinander gekost hatten.« Und er hielt dem jungen Ehemann den Ring unter die Nase, den er seiner Frau entwendet hatte.
Da hatte der Arme genug gesehen und gehört. Er stürzte zur Tür hinaus, und das boshafte Gelächter, das sich hinter ihm erhob, traf ihn wie ein Peitschenhieb.
Als die Frau seine Schritte hörte, kam sie ihm, wie sie es gewohnt war, voll Freude entgegen, er aber stieß sie zur Seite und eilte an ihr vorbei und ins Haus hinein. Bestürzt über sein so völlig verändertes Wesen ging sie ihm nach und sah, dass er seinen Koffer, der noch unausgepackt im Zimmer stand, zur Hand nahm und Anstalten machte, damit das Haus zu verlassen. Da stellte sie sich ihm in den Weg und rief in höchster Angst: »Wohin willst du denn gehen?« — »Fort aus diesem Hause, fort aus dieser Stadt, fort von dir, so weit mich meine Füße tragen!« — »Aber warum denn nur, warum?« Tränen erstickten ihre Stimme. »Das fragst du auch noch, du Schamlose?« antwortete er, und er schlug ihr ins Gesicht, dass sie mit einem Aufschrei zu Boden sank und er an ihr vorbei zur Türe hinausschreiten konnte. Und als die Frau wieder zu sich kam, wusste sie, dass ihr Gatte das Haus verlassen hatte, um es nie wieder zu betreten.
Da erfasste die Unglückliche eine grenzenlose Verzweiflung. Ihr ganzes Leben schien ihr sinnlos geworden zu sein, und es fehlte nicht viel, so hätte sie es von sich geworfen. Aber nach einer in Kummer und Tränen durchwachten Nacht fasste sie den Entschluss, sich aufzumachen und ihren Gatten zu suchen, und wenn sie wandern müsste bis ans Ende der Welt. Auf ihre Mutter musste sie keine Rücksicht mehr nehmen, denn die war schon vor einigen Jahren gestorben.
Sobald der Morgen dämmerte, legte sie Männertracht an, steckte das Kleid, das sie angehabt hatte, als ihr Mann sie verließ, in einen kleinen Koffer, dazu Wäsche und das Bargeld, das sie besaß, und machte sich auf den Weg. Und als der reiche Kaufmann, der die Wette gewonnen hatte, kam, fand er das Haus leer und nahm von ihm Besitz. Die arme Frau aber ging zum Hafen und fand ein Schiff, das nach Holland segeln wollte, und mit diesem setzte sie über auf den Kontinent.
In Amsterdam verdingte sie sich bei einem berühmten Arzt, zu dem viele Leute von nah und fern kamen, um sich heilen zu lassen. Sie stellte sich bei allen Handreichungen sehr geschickt an, sodass der Arzt ihr großes Vertrauen schenkte und sie mit der Zeit in alle Geheimnisse seiner Kunst einweihte. Doch so sehr sie gehofft hatte, von einem der vielen Menschen, die den Arzt aufsuchten, etwas über ihren Gatten zu erfahren — es verging ein Jahr ums andere, ohne dass ihr jemand hätte Auskunft geben können.
In drei Jahren aber hatte sie so viel gelernt, dass sie ihren Lehrmeister sogar noch übertraf. Da nahm sie Abschied von ihm, um selber als Arzt durch aller Herren Länder zu ziehen in der Hoffnung, eines Tages den Aufenthaltsort ihres Mannes zu entdecken.
Sie reiste durch Frankreich und Spanien, durch Italien, Österreich und Deutschland. Und obgleich sie nirgendwo auch nur eine Spur des Gesuchten finden konnte, verlor sie doch den Mut nicht, sondern fuhr von Stadt zu Stadt, und der Ruf ihrer Kunst begleitete sie; denn sie kannte die Heilkräfte vieler Pflanzen und besaß Salben und Tränklein gegen mancherlei Gebrechen.
So kam sie auch nach Dänemark und ließ sich für einige Zeit in Kopenhagen nieder.
Nun hatte der König von Dänemark einen Feldmarschall, der an einer hartnäckigen und quälenden Krankheit litt und schon viele Ärzte umsonst bemüht hatte. Der suchte sie auf, und es gelang ihr, ihn zu heilen. Darüber war der Feldmarschall so froh, dass er sie sofort zum Generalstabsarzt der ganzen dänischen Armee ernannte.
»Gut«, sagte die Kaufmannsfrau, »dann will ich einen Soldaten um den andern, ob krank oder gesund, untersuchen, denn solange ich Generalstabsarzt bin, darf es in der Armee keine Kranken geben.« Sie tat das aber in der Hoffnung, auf diese Weise endlich ihren Gatten zu finden.
Und diesmal hatte ihre Hoffnung sie nicht getrogen. Nach einigen Wochen stand ein Soldat vor ihr, eingefallen und abgemagert, in schlechter, schäbiger Montur — und doch erkannte sie ihn auf den ersten Blick, und ihr Herz schlug ihr bis zum Halse. Er aber erkannte sie nicht in ihren Männerkleidern und mit dem falschen Bart, den sie sich ans Kinn geklebt hatte.
»Deine Krankheit kann ich nicht heilen«, sagte sie, nachdem sie ihn gründlich untersucht hatte, »denn es ist keine Krankheit des Körpers, sondern eine der Seele. Ein geheimer Kummer nagt an deinem Herzen, und erst wenn du mir den Grund dieses Kummers anvertraust, kann ich versuchen, dir zu helfen.«
Da fasste der Mann Vertrauen zu dem fremden Arzt und erzählte ihm, worüber er noch mit keinem Menschen gesprochen hatte, dass er eine schöne Frau besessen habe, auf deren Treue er felsenfest gebaut, und dass sie ihm bei der ersten Gelegenheit, da er sie einmal für acht Tage allein gelassen habe, mit einem reichen Kaufmann untreu geworden sei.
»Und ist es nicht möglich, dass du dich irrst«, fragte sie und hatte Mühe, ihre Erregung zu unterdrücken, »dass du ihr Unrecht tust?«
»Das ist nicht möglich. Denn dieser Kaufmann schilderte mir ihre geheimsten Merkmale und zeigte mir den Ring, den sie ihm zum Andenken geschenkt hatte und den ich als den ihren erkannte.«
Nun hatte die Frau genug gehört, und sie versprach dem Soldaten, ihn ganz gewiss zu heilen, nur sei das eine langwierige Sache, und deshalb wolle sie ihn bei sich und unter ihrer Beobachtung behalten. Und so bat sie sich ihn vom General zu ihrem Diener aus.
Nach einer Weile verlangte sie Urlaub für mehrere Monate, der ihr auch ohne Weiteres gewährt wurde. Sie fand ein Schiff, das nach London ging, und reiste mit dem Diener in ihre alte Heimat, und dem wurde ganz eigen ums Herz, als sie die Themse hinauffuhren und er von Weitem die Türme der großen Stadt aufragen sah, wo er so glücklich und so unglücklich gewesen war.
Wie aber schlug erst sein Herz, als er eine Droschke holte und hörte, dass der Arzt dem Kutscher die Adresse seines ehemaligen Hauses angab. »Was soll das werden?« dachte er beklommen, als er das Gepäck verstaut hatte und sich neben dem Kutscher auf dem Bock niederließ.
Der reiche Kaufmann hatte das Haus, das er durch die Wette gewonnen hatte, bezogen, da es schöner und prächtiger war als sein eigenes. Und er empfing den fremden Arzt, der ihm Empfehlungsschreiben der angesehensten Männer vorwies, sehr zuvorkommend und bat ihn, solange er in London zu bleiben gedenke, sein Gast zu sein.
»Trage alle Koffer auf mein Zimmer«, sagte daraufhin die Frau zu ihrem Diener, »und packe sie aus bis auf den kleinen grauen. Den darfst du nicht öffnen, denn dort sind so scharfe Gifte, dass jeder, der nicht damit umzugehen versteht, sich den Tod holen kann.« Es waren aber gar keine Gifte darin, sondern das Kleid, das die Frau an dem Tag angehabt hatte, als ihr Mann sie verließ.
Der junge Arzt hatte sich durch sein angenehmes Wesen bald die Zuneigung des reichen Kaufmannes erworben, der ihm zu Ehren ein Fest gab und seine Freunde dazu einlud.
Es ging dort hoch her, die Tische bogen sich unter der Fülle der Speisen, der Wein floss in Strömen, und der Gastgeber trank Brüderschaft mit seinem Gast.
Der Diener des Arztes kannte fast jeden der Anwesenden, und er wäre am liebsten in der Küche geblieben und hätte sich bei der Tafel gar nicht gezeigt. Der Arzt aber rief ihn zu sich, er musste hinter seines Herrn Stuhl stehen und ihm eingießen, sooft er es verlangte. Seine Angst, erkannt zu werden, war jedoch unbegründet, denn Kummer und Krankheit hatten ihn so verändert, dass keiner der vielen Gäste auf den Gedanken kam, in dem verhärmten Soldaten den ehemals so fröhlichen jungen Kaufmann zu suchen.
Als die Feststimmung auf dem Höhepunkt angelangt war, machte der Arzt den Vorschlag, es solle jeder aus seinem Leben die pfiffigste Tat erzählen.
»Dann will ich der Erste sein!« rief der reiche Kaufmann, der schon ein wenig angeheitert war, laut aus. »Und ich wette hundert goldene Dukaten, dass sich an Pfiffigkeit keiner mit mir messen kann!« — »Und ich der Zweite!« sagte der Arzt. »Und ich setze mein ganzes Vermögen gegen deine hundert Dukaten, dass ich dich übertreffe.« Da freute sich der alte Heimtücker, dass er auf so leichte Art auch das Vermögen seines neuen Freundes sollte an sich bringen können, denn es schien ihm ohne jeden Zweifel zu sein, dass er die Wette gewinnen werde. Und er erzählte, wie er den jungen Kaufmann, dessen Haus er nun bewohnte, überlistet habe.
Dem Diener, der hinter des Arztes Stuhl stand, krampfte sich das Herz zusammen.
»Das hast du pfiffig genug angestellt«, antwortete der Arzt, als der Kaufmann seine Erzählung beendet hatte. »Und es wird nicht so leicht für mich sein, dich zu überzeugen, dass ich noch pfiffiger war. Aber ich hoffe, es wird mir doch gelingen, du musst mir nur einen kleinen Augenblick Zeit lassen.«
Damit ging die Frau rasch auf ihr Zimmer, riss sich den falschen Bart ab, zog sich das Kleid an, dass sie in ihrem grauen Koffer verborgen hatte, und kam so nach kurzer Zeit wieder in den Saal zurück.
Dort entstand große Bewegung, als man sie kommen sah, denn viele der Anwesenden erkannten sie wieder, sie aber verschaffte sich mit einer Handbewegung Ruhe und sagte zu dem reichen Kaufmann: »Ich bin die Frau, der du so übel mitgespielt hast! Und dort (sie machte eine Handbewegung zu dem Diener hin) steht der Mann, der an meiner Treue zweifelte und den deine eigenen Worte nun von meiner Unschuld überzeugt haben. Jetzt urteile selbst, wer von uns beiden pfiffiger war!«
Da musste der boshafte Kaufmann das Vermögen, das er mit seiner schändlichen Tat an sich gebracht hatte, wieder herausgeben und verlor alle Achtung bei seinen Mitmenschen, sodass kein Hund mehr ein Stückchen Brot von ihm nahm und er nicht lange danach vor Wut und Ärger gestorben ist. Das Glück der beiden Menschen aber, die so lange Zeit das bitterste Leid umeinander getragen hatten, wurde jetzt erst vollkommen.
Das Geschenk der Tiere
Ein armer Sauhirt hatte einen Sohn namens Valentin, den er zu einem Metzger in die Lehre gab, weil er wollte, er solle eines Tags ein besseres Leben haben und nicht bei Sturm und Regen, bei Hitze und Kälte um geringen Lohn anderer Leute Schweine hüten müssen.
Als der Junge ausgelernt hatte und Geselle geworden war, musste er auf die Wanderschaft gehen. Eines Tages führte ihn sein Weg durch einen großen Wald. Da hörte er von Weitem ein Geschrei und fand, als er näher kam, vor einem gefallenen Ochsen vier Tiere, einen Löwen, einen Windhund, einen Falken und eine Biene, die stritten sich, welches Stück jedes von ihnen bekommen sollte. »Willst du unser Schiedsrichter sein?« fragten sie den Metzgergesellen.
»Herzlich gern«, antwortete der, zerlegte, wie er es gelernt hatte, den Ochsen in seine Teile, gab der Biene den Kopf, dem Falken die Eingeweide, dem Windhund die Schenkel und dem Löwen den Rumpf.
Die Tiere waren des zufrieden und sagten: »Nun sollst du auch deinen Lohn haben. Gold und Silber können wir dir zwar nicht geben, aber wir verleihen dir die Gabe, die Gestalt eines Löwen oder eines Windhundes, eines Falken oder einer Biene anzunehmen, sooft du das wünschest.«
Darüber war Valentin hoch erfreut. Mit herzlichen Dankesworten schied er von ihnen und setzte seinen Weg fort.
Es dauerte nicht lange, da kam er in eine Stadt, größer und schöner, als er je zuvor eine gesehen hatte. Er ging straßauf und straßab, bewunderte die prächtigen Häuser, die stolzen Türme, die hohen Kirchen und gelangte schließlich vors Königsschloss. Um dieses herum aber war eine mächtige Mauer gezogen, und man sagte ihm, dass dort niemand hineinkomme, der nicht zum königlichen Hofstaat gehöre. ›Das wollen wir ja sehn!‹, dachte der Bursche, wünschte sich, ein Falke zu sein (und war's auch schon beim bloßen Gedanken), und flog über die Mauer. Hier kam er in einen überaus herrlichen Garten, in dem bunte Blumen blühten und dufteten und das köstlichste Obst reifte: Zitronen und Orangen, Pfirsiche und Aprikosen, Weintrauben und Honigbirnen. Ja, sogar zwei Granatapfelbäume erblickte er, aus deren grünem Laub die gelben Früchte leuchteten wie kleine Sonnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!