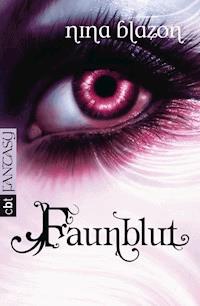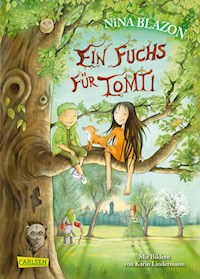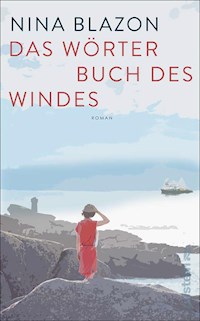6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Auf dem Nachhauseweg von einem Club wird Zoë auf der Straße angegriffen. Von wem, weiß sie nicht - ein Blackout hat ihr Gedächtnis gelöscht. Doch an ihren Händen klebt fremdes Blut. Der gut aussehende Gil, den sie aus der Szene kennt, ahnt, dass etwas Unheimliches mit ihr vorgeht: In Zoë schlummert das Erbe der Panthera, eines uralten Volkes, das unerkannt unter den Menschen lebt. Aber sie ist nicht die Einzige ihrer Art, die von ihrer Raubtiernatur getrieben die Straßen der nächtlichen Metropole durchstreift ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum
Als Ravensburger E-Bookerschienen 2010Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2010 Ravensburger Verlag GmbHAlle Rechte dieses E-Booksvorbehalten durchRavensburger Verlag GmbHISBN 978-3-473-38393-1www.ravensburger.de
Wir verteidigen.Niemals töten wir Angehörige unserer Art.Unser Sein ist geheim, unser Platz der Schatten, das Schweigen.Wir weichen oder nehmen uns den Raum.Jeder für sich, keiner für alle.Aber alle schützen das Geheimnis unserer Art.Gesetz der Panthera
Zeichen
Sie tanzte direkt unter dem Stroboskop, im Lichtgewitter. Und wie sie tanzte! Selbstvergessen, mit geschlossenen Augen. Das war kein gutes Zeichen. Es konnte bedeuten, dass sie zwinkerte und sich plötzlich an einem anderen Tag wiederfand, an einem anderen Ort, mit anderer Musik. Mit einem Muskelkater im Kiefer und braunen Krusten unter den Fingernägeln.
Wie alt war sie? Sechzehn, vielleicht siebzehn. Etwas jünger als ich jedenfalls. Mädchen wie sie sollten um zwei Uhr morgens zu Hause sein und unruhig von der Mathearbeit am nächsten Tag träumen. Ich wusste nicht, wie sie es geschafft hatte, ins Mata Hari zu kommen. Vielleicht hatte der Gorilla an der Tür sie wegen der Prügelei einfach übersehen. Klein genug war sie. Ich bin kein Riese, aber sie ging mir höchstens bis zur Schulter. Sie war eines dieser zierlichen Mädchen mit Schneewittchenfarben. Eine von denen, die in jeden vergifteten Apfel beißen. Allerdings sah sie nicht so aus, als würde Gift sie so schnell umbringen.
Ich bemühte mich, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich sie unentwegt ansehen musste. Aber wenn man schon vor sich selbst Ausreden dafür braucht, dass die Gedanken zu flirren beginnen, die Farben plötzlich stärker werden und die Tanzfläche leer erscheint bis auf diese eine Frau, dann ist das ebenfalls ein schlechtes Zeichen. Jedenfalls bei mir.
Hör auf sie anzustarren, befahl ich mir. Verschwinde! Besser für sie. Und für dich.
Aber mein Körper gehorchte nicht. Ich nahm jede kleine Einzelheit wahr: ihr Haar, das ihr glatt und schwarz über den Rücken fiel, die langen Wimpern und die feine Linie der Wangenknochen. Sie hatte etwas Sanftes in ihren Zügen, das mich berührte – ich spürte ein warmes Pochen unter dem Rippenbogen, dort, wo manchmal auch der Schmerz saß. Sie trug weiße Jeans und ein weißes T-Shirt, auf dem ein tellergroßer roter Punkt prangte – mitten auf der Brust. Japan-Fan? Meine Sehnsucht danach, sie einfach anzusprechen, wurde gerade noch rechtzeitig von einer Welle aus Besorgnis verdrängt. Lass sie. Es geht dich nichts an. Und du gehst sie nichts an. An dieser Stelle war ich fast erleichtert, mir einreden zu können, dass es Mitleid war. Nur Mitleid, Gil!Keine Gefahr für dich.
Mann, sie hatte wirklich keine Ahnung.
Die Art, wie sie im Schwung der Musik ihr Haar nach hinten warf, die Unruhe, die die Luft zwischen uns nicht nur im Rhythmus der Musik pulsieren ließ – all das machte es mir unmöglich, mich abzuwenden. Selbst im abgehackten Stroboskop-Licht, wo alle Tänzer wie eine Serie von Schnappschüssen wirkten, war ihre Bewegung gleitend. Sie bewegte sich schneller als die anderen, nur wusste sie es nicht. Und das war eindeutig ein schlechtes Zeichen Nummer drei.
Jetzt kam fließendes Licht, violett, es verwandelte ihre Lippen in dunkles Purpur. Und als ein Typ sie anrempelte und sie endlich die Augen öffnete und ihn mit einer Mischung aus träge aufquellender Wut und Verwirrung anblickte, hielt ich den Atem an. Die Tanzfläche kochte und mir war plötzlich kalt.
Alles verändert sich. Damit fängt es an. Die Muskelspannung, die verhaltene Reizbarkeit. Und die Herzfrequenz.
»French!«, brüllte Irves gegen den Beat an. Widerwillig wandte ich mich von der Tanzfläche ab und sah zu ihm hinüber. Irves lehnte nie an einem Tresen. Er stand aufrecht, alles an ihm war vibrierende Energie, nur sein Gesicht blieb unbewegt. Im Lounge-Licht glühte sein weißes Haar violett, und auch die Augen, bei Tag von einem rötlichen Hellgrau, hatten Farbe: der Geistermann in seinem Reich der Nacht. An seiner Seite sah ich aus wie sein Negativ: Dunkel neben Hell, Schwarz neben Weiß. Zwei Schachfiguren, die auf verschiedenen Seiten spielten. Einen Moment lang dachte ich, dass Schneewittchen und er ein gutes Paar abgeben würden. Die Schöne und das Biest, Manga-Style. Dieser Gedanke gefiel mir ganz und gar nicht.
Er ruckte mit dem Kinn zur Tür, die Pantomime einer Frage, und ich schüttelte den Kopf, drehte der Tanzfläche den Rücken zu und stützte mich auf den Tresen. Licht spiegelte sich auf der mit Colaringen übersäten Glasplatte. Ich konnte jetzt nicht gehen. Noch nicht.
Ich wünschte mir, Irves würde einfach verschwinden, ohne Fragen zu stellen. Aber er hatte seine Antennen ausgefahren. Wenn er mitschwang, fing er Stimmungen auf, er folgte Blicken, als würden sie Laserspuren im Raum hinterlassen. Die Leute um ihn herum wichen ihm unwillkürlich aus. Wenn er tanzte, gab er den Takt an. Alpha-Beat.
Er warf einen abschätzenden Blick zu den Tänzern, mit schlafwandlerischer Sicherheit entdeckte er das Mädchen und musterte es von oben bis unten. Ich biss die Zähne zusammen, als er mir wissend zugrinste und die Augenbrauen hob.
Sobald er sich zu mir beugte, konnte ich ihn wahrnehmen: Facetten verschiedener Gerüche. Am deutlichsten der trockene, staubige Geruch des Pelzkragens, Ambra und ein herber Ton zwischen Haut und Leder, dunkel, gefährlich und warnend. Das war die Botschaft, die ihm die Straßen frei hielt.
»Na, einen Läufer gefunden?«, brüllte er mir ins Ohr. »Wie heißt sie?«
Ich zuckte mit den Schultern. Irves’ Grinsen bekam etwas Freundliches. Zu freundlich.
Mist.
»Kleine Jagd?«, schrie er gegen die dröhnenden Bässe an.
Ich atmete tief durch.
»Hast du deine Zunge verschluckt?« Sein Grinsen wurde noch breiter. »Was meinst du, würde sie es über die Brücke schaffen?«
Die Wut kam ganz plötzlich, eine heiße, geballte Faust im Magen. »Arschloch!«, zischte ich ihm zu.
Irves lachte und klopfte mir gönnerhaft auf die Schulter. Ich hasste es, berührt zu werden. Genau wie er. Aber das Spiel, das wir beide gerade spielten, war ihm den Verstoß gegen die Regeln unseres Miteinanders wohl wert. Er wandte sich ab und ging: vierzehn verschiedene Geruchsfacetten, die im Nebel aus Schweiß und stechenden Deodorants davontrieben.
Als ich das nächste Mal den Blick hob, war Irves schon bei der Tür. Um ihn herum sah ich verschwitzte Haare an Stirnen kleben und glänzende Oberlippen, nur Irves störte die Hitze nicht. Zwei bullige, unrasierte Kerle beobachteten ihn, blieben aber, wo sie waren.
Für Irves begann die Nacht, Zeit für die nächste Bar. Vermutlich das Exil. Es gab nur wenige Clubs, wo die Boxen erträglich sauber klangen und nicht übersteuerten.
Sobald er verschwunden war, öffnete ich die Fäuste wieder, atmete. Jetzt war es auch für mich Zeit zu gehen und noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Immerhin fing meine Schicht in den Verladehallen des Großmarkts schon in drei Stunden an.
Aber da war immer noch das Mädchen. Verrückt. Es sollte mich nichts angehen. Das war die erste Lektion, die der Kodex in jede Faser meines Hirns gebrannt hatte: Jeder ist allein.
Aber trotzdem musste ich sie wenigstens noch einmal ansehen. Ein Blick nur, flüsterte ich mir selbst zu. Vielleicht ein Lächeln. Ich drehte mich um, kniff die Augen zusammen und suchte die Tanzfläche ab. Schneewittchen war nicht mehr da. Auch nicht am Tresen oder bei den fluoreszierenden Plastikwürfeln, die als Tische dienten.
Deshalb war Irves also so schnell aufgebrochen! Er hatte gesehen, dass sie die Tanzfläche verlassen hatte, und war ihr gefolgt.
Ich spürte kaum, wie ich die Leute anrempelte, als ich mich zur Tür durchkämpfte. Noch hatte ich die besonderen Merkmale des Mädchens nicht aufgenommen, noch konnte ich sie nicht aus der Masse herauslesen und musste mit den Augen suchen.
Der Lärm blieb hinter mir zurück, während ich die Treppe hochhetzte. Nur noch dumpf klopften die Bässe im Zwerchfell. Nachtluft wehte Zigarettenqualm in den Vorraum, den Gestank der Abgase und den Geruch von Wasser und Märzwind. Noch bevor ich aus der Tür rannte, zog ich mir die Silikonkegel aus den Ohren. Der jetzt ungefilterte Lärm traf mich wie ein Hieb. Die Sirene eines Krankenwagens, in der Nähe des Denkmals, hinter dem Hotel. Das harte Stakkato von hohen Absätzen auf Asphalt und irgendwo unter mir das Surren der U-Bahn-Räder auf den Gleisen.
Einer der Türsteher beobachtete misstrauisch, wie ich den Kopf schüttelte, als hätte ich Wasser in die Ohren bekommen. Aber dann war der Gesang der Stadt mit einem Mal nur noch Hintergrundrauschen. Das Mädchen lief gerade über die Straße. Sie ging mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf, die Ampel sprang schon wieder auf Rot. Und hinter ihr: Irves. Sein langer, heller Mantel war fast bis zum Rücken geschlitzt, die Schöße flatterten.
»Hey, warte mal!«, rief er über die Straße.
Sie fuhr herum, direkt bei der Ampel, und beobachtete mit unbewegter Miene, wie Irves über Rot zu ihr spurtete. In diesem Augenblick verstand ich, womit sie meinen Blick auf sich gezogen hatte: Sie war nicht nur zum Tanzen unterwegs gewesen. Sie war ausgegangen, um zu vergessen. Ihre ganze Haltung, sogar das Misstrauen in ihren Augen, die Feindseligkeit darin spiegelte ein kaum verheiltes Leid wider. Sie war wütend und traurig und sie litt an etwas – oder an jemandem? Diesen Ausdruck kannte ich nur zu gut – oft genug sah ich ihn im Spiegel.
Ich zuckte zusammen, als zwei Autos gleichzeitig loshupten wie verrückt. Ein Taxi nickte bei einer Vollbremsung, doch Irves war schon über die Straße. Er sprang auf den Gehsteig und war mit einem Satz bei dem Mädchen.
»Hier, das hast du verloren«, sagte er und hielt ihr ein Plastikmäppchen hin. Vielleicht eine Monatskarte für den Bus. Leuten im Vorbeigehen Dinge zu klauen war einer von Irves’ leichtesten Tricks. Wo hatte er ihr das Mäppchen abgenommen? Im Gewühl im Vorraum vielleicht, in der Sekunde, in der sie ein letztes Mal zur Tanzfläche zurückblickte oder in Gedanken schon auf der Straße war.
Offensichtlich vergaß sie ihr Misstrauen für einen Moment. Ihre Augenbrauen zuckten nach oben. Sie nickte knapp und nahm das Mäppchen hastig an sich.
Die Fußgängerampel sprang wieder auf Grün. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, über die Straße zu gehen und Irves in die Quere zu kommen. Wenn er vorhatte…
Nein, nicht jetzt, beruhigte ich mich. Nicht hier. Das ist nur Show. Eine kleine Vorstellung für den Zauderer French, der um eine Fremde so viel Angst hat, als wäre sie sein Mädchen.
Irves machte keine Anstalten zu gehen. Er sah das Mädchen in stummer Erwartung an, mit einem Blick, dem sie sich kaum entziehen konnte. In solchen Momenten erschien er sogar mir einige Jahre älter, als er in Wirklichkeit war. Ich wette, auch das Mädchen schätzte ihn auf über zwanzig, aber wahrscheinlich war auch diese zur Schau getragene erwachsene Ruhe Teil des Auftritts. Ich konnte sehen, dass allein sein Aussehen sie neugierig machte. Was sicher nicht nur an seinem Auftreten lag. Man sieht schließlich nicht jeden Tag einen Albino-Asiaten.
»Danke«, sagte sie schließlich. »Muss mir runtergefallen sein.«
Ich hatte erwartet, dass ihre Stimme hell und sanft klingen würde, aber sie war dunkel und voll, mit vielen Schatten. Ich war froh, dass sie Irves auf Distanz hielt.
Irves’ Blick löste sich nicht von ihr, aber ich wusste, dass er mich ganz genau wahrnahm: French, der mit geballten Fäusten auf der anderen Straßenseite stand. Ich begriff, dass er das Theater hier nur für mich spielte. Das Stück hieß: Locken wir den weichherzigen Algerier mal wieder aus der Reserve. Mühsam verkniff ich mir einen gezischten Fluch.
Irves holte eine Packung Zigaretten hervor und hielt sie ihr hin, doch sie lehnte mit einem Kopfschütteln ab. Das Schnappen seines Feuerzeugs, ein roter Punkt, der aufglühte. Dabei rauchte Irves überhaupt nicht. Die Zigaretten waren Schnickschnack, ein Spielzeug, mit dem er Leute lockte. Damit gewann er Zeit für ein Gespräch und gab vor, zu ihnen zu gehören: Der Abgedrehte mit dem Mantel, der Geistermann.
»Ich bin übrigens Irves«, sagte er nun in ihr Schweigen hinein.
Sprich nicht mit ihm!, hätte ich ihr am liebsten zugerufen. Lass ihn stehen und geh heim!
»Zoë«, erwiderte sie nach einer Weile. »Aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, das hast du sicher schon gelesen.« Sie hielt das Mäppchen hoch.
»Zoë«, wiederholte Irves so betont, als würde er mir das Wort vor die Nase halten, damit ich es von allen Seiten betrachten konnte. Jetzt erst warf er mir einen triumphierenden Blick über die Straße zu. »Schöner Name. Französin?«
Er lachte und ich musste tief Luft holen, um ruhig zu bleiben. Weil ich an die Brücke dachte, daran, dass Irves fähig war, Dummheiten zu machen, einfach um mich zu provozieren. Und weil das Rot der Ampel vor meinen Augen bereits zu verblassen begann. Grauschleier legten sich darüber. So fing es meistens an. Ich ballte die Hände zu Fäusten, bis meine Fingernägel in meine Handflächen drückten. Ja, auf diese Art war es auszuhalten.
Als hätte sie meine Angst gespürt, schweifte ihr Blick zu mir. Mein erster Reflex war, mich im Schatten der Mauer zu verbergen, aber dann fiel mir ein, dass sie mich ja gar nicht kannte. Alles, was sie sehen würde, war ein schwarzhaariger junger Typ mit dunkler Lederjacke, der sich in der Nähe des Clubeingangs herumdrückte. Vielleicht würde sie mich für einen Dealer halten.
»Bist du öfter hier?«, fragte Irves.
Sie blickte zu ihm zurück. »Warum willst du das wissen?«
»Habe dich hier noch nie gesehen.«
»Natürlich nicht«, gab sie trocken zurück. »Du hast mir gerade meinen Schülerausweis zurückgegeben, schon vergessen? Und der Club ist erst ab achtzehn.«
Sie wandte sich ab und ging – in Richtung Norden. Ich biss mir auf die Lippe. Norden war nicht gut. Zumindest nicht um zwei Uhr morgens.
Irves sah ihr nach, während sie mit großen Schritten davonging über die Verkehrsinsel, die nächste Ampel. Ich war mir nicht sicher, was er tun würde. Nord oder Süd? Langsam wandte er sich mir zu. Die angerauchte Zigarette flog in eine Pfütze und erlosch. Irves beobachtete mich, offenbar zufrieden. Und ich kämpfte. Ampel auf Grau, erhöhte Herzfrequenz.
Ruhig durchatmen!, befahl ich mir. Meine Schultern entspannten sich. Irves lachte, als hätte er einen großartigen Witz gemacht, dann kam er über die Straße direkt auf mich zu. Eine Pfütze zersplitterte unter seinem Schritt und fing gleich darauf wieder die Lichter der Stadt ein.
»Ganz ruhig, French«, sagte er im Vorübergehen. »Hast du wirklich gedacht, ich rühre deine Kleine an?«
»Gil heiße ich!«
Ein träges Schulterzucken. »Na schön, Gil. Was ist jetzt? Kommst du mit?«
Ich schüttelte den Kopf. Irves folgte meinem Blick in Richtung Nordstadt.
»Tu, was du nicht lassen kannst«, meinte er nur. »Aber komm Maurice nicht in die Quere. Nur so als Tipp.«
Doch da tauchte ich schon in den Schatten einer Toreinfahrt und lief Zoë hinterher. Schon bald holte ich sie ein. Sie hatte keine Jacke dabei, ihr weißes T-Shirt war gut zu erkennen – schwebend vor dem Dunkelgrau der Gassen. Die verspiegelten Fassaden der Börse waren blind und dunkel. Fenster wie tausend geschlossene Augen. Sorgfältig blieb ich auf Abstand. Sie hielt sich dicht an den Häusern und sah sich oft um. Sie nutzte die Schatten gut, duckte sich hinter geparkten Autos, wenn einige Betrunkene die Straße entlangtorkelten, und wartete, bis sie hinter der nächsten Ecke verschwunden waren, bevor sie weiterhuschte. Sie sah sich so oft um, dass ich mich schließlich ganz aus ihrem Sichtfeld zurückzog. Offenbar spürte sie, dass ihr jemand folgte. Gut so!, dachte ich grimmig. Besser, ich jage dir Angst ein und treibe dich heim, bevor die anderen dich sehen!
Doch wenn einer von uns beiden im Augenblick mehr Angst hatte, dann war das eindeutig ich.
Zoës Weg führte vom noblen Flussviertel weg nach Norden, an den Blockbauten der ehemaligen Bahnhofshallen vorbei. Nicht in die U-Bahn. Schlecht für mich.
Ich wurde nervös. Ich gehörte nicht in diesen Stadtteil. Das italienische Schuhgeschäft kam in Sicht – die Grenze, die ich bisher nur am Tag überschritten hatte. Bonbonfarbene Beleuchtung, mit Strass verzierte Stöckelschuhe. Wie die Wächterin vor dem Eingang zur Unterwelt lag eine Pennerin auf der Bank vor dem Geschäft. Ich konnte ihr verfilztes, rotes Haar erkennen. Ich wusste, dass sie Barb hieß. Nur Irves, der für jeden einen anderen Namen fand, nannte sie Kassandra, weil sie tagsüber vor der Börse stand, vom Untergang der Stadt redete und Verwünschungen ausstieß. Ich hoffte, sie würde schlafen oder wenigstens zu betrunken sein, um Zoë wahrzunehmen. Doch ihre Nasenflügel blähten sich und ihre Augen öffneten sich weit, als das Mädchen an ihr vorbeiging. Zoë hätte sich genauso gut ein Schild mit der Aufschrift »Läufer« umhängen können. Barbs Blick folgte ihr, doch nicht einmal das Zeitungspapier, das sie sich sogar im Sommer zum Wärmen unter den Pulli stopfte, raschelte. Glück gehabt. Barb galt zwar als überwiegend friedlich, aber ich hatte nicht die geringste Lust auszuprobieren, wozu diese verrückte Prophetin fähig war, wenn sie von ihrer Bank aufstand.
Ich schlug mich in eine Seitengasse und machte so um den kleinen Platz mit der Bank einen großen Bogen. Erst an der nächsten Querstraße stieß ich wieder zu Zoë. In Gedanken ging ich den Stadtplan ab: Tankstelle, Kreuzung, vier Seitenstraßen, die Baustelle, das Neubaugebiet. Ich begann auf meine Schritte zu achten, trat noch leiser auf. Reviere überschnitten sich hier. Genau an den Kreuzungen, den Nervenknoten der Stadt, wo die Leute innehielten, um sich zu orientieren oder zu verweilen. Dort, wo sich Absätze knirschend auf verlöschenden Kippen drehten.
Ein ziehendes Unbehagen kroch mir den Rücken hoch, als ich die Edelstahlskulptur vor dem Planetarium entdeckte. Zwei Himmelskörper auf Umlaufbahnen aus metallenen Bögen, die ineinander verschlungen vor der Treppe zu schweben schienen. Hier begann die Maurice-Zone. Nervös blickte ich auf meine Armbanduhr, ein silbergelbes Billigteil für ein paar Euro. Nicht schade drum, wenn ich es verlor. Die phosphoreszierenden Zeiger zeigten auf zwanzig vor drei – ich war also noch mitten im Zeitfenster.
Das Mädchen lief am Planetarium vorbei, wurde schneller und hielt auf eines der Neubauviertel zu. Monster und Mangafiguren waren an die Wände gesprüht. Neben dem Tor einer Tiefgarage lieferte sich Prinzessin Mononoke einen Stockkampf mit einem ziemlich fetten, fiesen Batman. Wenigstens hatte die Prinzessin eine Waffe. Zoë hatte nur mich. An ihrer Stelle würde mich das nicht gerade beruhigen.
Ich erstarrte, als ich aus meinem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Eine Gestalt kam um die Ecke, ein kleiner, bulliger Mann, das glatte schwarze Haar mit Pomade quer über die Halbglatze geklatscht. Ich war ihm noch nie begegnet, aber ich wusste, dass dieser Mann dort Maurice war – so wie ich beim Blick auf die Uhr wusste, dass ich in der falschen Zeitzone war. Seine dünnen Beine standen in einem fast lächerlichen Kontrast zu seiner breiten Brust und dem Bauchansatz. Aber den Fehler, mich vom Äußeren täuschen zu lassen, hatte ich bisher nur einmal gemacht. Die körperliche Erscheinung sagte nichts, aber auch gar nichts darüber aus, was einem bevorstehen konnte, wenn ein Typ wie Maurice in den Schatten ging. In diesem Moment wäre ich froh gewesen, wenn Irves oder irgendeiner der anderen mir mehr über Maurice erzählt hätte. Dann hätte ich wenigstens einen Ansatzpunkt gehabt. Aber so lief das ja bei uns nicht.
Er kam näher, mit geschmeidigen, selbstsicheren Schritten. Sein Jogginganzug war ausgeleiert und schlotterte um seine Beine. Ein Adrenalinschub jagte meinen Herzschlag hoch. Lauf!, flüsterte es in mir. Bevor er dich bemerkt. Aber dann würde er Zoë sehen. Sie hatte das Ende der Straße noch nicht erreicht, sie ging gerade an einem Kiosk vorbei und passierte die Bushaltestelle, die selbst jetzt noch beleuchtet war. Jeden Augenblick musste sie Maurice auffallen.
Ich griff hastig in meine Jackentasche und suchte nach meinem Schlüssel, klapperte laut damit herum, während ich fieberhaft abschätzte, wie schnell ich mich in Richtung Süden davonmachen konnte. Maurice hob den Kopf nicht, beschleunigte auch nicht, und dennoch hielt er auf mich zu. Da begriff ich, dass er mich schon längst wahrgenommen hatte. Manchmal vergaß ich, um wie viel besser die anderen sahen, rochen und hörten.
Fünf Sekunden für eine Entscheidung: Rannte ich jetzt sofort weg, würde er mich zwar gehen lassen, aber das Mädchen vielleicht doch noch entdecken. Machte ich ihm Ärger und griff ihn an, würde Zoë sich umdrehen und zwei Männer sehen, die sich an die Kehle gingen. Vermutlich würde sie ihr Handy zücken und die Polizei rufen. Spätestens dann würde sie Maurice auffallen. Er würde sie nicht in dieser Nacht erwischen. Aber in der nächsten. Oder der übernächsten.
Pokern um Sekunden. Ich ging noch langsamer, tat so, als würde ich in meiner Jacke nach Zigaretten oder dem Handy suchen, wechselte wie beiläufig die Straßenseite. Das Blut rauschte in meinen Ohren. Nicht hinsehen.
Maurice erschien so schnell an der Straßenecke, als hätte ich ihn herbeigezwinkert. Ich hatte keinen Schritt gehört.
»Sieh mal an«, knurrte er. »Besuch.« Der Geruch von ungewaschener Haut stieg mir in die Nase, zusammen mit einer stechenden, bedrohlichen Note. Falscher Stadtteil, sagte sie. Falsche Zeit, falscher Ort, Junge.
»Ganz ruhig!«, sagte ich versöhnlich und hob die Hände. »Gibt es ein Problem, Mann?«
Ich konnte seine Augen funkeln sehen. Für einige Sekunden war er durch meine ruhige Reaktion irritiert und zweifelte wohl an seinem ersten Eindruck. Er versuchte mich einzuordnen, aber offenbar gelang es ihm nicht ganz. Er kannte mich nicht, nicht umsonst hielt ich mich an mein Viertel. In diesen vagen Momenten war ich einfach nur ein verdächtiger Typ, der seinem Blick auswich. Langsam ging ich zurück, einen Schritt zur nächsten Straßenecke, noch einen. »Ich suche nur die U-Bahn«, sagte ich im Plauderton. »Ich geh schon, ich will keinen Ärger.«
Ich weiß nicht, was mich verraten hatte. Mein Tonfall? Eine Bewegung? Oder das Licht einer Neonreklame, das sich in meinen Augen spiegelte?
»Da müsstest du schon verdammt schnell rennen!«, fauchte Maurice und duckte sich.
Es war einer dieser Augenblicke, in denen man sich wünscht, den Film noch mal zurückzudrehen. Zwanzig Sekunden nur. Ich hätte Zoë Angst machen sollen, ihr den Eindruck geben, sie würde tatsächlich verfolgt, dann wäre sie schneller gelaufen. Wir hätten Maurice um eine Straße verpasst. Und ich säße jetzt nicht in der Klemme.
Über seine Schulter sah ich Zoë ganz am Ende der Straße in einem Hauseingang verschwinden. Es war ein frisch verputztes Hochhaus gegenüber der Bushaltestelle, das zwischen den älteren Backsteinbauten aussah wie der letzte gesunde Zahn in einer Gebissruine. Überlaut nahm ich das Klappern eines Schlüsselbunds wahr, dann schlug die Tür zu. Zoë war zu Hause. In Sicherheit. Schön für sie.
Schlecht für mich. Denn jetzt sah ich, was Irves mir alles nicht über Maurice erzählt hatte. Verdammt! Mein Adrenalinspiegel schnellte so abrupt hoch, dass meine Muskeln glühten. Wie in Zeitlupe nahm ich wahr, dass ich davonschnellte. Beim letzten Blick über die Schulter sah ich die Baustelle. Neben Zoës Haus wachten ein paar schlafende Kräne wie eine Herde von Metallgiraffen über tiefe Baugruben. Hübsche Szene. Tja, und so ziemlich das Letzte, was ich sah.
Schwarz und Weiß
Es hatte Zeiten gegeben, in denen Zoë auch tagsüber die schwarzen Gardinen nicht öffnete. Und Nächte, in denen nur das Flimmern und das Gemurmel der Fernsehbilder die Träume überdecken und sie in einer Art Wachschlaf halten konnte. Betäubung war alles, und ohne den Fernseher hätte sie früher oder später den Halt verloren und wäre in ihre eigenen Träume gestürzt, wo immer dieselben Bilder auf sie warteten.
Immerhin – jetzt, nach drei Wochen (zwanzig Tage und sieben Stunden, um genau zu sein), spürte sie wieder Boden unter den Füßen. Zumindest brachte sie es inzwischen fertig, David auf dem Pausenhof zu sehen, ohne sofort dieses endlose, schreckliche Fallen im Bauch zu spüren. Sie hatte es im Griff. Und wenn die Wut zu schlimm wurde, gab es immer noch das Tanzen. Wenn die Musik so laut war, dass sie im Zwerchfell vibrierte, gleißte hinter Zoës Lidern nur noch ein gnädiges, kühles Weiß, das alle Bilder löschte. Lediglich die Unruhe, die ihr seit Tagen zu schaffen machte, ließ sich nicht vertreiben. Eine Rastlosigkeit, die es ihr auch heute Morgen unmöglich gemacht hatte, sich auf die Mathearbeit zu konzentrieren. Eine innere Unruhe, die sie jetzt dazu brachte, mit den Fingern auf dem Oberschenkel herumzutrommeln, als hätte sie einen Koffeinrausch. Unter Strom, dachte Zoë. Wie ein Sprinter vor dem Lauf. Vermutlich war es wirklich höchste Zeit, wieder ins Training einzusteigen.
Im Moment konnte sie sich allerdings nicht vorstellen, heute noch zu laufen. Die Nacht saß ihr noch in den Knochen. Sie war erst gegen drei Uhr nach Hause gekommen – mit klopfendem Herzen und der Angst, dass der Schlüssel sich diesmal zu laut im Schloss drehen könnte. Das Bild des Weißhaarigen blitzte vor ihrem inneren Auge auf: Irves. Bestimmt war das nicht sein richtiger Name. Sie versuchte sich an sein Lächeln zu erinnern, aber alles, was ihr im Gedächtnis geblieben war, waren das weiße Haar und die mandelförmigen, schmalen Augen, beunruhigend und faszinierend zugleich, die Iris eine farblose Milchglasscheibe. Ein Blick, der nur auf sie gerichtet war. Die Erinnerung daran jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Sie tastete nach dem Schülerausweis in ihrer Hosentasche und zog ihn hervor. Eine Weile drehte sie das Mäppchen zwischen den Fingern, dann klappte sie es zum zwanzigsten Mal an diesem Tag auf und betrachtete die Notiz, die sie erst heute Morgen entdeckt hatte. Sonntag: Buddha Lounge, stand dort mit schwarzem Edding an den Rand gekritzelt. Und daneben eine Handynummer. Eine Sieben am Ende, bei der der Stift abgerutscht war. Diese hastig hingeworfene Schrift weckte wieder eine ungerufene Erinnerung: an zahllose Zettel, Briefe, die sie in einer ihrer schlimmsten Nächte in einer Schale verbrannt hatte.
Rasch steckte sie das Mäppchen ein und trat zum Fenster. Mit einer heftigen Bewegung riss sie die Vorhänge ganz zur Seite und begann ihre Sportsachen zu suchen. Es dauerte eine Weile, bis sie fündig wurde. Im Zimmer hatte sich so einiges verändert. Genug für zwei tiefe Sorgenfalten auf der Stirn ihrer Mutter. Die Regale waren abgeräumt. Schwarz und Weiß war alles, was im Zimmer geblieben war. Weiße Wände ohne Bilder, schwarze Vorhänge und Bettwäsche. Diese Klarheit wurde nur von den bunten Spielzeugautos auf Bett und Teppich durchbrochen. Neben der Tür lag auch Leons Peter-Pan-Puzzle in fünfzig Einzelteilen.
Zoë kniete sich auf den Teppich und angelte nach den Sportschuhen. Wie vergessene Artefakte lagen sie unter dem Bett zwischen Kisten, die mit Paketband verklebt waren. Darin lagerten die Überreste ihres alten Lebens: Fotos, Spielzeug aus der Zeit der Stadtteilfreizeiten, sogar ein steinhartes Lebkuchenherz vom Volksfest auf dem Parkplatz des Einkaufscenters. Sechs Jahre alt und hart wie Stein. Rasch zerrte sie die Schuhe hervor und stopfte sie in einen Beutel.
Im Wohnzimmer lief der Fernseher schon seit einer ganzen Weile, doch nun nahm die Lautstärke plötzlich zu. Irgendein Trickfilmmonster lieferte sich ein Brüllgefecht mit irgendeinem Superhelden. Zoë fluchte, warf den Beutel aufs Bett und lief ins Wohnzimmer. Natürlich: Ihr kleiner Bruder saß im Schneidersitz vor dem Fernseher. Nein, eigentlich klebte er direkt am Bildschirm – mit offenem Mund, die Nase fast an der flimmernden Fläche.
»Leon!«, fuhr Zoë ihn an. »Mach den Fernseher leiser! Mama will noch schlafen.«
Der Kleine wandte den Kopf. Braune Locken und ebenso braune Augen, die klaren Züge seines Vaters. »Die schläft doch gar nicht«, maulte er und wandte sich wieder den Figuren zu. Als Zoë auf ihn zukam, schnappte er sich die Fernbedienung und stopfte sie sich unter sein Sweatshirt. Kampfansage.
»Weg vom Bildschirm!«, schalt ihn Zoë. »Setz dich wenigstens auf das Sofa und nimm den Kopfhörer.«
»Nein!«, brüllte er und verschränkte trotzig die Arme. Die Fernbedienung rutschte unter seinem Shirt hervor, er fing sie hastig auf und schob sie wieder in den Kragen. Dabei musste er auf eine Taste gekommen sein. Das Programm schaltete um zu einem Reporter, der mit Donnerstimme gegen den Lärm eines Fußballspiels anschrie.
»Gib die Fernbedienung her, los!«, befahl Zoë.
Leon schoss hoch. »Nein!«, heulte er mit hochrotem Kopf.
Sie streckte die Hand aus, doch Leon schlug nach ihr.
Das reichte! Leon bekam vor Schreck riesige Augen, als sie auf ihn zusprang und ihn kurzerhand am Handgelenk fasste. »Lass mich los!«, brüllte er so laut, als würde sie ihm tatsächlich wehtun. »Aua! Aua!«
»Du schlägst mich nicht!«, fauchte sie. In der Sekunde, in der sowohl der Reporter als auch Leon Luft holten, hörte Zoë ein leises Schnappen. Doch bevor sie dem Geräusch nachgehen konnte, wand sich Leon wie eine Schlange aus ihrem Griff und rumpelte gegen den Couchtisch. Scheppernd fiel ein Tablett mit einer leeren Kaffeetasse und mehreren Tellern auf den Boden. Überall auf dem Teppich lagen Kekse. Leon verschluckte sich vor Schreck, dann japste er nach Luft und legte richtig los. Sein Kreischen schnitt in Zoës Ohren. Ein Fußballfan mit Kriegsbemalung jubelte dröhnend im Fernsehen. Und zu allem Überfluss schrillte im selben Moment die Türklingel. Zoë musste Luft holen, um ruhig zu bleiben. Falls ihre Mutter geschlafen haben sollte – jetzt war sie garantiert wach. In dem Moment, in dem sie dem Impuls widerstand, Leon den Hals umzudrehen, erwischte sie die fallende Fernbedienung. Die Stille, die einsetzte, als sie die Off-Taste drückte, war ohrenbetäubend. Leon verstummte und starrte auf die Tasse vor seinen Füßen. Eben noch hätte Zoë ihren kleinen Bruder erwürgen können, jetzt aber tat er ihr leid, so schuldbewusst sah er aus. Alles tat ihr leid – ihre eigene Gereiztheit, der plötzliche Zorn auf ihn und ihre Grobheit. Er war nun mal erst fünf Jahre alt und oft überdreht und trotzig. Kein Grund, ohne Vorwarnung auf ihn loszugehen. Es hätte genügt, einfach den Fernseher auszumachen. Was war nur los mit ihr?
Sie kniete sich vor ihren Bruder auf den Boden und sah in sein verheultes Gesicht. »Ist doch nicht so schlimm«, sagte sie sanft und fuhr Leon durchs Haar. »Alles gut, Löwe. Schau, die Teller sind alle noch heil. Es ist nichts kaputtgegangen.« Zumindest, was das Geschirr betrifft, setzte sie in Gedanken hinzu. Alles gut, Zoë, Scherben bringen Glück. »Aber du weißt genau, dass wir nicht laut sein dürfen, solange Mama schläft. Sie hat die ganze Nacht gearbeitet und muss sich ausruhen.«
Leon schniefte und murmelte etwas, dann stapfte er mit hochgezogenen Schultern hinaus.
Es klingelte noch einmal. Zoë rappelte sich hoch und ging zur Haustür.
Paula war das einzige Mädchen, dem lilafarbene Laufshirts standen, obwohl sich die Farbe mit ihrem Kupferhaar biss. Aber Paula scherte sich nie darum, ob etwas passte oder nicht. Zoë bezweifelte, dass sie morgens überhaupt hinsah, wenn sie Kleidungsstücke aus dem Schrank zerrte. Doch Paula hätte sich auch eine karierte Gardine umhängen können und dabei hübsch ausgesehen, so als trüge sie nur ein ausgefallenes Designerstück.
»Was ist denn bei euch los?«, fragte sie, während sie auf den Flur trat.
»Nur das Übliche«, gab Zoë trocken zurück. »Leben im Irrenhaus.«
Sie konnte Paula ansehen, dass sie überlegte, ob der Satz witzig gemeint war. Es war unfair, so etwas zu denken, aber Ellen hätte keine Sekunde überlegt. Ellen hätte einfach gelacht.
Etwas Schlimmes, Heißes drohte in ihrer Brust aufzublühen. Sie musste krampfhaft schlucken, einmal, zweimal, um den Kloß in ihrer Kehle aufzulösen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Paula. »Geht es dir nicht gut? Du bist ganz blass.«
»Alles bestens«, gab Zoë zurück. »Fang bloß nicht wieder an, mich wie ein rohes Ei zu behandeln.«
Paula zupfte an ihrem Schweißband. »Das tue ich doch gar nicht«, sagte sie und musterte Zoës weißen Trainingsdress. Sie sah so aus, als hätte sie noch etwas auf dem Herzen, aber sie schwieg. Und genau das war das Problem bei Paula: Ihr Schweigen enthielt immer sehr, sehr viele Worte.
»Ich weiß, dass vielleicht auch David auf dem Platz ist«, sagte Zoë in das Schweigen. »Ich habe auf dem Plan gesehen, dass die Elfte am Freitagnachmittag spielt. Das ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, ich werde ihm schon keine Szene machen. Ich sehe ihn jeden Tag, schon vergessen? Ich bin drüber weg.«
In diesem Augenblick stimmte das sogar. Die Aussicht, David auf dem Sportplatz zu sehen, löste nichts aus, nicht einmal ein flaues Gefühl im Magen. Zwanzig Tage genügten offenbar, um die Sehnsucht zu kühler, beherrschter Wut erstarren zu lassen.
»Okay«, sagte Paula gedehnt. Zoë fragte sich, ob sie auf ihre Freundin tatsächlich wie jemand wirkte, der beim Anblick des Exfreundes zusammenbrechen würde. Paula sah auf ihre Armbanduhr. »Schon Viertel vor drei. Los jetzt!«
Zoë lief in ihr Zimmer und schnappte sich den Beutel mit den Sportschuhen. An der Tür zu Leons kleinem Zimmer, das ihre Mutter nur »Räuberkammer« nannte, zögerte sie und lauschte. Die mechanische Stimme eines Märchenerzählers erklang hinter der Tür. Eine Sekunde kämpfte sie noch gegen das schlechte Gewissen an, aber dann beschloss sie, dass Leon schon klarkommen würde. Sie war bereits auf halbem Weg über den Flur, als ihr das Chaos im Wohnzimmer wieder einfiel.
»Bin gleich da!«, rief sie Paula zu. Hastig klaubte sie die Tasse und die Teller zusammen und stellte sie auf das Tablett. Dann sammelte sie die Kekse ein. Als sie sich aufrichtete, ließ eine Bewegung an der Balkontür sie zusammenzucken.
Ihre Mutter stand draußen auf dem winzigen Balkon und blickte zu den Kränen hinüber. Sie trug ihren blauen Bademantel, ihr Haar stand in wirren Wellen vom Kopf ab. Eine hübsche, mollige Frau mit müden Augen von der Nachtschicht im Krankenhaus. Die Nachmittagssonne legte eine schmale goldene Aura um ihr Profil. Zoë hatte sie nicht ins Wohnzimmer gehen hören, was die Vermutung nahelegte, dass sie schon eine ganze Weile draußen stand. Natürlich: Das Schnappen! Das Schloss der Balkontür. Vom Balkon aus hatte sie das Chaos im Wohnzimmer mitbekommen, einfach die Tür zugezogen und sich außer Sichtweite an den rechten Rand gestellt. Ausgeblendet, dachte Zoë. Wie das Fernsehprogramm. Zu den Kränen gezappt. Beinahe hätte sie gelacht. Die Flucht hinter Glas. Ein paar Minuten weiße Zeit. Es war einer dieser seltenen Augenblicke, in denen Zoë gerne zu ihrer Mutter getreten wäre, um einfach die Stille mit ihr zu teilen. Aber das war natürlich unmöglich. Die Glasscheibe zwischen ihnen war unüberwindbarer als eine Mauer. Noch nie war Zoë über die Schwelle zum Balkon getreten. Er war nicht viel mehr als ein an die Fassade geklebter Schuhkarton. Der Gedanke, ihn zu betreten und die Höhe des sechsten Stockwerks unter den Sohlen zu spüren, machte Zoë schwindelig.
Es tat gut, wieder unterwegs zu sein. Der Nachmittagsverkehr hatte seinen Höhepunkt erreicht, die Frühjahrssonne spiegelte sich auf Motorhauben. Es war zu laut für Gespräche und die roten Fußgängerampeln bremsten sie aus. Paula sah immer wieder auf die Uhr. Was Pünktlichkeit anging, verstand Frau Thalis keinen Spaß.
Zoë merkte, dass sie wieder nervös mit den Fingern trommelte – diesmal auf ihrem Beutel. Sie sah sich um, ließ den Blick schweifen und stutzte. Unter den vielen Leuten, die gleichgültig an der Ampel standen, nahm sie eine Bewegung wahr. Jemand machte einen Schritt in eine Gasse. Sie sah nur noch ein schwarzes Hosenbein hinter einer Hausecke verschwinden. Das Seltsame war, dass die Person offenbar einen Schritt rückwärts gegangen war, als wollte sie sich rasch verbergen.
»Zoë? Was ist?«, rief Paula im Gehen.
Zoë fuhr herum und sah, dass die Ampel auf Grün umgesprungen war und die Leute schon halb über die Straße waren. Sofort beeilte sie sich, zu Paula aufzuholen.
»Nichts«, sagte sie. »Ich dachte nur, jemand hätte uns beobachtet.«
Der Sportplatz, der zwar zur Schule gehörte, aber einige Straßen davon entfernt lag, war nicht besonders groß. Kein Wunder: Er war der ständig wachsenden Stadt abgetrotzt, eingeklemmt zwischen einer Mauer, hinter der sich ein Verladebahnhof befand, und den Rückseiten von zwei Gebäuden. Es gab nicht viel: einen Basketballplatz und die schmale Laufbahn, die um das Spielfeld herumführte. Kein Grün. Die Hochstraße, die in einer Schleife ein Stück über das Spielfeld ragte, legte einen Lärmteppich und an heißen Tagen den staubigen Dunst von Abgasen über das Feld. Aber dennoch wurde Zoë von einem überwältigenden Gefühl von Vertrautheit überwältigt, als das Orange der Tartanbahnen in Sicht kam. Die Gruppe, die Frau Thalis hochtrabend »mein Marathonteam« nannte, stand am rechten Ende der Bahn und machte sich bereits warm. Frau Thalis entdeckte Paula und Zoë und winkte ihnen zu. Beeilung, hieß das ungeduldige Zeichen.
Zoë wollte losrennen, doch Paula packte sie im selben Moment am Arm.
»Oh nein!«, raunte sie ihr von der Seite zu. »Was hat denn die hier zu suchen?«
Zoë brauchte nur auf das Achterbahngefühl tief in ihrem Magen zu hören, um zu wissen, wen Paula meinte. Sie betete, dass sie sich irrte, und blickte nach links.
Es war eine Sache, David jeden Tag in der Schule zu sehen, aber eine ganz andere, zum ersten Mal wieder Ellen zu begegnen. Ellen, die überhaupt nicht hierhergehörte. Nicht in Zoës Leben, nicht an diese Schule und schon gar nicht an den Spielfeldrand, wo das Basketballteam auf den Schiedsrichter wartete. Eines war klar: Zwanzig Tage und acht Stunden mochten genügen, um Davids Anblick zu ertragen, aber sie waren nicht genug, um Ellen aus ihrem Leben zu verbannen. Auch vierzig Tage würden nicht genügen. Vielleicht nicht einmal hundert.
Im gleißend hellen Frühlingslicht sahen die beiden Gestalten am Rand des Basketballfeldes aus wie eine Skulptur, Teile aus verschiedenen Welten, die nun zu etwas Neuem, Unbegreiflichem verschmolzen waren. Ein monströses Wesen, bestehend aus zwei Teilen, und jeder von ihnen hatte Zoë bis vor Kurzem noch unendlich viel bedeutet.
»Wusstest du, dass die sich das Spiel ansehen will?«, fragte Paula.
»Woher sollte ich das wissen?«, erwiderte Zoë. »Glaubst du wirklich, Ellen und ich reden noch miteinander?«
Ihre Stimme klang seltsam – belegt und tonlos, aber wenigstens zitterte sie nicht.
»Sollen wir lieber wieder gehen?«, fragte Paula besorgt.
»Nein, wieso?«, gab Zoë unwillig zurück. Sie wunderte sich selbst, wie ruhig sie weitergehen konnte, einen Schritt nach dem anderen, als wäre die Welt noch völlig in Ordnung. Das Paar löste sich voneinander – gerade so viel, um wieder Luft zum Atmen zu haben.
Ellen schien ihre Aufmerksamkeit zu spüren. Als hätte Zoë sie gerufen, wandte sie den Kopf und fuhr ertappt zusammen. Immerhin – es tat gut zu sehen, wie Ellen blass wurde und sie mit offenem Mund anstarrte.
Was hast du denn geglaubt?, dachte Zoë grimmig. Dass ich wegen David die Schule verlassen und diesen Teil der Stadt nie wieder betreten würde?
Sie sahen sich in die Augen, bis Ellen errötete und den Blick senkte. Verlegen schob sie sich die halblangen, braunen Locken aus dem Gesicht hinter die Ohren. Die Vertrautheit dieser Geste war es, die am meisten schmerzte. Die Verbindung, die immer noch zwischen ihnen bestand, die Jahre, die randvoll waren mit Ellen und Zoë. Was nützte es, das Zimmer auszuräumen, das Lebkuchenherz vom elften Geburtstag unters Bett zu verbannen und Ellens Briefe zu verbrennen, wenn schon allein ihr Anblick genügte, Zoës Brust in einen Lavastrudel zu verwandeln. Reiß dich zusammen!, befahl sie sich.
David wollte Ellen den Arm um die Schulter legen und sie wieder zu sich heranziehen, aber sie trat einen Schritt zur Seite und sagte etwas zu ihm. Wie immer, wenn sie aufgebracht war, fuchtelte sie hektisch mit den Händen herum. Zoë kannte sie so gut, dass jede Geste wie ein Wort war. Im Moment war Ellen ziemlich sauer. Natürlich hatte David gewusst, dass die Marathongruppe der Zehnten heute Nachmittag ebenfalls hier auf dem Sportplatz trainieren würde. Und dass die Chancen gut standen, dass Zoë auch da sein würde. Nur hatte er es Ellen nicht gesagt, sondern sie ohne groß nachzudenken zum Basketballspiel eingeladen. Typisch David.Undblödes Pech für dich, Ellen. Mitten in den Fettnapf.
Jetzt sah auch David zu ihr herüber. David mit seinem blonden Haar, in seinem schwarzen Trainingsshirt, das betonte, wie hochgewachsen und sportlich er war. Derselbe Junge, der ihr vor drei Monaten einen Metallstern vom Weihnachtsbaum vor der Börse geholt hatte. David, mit dem sie noch vor vier Wochen mitten in der Nacht zum höchsten Punkt der Stadt gefahren war, die Wange an seine Schulter gelehnt, während das Dröhnen seines Motorrads sie beide stumm machte und der eisige Februarwind durch ihre Haare fuhr. Und nicht zuletzt David, dessen Nachrichten sie vor zwanzig Tagen gelöscht hatte. Hundertdreißig Mal »Löschen«. Nur die letzte SMS hatte sie aufgehoben. Ausgerechnet die sprachloseste von allen, die nicht viel mehr war als eine lahme, nüchterne Entschuldigung, die hundertdreißig Liebeserklärungen zu wertlosen, leeren Buchstaben verblassen ließ.
Er hob die Hand und winkte ihr zu.
»Idiot!«, zischte sie und beschleunigte ihre Schritte. Paula hakte sich bei ihr unter. Die Nähe tat gut. Gemeinsam liefen sie zur Gruppe – sechs Mädchen aus Zoës und Paulas Jahrgang, die nun mit verschränkten Armen abwartend dastanden. In ihren Blicken konnte Zoë das Mitleid sehen. Willkommen bei der Vorher-nachher-Freakshow. Der Exfreund führt seine Neue aus der Südstadt-Schule vor – und hier kommt die Verlassene.
Sie biss die Zähne zusammen. Auf eine Vorstellung würden sie lange warten können. Ellen konnte ihr David wegnehmen (oder David ihr Ellen, schwer zu sagen, was schlimmer war), aber zum Heulen würden sie sie nicht bringen.
»Schön, dass ihr doch noch zu uns stoßt!«, begrüßte Frau Thalis sie mit schneidender Ironie und tippte vorwurfsvoll auf ihre Armbanduhr.
Zoë murmelte eine Entschuldigung und hielt dem verärgerten Blick ihrer Sportlehrerin stand. Frau Thalis war groß, athletisch, die kurz geschnittenen Haare standen hinter dem Stirnband hoch wie Igelstacheln.
Während Zoë die Schuhe aus dem Beutel zerrte, musterte die Lehrerin sie unbarmherzig.
»Siehst ein bisschen mitgenommen aus«, bemerkte sie mit einem Unterton, den Zoë nicht recht einordnen konnte. »Na ja, jedenfalls willkommen zurück im Team.«
Paula lächelte ihr von der Seite zu. Ihre Sommersprossen leuchteten in der Frühlingssonne, eine Brise wehte ihr die kupferroten Strähnen über die Wange, bis sie sie mit einem Gummi zusammenfasste.
Frau Thalis wandte sich an die anderen. »Zehn Minuten Stretchen und dann zweimal zweihundert zum Aufwärmen! Zoë, du machst am Anfang noch langsam.«
Zoë nickte und zog sich hastig die Turnschuhe an. Dann gesellte sie sich zu den anderen und konzentrierte sich ganz auf das Dehnungsziehen in der Wade. Der Schmerz fühlte sich beinahe tröstlich an. Nicht hinsehen, befahl sie sich. Und dennoch glaubte sie Ellens Blick zu spüren, ein heißes Prickeln im Nacken. Es kostete Kraft, so viel Kraft, gleichgültig und beherrscht zu wirken! Um sich zu beruhigen, zog sie den herben Gummigeruch der Bahn tief in ihre Lungen.
Die Mädchen lockerten die Muskeln, machten sich bereit.
»Los!«, rief Frau Thalis. Zoë startete, spürte das Federn der Bahn unter ihren Sohlen. Noch empfand sie den Wind als kühl, er kitzelte die Gänsehaut auf den Armen hervor. Paula holte auf, bis sie Seite an Seite liefen. Nach und nach fanden sie einen gemeinsamen Rhythmus. Schritt, Schritt, Atem. Schritt, Schritt, Atem. Erste Runde um das Basketballfeld.
Schon jetzt büßte sie für die lange Pause. Die Gelenke waren steif, die Müdigkeit zerrte an ihren Beinen. Sie zwang sich in den Rhythmus, und tatsächlich gelang es ihr, einen Zipfel der alten Leichtigkeit zu erhaschen: Sekunden, in denen sie einfach nur lief, befreit von allen Gedanken.
Zweite Runde. Am Ende der langen Bahnseite nahm sie eine Gestalt im Gegenlicht wahr. Die helle Jacke, die sie gemeinsam gekauft hatten, vor… zwei Monaten? Ein grelles Erinnerungsbild flammte auf: Ellen, wie sie sich nach der Party hinter David aufs Motorrad schwang. War die Berührung damals schon vertraut gewesen? Oder sogar mehr als das? Haben sie sich da schon geküsst? Sich verliebt? Oder die Nacht zusammen verbracht?
Der Startpfiff auf dem Basketballfeld ging ihr durch jede Faser ihres Körpers. Beinahe wäre sie gestolpert. Der Pfiff war so laut, dass es in den Ohren wehtat. Irritiert blickte sie nach links. David dribbelte, sprang hoch und warf den Ball in den Korb. Im Vorübergleiten glaubte Zoë die Bewegungsabfolge wie eine Skizzenstudie zu sehen. »Bild 1, Titel: Hundertdreißig SMS« – »Bild 2, Titel: Sagt, er liebt dich« –»Bild 3: Schläft mit deiner besten Freundin«.
Überlaut schnitten ihr die Motorengeräusche und die Piepstöne von Handys ins Trommelfell. Als würden ihre Nerven plötzlich keine schützende Hülle mehr haben.
»Runter vom Gas, Zoë!«, hörte sie Frau Thalis’ mahnende Stimme. Doch sie achtete nicht auf das Brennen in ihren Beinmuskeln und auch nicht auf das Seitenstechen. Sie ließ Paula zurück, holte mühelos zu zwei anderen auf und zog an ihnen vorbei.
Ellen trat noch dichter an den Bahnrand und rief ihr etwas zu, was Zoë nicht hörte. Zu laut summte irgendwo das Rad einer Straßenbahn auf dem Gleis. Hupen und das Schleifen von Bremsscheiben auf der Hochstraße.
Dann schnappte etwas in ihrem Inneren ein wie ein Riegel. Etwas Seltsames geschah: Als würde sie einen Teil von sich selbst ausblenden, schnurrte die Tartanbahn zu einer Linie ohne Rechts und Links zusammen. Ihre Sohlen flogen über das flirrende Orange. Bei jedem Sprung flatterten die Gedanken davon, als wären sie nichts weiter als ein wertloser Papiermantel. Zurück blieben ihr Körper und die reine, kalte Wut. Blankes, unmaskiertes Gefühl. Ihre Hände waren nur noch Fäuste. Und Ellen nur noch das Ziel.
Siebzig Meter noch, sechzig, vierzig… Schritt, Schritt, Kehle. Schau auf ihre Kehle!
»Zoë, pass auf!«, schrie Paula irgendwo weit hinter ihr. Ein heransausender runder Schatten von links. Im Reflex wirbelte Zoë herum, strauchelte und fing den Basketball auf, der vom Spielfeld auf sie zugeflogen kam. Hart ruckte der Aufprall durch ihre Fingergelenke. Im Schwung ihres Sprunges drehte sie sich und nutzte die Wucht. Der Ball verwandelte sich in eine Waffe. Ellens Mund klappte auf. Eine Stummfilmheldin, die erkannte, dass der Mörder sie gefunden hatte. Ein hässlicher Aufprall, Haare flogen, ihr Kopf ruckte herum, dann fiel sie.
Es war nur eine Sekunde, doch Zoë erschien es wie ein Moment ohne Zeit. Mit kaltem Interesse betrachtete sie Ellen. Und dahinter – am Zaun – fiel ihr ein anderes Gesicht auf. Finger, wie Affenpfoten um die Gitterdrähte gekrampft. Rissige Hände mit schmutzigen Fingernägeln. Eine Obdachlose mit verfilzten roten Strähnen stand am Zaun. Sie starrte Zoë an und grinste wie ein verrückter Golem.
Schlagartig fiel Zoë aus dieser seltsamen kühlen Trance in die Wirklichkeit zurück. Sie hörte ihr eigenes Keuchen, während sie immer noch weiterlief. Pfiffe schrillten. Nur noch aus den Augenwinkeln nahm Zoë die Basketballspieler wahr, allen voran David, der vom Spielfeld zu Ellen stürzte. »Spinnst du?«, brüllte er. Wie zwei Sprinter bewegten sie sich auf das liegende Mädchen zu. Ellen blinzelte und tastete benommen nach ihrem Gesicht. Blut lief aus ihrer Nase und am linken Wangenknochen zeichnete sich die rote Stelle ab, an der der Ball sie getroffen hatte. Sie sah Zoë heranrasen, krümmte sich sofort zusammen und schützte den Kopf mit den Armen. Wenige Sekunden vor David erreichte Zoë sie, sprang über die Liegende hinweg – und rannte. Nicht in die Kurve der Bahn, sondern weiter. Sie fegte durch das Tor. Drehe ich jetzt völlig durch? Endlich lösten sich ihre Sohlen von der Bahn und hämmerten auf Asphalt.
Sie hörte nicht das Hupen der Autos und nicht die empörten Rufe der Passanten, denen sie den Weg abschnitt. Wenn sie eine rote Ampel sah, nahm sie einen Umweg, um nicht anhalten zu müssen. Benommen sah sie die Häuser an sich vorbeiziehen. Und da war noch etwas: ein Schatten, der parallel zu ihr in den Seitenstraßen lief wie ein verzerrtes Spiegelbild. Als sie einen gehetzten Blick über die Schulter warf, glaubte sie zu erkennen, dass es ein Mann war. In einem schwarzen Trainingsanzug, ein Jogger. Sie bog auf die lange Straße ab und legte einen Sprint ein, holte alles aus sich heraus, was ihre Lungen noch hergaben. Als würde die Energie ihr ausgehen, nahmen die Geräusche wieder eine normale Lautstärke an, die Schwere kehrte in ihre Beine zurück. Ein Laster hupte und überholte sie auf der Höhe des Planetariums.
Zoë taumelte und keuchte und wurde langsamer. Gehetzt blickte sie sich um, denn sie hätte schwören können, dass jemand hinter ihr war. Aber die Straße war so gut wie leer. Mit Seitenstechen kam sie an der Straßenecke bei den Kiosks zum Stehen. Sie hätte erschöpft sein müssen, müde, aber die Unruhe pulsierte immer noch durch ihre Adern. Vielleicht zitterte sie deshalb am ganzen Körper. Ein Gefühl, als müsste sie aus ihrer Haut.
Am Ende der Straße erhob sich der getünchte Hochhausklotz, sie konnte den Balkon im sechsten Stock sehen. Mit der Ernüchterung kamen die Scham und das Entsetzen. Ellens Blick, der stumme Aufschrei, das Blut. Und erschreckender als alles andere: Zoës Triumph, so hart getroffen zu haben. Verdammt, was war los mit ihr?Manchmal, in den Nächten, hatte sie sich tatsächlich gewünscht, ihrer Freundin wehzutun. Aber sie wirklich niederzuschlagen? Was auch geschehen war, es war immer noch Ellen!
Zoë schluckte und rang nach Luft – und dann brach sie in Tränen aus. Zwanzig Tage Wut und Stärke, einfach weggewischt.
Eine Frau, die einen Kinderwagen aus einem Kiosk bugsierte, hielt inne und musterte sie fragend. Zoë wandte sich ab und suchte vergeblich nach einem Taschentuch. Sie schniefte und wischte sich mit dem Unterarm über die Nase. Mitten in der Bewegung erstarrte sie. Durch den Tränenschleier sah sie einen dicklichen Mann in ausgebeulten schwarzen Trainingshosen und einem ebenso ausgeleierten T-Shirt. Er stand halb im Schatten, an den Lotto-Kiosk gelehnt. Einen Augenblick lang war Zoë verwirrt. Aber es konnte unmöglich der Jogger aus der Nebenstraße sein. Erstens sah er nicht so aus, als wäre er trainiert, und zweitens war er im Gegensatz zu ihr kein bisschen außer Atem.
»Hi«, sagte er und strich sich mit einer seltsam gezierten Bewegung die quer gelegten Haare auf der Halbglatze glatt. Zoë fröstelte.
Seine Fingerknöchel waren aufgeschürft. Und er hatte rötlichen Dreck unter den Nägeln. Die Augen waren hellblau und hatten etwas Stechendes, Starres. Hat er Drogen genommen? Ein unangenehmer Geruch ging von ihm aus. Schweiß, der etwas zu scharf roch, dazu der Dunst ungewaschener Kleider.
Zoë drehte sich auf dem Absatz herum und machte, dass sie davonkam. Ist es dumm, auf das Haus zuzulaufen?, dachte sie beunruhigt. Der Kerl beobachtet mich!
Als sie keine Schritte hörte, wagte sie einen flüchtigen Blick über die Schulter und atmete auf. Er war verschwunden. Also doch nur irgendein Idiot, der nichts Besseres zu tun hatte, als Leute anzuquatschen. Dennoch blieb ein seltsames Gefühl zurück.
Atemlos kam sie bei der Bushaltestelle an. Beinahe wäre sie auf etwas getreten, was neben dem Fahrkartenautomaten lag. Eine Armbanduhr. Silber, gelbe Streifen. Sie wusste nicht warum, aber sie bückte sich und hob die Uhr auf. Im Laufen warf sie einen genaueren Blick darauf. Das Armband war gerissen, aber ansonsten sah sie neu aus. Allerdings hatte das Uhrglas aus Plastik einen Kratzer. Genau vierzehn Minuten vor drei war die Uhr stehen geblieben. Doch als Zoë mit dem Mittelfinger gegen das Gehäuse schnippte, ruckte der Sekundenzeiger und begann wieder zu laufen, als sei nichts gewesen.
Dschungelfunk
Diesmal war es ziemlich schlimm. Ehrlich gesagt verfluchte ich Zoë in dem Moment, in dem ich wieder zu mir kam. Ich versuchte die Augen zu öffnen. Schlechte Idee. Ich war blind. Eigentlich wollte ich aufschreien, aber das ist gar nicht so einfach, wenn man das Gefühl hat, gerade unter einer Dampfwalze hervorgekrochen zu sein. So kam nur ein Stöhnen über meine Lippen.
»Willkommen zurück«, sagte eine ruhige Stimme aus dem Off. Als hätte jemand meine Sinne wieder angeknipst, nahm ich auch mein Umfeld deutlicher wahr: Piepsen und Surren, das Klappern einer Tastatur. Und den Geruch nach Kellerstaub und durchgeschmorten Kabeln. Die Erleichterung ließ mich das Pochen in meinem Schädel für einige Momente vergessen. Ich war in Sicherheit!
»Gizmo?«, flüsterte ich. »Meine Augen…«
»Nimm den Lappen runter«, kam die trockene Antwort. »Aber freu dich nicht zu früh – wenn das Eis weg ist, lässt die Taubheit nach.« Ich konnte den ironischen Unterton in seiner Stimme hören, als er hinzufügte: »Ich wette, Gefrierbrand wäre dir lieber.«
Ich schluckte mühsam und ließ die Informationen langsam in mein Gehirn sickern. Irgendwie hatte ich es geschafft, zu Gizmo zu kommen. Zumindest meine Reflexe hatten nach dem Zusammenprall mit Maurice noch funktioniert. Ganz schwach erinnerte ich mich an den leicht metallischen Geruch des Flusses. Ich war wohl vom Planetarium aus nach Süden abgehauen. Wie war ich über die Brücke gekommen? (Ich hoffte nur, ich hatte Kleidung angehabt!) Was natürlich nur halb so interessant war wie die Frage, wie ich es geschafft hatte, Maurice zu entwischen, bevor er mich ganz auseinandernehmen konnte.
Lappen runternehmen, dachte ich. Eins nach dem anderen. Vorsichtig hob ich die Hand und tastete nach dem Kühlen, das meine Augen bedeckte. Meine Finger streiften meine Stirn. Das fühlte sich nicht gut an. Entweder hatte mir Gizmo einen ziemlich verknautschten Lappen über die Augen gelegt oder mein Gesicht sah aus wie ein ausgebeulter Kartoffelsack. Meine Fingerspitzen berührten kaltes Nass. Es war ein zum Beutel geschlungenes T-Shirt, mit Eiswürfeln gefüllt. Dann bestand für mein Gesicht ja noch Hoffnung. Vorsichtig hob ich den Packen herunter und blinzelte. Verschwommen sah ich Gizmos Keller. Alles auf einem Haufen: seine Macs, gestapelte Kisten, ein Kühlschrank. Leuchtstofflicht und verstaubte Glasbausteine, hinter denen keine Sonne war. War das da draußen noch die Morgendämmerung oder hatte ich etwa den ganzen Tag im Koma verbracht? Ich musste nicht erst auf mein Handgelenk schauen, um zu wissen, dass die Uhr weg war.
»Wie spät ist es?«, nuschelte ich.
Lippe: geschwollen, fuhr ich mit der Liste fort.
Als ich keine Antwort bekam, wandte ich den Kopf zu dem Verhau aus Regalen, die sich scheinbar willkürlich entlang der Wand auftürmten. Dazwischen Gizmos schmaler Rücken und drei Mac-Monitore, auf denen es flimmerte. Programmiercodes auf dem mittleren, rechts und links davon ein Nachrichtenkanal und eine der fünf Stadt-Webcams, deren Bilder Gizmo gerne abrief. Im Moment war die Kamera, die die Skyline am Fluss zeigte, auf dem Schirm. Die Spinnweben und der graue Beton des Kellerraums bildeten einen harten Kontrast zu der Hightech-Szenerie. Ich fragte mich jedes Mal, wie Gizmo die ganzen Frequenzen und Piepsgeräusche aushielt, ohne durchzudrehen.
»Es ist gleich vier Uhr«, beantwortete mir Gizmo endlich meine Frage, während er weiter konzentriert auf der Tastatur herumhämmerte. »Am Nachmittag.«
»Mist!«, stieß ich hervor. »Dann habe ich meine Schicht verpasst.«
Gizmo tippte noch eine Zeile ein und schwang dann auf seinem Bürostuhl zu mir herum. Jedes Mal, wenn ich ihn ansah, konnte ich nicht fassen, dass er sein Geld mit Raubkopien und dem Verkauf geklauter Macs verdiente. Mit seiner runden Brille (einer Attrappe mit Fensterglas, das hielt er vermutlich für witzig) und dem Gesicht eines Klosterschülers wirkte er wie Schwiegermutters Traum. Man wollte ihn an die Sonne schicken, ihm ein Eis kaufen und einen Besuch beim Friseur spendieren, weil sein hellbraunes Haar so aussah, als würde er es bei Bedarf einfach mit der Kabelschere zurückstutzen. Ich vermutete jedenfalls, dass er genau das tat. Mit seinen sehr regelmäßigen Gesichtszügen und dem schlanken Körper sah er nicht schlecht aus, aber er trug fast nur spinatgrüne und türkisfarbene Polohemden. Wer uns zusammen sah, wäre nie auf die Idee kommen, dass wir irgendetwas miteinander zu tun hatten. Aber Kleidung täuscht niemanden über unser Wesen hinweg und spielt deshalb auch keine Rolle für uns. Genauso wenig wie Namen. Ich hatte sogar mal gewusst, wie Gizmo wirklich hieß, aber inzwischen erinnerte ich mich nicht mehr daran.
»Morgen kannst du deine Schicht auch vergessen«, sagte er trocken. »Es wird eine Weile dauern, bis du wieder Kisten schleppen kannst. Schon mal unter die Decke geschaut?«
»Decke« war nett ausgedrückt. Ich lag auf dem alten gelbbraun karierten Sofa vom Sperrmüll, das Gizmo als Bett diente, unter einer Luftpolsterfolie, die eigentlich für die Verpackung von Elektrogeräten gedacht war. Meine Nackenmuskeln begannen zu brennen, als ich mühsam den Kopf hob, bis mein Kinn die Brust berührte. Und als ich die Folie anhob, war wenigstens eine meiner Fragen beantwortet: Ich war tatsächlich nackt. Und quer über meinen Oberschenkel zogen sich vier dick verkrustete Kratzer. In dem Moment, da mein Blick auf sie fiel, fingen sie an, höllisch zu brennen. »Scheiße«, murmelte ich. Dabei hatte Maurice nicht mal richtig zugelangt. Ob er die Erinnerung daran irgendwie bewahrte? Träumte er davon und wachte mit einem zufriedenen Grinsen auf? Ich schwor mir, dass ich das nächste Mal von Anfang an alles vergessen würde: den Kodex, meine eigenen Gesetze – einfach alles. Nun, andererseits würde ich es ganz bestimmt nicht auf ein nächstes Mal anlegen.
In einem Anflug von diffuser Panik bewegte ich meine Füße auf und ab und war erleichtert. Keine Zerrungen und Stauchungen. Obwohl es glimpflich abgelaufen war, hatte ich vor allem auf Zoë und auf mich selbst eine Höllenwut. In diese Geschichte hatte ich mich selbst gründlich reingeritten. Die Verletzung bedeutete, ich würde mindestens eine Woche hinken und außer Gefecht sein. Dazu kam die Gefahr einer Infektion, was ohne Krankenkassenkarte kein Spaß war. Vielleicht würde ich den Job in den Lagerhallen verlieren, vielleicht würde ich nie wieder richtig laufen können und…
»Das kommt schon wieder in Ordnung«, sagte Gizmo beruhigend. Er fing Stimmungen und Ängste ähnlich gut auf wie Irves. Nur spielte er das im Gegensatz zu Irves nicht gegen einen aus.
»Wie bin ich hergekommen?«, wollte ich wissen.
Gizmo lachte, was nicht oft vorkam. Seine Augen wurden dabei schmal – goldbraune, scharfe Augen ohne eine Spur des Schattens. Ich fragte mich, wie er das machte. Die Lehne seines Schreibtischstuhls knarzte, als er sich zurücklehnte und die Arme verschränkte. »Unser Freund Irves hat mich angerufen«, erklärte er und streckte die langen Beine aus. »Muss so um drei Uhr morgens herum gewesen sein. Er war gerade auf dem Weg ins Exil. Er hat mir von deinem Selbstmordkommando erzählt. Und heute Morgen gegen sieben dachte ich, ich schau mal, ob du noch lebst. Aber dein Handy…«
»Weg, ich weiß«, murmelte ich. Verdammt. Auch das noch! Warum hatte ich nicht daran gedacht, es in irgendeinem Mülleimer zu deponieren? Bestimmt hatte Choi mindestens zwanzigmal versucht, mich zu erreichen, weil ich nicht bei der Schicht erschienen war, und sicher war er fuchsteufelswild. Ich konnte es mir nicht leisten, diese Arbeit zu verlieren. Es gab nicht viele Chefs, die Leute ohne Papiere beschäftigten. Neues Handy besorgen, fügte ich meiner Liste hinzu. Choi anrufen. Zu Kreuze kriechen.
»Ich musste heute ohnehin mit dem Lieferwagen in den Norden«, fuhr Gizmo fort, »und auf dem Rückweg habe ich mal auf gut Glück auf der Brücke nachgesehen. Und rate mal, wer sich im Versteck verkrochen hatte?« Er zog vielsagend die Brauen hoch.
Ich biss die Zähne noch fester zusammen.
»Danke fürs Mitnehmen«, sagte ich heiser. Das Seltsame war: Obwohl ich keinen Einfluss auf den Blackout hatte, schämte ich mich. Zum tausendsten Mal fragte ich mich, wie die anderen es ertragen konnten. Klar, vermutlich konnte ich stolz sein, es aus eigener Kraft aus der Todeszone geschafft zu haben. Irgendein Bild drängte an die Oberfläche, etwas, was ich kurz vor dem Blackout gesehen hatte. Doch sosehr ich auch danach suchte, ich fand nur das Gefühl der Angst wieder. Symptom ohne Ursache. Außerdem wollte ich mir lieber nicht vorstellen, wie Gizmos Bergungsaktion an der Brücke ausgesehen hatte. Vielleicht stammten die blauen Flecken an meinen Armen von ihm. Er war weitaus stärker, als er aussah. Auf eine Art war ich sogar froh, auf diese Erinnerung verzichten zu können: nackt in eine Polsterfolie gewickelt zwischen Hehlerware im Lieferwagen durch die Stadt kutschiert zu werden. Tiefer geht es nicht mehr, Gil, dachte ich niedergeschlagen.
»Ich hoffe jedenfalls, das Mädchen war die Aktion wert«, bemerkte Gizmo. »Obwohl es mir immer noch schleierhaft ist, was das Ganze sollte. Du kannst kein Retter in weißer Rüstung sein. Wenn die anderen sie erwischen, erwischen sie sie eben.«
Ich zog scharf die Luft ein. Bisher war ich einfach nur verstimmt gewesen, jetzt aber war ich wütend. Diese dumpfe, pochende Wut, die gefährlich war und nach der ich doch immer wieder die Hände ausstreckte, trotz der Gewissheit, mich daran zu verbrennen.
»Der Dschungelfunk zwischen euch funktioniert ja wirklich gut«, zischte ich. Gerade eben hatte ich noch gedacht, Zoë könnte mir gestohlen bleiben, aber jetzt überkam mich wieder die Sorge um sie. Zumindest letzte Nacht hatte sie mir zu verdanken gehabt, dass sie ruhig schlafen konnte. Und heute Morgen aufstehen und ihr Leben leben wie an jedem anderen Tag. Seit so ziemlich genau fünf Monaten wusste ich, wie unendlich kostbar das war. Doch, ein Retter in weißer Rüstung, genau das war ich!
»Lass sie aus dem Spiel«, knurrte ich. gereizt »Das ist meine Sache.«
»Deine Sache?«, erwiderte Gizmo lakonisch. »Sieh zu, dass du dich um deinen eigenen Kram kümmerst.«
»Jeder für sich«, murmelte ich bitter. »Keiner für alle.«