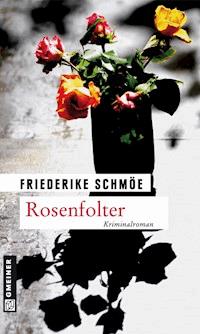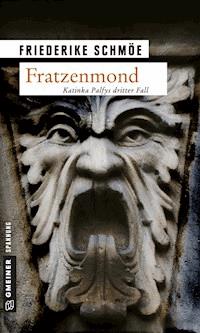Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Ein eiskalter dritter Advent. Die resolute Drummerin Ilsa hat ihren Mann verlassen und ist auf dem Weg in ihr Ferienhaus. An einer Tankstelle liest sie die völlig verstörte Moni auf. Kurzerhand nimmt Ilsa sie mit in die Fränkische Schweiz. Monis Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Sie wiederholt ein ums andere Mal, dass sich ein Wagen überschlagen hat und jemand ums Leben kam. Doch wer? Und worauf ist der Typ aus, der einige Tage vor Weihnachten plötzlich beim Ferienhaus auftaucht? Bevor Ilsa die Zusammenhänge begreift, eskaliert die Lage …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friederike Schmöe
Schaurige Weihnacht überall
Ein eiskalter Weihnachtskrimi
Zum Buch
Eiskalter Mord Am dritten Advent verlässt Drummerin Ilsa ihren Mann; sie träumt davon, als Komponistin zu arbeiten, und fühlt sich von ihm nicht ernst genommen. Ihr Ziel ist ihr Ferienhaus in der fränkischen Schweiz. An einer abgelegenen Tankstelle stößt sie auf Moni: die junge Frau ist verletzt, blutbefleckt und völlig verstört. Es schneit, die Temperaturen fallen: Kurzerhand nimmt Ilsa Moni mit in ihr Ferienhaus. Doch die beiden Frauen sind grundverschieden: Ilsa ist eine resolute Persönlichkeit voller Freiheitsdrang. Moni ist harmoniesüchtig – und ihre Erinnerung an jene blutige Nacht ein weißer Fleck. Langsam tastet sich Ilsa an Monis Vergangenheit heran: Sie erfährt von ihrem Freund Gerolf. Er scheint an einer Persönlichkeitsstörung zu leiden, fügt Moni immer wieder Verletzungen zu und verleumdet sie bei ihren Freunden. Ilsa ist hin- und hergerissen: Hat Gerolf versucht, Moni zu töten? Oder hat Moni ihren Freund umgebracht? Kurz vor Weihnachten taucht ein Typ beim Ferienhaus auf. Ilsa nimmt es mit dem Unbekannten auf – sie will endlich die Wahrheit herausfinden.
Geboren und aufgewachsen in Coburg, wurde Friederike Schmöe früh zur Büchernärrin – eine Leidenschaft, der die Universitätsdozentin heute beruflich nachgeht. In ihrer Schreibwerkstatt in der Weltkulturerbestadt Bamberg verfasst sie seit 2000 Kriminalromane und Kurzgeschichten, gibt Kreativitätskurse für Kinder und Erwachsene und veranstaltet Literaturevents, auf denen sie in Begleitung von Musikern aus ihren Werken liest. Ihr literarisches Universum umfasst unter anderem die Krimireihen um die Bamberger Privatdetektivin Katinka Palfy und die Münchner Ghostwriterin Kea Laverde.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Gortincoiel / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4184-4
0
16. Dezember 2013
Die Bässe schlugen in das Hirn des jungen Mannes. Er hielt sich an seinem Bier fest. Seine großen Hände verbargen das Etikett. Es musste ja nicht jeder gleich sehen, dass er Jever Fun trank.
Er lehnte am Türstock und starrte in die verrauchte Küche. Die Party war in vollem Gang. Er kannte kaum einen Bruchteil der Leute. Fast alles Jura-Studenten, von denen die meisten nicht in seiner Liga spielten. Genauer gesagt spielte er nicht in ihrer. Er wollte Lehrer werden. Aber das war nur ein Teil des Problems.
Außer ihm hingen noch ein paar Lehramtsstudenten auf der Party herum und eine rothaarige Tussi, von der er wusste, dass sie in Psychologie eingeschrieben war. Sie war mollig und hatte ein teigiges Gesicht. Nicht sein Typ.
Er nahm einen Schluck. Das Bier war längst warm. Jacko mixte einen Cocktail nach dem anderen. Er hatte seine Utensilien auf dem Ceran-Kochfeld eines megagroßen Herds aufgebaut. Alles schwamm: Tomatensaft, Fruchtsaft, Zucker. Obwohl das Zeug unappetitlich aussah, hätte der junge Mann gern einen eiskalten Drink gehabt. Irgendeinen Mix aus Tequila und ein bisschen Farbe. Aber das kam nicht infrage. Er musste nüchtern bleiben.
Der Eiscrusher machte einen Heidenradau. Die Rothaarige baute sich davor auf und quatschte auf Jacko ein. Wie irgendjemand bei diesem Lärm überhaupt irgendwas verstehen konnte, war dem Studenten mit dem Jever Fun in der Hand schleierhaft. Die Musik aus der Stereoanlage im Wohnzimmer schien das ganze Haus zu durchdringen, die Wände zu tränken, die Decken und jeden verfluchten Stein dieses mega-angeberischen Anwesens.
Er stieß sich vom Türstock ab und ging in die Diele. Jemand hatte Jumbo-Sitzsäcke ausgelegt. Ein Pärchen ging auf einem quietschgrünen Sack zur Sache. In dem anderen hockte die Frau, für die er etwas übrig hatte.
Sie war schlank und hatte lange Beine. Und diese unglaublich strahlenden grauen Augen! Doch sie sah traurig aus. Das Haar hing ihr strähnig ins Gesicht. Sie hätte durchaus mehr aus sich machen können. Er ahnte, dass es jemandem anderen auch gefallen würde, wenn Moni mehr auf ihr Äußeres achtete. Aber das war jetzt nicht sein Problem. Er schaute auf die inneren Werte. Obwohl er sich natürlich von runden Brüsten begeistern ließ, das stand außer Frage.
Moni schien in ihrem Pulli zu schwitzen. Sie hatte die Ärmel ein klein bisschen hochgeschoben, sodass man ihre Handgelenke sehen konnte. Sie trug ein Armband, grüne Steine. Es sah teuer aus. Er fasste sich ein Herz.
»Willst du was trinken?«, fragte er.
»Ein Wasser.« Das kam leise und tonlos. Moni wandte den Blick ab. Man hätte auch meinen können, dass sie gar nichts gesagt hätte.
Er ging zurück in die Küche. Jacko machte mit der Rothaarigen rum. Er war ein verdammt guter Kerl, lud massenweise Leute ein, und Partys wie diese, mit einem Spanferkel, das draußen im Garten auf einem Spieß gegrillt wurde, mehreren Fässern Bier, die im Schnee kühlten, und den ganzen Cocktails, schmiss er mehrmals im Jahr. Seine Eltern arbeiteten als Anwälte für einen Riesenkonzern. Sie verbrachten den ganzen Dezember in Dubai.
Der Student guckte in den Kühlschrank. Der war bis obenhin mit Weißwein vollgestopft. Kein Wasser. Er trat zum Hahn und ließ Leitungswasser in ein Glas, spülte es sorgfältig aus und füllte es erneut. Dann ging er zu Moni. Aber neben ihr stand schon der Kerl.
Es wäre ziemlich unvernünftig, ihr das Wasser jetzt in die Hand zu drücken. Wobei es keine Gefahr für den zukünftigen Lehrer gäbe. Nur für Moni.
Er trank selbst von dem Wasser, während er cool ins Wohnzimmer weiterschlenderte, als würde er Moni gar nicht sehen. Er presste das Glas an seine Stirn. Es war schön kalt.
Plötzlich kehrte die Anspannung zurück, die ihn den ganzen Tag auf Trab gehalten hatte. Die Ahnung von Gefahr machte sich in den Räumen voller Zigarettenqualm breit. Wenn er überhaupt auf solche Partys ging, dann aus einem ganz bestimmten Grund. Er dachte an das grüne Armband. Ob das Smaragde waren? Ständig fürchtete er, Moni könnte irgendwann einen Verlobungsring tragen. Sogar ohne Ring war es beinahe zu spät. Er musste eingreifen, bevor alles den Bach runterging. Er machte sich wirklich Sorgen! Deswegen also ging er zu Partys. Er spielte gut Freund mit Typen wie Jacko, um einen Fuß in der Tür zu haben. Das Wohnzimmer war überheizt. Ein paar Leute zogen sich eine Linie und guckten den Neuankömmling betreten an. Außer Jacko war hier keiner großzügig. Ein späterer Lehrer, der nicht zum Club gehörte, stand nicht auf der Liste der potenziellen Kokser. Er machte kehrt. Trat in die Diele.
Monis Typ drehte sich langsam um. Der Student achtete nicht auf ihn, sondern wandte seinen Blick dem knutschenden Pärchen zu. Der Sitzsack erwies sich für die beiden mittlerweile als zu schmal, und sie machten alle möglichen Verrenkungen, um an die richtigen Stellen zu kommen. Aus den Augenwinkeln sah der Student, wie Monis Kerl ihn begutachtete. Der Knabe war nicht blöd.
Der Lehramtsstudent war außerordentlich vorsichtig, denn er hatte in seinem Leben schmerzhaft lernen müssen, dass es dumm war, einen Gegner zu unterschätzen und in unklaren Situationen impulsiv zu handeln, ohne ausreichende Informationen zu besitzen. Das würde ihm nicht noch mal passieren.
Jacko stolperte aus der Küche und stieß ihn dabei an. »He, Bruder, die Psychotante ist ganz schön auf Zack!« Er lachte. Am Hals zeichnete sich ein riesiger Knutschfleck ab.
»Cool, Mann!« Der Student, der fremd war in dieser Umgebung, schlug dem Gastgeber auf die Schulter. Es war wichtig, sich kumpelhaft zu geben, das ganz normale Programm abzuziehen. Deshalb würde er sich gleich noch ein Bier holen.
Jetzt zog der Typ Moni vom Sitzsack hoch. Er packte sie an den Armen und zog sie dicht zu sich heran. Sein Gesicht war nur Millimeter von ihrem entfernt.
Der Student konnte ihre Angst riechen.
»Alter, willst du einen Drink?«, fragte Jacko.
»Nein.«
»Immer noch auf dem Abstinenzlertrip?« Jacko lachte laut, aber gegen die Bässe kam er nicht an.
Der Student zuckte die Achseln.
»Klar, du willst nicht darüber sprechen. Kann ich ja verstehen. Du könntest sogar hier übernachten! Die Putze kommt erst morgen Nachmittag.«
»Ein andermal, okay?«
Jacko grinste und hob den Daumen. »Schon klar!«
Genau in diesem Augenblick verstummte die Musik. Die unerwartete Stille schlug gegen die Wände, warf sich gegen die Menschen in der Diele. Der Student schnappte nach Luft.
Für Sekunden stand die Zeit still. Der Raum um ihn schien aus Glas zu sein. Sein Blick wanderte zu Moni und dem Kerl, und der schaute ihn an. Ohne jegliche Zurückhaltung. Lauernd und gefährlich.
Es ist nicht für mich gefährlich, versuchte er sich zu beruhigen, während sein Herz hämmerte wie ein Schlagbohrer. Sondern für Moni. Jedenfalls würde das alles nicht mehr lange dauern. Jeder konnte seine Lektionen lernen, sogar so ein Fatzke wie Monis Typ.
»Na, dann schauen wir mal, ob unser DJ umgekippt ist!«, juxte Jacko und tappte mit unsicheren Schritten Richtung Wohnzimmer. Damit durchbrach er die unheimliche Stille.
»Wir gehen«, sagte Monis Typ, und Moni nickte. Sie sah ihren Freund nicht dabei an. Sie sah auch den Studenten nicht an und hatte keinen Blick für das Pärchen, das mittlerweile vom Sitzsack gerollt war und nun auf dem Teppich knutschte.
1
Das mit dem Spielen ist nur am Anfang gut. Da spürst du den Drive, den Flow, den Typen wie ich sonst ausschließlich vom Drummen kennen. Dass plötzlich alles weich ist und schön und so richtig genau ineinanderpasst, die Ordnung der Welt, du schiebst die Türen zum Paradies auf und kommst in eine Art Vorraum, und freust dich auf das, was hinter der nächsten Tür liegt.
Du gewinnst. Du verlierst manchmal, eigentlich sogar ziemlich oft, aber in deiner Eigenwahrnehmung gewinnst du.
Danach beginnt die Konsolidierungsphase. Du knallst dir die Birne weich. Du bist nicht mehr du selbst, nur ein Objekt, das im Sinne von irgendwas agiert, und dieses irgendwas verstehst du nicht mal mehr. Du starrst mit roten Augen auf den Bildschirm, bewegst mit dem Cursor animierte Karten und verfestigst dich zu einem erstarrten Gewebe. Du lässt Telefone ins Unendliche klingeln, Suppe anbrennen, deine Freunde in Cafés warten. Du bist in der Garderobe der Hölle gelandet und findest den Rückweg nicht.
Ich konnte nicht mehr. Schon lange. Ich gab es nur nicht zu. Später stellte ich fest, dass ich 88 Prozent aller Spiele verloren hatte. Und eine Menge Kohle dazu. Aber es ging nicht allein ums Geld. Auch nicht ums Gewinnen und Verlieren. Es ging um Zeit und Energie. Ich hing monatelang mit leerem Blick herum, klickte mich morgens in die entsprechenden Gamerooms im Internet. Blieb drin, bis ich nur noch kleine Quadrate vor meinen Augen sah, und trank Kaffee und Weizenbier, um mich bei Laune zu halten und den widerlichen Geschmack nach Fahrradschlauch aus meinem Mund zu vertreiben.
Im Prinzip hatte es im vergangenen März angefangen. Sie sagen, allein drei gerauchte Zigaretten machen schon abhängig. Ich sage, drei Spiele an einem einzigen Abend, und du bist verratzt.
Hungrig starrte ich auf den Computer. Piet war so was von durchgedreht! Er hatte den Laptop vom Netzwerkkabel gerissen, hatte ihn auf die Tischplatte geknallt, wieder und wieder, und das war weder dem Laptop noch dem Tisch bekommen. Der Computer lief nicht mehr.
Ich war auf kaltem Entzug.
Ich muss zugeben, Piet tat damals, als er mitbekam, wie es um mich stand, alles, um mir zu helfen. Er meldete mich bei einer Selbsthilfegruppe an und trat mir 20.000 Mal in den Arsch, damit ich hinging. Ich suchte einen Psychoheini auf und machte eine Therapie. Ich quatschte stundenlang über meine Spielsucht, aber der einzige Gewinn war, dass ich währenddessen eben nicht spielen konnte. Danach ging ich in ein Starbucks und pfiff mir einen halben Liter Kaffee rein, weil das gut gemeinte Gequatsche so öde und vorhersagbar war, dass ich davon regelrecht verblödete. Ich bildete mir ein, das Spielen wäre im Vergleich zur Therapie der absolute Kreativflow gewesen.
Das stimmte natürlich nicht, und etwas in mir wusste, dass ich mir was vormachte. Ich kam schlicht nicht darüber hinweg, dass ich nun auch zu den Millionen durchgedrehter Deutscher gehörte, die ihr Glück bei einer Therapie suchten.
Der Therapeut war ein netter Kerl; er hieß Heiner und trug zu seinen Jeans und Flachwichser-Slippers ein kariertes Sakko mit Lederapplikationen am Ellenbogen. Ich war wahrhaftig tief gesunken.
Mit manchem indes hatte Heiner recht: Ich brauchte einen Sinn im Leben.
Meine Ehe war okay, aber nichts, was meinem Dasein in irgendeiner Form einen Sinn verliehen hätte. Das bisschen Sex war trostlos. Ich empfand ebenso wenig Befriedigung darin, Piet schick zu bekochen, obwohl ich es ein paar Wochen lang versuchte und sogar teure Hochglanz-Foodmagazine kaufte. Und schließlich hatte ich auch beruflich gerade nichts zu lachen.
Meine Band war zerbrochen. Skunky Pie existierte nicht mehr. Der Bassist war Vater von Zwillingen geworden, die Frontfrau hatte einen Job bei einer Produktionsfirma angenommen und war auf einen Dreh nach Australien abgehauen. Der Gitarrist wollte sowieso schon länger aufhören, und der Techniker war ins Kiffen abgerutscht. Spielen ist nichts anderes als Kiffen ohne Gras, und insofern waren wir beide auf dem absteigenden Ast: Uns war alles vollkommen egal.
Heiner motivierte mich, einen anderen Sinn in meiner Existenz zu suchen, und wenn ich keinen finden könnte, dann eben selbst so einen Sinn zu erschaffen, als könnte man flugs ein bisschen Ton in die Hände nehmen und ihn formen und brennen und hinstellen und sagen: Hier, das ist doch jetzt ein toller Sinn in meinem Leben.
Die meisten Menschen haben keinen. Sie bilden ihn sich ein. Das macht den Unterschied. Aufstehen, frühstücken, scheißen, zur Schule, Uni, Arbeit, sich abrackern, Haus kaufen, Kinder kriegen, großziehen und zusehen, wie sie in derselben Plattenrille festhängen. Sie sehen, ich hatte eine extrem negative Phase. Letztlich war es Piet, mein Mann, der mich auf die rettende Idee brachte: Schreib doch Songs!
Um einen Song zu schreiben, brauchst du keine Band. Du brauchst nur dich und einen Stift und Papier.
Ich fing an.
Wenn ich zurückdenke – es waren ein paar geniale Wochen. Ich vertiefte mich bis zum Anschlag in Bücher über das Songschreiben, ich experimentierte, schrieb, vernichtete. Schließlich hatte ich drei Balladen zusammen. Ich verklickerte Piet, dass ich meinen PC brauchte, um meine Texte ins Reine zu schreiben und vielleicht Verlagen und Plattenlabels zu mailen, sobald ich der Meinung war, dass sie gut genug waren.
Piet fand das in Ordnung.
Ich spielte nicht. Wirklich nicht. Die Spielplattformen waren für mich tabu. Ich klickte sie nicht einmal an. Ansonsten hätte sich der Automatismus sofort über mich gestülpt, wie ein willenloser Koala wäre ich der Verführung durch die Eukalyptusblätter des Spieleflows verfallen.
Also spielte ich nicht mehr und drummte nicht mehr. Ich schrieb nur noch Songs.
Was jedoch weder der superschlaue Heiner noch der wohlmeinende Piet kapiert hatten: Der Sinn, der aus dem Schreiben von Songs für klasse Bands erwachsen sollte, würde nur so lange existieren, wie ich Freude am Schreiben selbst empfand. Doch ich wollte meine Produkte natürlich verkaufen. Ich wollte, dass eine Band die Songs spielte. Dass ich sie auf MTV hören und die passenden Videos sehen könnte. Okay, wenn sie es nicht bis in die Fernsehstudios schafften, so wenigstens in die angesagten Berliner Clubs.
Ich hängte mich rein. Ich schrieb Bands und Künstler an, von denen ich meinte, die hätten das Zeug für meine Songs. Meistens bekam ich überhaupt keine Antwort. Gerade mal zwei schrieben fairerweise Absagen, und die Mails habe ich ausgedruckt und aufgehoben, einfach um die Freundlichkeit und Menschenkenntnis dieser Leute zu ehren: Für sie war ich keine Null, sondern ein menschliches Wesen, das eine ehrliche Antwort verdient hatte.
Es war absehbar: Ich würde wieder in die Sucht kippen. Am Frust lag der Rückfall nicht; eher an der Langeweile. Ich hatte nichts zu üben, nichts zu schreiben, nicht einmal die Aussicht auf einen Auftritt in irgendeinem drittklassigen Club. Einen Job hatte ich auch nicht, weil ja Skunky Pie mein Job gewesen war, und um Missverständnissen vorzubeugen muss ich sagen, dass wir ein paar echt gute Jahre hatten. Wir haben ganz schön abgeräumt, und in Berlin kamen wir überall gut an. Letztes Jahr wurden wir in einem Club sogar fest für die ganze Saison gebucht, und das war großartig, dieser Stress, dieses »ich muss noch üben, scheiße, wir haben jetzt jede Woche einen Auftritt«. Ich fühlte mich wie ein Börsenbroker, der weiß, dass es echt drauf ankommt. Es war genau die richtige Situation für meinen Stoffwechsel.
Beim Spielen ist das genauso. Du bist an einer bestimmten Position im Spiel und spürst, es könnte jetzt den Bach runtergehen. Es geht sehr wahrscheinlich den Bach runter. Also konzentrier dich. Denk nach. Wäge deine Möglichkeiten sorgfältig ab, sehr sorgfältig, denn sonst ist es gleich zu spät und deine Schulden wachsen …
Heiner hatte ziemlich daneben gelegen. Ich brauchte nicht nur einen Sinn: Ich brauchte auch Aufregung, Nervenkitzel, Unberechenbares. Mit Skunky Pie hatte ich ein paar Jahre in fortwährender Suspense zugebracht, der Kick hatte so gut wie nie nachgelassen, erst dann, wenn nach einem echt gelungenen Gig der Techniker für jeden ein bisschen Gras spendierte.
Müde starrte ich auf den zerstörten Laptop und die zerbrochene Tischplatte. Die Sinnlosigkeit von Piets Kraftattacke rührte mich fast. Ich fühlte mich wie eine zertretene Laus. Falls zertretene Läuse überhaupt irgendetwas fühlen.
Noch vor ein paar Wochen hätte ich ihm abgekauft, dass er es aus Sorge um mich tat. Um mich von der Sucht wegzuholen. Dabei konnte man das nicht. Niemand konnte einen anderen aus der Sucht rausziehen. Man schaffte das nur selbst. Hatte Heiner doch ständig gepredigt: »Auf dich kommt es an, auf dich selbst!«
Ich hätte kotzen können.
Piet hatte schlicht die Nase voll.
Und endlich hatte er die Wahrheit gesagt, als er den Computer stakkatomäßig auf den Tisch krachen ließ. Die Wahrheit, die er seit Wochen als ›berufliche Veränderung‹ etikettierte, obwohl ich genau wusste, dass die berufliche Veränderung einen Namen hatte: Anita.
Ich sagte es ihm auf den Kopf zu. In dem Moment war er so konsterniert, dass er den Computer fast fallen gelassen hätte, worauf es natürlich auch nicht mehr angekommen wäre.
»Piet«, sagte ich so gelassen wie möglich, »du hast dein Facebook-Konto nie geschlossen, wenn du den PC runtergefahren hast. Ich habe mitgelesen. Chat mit Anita.«
Er wurde blass.
»Du hintergehst mich!«, brüllte er. Ein Plastikteil löste sich vom Laptop und schepperte gegen die Wand.
»Spinnst du?«, kreischte ich zurück. »Du hintergehst mich! Hängst dich an eine Tante namens Anita ran? Wie lange schon, hä?«
Wir warfen einander die üblichen Dinge an den Kopf, die bereits Milliarden von Malen ins Universum hinausgeschrien worden sind; immer dann, wenn Enttäuschung, Untreue, Eifersucht und die passenden unausgesprochenen Spitzfindigkeiten sich zu einer Munitionsmischung vermixen und explodieren. Ich erspare Ihnen die Details.
Piet war gegangen. Hatte einen Koffer gepackt und die Wohnung verlassen. Ich trat gegen die schiefe Tischplatte, die noch ein Stück weiter aus ihrer ursprünglichen Position rutschte, und ging in den Keller. Ein letztes Mal wollte ich mit meinen Drums allein sein.
Ich nahm die Stöcke in die Hand. Mein Kopf war voller Kleister. Ich taktete mich ein. Und begann zu trommeln.
›Drummen‹, das Wort trifft es für mich besser. Ich selbst werde zur Drum, zum Stock, zum Rhythmus. Ich fange an, lasse mich einfach fallen in einen Viervierteltakt, und es beginnt von selbst. Das ist das Geheimnis der Musik: Du machst sie nicht. Niemals. Sie kommt aus dem Kosmos und sucht sich durch den Musiker einen Weg in die Realität.
Der Rhythmus hob mich von meinem Sitz. Ich flatterte zuerst unwuchtig, schlug mit den Flügeln, bis ich in den Gleichklang fand und meine Hände, meine Füße von allein alles taten, was sie für das große Diktat des Weltenraums tun mussten. Ich drummte. Ich war Trommel, ich war Stock, ich war Klang, ich war Rhythmus. Mein Geist zischte wie eine Flipperkugel durch den Übungsraum, ein tristes, schallisoliertes Kellerabteil, die Königssuite dieser außerordentlichen Minuten, die vor meinen Augen nach und nach verschwamm. Mein Puls beschleunigte. Schweiß trat mir auf die Stirn und rann an meinen Schläfen herab. Meine Haare klebten an den Ohren. Ich hatte den Mund leicht geöffnet und atmete schubweise. Ich war im Flow.
Besser als beim Spielen. Besser als beim Kiffen. Besser als bei allem.
Nur ein Musiker kann das verstehen. Nur ein Drummer.
Ich habe keine Ahnung, wie lang ich meine Trommeln schlug, fegte, bürstete. Irgendwann durchdrang mich eine sanfte Mattheit, so wie sie aufkommt, wenn man lange geweint hat. Man ist sediert, irgendwie. Man möchte sich zusammenringeln und schlafen. Ich legte die Stöcke weg. In meinem Hirn zerstob etwas Weißes. Der Kellerraum tauchte allmählich vor meinen Augen wieder auf, die Drums, das schmuddelige Skunky-Pie-Poster an der Wand gegenüber.
Ich strich sanft über das Becken und lauschte dem zarten Sirren, das meine Ohren streichelte. Schließlich stand ich auf, löschte das Licht, ließ die Tür offen stehen und ging in die Wohnung hinauf. Ich packte ein paar warme Klamotten, Brot, Salami, zwei Flaschen Rotwein und eine Packung Tilsiter in meinen Tramperrucksack, außerdem den mp3-Spieler und all das Kleinzeug, auf das eine Frau so angewiesen ist, schob den Schlüssel vom Ferienhaus in meine Jeanstasche, hievte den Rucksack die Treppen runter und setzte ihn auf den Beifahrersitz meines Autos.
Ich wollte mich gerade hinter das Steuer klemmen, als ich mich besann und noch einmal zurückging. Ich holte die Congas aus dem Keller und warf sie in die Klappkiste im Kofferraum. Darin lagen ein paar Wasserflaschen, Kekse, ein Schlafsack und eine Taschenlampe. Ich warf einen Blick auf mein Handy, schaltete es aus und schob es in die Anoraktasche.
Dann hockte ich mich endlich hinter das Steuer und ließ den Motor an.
Endlich raus aus Berlin. Weg hier. Zurück in die Welt, die ich irgendwann aus Größenwahn verlassen hatte. Die Uhr am Armaturenbrett zeigte 18.00 Uhr.
Nebel glitt in Schwaden über den Asphalt. An den Fenstern der Nachbarhäuser blinkten Weihnachtsbeleuchtungen. Dritter Advent.
Als ich auf den Avus auffuhr, tätschelte ich dem Rucksack die dicke Haube.
2
Ich fuhr und fuhr, das Radio auf voller Lautstärke, bis ich die Grenze zu Bayern überquerte. An der nächstbesten Raststätte hielt ich an, einem monumentalen Gebilde mit einem über die Fahrbahnen gebauten Restaurant. Ich stellte den Motor ab und starrte eine Weile in die Dunkelheit. Minus sieben Grad. Auch hier überall Weihnachtsbeleuchtung. Ich fragte mich, wo Piet steckte, und tadelte mich, dass ich überhaupt einen Gedanken an den untreuen Fatzke verschwendete. Natürlich steckte er bei Anita. Wo sonst.
Ich stiefelte in das Restaurant hinauf. Amerikanische Weihnachtslieder troffen aus allen Ritzen. Als Musiker achtest du auf so was. Du kriegst sofort zu viel, wenn die Geräuschkulisse und die Musik gegeneinander anrennen, als müsste einer den anderen von der Bühne drängen.
Ich kaufte mir ein Brötchen mit Käse und Ei und einen Kaffee. Versteckt am dunkelsten Ende des wahrhaft riesigen Gastraums waren ein paar Spielautomaten angebracht. Abrupt drehte ich mich um und setzte mich so, dass ich sie nicht sah. Aber ich hörte ihr Gejaule und plötzlich ein vielversprechendes Klirren und Klackern, als einer der Automaten Geld ausspuckte. Meine Kopfhaut juckte. Ich schüttete den Kaffee in mich hinein, biss zweimal vom Brötchen ab und verließ fluchtartig das Restaurant.
Im Waschraum spritzte ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Was ich im Spiegel sah, gefiel mir nicht. Ich trug einen grauen Wollpulli, der mich unter den Neonröhren wie eine Knastschwester aussehen ließ, genauso wie die bleiche Gesichtsfarbe und die strähnigen Haare.
Seit ich von Piets beruflicher Veränderung mit dem Namen Anita wusste, ließ ich mich gehen. Mein sonst immer volles braunes Haar hing traurig an den Seiten herab. Es brauchte dringend eine Spülung oder eine Packung Glanz. Ich hatte abgenommen, und das sah man zuerst im Gesicht. Die Wangenknochen traten gespenstisch weit hervor.
Vielleicht war ich auch nur müde von der Fahrt.
Als ich zum Parkplatz zurückging, trat mir ein Plüschnikolaus in den Weg und hielt mir einen Flyer hin, den ich nahm und sofort fallen ließ. Nicht mal zu einem kleinen Zweikampf mit dem Nikolaus war ich aufgelegt!
Ich klemmte den mp3-Spieler ans Autoradio und hörte die nächsten 100 Kilometer alte Skunky-Pie-Songs. Beim Fahren analysierte ich das Potenzial, das in unserer Musik steckte. Während Connie, die Frontfrau, Silbe um Silbe schmetterte, tänzelte ich im Geiste mit den Drums mit.
Endlich verließ ich die Autobahn und schaltete die Musik ab. Ich musste mich konzentrieren.
Ich bin hier im Norden Bayerns zur Welt gekommen. Meine Eltern waren beide Vertriebenenkinder aus dem Sudetenland, allerdings schon in Franken geboren. Aber selbst ich, in der zweiten Generation sozusagen, gehörte nie richtig dazu. Jedenfalls nicht auf dem Land. Dort, wo unser Ferienhaus liegt, das meine Eltern mir vererbt haben. Sie sind vor ein paar Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Häuschen gehört jetzt mir. Es liegt in einem einsamen Dorf in der Fränkischen Schweiz namens Rothenfels, klebt sozusagen an einem den Ort überragenden Felsen, wie es in der Gegend häufig vorkommt, und wäre eigentlich eine ideale Geldmaschine. Gestresste Städter machen nach wie vor gern auf dem Land Urlaub. Mit ein bisschen Renovierung könnte ich ein prima Bed&Breakfast vermieten.
Allerdings hatte meine Spielsucht die Planungen nicht richtig in die Gänge kommen lassen. Und zuvor stand meine Karriere mit Skunky Pie im Vordergrund. Ich war seit Langem nicht in Rothenfels gewesen. Mein Nachbar, Bernhard Wich, schaute im Haus nach dem Rechten.
Jetzt, wo das Kapitel Ehe geschlossen war, wurde es wohl Zeit, ein paar Seiten umzublättern und mit etwas Neuem zu beginnen. Warum nicht hier!
Ich rollte auf der Bundesstraße dahin, die mich durch Dörfer führte, winzige Ansiedlungen, in denen die Menschen vor dem Fernseher saßen und auf Weihnachten warteten. Einfach deshalb, weil sie das jedes Jahr machten. Schließlich bog ich zu einer Tankstelle ab, deren blassblauer Neonschein in den Nebel hinausleuchtete.
Ich tankte. Außerdem musste ich aufs Klo. Ich fragte den Hänfling hinter der Kasse nach der Toilette und bekam eine Kehrschaufel, an der ein Schlüssel hing. Genervt stapfte ich durch matschiges Laub und Schneereste um die Tanke herum. Auf der Rückseite des Gebäudes, im toten Winkel einer Autowaschanlage, für die sich an diesem späten Abend niemand mehr interessierte, war es finster wie im Arsch der Hölle. Ich tastete mich zur Toilettentür. Schob den Schlüssel ins Schloss, wobei sich die Kehrschaufel an der Klinke verkantete. Fluchend rüttelte ich an der Klinke, bis ich endlich die Tür offen hatte. Ich suchte den Lichtschalter. Gleißend hell flammte Neonlicht auf. Geblendet kniff ich die Augen zusammen. Ich knallte die Tür zu.
Während ich auf dem Klo hockte, glaubte ich, Schritte draußen zu hören. Ein Vergewaltiger, der ein Opfer suchte, war hier genau an der richtigen Stelle. Auf der Rückseite eines Tankstellengebäudes in stockfinsterer Nacht ohne Außenbeleuchtung.
Hörte ich wirklich Schritte?
Ich spülte und wusch mir die Hände. Irgendein Tölpel hatte einen Tannenzweig mit roter Kugel am Spiegel befestigt. Ich hatte größte Lust, ihn abzureißen und in die Kloschüssel zu schleudern.
Nicht abgleiten jetzt! Alles nur Fantasie. Da draußen war die Wirklichkeit, und die war in den meisten Fällen harmlos.
Trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl, als ich den Schlüssel drehte und hinaus in die Nacht trat. Ich löschte das Licht, ließ die Tür ins Schloss fallen. Alles war schwarz wie Tinte.
Am liebsten hätte ich die Kehrschaufel mitsamt dem Schlüssel fallen lassen und wäre losgerannt. Meine Finger juckten. Sie bewegten sich wie von selbst, zappelten wie hyperaktive Kinder.
Ich hörte – scheiße noch mal – Schritte. Und noch etwas. Ein Schluchzen.
Ich war ein stolzer Mensch und hatte noch nie um Hilfe gerufen. Bisher hatte es sich sozusagen nicht ergeben. Und jetzt, in diesem tiefseeschwarzen Augenblick hinter einer versifften Tankstelle in der Fränkischen Schweiz, wollte ich den Anfang nicht machen. Es war ohnehin fraglich, ob der Hänfling hinter seiner Kasse mich hören würde.
»Hallo?«, rief ich. Es kam nur ein heiseres Flüstern aus meinem Mund. Meine Beine wollten laufen, ohne dass ich ihnen den Befehl dazu gegeben hatte. Meine Lungen pumpten stoßweise Atemluft in sich hinein, durch den geöffneten Mund, und meine Zähne fühlten sich so kalt an, dass ich fürchtete, sie würden gleich allesamt aus meinem Mund fallen.
»Hallo?«
Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Schiet, warum installierte der Hänfling nicht wenigstens einen Bewegungsmelder?
Die Kehrschaufel in der erhobenen Faust, suchte ich Sicherheit an der rauen Betonwand der Tankstelle. Seitwärts bewegte ich mich zur Ecke.
Jemand schluchzte. Trockene Schluchzer in Schüben kamen aus der Finsternis hinter der Waschanlage. In der Nacht war sie nicht in Betrieb und schon gar nicht beleuchtet. Wahrscheinlich musste der Petro-Großkonzern, zu dem die Tanke gehörte, Strom sparen.
Eigentlich hätte ich abhauen sollen. Rein ins Auto und weg. Was ging es mich an, wenn jemand den lausigsten Ort in dieser Gegend ausgesucht hatte, um zu heulen? Um den Verflossenen, eine versaute Prüfung oder sonst was, das sich alsbald als unwichtig herausstellen würde?
Aber ich stieß mich von der Wand ab und ging Schritt für Schritt auf das kehlige Schluchzen zu. Umrundete die Waschanlage und sah vor mir – eine junge Frau. Typ Studentin. Oder Sachbearbeiterin. Oder … egal. Sie hatte langes blondes Haar, das ihr feucht vom Nebel über die Schultern fiel. Trug keine Jacke. Nur einen Troyer und Jeans. Starrte auf ihre Hände und schluchzte. Sie stieß trockene, heisere Laute aus, die mich an die Stimmbandentzündung unserer Frontfrau nach einer langen Auftrittssession erinnerten.
»He!«, rief ich. »Was ist los?«