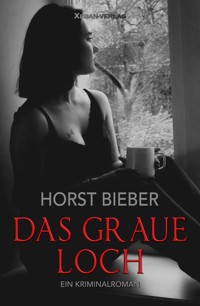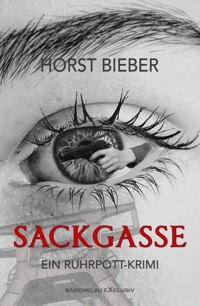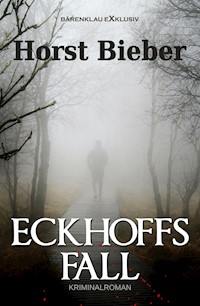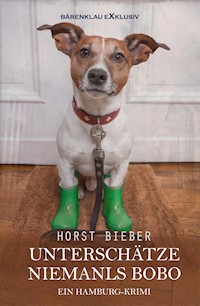3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kriminalrat Wegener ist des Mordes an seiner Frau Gesine angeklagt. Das Gericht spricht ihn zwar frei, weil die Beweise nicht ausreichen, aber damit ist seine Karriere am Ende. Vom Dienst suspendiert, zieht er in das Dorf und in das Haus, in dem seine Frau seit ihrer Trennung gelebt hat. Hier sucht er Indizien, die ihn auf die Spur des Mörders führen könnten.
Die Dorfbewohner reagieren mit Verachtung und offener Feindseligkeit. Wegener erhält anonyme Drohbriefe. Dann entgeht er knapp einem Mordanschlag. Wollen die Dorfbewohner nur einen vermeintlichen Mörder verjagen oder steckt etwas anderes dahinter?
Wegener versucht, die Vergangenheit seiner Frau aufzuhellen. Wer könnte ein Motiv haben, sie umzubringen? Er findet heraus, dass sie offensichtlich erpresst worden ist. Es tauchen Hinweise auf, dass sie Kontakt zu zwei Kriminellen gehabt hat.
Und dann macht er eine Entdeckung, die eine längst geahnte Wahrheit enthüllt …
Der Fernsehfilm VOM ENDE DER EISZEIT, der 2007 erschien, wurde nach Motiven dieses hier vorliegenden Krimis gedreht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Horst Bieber
Schnee im Dezember
Ein Hamburg-Krimi
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Schnee im Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Horst Bieber – sein Leben und Wirken
Das Buch
Kriminalrat Wegener ist des Mordes an seiner Frau Gesine angeklagt. Das Gericht spricht ihn zwar frei, weil die Beweise nicht ausreichen, aber damit ist seine Karriere am Ende. Vom Dienst suspendiert, zieht er in das Dorf und in das Haus, in dem seine Frau seit ihrer Trennung gelebt hat. Hier sucht er Indizien, die ihn auf die Spur des Mörders führen könnten.
Die Dorfbewohner reagieren mit Verachtung und offener Feindseligkeit. Wegener erhält anonyme Drohbriefe. Dann entgeht er knapp einem Mordanschlag. Wollen die Dorfbewohner nur einen vermeintlichen Mörder verjagen oder steckt etwas anderes dahinter?
Wegener versucht, die Vergangenheit seiner Frau aufzuhellen. Wer könnte ein Motiv haben, sie umzubringen? Er findet heraus, dass sie offensichtlich erpresst worden ist. Es tauchen Hinweise auf, dass sie Kontakt zu zwei Kriminellen gehabt hat.
Und dann macht er eine Entdeckung, die eine längst geahnte Wahrheit enthüllt …
Der Fernsehfilm VOM ENDE DER EISZEIT, der 2007 erschien, wurde nach Motiven dieses hier vorliegenden Krimis gedreht.
***
Schnee im Dezember
Die Hauptpersonen
› Gesine Wegener – wird ermordet
› Kriminalrat Achim Wegener – will nicht als Mörder dastehen
› Egon und Adelheid Hellbich – vertragen alles, nur nicht die Wahrheit über ihre Tochter
› Oberkommissarin Frauke Thayer – ermittelt nachlässig, weil der Mörder für sie feststeht
› Hauptmeister Kroppjahn – sieht alles, weiß manches, sagt nichts
› Jens Peddersen, Erwin Allers, Uwe Tackenberg, Gustav Andersen, Albert Busche – sind die öffentliche Meinung im Dorf
› Monika Busche – sucht verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit
› Thomas Schwartz – will sich nicht die Freundin wegnehmen lassen
› Gerold Andersen und Andrea Koslowski – leiden unter einem furchtbaren Geheimnis
› Kurt und Ewald Jensen – treiben Schulden ein
› Harald Kamphausen – stirbt an einer Flasche Champagner
› Karin Bollnow – weiß Liebe und Geschäft gut zu verbinden
› Krischan Zander – zerstört mehrere Leben
Alle Personen und Taten, selbst einige Orte sind frei erfunden.
Die Verletzung von Seelen und Wahrheit findet allerdings jeden Tag statt.
***
1. Kapitel
Die Lautstärke sank in deutlich unterscheidbaren Stufen ab. Erst verstummte einer und stieß seinen Nachbarn an, der den Satz nicht zu Ende brachte. Ein dritter wurde aufmerksam und presste die Lippen zusammen. Die Männer am Nebentisch drehten sich um, folgten den Blicken der schon Schweigenden; die sich ausbreitende Stille irritierte die letzten Redner, die mit ihren Stühlen herumrückten. Für Sekunden herrschte absolute Ruhe, als sei die Zeit stehen geblieben.
Wegener stand regungslos unter der Tür und spürte die Feindseligkeit wie eine Woge gegen ihn heranrollen. Dreißig Männer betrachteten ihn jetzt mit unbewegten Mienen; sie waren gewohnt, ihre Gedanken hinter langsamer Schwerfälligkeit zu verbergen und sich jede Äußerung gründlich zu überlegen, als müssten sie mit Wörtern und Gefühlen geizen. Unter der niederen Balkendecke bildeten Zigarettenrauch und Pfeifenqualm einen graublauen Baldachin. Es roch nach Bier und verschüttetem Korn, aus der Küche zog der Geruch von Bratwürsten und Bratkartoffeln verlockend heran. Für einen Mittwochabend war der »Krug« ungewöhnlich gut besucht.
Auf den breiten, geölten Dielen knirschte der Sand, als er zur Theke ging, und seine Bewegung brach den Bann. Bedächtig wandten sich alle wieder weg und setzten ihre Gespräche fort. Einer war gekommen, den sie hier nicht sehen wollten, aber auch nicht vertreiben konnten. Also nahmen sie ihn in stillschweigender Übereinkunft nicht zur Kenntnis. Sie waren eine Gemeinschaft, und er würde nie dazugehören. Die Lautstärke stieg wieder an.
Der massige Koloss hinter dem Tresen musterte ihn ausdruckslos, eine Hand aufgestemmt, in der anderen eine vor Kälte beschlagene Kornflasche. Breite Hosenträger spannten über einem halbärmeligen Unterhemd. Es war heiß in der Gaststube. Vor den beiden deckenhohen Kachelöfen an den Schmalseiten waren Holzkloben gestapelt.
»Guten Abend, Herr Busche«, grüßte er höflich.
»Abend, Herr Wegener.« Der Wirt hatte eine tiefe, heisere Stimme, die weniger bedrohlich als unschön klang. Seine verhangenen, blutunterlaufenen Augen sahen alles und nichts.
»Haben Sie ein Zimmer für mich?«
»Ein Zimmer?«
»Für zwei Nächte. Bis ich das Haus so weit in Ordnung gebracht habe, dass ich dort einziehen kann.«
Der Dicke stopfte die Kornflasche in die Kühlröhre, griff nach einem Tablett und belud es mit sechs randvoll eingeschenkten Pinnchen. Geschickter, als seine Größe vermuten ließ, schob er es auf die Theke, rieb sich mit einer Hand über das unrasierte Kinn und wiederholte: »Zwei Nächte. Gut. Zimmer zwölf.« Er sprach leise und verbarg seinen Unmut nicht. »Meine Tochter zeigt Ihnen das Zimmer.«
Wegener erwiderte nichts. Busche hatte Arme wie ein Preisringer und Fäuste wie ein Dampfhammer, der Schlüssel mit der anhängenden Kugel verschwand völlig darin. An seiner Stärke bestand kein Zweifel, und das verlieh ihm eine gewisse Gutmütigkeit, unter die sich Verachtung mischte. Weil er keine offenen Feinde kannte, bemühte er sich nicht um Freunde.
»Monika kommt gleich.« Es war ein Befehl.
Monika lief durch den schmalen, hohen und düsteren Gang eilig voran. Von irgendwoher zog es eiskalt, aber nicht genug, den Gestank von Urin und Pinkelsteinen zu vertreiben oder die feuchte Miefigkeit zu besiegen, die sich für ewig in dem alten Gemäuer eingenistet hatte. Hinter einer Schwingtür lag, zum Hof hinaus, der Anbau, den der Krug-Wirt vor einigen Jahren errichtet hatte, sechs moderne Zimmer, alle mit Bad, im ersten Stock über den Garagen. Viele Fliesen, Steinplatten und falscher Marmor, kalt, abweisend und aseptisch sauber, das ebenfalls abstoßende Gegenteil des Vorderhauses. Ihre Schritte hallten auf den Steinstufen.
»Ihr Zimmer.«
»Vielen Dank, Monika.«
»Ich hoffe, es fehlt nichts.« Bevor er sie daran hindern konnte, war sie ins Zimmer gehuscht. Voll nervöser Hast kontrollierte sie im Bad Seife, Handtücher, Zahnputzglas, mit einer Bewegung hatte sie die Heizung voll aufgedreht, die Sekunden später zu knacken begann. Aufatmend stellte er Koffer, Reisetasche und Aktenköfferchen auf das Gestell.
»Es ist alles da.«
»Danke, Monika.« Er war müde.
»Haben Sie Hunger?« Ihre Stimme zitterte, aber ihr Blick blieb fest. »Soll ich Ihnen etwas aufs Zimmer bringen?«
Einen Moment war er verblüfft, dann schaltete er: »Geht das?«
»Gerne.« Sie lächelte knapp.
»Und ein paar Flaschen Bier? Und Sprudel für die Nacht?«
»Mach ich, Herr Wegener.«
Er hatte tatsächlich Hunger, und sie hatte recht: In der Gaststube würde er stören. Niemand würde ihn belästigen, in diesem Punkt durfte er sich auf den Wirt verlassen. Aber mit ihrem Schweigen würden die Gäste ihn einmauern.
Viel packte er nicht aus, den größten Teil seiner Sachen hatte er ohnehin im Wagen gelassen.
Eine halbe Stunde später bummerte sie gegen die Tür, er öffnete ihr, weil sie beide Hände für das schwere Tablett benötigte. Während sie stumm das Essen auf dem kleinen runden Tisch ablud, beobachtete er sie und fragte sich nicht zum ersten Mal, welche Laune der Natur dem ungeschlachten Vater diese Tochter beschert hatte; die Mutter musste schon vor langer Zeit verstorben sein. Monika war recht groß und schlank, aber darauf achtete keiner, der ihr zum ersten Mal begegnete, weil ihr Gesicht fesselte, schmal, mit einer hohen Stirn, etwas bleich, sodass die schwarzen Locken, die ihr bis auf die Schultern reichten, umso mehr auffielen. Er hatte sie immer freundlich und hilfsbereit erlebt, aber selbst wenn sie lachte, verschwand dieser melancholische Ausdruck nicht, den sogar die jungen Männer in bierseligem Mut respektierten. Sie schien viel allein zu sein.
»So, das wär’s.«
»Danke. Ich habe jetzt wirklich Hunger.«
Sie trat zwei Schritte zurück, das Tablett wie einen Schutz vor die Brust gepresst. »Es tut mir leid.« Sie hatte eine jener klaren, hellen Stimmen, die immer gut zu verstehen waren.
»Was tut Ihnen leid?«, fragte er überrascht.
»Meine Aussage. Dass ich Sie an dem Tag getroffen habe.«
»Warum soll Ihnen das leidtun?«
Statt einer Antwort schüttelte sie den Kopf und schlug die Augen nieder. Heimlich seufzte er. Jetzt hing die Müdigkeit wie Blei an seinem Körper, aber er wollte Monika nicht kränken. »Sie haben nur die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit kann nicht schaden – wenn Sie daran denken sollten.« Hoffentlich begriff sie, dass er ihr wirklich keine Vorwürfe machte, nicht einmal in Gedanken.
»Ja, vielleicht«, flüsterte sie. »Gute Nacht, Herr Wegener.«
»Gute Nacht, Monika, und nochmals vielen Dank.«
Er aß mechanisch, um den Hunger zu stillen, trank zwei Flaschen Bier und öffnete vor dem Schlafen das Fenster einen Spalt. Die Kälte drang wie eine Drohung herein, und er suchte im Schrank nach einer Wolldecke, um sie am Fußende um das Deckbett zu schlagen. Die Stille zerrte an seinen Nerven, bis das Rauschen in seinen Ohren so groß geworden war, dass er dahinter die Geräusche einer pechschwarzen Nacht zu vernehmen glaubte.
Stunden später wachte er auf, hochgeschreckt von dem Traum, der ihn jetzt seit Monaten plagte, kein Albtraum, sondern nur eine unerträglich genaue Erinnerung an das, was er getan und für viele Jahre aus seinem Gedächtnis verbannt hatte. Regine hieß sie, ein Nachbarskind; die Eltern waren zugezogen, und Regine hatte ihn vom ersten Tag an bis in seine Träume verfolgt. Groß, dürr, schlaksig, ungelenk, hässlich, frech, dreist, unweiblich. Wenn sie ihn ansprach, konnte er nicht mehr atmen. Er lud sie ein, ins Kino, zum Tanzen, in die Eisdiele, und immer lehnte sie lachend, kichernd, spottend ab. Sie spielte mit ihm, warf und traf mit schmerzhaften Schneebällen, boxte hart und gemein, wenn er sie umarmen wollte, und streckte ihm die Zunge heraus, wenn er was Nettes, Zärtliches stotterte.
Regine. Ein Wirbelwind aus zu langen Armen und Beinen, knochig und selbst ein Jahr später nur mit einer Andeutung von Busen und Hüften. Seine Freunde lachten ihn aus; was wussten sie schon von der schönsten Frau der Welt, aber ihr Hohn senkte sich wie Gift in seine Seele. Eines Abends lauerte er ihr auf, da war er siebzehn und sie fünfzehn. Ein warmer Abend im Juli. Regine kam aus dem Freibad und marschierte pfeifend und singend die Abkürzung durch den Wald. Zitternd stellte er sich ihr in den Weg, sie tippte mit dem Zeigefinger an die Stirn, lachte, er zerrte sie ins Gebüsch. Und jetzt erinnerte er sich wieder genau an ihre ängstlichen Rufe: »Nicht das Kleid, bitte, Achim, nicht das Kleid …« Ein Hängerchen, weißgelb gewürfelt, sie schob es selber hoch. Sie schrie vor Schmerzen, wie hässlich und scheußlich und widerlich war das alles, und hinterher weinte sie: »Ich liebe dich doch. Warum hast du das getan? Ich liebe dich doch. Warum musstest du das tun …?«
Er stürzte davon, ließ sie liegen und hörte noch viel später ihr »Warum hast du das getan?«. Da war die Angst vor Bestrafung fast vergangen, und vielleicht hätte er die lähmende Erinnerung abschütteln können, wenn er damals bestraft worden wäre. Doch Regine schwieg, sah ihn nur traurig an und senkte gleich den Blick, wenn sie ihm allein begegnete. Sie wurde schön und fraulich, doch sie redeten nie wieder miteinander, und als er noch vor dem Abitur gemustert wurde, verpflichtete er sich auf drei Jahre unter der Bedingung, dass sein Standort möglichst weit entfernt lag.
Er lag regungslos und versuchte nicht, vor der Vergangenheit zu fliehen.
Kurz nach sieben schnarrte sein Wecker, und als er, schon bei dem Gedanken an die Kälte zitternd, aus dem Bett sprang, entdeckte er den Zettel auf dem Fußboden. Jemand hatte ihn nachts unter der Tür durchgeschoben. Große, gemalte Druckbuchstaben: »Hau ab, Wegener. Raus aus Södjen.«
Damit hatte er zwar nicht gerechnet, aber es überraschte ihn auch nicht. Den Fetzen warf er in den Papierkorb.
Der »Krug« schien wie ausgestorben. Offenbar war er der einzige Schlafgast. Sein Frühstück wurde ihm in einem kleinen Nebenzimmer serviert; er sah nur noch den Rücken einer alten Frau, die ihm die Warmhaltekanne auf den Tisch gestellt hatte und eilig davonschlurfte. Doch die Zeitung lag bereit, und er kannte die Sitten gut genug, nicht beleidigt zu sein. Auf Logiergäste war der »Krug« allenfalls im Sommer eingerichtet, außerhalb der Saison wurden übernachtende Gäste abgefüttert und missachtet. Wer verbrachte schon die Nacht in Södjen, halbwegs zwischen Kiel und Eckernförde?
Der Geruch von kalter Asche und verbranntem Holz waberte bis auf den Hof. Sein Auto murrte und bockte, als er den Zündschlüssel drehte. Für Anfang Dezember war es ungewöhnlich kalt, minus zehn Grad oder mehr, und unter der Dusche hatte er geflucht, weil es Ewigkeiten dauerte, bis sich das Wasser erwärmte und er sich nicht länger vor den eiskalten Spritzern an die eiskalten Kacheln pressen musste. In diesem Jahr hatte er gelernt, sich vor der Kälte zu fürchten. Der Himmel war wolkenlos, aber von einem fahlen Hellblau, die Sonne wärmte überhaupt nicht. Die Pappeln standen regungslos, kein Windhauch bewegte sie. Im Januar oder Februar gab es solche wolkenlose Tage, an denen der Wind nicht blies, sondern von See gekrochen kam, kaum spürbar, aber zäh in alle Ritzen und Fugen eindringend, über alle Schals, Handschuhe und Mützen spottend.
Er fuhr vorsichtig Richtung Osten, auf die Küste zu, die hier einen unmotivierten Viertelkreis nach Süden beschrieb. Södjen lag nahe genug an der Ostsee, um die Kälte und Feuchtigkeit des Wassers mitzubekommen, aber etwas zu weit vom Strand entfernt, um für Urlauber attraktiv zu sein. Fünfzehn Minuten strammen Fußmarsches, das war zum Beispiel für Familien mit Kleinkindern zu viel. Und hinter dem schmalen Strand fehlten Parkmöglichkeiten, auf der Straße herrschte Parkverbot, weil sie ohnehin so eng war, dass zwei Autos vorsichtig aneinander vorbeisteuern mussten. Auf der anderen Seite der Straße stieg die Klippe an.
Trotz des herabgeklappten Schutzes blendete ihn die tief stehende Sonne. Vom Södjener Ortsrand bis zum Haus brauchte ein tüchtiger Fußgänger um die zwölf Minuten. Es gab entlang eines alten Knicks einen kleinen, kaum erkennbaren Trampelpfad, der direkt zum Haus führte. Auf der Straße Richtung Strand musste man sich schon auskennen, um die steile Auffahrt nicht zu verpassen. An sich war es eine herrliche Lage, im Osten von altem, hohem Buchenwald geschützt, im Norden freier Blick auf die See, im Westen Felder, Wiesen und Weiden. Das Haus stand auf der Kuppe der alten Dünen, von unten nicht zu sehen. Den Zaun um das Grundstück brauchte es eigentlich nicht, hierhin verirrte sich kein Fremder, und die Södjener mieden den Platz. Wegener hatte sich mit der abgeschiedenen Lage – denn Einsamkeit konnte man es kaum nennen – nie recht anfreunden können. Und jetzt wirkte alles noch verlassener, wie erstarrt unter dem Frosthauch. Selbst der Kies auf dem Vorplatz schien festgefroren.
Bevor er aufschloss, lief er einmal um das Gebäude herum. Alle Fensterläden waren von innen verriegelt. Soweit er feststellen konnte, gab es keine Schäden oder Zerstörungen, auch im Garten nicht. Das Garagentor quietschte wie immer.
Noch von Hamburg aus hatte er brieflich und telefonisch gebettelt, geschmeichelt und gedroht, und deshalb betätigte er gespannt den Lichtschalter in der Diele. Das Wunder geschah: Es gab Strom. Er lachte befreit. Nachdem er die Läden zurückgeschlagen und alle Fenster geöffnet hatte, verflog ein Stück Bedrohlichkeit. Alles war verstaubt, aber an die Tragödie, die sich hier abgespielt hatte, erinnerte nichts mehr. Das Wasser war abgestellt, die Heizung geleert. Fast eine Stunde war er beschäftigt, Ventile aufzudrehen, Wasser nachzufüllen, Luft abzulassen, alle Heizkörper auf Lecks zu kontrollieren. Laut Anzeige war das Heizöl bis auf knapp vierhundert Liter aufgebraucht. Er schrieb auf den Besorgungsblock »Öl«.
Um zehn Uhr bremste ein gelber Golf vor dem Haus; der junge Mann grüßte lässig: »Moin, wo soll’s denn hin?«
»Ein Apparat ins Wohnzimmer, der zweite oben ins Schlafzimmer.«
»Mach’n w’r.« Er arbeitete flott, hatte gleich beim ersten Mal alles Werkzeug mitgebracht und pfiff melodisch vor sich hin. Nur einmal erkundigte er sich zähneklappernd: »Ist was mit Ihrer Heizung nicht in Ordnung?«
»Nein, aber das Haus hat Monate leer gestanden, ich bin erst heute zurückgekommen.«
»Ja, dann.« Der junge Mann hauchte auf seine klammen Finger. Er schien nicht aus der näheren Umgebung zu sein. Wegener bot ihm einen Zehn-Mark-Schein an; der Postler griente: »Wenn ich die Wahl hätte, würd ich lieber einen heißen Kaffee haben.«
»Die Wahl haben Sie leider nicht.«
»Dann vielen Dank, und passen Sie auf, dass Sie nicht erfrieren.«
Die Nummer der Firma, die Heizöl lieferte und die Anlage wartete, stand auf einer Bedienungsanleitung, die neben dem Kessel an die Wand genagelt war. Als Wegener anrief und eine Tankfüllung plus Inspektion bestellte, trat am anderen Ende für eine lange Minute Schweigen ein. Weil er sich an solche Reaktionen gewöhnt hatte, blieb er ruhig.
»Haus Geese in Södjen? Und Ihr Name ist Wegener?«
»Ganz recht.«
»Tja, dann – also, sagen wir, um dreizehn Uhr.« Hatten sie so wenig zu tun, oder war es die Neugier?
Mit der Wärme meldeten sich die Gerüche, aber noch war alles zu klamm und zu kalt, um mit dem Putzen anzufangen. Davor hatte er ein wenig Bammel, um Hausarbeiten hatte er sich sein Leben lang gedrückt, so gut es ging, aber er wusste nicht, wo er hier eine Putzhilfe organisieren sollte. Aus dem Dorf würde niemand kommen.
Gegen Mittag hörte er ein Auto vorfahren, und als er die Haustür öffnete, stand Kroppjahn vor ihm, der die Hand an die Mütze legte und mit schlecht gespielter Gleichmütigkeit grüßte: »Guten Tag, Herr Kriminalrat.«
»Tag, Herr Kroppjahn. Kommen Sie rein! Drinnen ist’s wenigstens etwas wärmer.«
»Danke.« Kroppjahn war groß, fast ein Meter neunzig, und breitschultrig. Selbst die weiteste Uniform schien ihm zu eng zu sein. »Albert hat mir erzählt, dass Sie wieder im Lande sind.«
Einen Moment musste er überlegen – Albert, das war Albert Busche, der Krug-Wirt. Im Dorf duzten sich fast alle, auch den Polizisten, der einer der ihren war. Wegener hatte es früher halb aus dienstlichem Interesse, halb aus Neugier beobachtet. Einerseits erleichterte es Kroppjahn das Leben, weil die Dörfler keine Geheimnisse vor ihm hatten. Auf der anderen Seite erforderte es viel Takt und Fingerspitzengefühl, jenen Abstand zu wahren, der im Ernstfall die nötige Autorität sicherte.
»Ich kann Ihnen einen Platz anbieten, aber sonst leider nichts. Zum Einkaufen bin ich noch nicht gekommen.«
Kroppjahn winkte ab. Er hatte ein breites, freundliches Gesicht, bewegte sich langsam und sprach schleppend, aber war alles andere als ein trotteliger Dorfpolizist. Wegener hatte ihn zu Anfang falsch eingeschätzt, sich aber zum Glück diesen Irrtum nie anmerken lassen.
»Eine Bitte hätte ich aber, Herr Kroppjahn.«
»Ja?«
»Lassen Sie den ›Kriminalrat‹ weg. Im Moment bin ich auf eigenen Wunsch vom Dienst suspendiert.«
Kroppjahn schaute ihn ernsthaft an: »Sie scheiden also aus?«
»Mitte nächsten Jahres. Das ist bereits geregelt.«
Der Hauptmeister nickte mehrfach. Im Wohnzimmer hatte er sich ohne Umschweife in einen Sessel gesetzt, auf den Schutzbezug. »Sie wollen sich hier niederlassen?«
»Nicht für immer. Bis ich weiß, was ich künftig machen werde.«
Mittlerweile kannte er das Dorf gut genug, um sich nicht zu täuschen. Es war mehr als ein Gespräch unter Bekannten, wenn auch kein Verhör. Kroppjahn wollte wissen, was auf ihn und das Dorf zukam. Wegener war ihm keine Auskunft schuldig, das nicht, wusste jedoch genau, dass er auf den Polizisten angewiesen war, auf seine wohlwollende Neutralität und Korrektheit. Und weil sie beide Polizisten waren, kannte jeder die Gedanken des anderen.
»Die Leute werden sich und mich fragen, was Sie hier wirklich wollen, Herr Wegener.«
Er zuckte die Achseln: »Ich habe meine Hamburger Wohnung aufgelöst und muss irgendwo unterkriechen.«
»Und den Mörder Ihrer Frau suchen?« Kroppjahn fragte es leichthin, aber das war es, was ihn beschäftigte.
»Ihre Kollegen und der Staatsanwalt waren überzeugt, ich hätte sie umgebracht.«
»Das Landgericht hat Sie freigesprochen.«
»Sicher. Mangels Beweisen, so hätte es früher geheißen. Unter Kollegen: Das war nicht einmal ein Freispruch zweiter, sondern höchstens dritter Klasse.«
Kroppjahn nickte wieder, ohne Verlegenheit: »Das Dorf glaubt, Sie seien’s gewesen, und nur weil Sie Polizist sind, hätten Sie’s so drehen können, dass die Schwurkammer Sie laufen lassen musste.«
»Und Sie, Herr Kroppjahn? Was glauben Sie?«
Der Hüne lächelte ohne Wärme: »Ich bin Polizist, Herr Kriminal… Herr Wegener. Ich halte mich an das rechtskräftige Urteil eines ordentlichen Gerichtes.«
»Herr Kroppjahn, ich habe nie bezweifelt, dass Sie ein tüchtiger und korrekter Beamter sind. Aber im Moment würde mich interessieren, was Sie wirklich glauben.«
»Das werde ich Ihnen nicht verraten, Herr Wegener.« Kroppjahn musterte ihn gelassen, und Wegener beneidete ihn einen Moment lang um seine unerschütterliche Ruhe. »Ich will und muss in Södjen leben. Bei der Kripo mag man sich daran gewöhnen, Verbrechen immer nur hinterher aufzuklären. Hier kann ich vieles verhindern, weil die Leute mir vertrauen.«
»Jetzt haben Sie etwas vergessen – und weil die Leute nicht wissen, was Sie denken und erfahren.«
Den versteckten Vorwurf bedachte Kroppjahn gründlich, bevor er aufstand: »Da ist was dran, Herr Wegener. Mir hat vieles nicht gefallen, was sich in diesem Hause abgespielt hat, aber ich konnte nicht eingreifen. Tja, dann machen Sie’s mal gut.«
Danach blieb ihm nicht viel Zeit zum Grübeln. Der Tankwagen erschien pünktlich, die Inspektion ergab keine Beanstandungen, er begann zu putzen, ein- und wegzuräumen, Staub zu wischen und mit wachsendem Eifer den Staubsauger zu bedienen. Um drei Uhr fuhr er mit einer langen Einkaufsliste ins Dorf. Auswahl hatte er nicht, es gab nur einen Supermarkt, so hieß es auf dem großen Schild, doch die Leute gingen nach wie vor »mal eben zu Jens«.
Jens Peddersen, klein und kugelig, wuselte hinter der Fleisch- und Wursttheke herum. Sein rundes, rosiges Gesicht erinnerte an ein frisch gewaschenes Schweinchen, er hatte Wurstfingerchen und vermittelte durchaus den Eindruck, der beste Kunde seiner Fleisch- und Wurstwaren-Abteilung zu sein. Christa, seine grauhaarige Frau, überragte ihn glatt um zehn Zentimeter, und was Jens an Pfunden zu viel mit sich herumschleppte, besaß sie sichtbar zu wenig.
Beide begrüßten ihn ohne Überraschung. Natürlich hatte der Dorftelegraf längst ausführlich getrommelt, und so glänzend lief das Geschäft nicht, dass sie einen möglichen neuen Stammkunden durch Unfreundlichkeit vergrault hätten, einen Kunden zumal, der zum Einkäufen ohnehin das Auto nehmen musste und deswegen ohne Weiteres in den Nachbarort Breeken zur Konkurrenz fahren konnte. Ihre geschäftsmäßige Heiterkeit wurde eine Spur echt, als er ihnen die lange Liste zeigte: »Ich brauche alles. In dem Haus verhungern sogar die Mäuse.«
Christa Peddersen lächelte säuerlich, nahm ihm die Liste aus der Hand und tadelte: »An Kaffee haben Sie gedacht. Aber auch an Filtertüten?«
Zum Schluss waren drei Einkaufswägelchen bis obenhin vollbepackt, vom Scheuermittel über Zahnpasta, Salz, Milch, Dosen, Konserven, Fleisch, Wurst bis zum Brot. Er hatte nicht vor, häufig ins Dorf zu kommen. Im Keller stand eine große Kühltruhe, in der Küche gab es unter dem Kühlschrank einen kleineren Tiefkühler, nein, er würde Vorräte anlegen und das Dorf nach Möglichkeit meiden. Er liebte die Södjener so wenig wie sie ihn. Mit Peddersens Hilfe verstaute er vier Kartons auf der Rückbank.
»Wollen Sie’s nicht in den Kofferraum stellen?«
»Nein, ich brauche noch Getränke. Bier, Sprudel, Orangensaft. Und – na, mal sehen.«
Langsam schob er ein leeres Wägelchen an den Flaschenborden vorbei. Gin, Wermut, Cognac, Campari – er trank nicht viel, aber er schätzte Abwechslung. Dann stockte er vor der Whisky-Abteilung: Glenfiddich, Dimple, Jack Daniels, von jeder Marke zwei Flaschen. Sechs verstaubte Flaschen, und bei diesen Preisen würden sie hier auch überwintern. Neben ihm hüstelte es, und unwillig schaute er auf Jens Peddersen hinunter.
»Die habe ich noch – hm, äh, ja – für Ihre Frau besorgt.«
»So?«, kommentierte er trocken. Peddersen nickte kläglich. Ob es stimmte? Richtig war, dass Gesine zum Schluss viel zu viel getrunken hatte, richtig war auch, dass sie auf harte Sachen umgestiegen war, aber sie hatte, und daran erinnerte er sich noch genau, nur Bourbon getrunken und Malt oder Scotch verabscheut. »Zu glatt, zu geschmacklos, zu edel – wie du!« Ihr höhnischer Ton klang ihm noch im Ohr.
Peddersen knetete seine Finger, wagte aber nichts zu sagen. In Södjen war der Gipfel alkoholischer Wunschträume mit einem guten, klaren Korn erklommen, und wenn die Flasche richtig kalt war, tat’s auch mittlere Qualität. Auf diesen Kostbarkeiten würde er sitzen bleiben, und sie selbst zu trinken, hinderte ihn sein Geiz.
»Hat meine Frau diese speziellen Marken bestellt?«, fragte er beiläufig. Außer ihm hielt sich kein Kunde im Supermarkt auf.
Peddersen antwortete nicht sofort, sondern schoss von unten einen schrägen Blick hoch, der Wegener unangenehm berührte. Was spielte da um das gespitzte Mündchen? – Häme oder Schadenfreude oder Verschlagenheit? Doch bevor er sich darüber schlüssig werden konnte, quiekte der Kaufmann: »Das weiß ich nicht mehr – guten Whisky, hat sie gesagt.«
Und für dich ist gut gleich teuer, ergänzte er unfromm in Gedanken. »Schön, ich nehme alle sechs Flaschen.«
Peddersen tat überrascht, aber er war ein schlechter Schauspieler, und an der Kasse strich er liebevoll die beiden Fünfhundert-Mark-Scheine glatt.
Nachdem er seine Vorräte verstaut und Kaffee getrunken hatte, putzte er noch eine Stunde. Alles in allem war das Haus in den wohl elf Monaten, die es leer gestanden hatte, weniger verdreckt und verkommen, als er befürchtet hatte. Diese altfränkische Manie, alles abzudecken, zusammenzurollen, zuzukleben und wegzupacken, war doch ganz hilfreich.
»Sehr geehrter Herr Wegener, nach Rücksprache mit meinem Anwalt habe ich mir erlaubt, in Gegenwart von Zeugen alle persönliche Habe meiner verstorbenen Tochter Gesine aus Haus Geese bei Södjen/Schleswig Holstein zu entfernen. Über die entfernten Gegenstände wurde eine Liste angefertigt und von den Zeugen unterschrieben. Das Original bewahrt mein Anwalt Dr. Hermann auf, eine beglaubigte Kopie lege ich bei.
Sollten Sie bei einzelnen Gegenständen Widerspruch erheben, darf ich Sie bitten, sich über Ihren Anwalt mit meinem Anwalt in Verbindung zu setzen.
Auf persönliche Kontakte, sei es brieflich, sei es telefonisch, legen mein Mann und ich keinen Wert.
Mit vorzüglicher Hochachtung Adelheid Hellbich.«
Den Brief hatte ihm seine Ex-Schwiegermutter in die U-Haft geschickt. Sein Verteidiger erregte sich: »Ein starkes Stück!«, doch er winkte ab, heimlich froh, Gesines Eltern auf diese Weise loszuwerden. Das Haus konnten sie ihm nicht nehmen, es war ihr Hochzeitsgeschenk gewesen, notariell beglaubigt und im Grundbuch je zur ideellen Hälfte auf Gesine und ihn eingetragen. Gesine hatte kein Testament hinterlassen, er war der Alleinerbe. Im ersten Jahr ihrer Ehe hatten sie noch vieles gemeinsam für das Haus angeschafft, renovieren und neue Teppichböden legen lassen. »Wollen Sie das wirklich hinnehmen?«, fragte Dr. König aufgebracht. »Die Rechtslage ist nun mal …«
»Hauptsache, ich habe mit den Eltern nichts mehr zu tun.«
Der Anwalt hatte zwar widersprochen, sich aber seinem Entschluss gebeugt.
Den Möbelwagen mit seinen persönlichen Sachen aus der Hamburger Wohnung hatte er leider erst auf morgen bestellt. Eine Nacht musste er also noch im »Krug« verbringen. Draußen war es bereits stockdunkel, aber die Kälte schien ihm nicht mehr so beißend.
Södjen war ein kleines Dorf. Das Kirchlein und der »Krug« auf der einen Seite des gepflasterten Platzes stellten so etwas wie einen Mittelpunkt dar. Auf der anderen Seite der Straße, die quer über den Platz führte, lagen Supermarkt, die unvermeidliche Filiale der Kreissparkasse und ein gesichtsloser, moderner Beton-Allzweck-Bau, der Post, Polizeiposten, Ortsvorsteheramt und eine Dienststelle der Landwirtschaftskammer beherbergte. Alle Häuser sahen ordentlich und gepflegt aus, aber keine Farbe vertrieb den überwältigenden Eindruck von Leere und Langeweile.
Diesmal drehten sich die Köpfe nur kurz in seine Richtung, als er die Gaststube betrat. Niemand unterbrach sein Gespräch. Der Wirt zapfte Bier und langte blind mit der Hand an das Schlüsselbrett hinter seinem Rücken. Er grüßte nicht, und Wegener sagte nichts. In dem Gang zum Anbau zog es noch eisiger als gestern.
Gegen neun Uhr klopfte es an seine Zimmertür, und noch bevor sie seinen Namen rief, wusste er, dass Monika ihm das Abendessen brachte. Sein Magen knurrte zaghaft, seit dem Frühstück hatte er nichts gegessen, und bei der für ihn ungewohnten körperlichen Arbeit war ein Loch im Bauch entstanden.
»Hoffentlich mache ich Ihnen nicht zu viel Arbeit«, dankte er.
»Ach nein!«, wehrte sie ernsthaft ab. »Vorn ist nicht viel los.«
»Aber doch so viel, dass Sie glauben, es wäre besser für mich, auf meinem Zimmer zu essen.«
Sein Spott machte sie einen Moment verlegen, aber dann stimmte sie zu: »Ich meine schon.«
»Ich weiß, was die Leute von mir denken.«
»Ja?« Nervös strich sie ihren Rock glatt.
»Kroppjahn hat mich heute besucht. Er war auch nicht glücklich darüber, dass ich in Haus Geese wohnen will.«
»Ja, sicher, man bloß keinen Ärger – das ist seine Devise.«
»Nicht die schlechteste für einen Dorfpolizisten.«
Zu seinem Erstaunen setzte sie sich auf das Bett und schaute ihn nachdenklich an: »Ja, in der Regel mag das so sein. Aber manchmal gerät man mächtig in den Graben, wenn man immer nur allen Unannehmlichkeiten ausweichen will.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Die Leute machen es sich hier zu leicht.«
»Das verstehe ich nicht …«
»Alle waren fest davon überzeugt, dass Sie Ihre Frau umgebracht haben. Jetzt hat das Gericht geurteilt, nein, Sie waren’s nicht. Jetzt muss das Dorf entscheiden, ob sich das Gericht geirrt hat oder der Mörder noch frei herumläuft. Und wenn er noch auf freiem Fuß ist – dann ist’s einer aus dem Dorf. Oder wenigstens einer, der sich hier gut auskennt.« Sie sprang auf, als habe sie bereits zu viel gesagt, und er wurde sich nicht klar, ob sie ihn gewarnt oder nur Kroppjahns Verhalten erklärt hatte.
»Für diesen … diesen Zwiespalt bin ich nicht verantwortlich«, verteidigte er sich lahm, doch sie spürte wohl, dass er nicht aufrichtig war: »Gute Nacht, Herr Wegener.«
Er trank noch zwei Flaschen Bier und konnte trotzdem nicht einschlafen. Von allen Dorfbewohnern durfte er bei Monika Busche sicher auf das größte Wohlwollen rechnen. Das hieß freilich noch lange nicht, dass er ihr auch vertrauen durfte. Sie hatte seine Verstimmung richtig erkannt, aber den Grund missverstanden. Selbst sie neigte zu diesen Kurz- und Fehlschlüssen: Wenn’s nicht der Ehemann gewesen war, musste es einer aus dem Dorf sein – oder zumindest einer, der sich in Södjen gut auskannte. Diese Fantasielosigkeit hatte ihn schon einmal vor Gericht geführt. Und wenn es nun ein Landstreicher gewesen war? Einer, der sich von der Straße hoch auf das Grundstück verirrt hatte? Oder ein früherer Bekannter Gesines aus Hamburg? Den sie unter Umständen sogar eingeladen hatte? Wer sagte denn, dass Gesine im Haus gestorben war? Schön, die Leiche war nackt gefunden worden, aber der Täter konnte sie draußen ausgezogen haben, weil sich Kleider identifizieren ließen.
Natürlich war er vom Regen in die Traufe geraten. In Hamburg, wo er den größten Teil seines Berufslebens verbracht hatte, kannten ihn zu viele Leute, die starr zur Seite blickten, wenn sie ihm auf der Straße begegneten. Auch beruflich war seine Situation unhaltbar geworden. Das Gericht hatte ihn freigesprochen, folglich konnte er nach Beamtenrecht nicht einfach aus dem Dienst entfernt werden. Doch die Richter hatten zugleich geurteilt, dass es erhebliche Zweifel an seiner Unschuld gebe, und damit konnte kein Kriminalbeamter in leitender Funktion weiterarbeiten. Zumal viele Kollegen von seiner Schuld überzeugt waren und andere zumindest so taten, weil sie die Chance nutzten, alte Rechnungen, Abneigungen und Rivalitäten zu begleichen. Dem hatte er sich freiwillig entzogen. Die Södjener störten ihn weniger. Mit ihren Vorurteilen ließ sich leben.
Am nächsten Morgen saß er bereits um sieben Uhr am Frühstückstisch. Diesmal war auf einer rot weiß gewürfelten Leinendecke angerichtet, und die Zeitung lehnte an einer kleinen Vase mit einem Strauß getrockneter Sommerblumen. Als er Schritte hörte, grüßte er, ohne sich umzudrehen: »Guten Morgen, Monika.«
»Guten Morgen, Herr Wegener.« Sie warf ihm nur einen schnellen Blick zu, doch der war nicht unfreundlich. Für zwei Übernachtungen samt Frühstück und zwei Abendessen zahlte er etwas über neunzig Mark. »Sie haben den Sprudel und das Bier vergessen.«
»Oh, entschuldigen Sie bitte!« Warum wurde sie rot?
2. Kapitel
Den Tag über schuftete er wie ein Wilder. Der Möbelwagen kam pünktlich, Fahrer und Beifahrer schienen es gar nicht eilig zu haben, nach Hamburg zurückzukehren; beschämend spät kapierte er ihre zarten Hinweise, dass dort auf sie zwei Container voll Umzugsgut aus Übersee warteten. Also spendierte er Bier und versprach, die »benötigte Stundenzahl« nach oben zu korrigieren und mit seiner Unterschrift zu bestätigen – den Leuten sollte es nicht schaden. Man schaute sich ungeheuer ernst ins Männerauge und legte los. Zu dritt tobten sie durch das Haus, bauten Regale zusammen, hängten Lampen auf, dübelten, nagelten und schraubten wie die Brunnenputzer; er beglückwünschte sich, gleich zwei Kästen Bier eingekauft zu haben; und als es dämmerte, war er fertig eingerichtet. Die Männer zogen trotz Fahne kerzengerade und vergnügt von dannen.
Er schlenderte um das Haus herum, als müsse er es jetzt endgültig in Besitz nehmen. Nach zwei Tagen und Nächten Dauerfrost war die Erde im Garten steinhart. Im Westen zeigte der Himmel die ganze Farbpalette von Hellrosa bis Dunkelviolett und Blaugrau, die ersten Sterne funkelten, und alle Bäume hatten scharf umrissene Konturen, wie versteinert unter der Kälte. Die See im Norden lag still wie ein gekräuseltes Tuch, und die Falten ganz weit draußen blitzten schwach und unregelmäßig. In den fast sechs Monaten Untersuchungshaft war er allein gewesen, jetzt beschlich ihn die Furcht, Einsamkeit könne etwas ganz anderes sein. Sein Atem dampfte, und er floh in die Wärme des Hauses zurück.
Um neun Uhr kroch er ins Bett, und auch in dieser Nacht träumte er wieder von Regine, bis er aufwachte. Er wankte aus dem Bett, schlich hinunter und trank in der Küche Bier, bis sich der schmerzhafte Klumpen in seinem Magen auflöste.
Über Mittag hatte er den Strand für sich allein. Die Sonne versteckte sich hinter einem dünnen Schleier, Vorbote einer dichteren Bewölkung, die von Westen heranschob. Am Morgen hatte noch ein leichter Wind geweht, der jetzt einschlief, und danach war die Kälte zu ertragen. Unter seinen Stiefeln knirschte der Sand, schmutzig und unwirtlich. Alle hundert Meter waren Holz, Taureste, Plastikkisten und leere Flaschen noch gesammelt und aufgehäuft, aber nicht mehr abgefahren worden. Regen und Frost hatten alle Farben zu einem hässlichen Graubraun ausgebleicht. Trotzdem freute er sich auf einen langen Spaziergang.
»Hallo, Herr Wegener.« Eine atemlose Frauenstimme; fast unwillig drehte er sich um. Monika lief mühsam auf ihn zu, ihr Fahrrad hatte sie einfach am Straßenrand abgelegt.
»Nehmen Sie mich mit?«, prustete sie, nach Luft ringend.
Lieber wäre er allein gelaufen, aber er scheute sich, sie wegzuschicken: »Gern, Monika. Was treibt Sie denn ans Wasser?«
»Ich wollte Sie besuchen, aber Sie waren nicht im Haus, und da hab ich’s auf gut Glück hier versucht.«
Ihr eifriger Ton verbot jede spöttische Abfuhr, und deswegen wedelte er nur mit einer Hand. Warum sie ihn besuchen wollte, würde er sie später fragen.
An einem ungewöhnlich heißen Wochenende hatte er Bereitschaftsdienst gehabt und war gegen dreiundzwanzig Uhr zu einer Schlägerei gerufen worden, die für einen Mann tödlich geendet hatte. Eine Streife hatte die schwer angetrunkenen Täter gestellt; keiner wollte zugestochen haben, aber auf dem Messergriff ließen sich wunderschöne Fingerabdrücke sichern. Am Morgen fühlte er sich dreckig und deprimiert, und das erstarrte Gesicht der jungen schwangeren Frau, der er den Tod ihres Mannes mitteilen musste, quälte ihn noch stundenlang. In seine Wohnung zog ihn nichts, und deshalb fuhr er nach Södjen. Eine Stunde schwimmen, ein langer Marsch an einem hoffentlich noch leeren Strand – als er in den Garten trat, erblickte er eine erschrockene Monika, nackt und nass, die Haare in ein Handtuch eingebunden.
»Sie … Sie … entschuldigen Sie …«
Er hatte nur gelacht. Warum sollte sie das Schwimmbecken nicht benutzen? »Erkälten Sie sich nicht!«, riet er freundlich und zog sich aus. Erst im Wasser fiel ihm auf, dass er sie zum ersten Mal gesiezt hatte, und dabei fühlte er einen albernen Stolz darauf, dass er instinktiv richtig gehandelt hatte.
Die Sonne wärmte schon wieder, als er aus dem Becken stieg, und sie lag mit geschlossenen Augen auf dem großen Badetuch und röstete. Sie hatte sich nicht angezogen; voller Zweifel betrachtete er sie einen Moment und beschloss, den Mund zu halten. Später begleitete sie ihn auf einem Spaziergang, sie wechselten keine drei Sätze, er war mit den Gedanken weit weg, und sie schien das vertraute Schweigen zu genießen. Erst als sie ihre Sachen auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades verstaut hatte, piepste sie schüchtern: »Sie sind mir nicht böse, dass ich … dass ich …?«
»Nein, Monika, schwimmen Sie so oft, wie Sie wollen.« Der Sonntagvormittag blieb ihr kleines Geheimnis, das sie nie wieder erwähnten.
Nach einer Stunde steuerte er auf eine Bank zu, die verlassen am Straßenrand stand, der Lack splitterte in breiten Streifen ab. Er hatte Hunger auf eine Zigarette. Sie setzte sich auf die Lehne, die Hände zwischen den Knien gefaltet, und schaute auf ihn herunter.
»Ich muss Sie etwas fragen«, begann sie unsicher.
»Ja?«
»Ich habe vorgestern Ihr Zimmer gemacht. Und dabei etwas im Papierkorb gefunden, was … nun ja, ich habe es gelesen.«
Leise seufzte er; daran hätte er denken sollen. Der Fetzen mit der Drohung oder Aufforderung, der Unterschied war nicht groß. »Hat Sie das gewundert?«
Weil sie höher saß als er, konnte sie über ihn hinwegschauen. »Das ist doch … unmöglich. Als hätten Sie kein Recht, hier zu wohnen.«
»Das Recht habe ich, und das lass ich mir auch nicht nehmen. Dass die Bewohner des Hauses Geese in Södjen nicht beliebt sind, weiß ich längst.«
»Aber deswegen kann man Sie doch nicht so einfach vertreiben!«, protestierte sie.
»Zum Vertreiben gehören zwei, Monika. Und ich spiele nicht mit.«
Darauf sagte sie lange Zeit nichts. Gedankenverloren zog sie ihre Handschuhe aus, nahm die dicke Wollmütze ab und strich sich mit beiden Händen durch die schwarzen Locken, die sie hochgeschlagen und unter die Mütze geschoben hatte. Eine Schönheit im landläufigen Sinne war sie nicht, aber apart, und ohne diesen halb scheuen, halb verschlossenen Ausdruck wäre sie sogar anziehend gewesen. Einen Moment sinnierte er, warum sie seine Begleitung suchte. Wurde sie im Dorf geschnitten?
»Solange ich denken kann, schimpfen die Södjener auf Haus Geese.« Es klang, als zähle sie sich nicht zu den Dorfbewohnern. »Besonders früher, als die Hellbichs noch oft kamen.«
»Haben Sie die Hellbichs gekannt? Auch Gesine?«
»Na ja, was heißt kennen? Sie war ja fast zehn Jahre älter als ich und hat mich nicht beachtet.« Ihr Lachen klang spitz. »Ich sie übrigens auch nicht.«
Unbehaglich registrierte er den Tonfall und konnte sich nicht entscheiden, was ihm daran missfallen hatte. Denn es stimmte auch nicht, was Monika Busche gerade behauptet hatte. In der ersten Woche ihrer Bekanntschaft hatte Gesine ihn nach Södjen mitgenommen. Es war fast tropisch heiß und schwül, alle Welt döste am Strand oder weichte im Wasser. Keine zwanzig Meter von ihnen entfernt kippte ein Mädchen sein Fahrrad in den Sand und ließ das Kleid fallen. Darunter trug es einen mehr als züchtigen Badeanzug; träge schaute er zu, wie das Mädchen die schwarzen Locken unter eine Bademütze stopfte und steif, fast ungelenk ins Wasser lief.
»Unsere Dorfschöne«, murmelte Gesine.
»Wer?«
»Die Tochter vom Krug-Wirt. Unsere Dorfmimose vom Dienst.« Damals entzückte ihn Gesines permanente Gehässigkeit noch. Tatsächlich blieb die Schwarzhaarige allein, niemand redete sie an oder kam zu ihr, obwohl viele Gleichaltrige an ihr vorbeirannten. Sie las in einem Buch und warf, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, abschätzige Blicke auf Gesine, die ihn amüsierten. Kaum glaublich, wie kurz das erst zurücklag.
»Was machen Sie eigentlich hier? – Nein, nein, ich weiß, was Sie Kroppjahn erzählt haben. Das ist im Dorf herum.«
Er grinste zu ihr hoch, aber sie blinzelte selbstbewusst zurück, während sie umständlich ihre Mütze aufsetzte und voller Spott so tief herunterzog, dass sie ihre Stirn bedeckte.
»Ich muss herausfinden, warum sich Gesine – meine Frau – hier verkrochen hat.« Sie verstand ihn nicht. »Einer der Gründe, warum unsere Ehe in die Brüche ging, war zum Schluss die Unfähigkeit meiner Frau, auch nur fünf Minuten mit mir allein zu bleiben. Geschweige denn, ganz allein. Und dann zieht sie Hals über Kopf in dieses einsame Haus, verkehrt mit keinem Menschen, vergräbt sich.«
Er stockte, was ihr nicht auffiel. So dargestellt war es eine Übertreibung. Gesine hatte ihr Auto, sie war wohl, auch wenn die Södjener das nicht bemerkt haben wollten, viel unterwegs gewesen. Trotzdem – warum dieses abgelegene Dorf?
»Das war Gesprächsstoff, darüber haben sich die Leute das Maul zerrissen. Viele haben Gesine – Ihre Frau – noch als Kind gekannt. Und was dann später über ihren … ihren Lebenswandel in Hamburg geklatscht wurde, aber nach drei, vier Monaten hatte man sich daran gewöhnt, wissen Sie. Es war ja kein Geheimnis, dass Gesine viel jünger war als Sie. Und Sie dazu noch Polizist, also, zum Schluss war Södjen überzeugt, dass Sie Ihre Frau rausgeschmissen hatten. Sie hatten sich getrennt, und sie wartete hier in Södjen das eine Jahr ab, das man für eine Scheidung braucht.«
»Hat Gesine das behauptet?«
»Nein, nein, sie hat darüber nie ein Wort verloren. Aber das war für Södjen die vernünftigste Erklärung.« Wütend und heftig setzte sie hinzu: »Das ist ja das Schlimme an so einem Dorf, dass immer alles glatt und logisch sein muss, logisch nach der Fantasielosigkeit und Engstirnigkeit dieser Leute.«
Solche Kritik hätte er ihr nicht zugetraut; er pfiff überrascht, und sie blitzte ihn an: »Habe ich Sie verwirrt?«
»Ein wenig schon«, erwiderte er.
»Nehmen Sie Thomas, meinen Freund.« Einen Moment musste er überlegen. Thomas Schwartz, Molkereiangestellter in Breeken. Mit Dienstwohnung neben dem Kühlhaus – er erinnerte sich. »Ich mag ihn, ja, und deswegen habe ich mit ihm geschlafen. Das blieb natürlich nicht geheim, konnte es ja auch gar nicht bei dieser … dieser brutalen Neugier. Alle waren entsetzt. Wir haben weiter miteinander geschlafen. ›Aha‹, sagten die Leute erleichtert, ›die wollen heiraten, dann ist das was anderes‹.«
»Wollen Sie denn nicht …«
»Und dann hier in Södjen oder Breeken versauern? Ich bin doch nicht verrückt. Thomas gehört zu diesen Leuten hier, der fängt jetzt auch schon an. Wann heiraten wir endlich? Wir kennen uns doch lange genug. Feste Stellung, Dienstwohnung, Geld auf der Bank. Und zwei Kinder möcht er haben, erst einen Jungen, dann ein Mädchen.«
Darauf erwiderte er lieber nichts. Er wollte keine Partei ergreifen. Aber Monikas wütendes Gesicht vermittelte ihm eine Ahnung von den Gefühlen, die Gesine bei den Södjenern ausgelöst hatte, seit sie fest in diesem Ferienhaus lebte. Theoretisch war ihm klar, dass alle Besucher und Bewohner von Haus Geese immer Fremde geblieben waren, aber was das wirklich bedeutete, hatte ihn nie beschäftigt. Zum ersten Mal beurteilte er Monika mit anderen Augen, heimlich und zugleich schuldbewusst, weil sie für ihn immer nur ein gewohnter und ausnahmsweise netter Bestandteil des Dorfes gewesen war. Dass sie mit und in Södjen nicht glücklich sein könnte, war ihm wohl ab und zu in den Sinn geraten, aber dann hatte er sich sofort zur Ordnung gerufen: Nur weil du aus der Stadt stammst, hast du kein Recht, dich über das Dorf zu mokieren.
»Sie wollen ja auch nicht ewig hierbleiben.«
»Nein«, antwortete er offen. »Aber das hat einen simplen Grund. Ab Mitte nächsten Jahres bin ich arbeitslos, bis dahin muss ich einen Job gefunden haben.«
»Was würden Sie denn gern machen?«
Ja, was eigentlich? Was hatte er wirklich gelernt? Viele Prüfungen bestanden, er kannte die Definition des »gesetzlichen Richters« und wusste, was die Gas-Chromatographie leistete. Aber nichts von dem würde er anwenden können. Eine Kneipe aufmachen? Schon der Gedanke ließ ihn schaudern. Taxifahren? Privatdetektiv oder »Sicherheitsdienst«? Sobald die Versicherung gezahlt hatte, besaß er Startkapital, um sich selbständig zu machen. Aber als was?
»Ich weiß es selbst noch nicht.«
»Ich auch nicht.« Das klang fast fröhlich.
»Wollen Sie denn aus Södjen weg?«
»Im nächsten Jahr ganz bestimmt. Und wenn ich kellnern muss, dann doch bitte gegen Bezahlung.