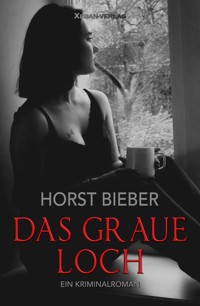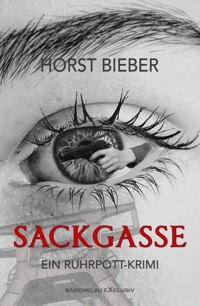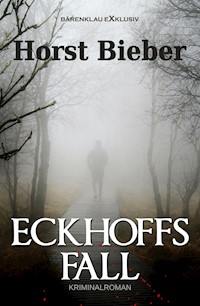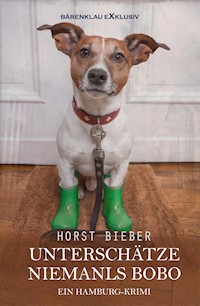3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Martina ist siebzehn Jahre jung, intelligent, tüchtig, hilfsbereit, zuverlässig – und jetzt liegt sie tot in einem Kleingartenverein, von ihrem Mörder achtlos über eine Hecke geworfen.
Kein leichter Fall für Hauptkommissar Richard Lewohlt, bis er herausfindet, dass die positiven Eigenschaften der Toten von Menschen ihrer Umgebung auch anders interpretiert werden: demnach war Martina berechnend, ehrgeizig, gerissen, aufmerksam für die Fehler und Schwächen anderer. Sie wusste, dass man im Leben etwas leisten musste, um vorwärts zu kommen. Und Martina wollte raus aus der spießigen Enge ihres Elternhauses.
Nachdem die Polizei im Besitz der Toten wertvollen Schmuck gefunden und festgestellt hat, dass sie im dritten Monat schwanger und kurz vor ihrem Tod mit einem Mann intim gewesen ist, führt das auf neue Spuren.
Aber die Aufklärung des Verbrechens zieht sich hin – zu lange, wie Lewohlts Vorgesetzte finden; ist ihre Dienststelle doch mit Computern und Datenbanken aufgerüstet worden, die eine Fahndung nach neuesten Erkenntnissen ermöglichen. Und die hat bei all den teuren Geräten gefälligst schnell, umfassend und erfolgreich zu sein!
So kommen zu der Tragik der Martina Kleinmann Frust und Verdruss des Hauptkommissars Lewohlt, der als berufserfahrener Praktiker berechtigte Zweifel an dem Wert der neuen Daten- und Papierflut hat. Er führt lieber ein handfestes Verhör auf die bewährte Art vor Ort. In den Augen seiner Vorgesetzten macht er dabei aber Fehler, die mit dem neuen Selbstverständnis der Kriminalpolizei nicht länger zu vereinbaren sind – zu viele Fehler!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Horst Bieber
Sein letzter Fehler
Ein Kriminalroman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Claudia Westphal nach Motiven, 2024
Korrektorat: Frank Schmidt
Alle handelnden Personen, die Taten, sogar die Stadt ist frei erfunden. Nur die Verhältnisse sollen an die Bundesrepublik erinnern.
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Sein letzter Fehler
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Horst Bieber – sein Leben und Wirken
Das Buch
Martina ist siebzehn Jahre jung, intelligent, tüchtig, hilfsbereit, zuverlässig – und jetzt liegt sie tot in einem Kleingartenverein, von ihrem Mörder achtlos über eine Hecke geworfen.
Kein leichter Fall für Hauptkommissar Richard Lewohlt, bis er herausfindet, dass die positiven Eigenschaften der Toten von Menschen ihrer Umgebung auch anders interpretiert werden: demnach war Martina berechnend, ehrgeizig, gerissen, aufmerksam für die Fehler und Schwächen anderer. Sie wusste, dass man im Leben etwas leisten musste, um vorwärts zu kommen. Und Martina wollte raus aus der spießigen Enge ihres Elternhauses.
Nachdem die Polizei im Besitz der Toten wertvollen Schmuck gefunden und festgestellt hat, dass sie im dritten Monat schwanger und kurz vor ihrem Tod mit einem Mann intim gewesen ist, führt das auf neue Spuren.
Aber die Aufklärung des Verbrechens zieht sich hin – zu lange, wie Lewohlts Vorgesetzte finden; ist ihre Dienststelle doch mit Computern und Datenbanken aufgerüstet worden, die eine Fahndung nach neuesten Erkenntnissen ermöglichen. Und die hat bei all den teuren Geräten gefälligst schnell, umfassend und erfolgreich zu sein!
So kommen zu der Tragik der Martina Kleinmann Frust und Verdruss des Hauptkommissars Lewohlt, der als berufserfahrener Praktiker berechtigte Zweifel an dem Wert der neuen Daten- und Papierflut hat. Er führt lieber ein handfestes Verhör auf die bewährte Art vor Ort. In den Augen seiner Vorgesetzten macht er dabei aber Fehler, die mit dem neuen Selbstverständnis der Kriminalpolizei nicht länger zu vereinbaren sind – zu viele Fehler!
***
Sein letzter Fehler
Ein Kriminalroman von Horst Bieber
1. Kapitel
»Können wir anfangen, Chef?«
»Nein, noch nicht!«, fauchte Lewohlt. Der Mann von der Spurensicherung warf ihm einen bitterbösen Blick zu, wagte aber nicht zu widersprechen, sondern trat betont unauffällig von einem Fuß auf den anderen. Lewohlt beachtete ihn nicht mehr. Diese Minuten gehörten ihm, die ließ er sich nicht nehmen, auch nicht von ungeduldigen Beamten, die heute, am Sonntag, schnell nach Hause wollten. Die Sonne brannte heiß aus einem tiefblauen Himmel. Weit weg läuteten Kirchenglocken, zwölf Uhr Mittag. Kein Lüftchen rührte sich, und Lewohlt spürte, wie ihm die Schweißtropfen in den Nacken rannen. Seit Mitte Juli hielt dieses Sonnenwetter an und jetzt, Ende August, waren Bäume und Sträucher staubbedeckt, Felder und Rasen braun verbrannt. Der Boden schien die Hitze für immer gespeichert zu haben, die Obstbäume ließen die Zweige hängen. Zu Beginn des Sommers hatte es nach einer Rekord-Ernte ausgesehen, doch die Äpfel und Pflaumen waren seitdem nicht mehr gewachsen und schrumpelten schon.
Er stand drei Meter hinter der Gartenpforte auf einem Plattenweg, der zu dem hölzernen Laubenhäuschen führte. Links von ihm, gut fünf Meter vom Tor entfernt, lag die Frauenleiche direkt neben der Hecke, mit den Füßen zum Plattenweg. Sie war halb auf die linke Seite gerollt, sodass der linke Arm unter dem Körper eingeklemmt wurde; mit der rechten Hand berührte sie eben noch die Blätter. Auf den ersten Blick konnte man glauben, sie schliefe, aber dann störte der Kopf, der in einem ganz unnatürlichen Winkel auf die falsche Seite, nach rechts, gefallen war. Und auch die Stellung der ineinander verschlungenen Beine passte nicht zu einer Schläferin.
Bekleidet war sie mit dunkelroten Jeans, einer weißen, dünnen Bluse mit aufgesetzten Taschen, unter der er den BH erkannte. Sie trug Sandalen, keine Strümpfe oder Söckchen. Um die Taille hatte sie sich eine dünne Strickjacke gebunden. Selbst aus der Entfernung erkannte er, dass sie eine Schönheit gewesen sein musste, groß, schlank, ein auffallend straffer Busen. Dunkelbraune, leicht rötlich schimmernde Haare, die sich wie ein Schleierkranz um ihren Kopf gelegt hatten. Die kurz geschnittenen Fuß- und Fingernägel waren rosa lackiert.
Gestorben war sie nicht hier, das verrieten die vielen abgerissenen Blätter und Heckenzweige und die Schmutzspuren auf der Bluse. Genau über ihr verwelkte schon das geknickte Grün.
»Sie ist über die Hecke geworfen worden, Richard.« Andy Schätzle beobachtete seinen Chef, von dem er gelernt hatte, dass kein Bild, keine Skizze den ersten Eindruck von einem Tatort ersetzen konnten.
»Eher gerollt, Andy.« Die Ligusterhecke mochte 1,60 bis 1,70 Meter hoch sein und bestimmt 70 Zentimeter dick. Wer immer sie über die Hecke gerollt hatte, musste groß und kräftig sein. Wie kräftig, das würde sich herausstellen, wenn die Leiche gewogen worden war. Aus dem Gesicht ließ sich nichts ablesen. Es zeigte den erstaunt-ungläubigen Ausdruck, den sie von vielen Opfern kannten, überlagert von der maskenhaft wirkenden Totenstarre. Sie mochte Anfang oder erste Hälfte Zwanzig sein, und zu ihren Lebzeiten würden sich viele Männer nach ihr umgedreht haben. An der sichtbaren rechten Hand steckte kein Ring; am linken Unterarm bemerkte er eine teuer aussehende goldene Armbanduhr. Sonst trug sie keinen Schmuck.
Lewohlt schwieg immer noch. In seinem Leben hatte er viele Tote gesehen, aber die Trauer um jedes einzelne Opfer hatte er nie verloren. Vielleicht verzichtete er deshalb nicht auf die Minuten am Tatort, um nie zu vergessen, dass er nicht nur für Recht und Gerechtigkeit, sondern auch für Menschen arbeitete. Später, wenn die Akten dicker wurden, würde das Opfer verblassen und der Täter in den Vordergrund treten, und obwohl er es nicht hätte erklären können, empfand er als ungerecht, dass sich dann niemand mehr an den Toten und dessen Ansprüche an das Leben erinnerte. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Selbst das Stimmengewirr der aufgeregten Neugierigen, die von den beiden Streifenpolizisten mühsam ferngehalten wurden, war verstummt.
»Okay, fangt an!«, sagte Lewohlt leise, und Andy echote vergnügt: »Auf geht’s, meine Herren.«
»Wir sind nicht taub«, knurrte der eine bissig, und Lewohlt griente schwach. Andy war ein guter Kriminalist und würde noch besser werden, sobald er mehr Gelassenheit aufbrachte und sich das Vergnügen verkniff, die anderen Menschen zu reizen und anzutreiben. Wahrscheinlich wusste er gar nicht, wie sehr seine »Hoppla-jetzt-komm-ich«-Selbstsicherheit andere verbiestern konnte.
Die beiden Fotografen hatten schon mit dem Knipsen begonnen. Der Ungeduldige neben Lewohlt klappte seinen Zeichenblock auf, befestigte ihn auf dem Klemmbrett und machte sich an die Skizze. Ein anderer steckte Tafeln mit Ziffern in den Rasen und rollte dann, das Maßband aus, um die Entfernungen festzustellen. Es war ein gutes Team, alle schon mehrere Jahre dabei, und Andy hätte wirklich nicht herumzukommandieren brauchen. Draußen, auf dem Weg jenseits der Hecke, reckten die unvermeidlichen Zuschauer die Hälse, um nur ja nichts von den neuen Aktivitäten zu versäumen. Bis sie dann die Köpfe drehten, weil ein neuer Mann von den Polizisten durchgelassen wurde.
»Mein Weib hat gedroht, sie lässt den Braten anbrennen, wenn ich nicht bis eins zurück bin. Tag, Richard.«
»Tag, Hans. Bestell ihr schöne Grüße von mir und richtet ihr aus, sie soll mich zum verkohlten Rest einladen!«
»Nix da, mein Lieber. Such dir eine eigene Frau!«
Seit sie sich kannten, flaxten sie sich an, und Lewohlt flirtete ausgesprochen gern mit Stellings Frau Heike.
»Irgendetwas, das ich wissen müsste?«
»Nein, bis jetzt noch nicht.«
»Hübsche Frau. Ausgesprochen flotter Käfer.« Stelling war nicht so abgebrüht, wie er tat, aber als Arzt hatte er sich den Schutzpanzer erworben, hinter dem auch die Kriminalpolizisten ihre Gefühle verbargen.
»Ja«, murmelte Lewohlt; laut sagte er: »Andy, Bilder von der Kleidung.« Andy kniete gerade vor der Leiche und schaute nicht hoch, sondern winkte nur mit einer Hand. Natürlich würden sie auch auf alle Indizien einer Vergewaltigung achten, das war Routine, und Lewohlt ärgerte sich einen Moment über seine überflüssige Anweisung. »Ich red’ mal mit dem Besitzer.«
Der alte Mann hatte sich auf die winzige Terrasse hinter der Laube verzogen und seinen Stuhl in den Schatten gerückt. Mit beiden Händen umklammerte er die Armlehne. Er sah schlecht aus, immer noch bleich vor Schrecken, und seine Lippen zitterten unkontrolliert. Das dünne graue Haar glänzte feucht vor Schweiß.
Lewohlt setzte sich auf die Bank und lächelte aufmunternd: »Na, Herr Brecker, geht’s besser?«
»Ja … Ja, es geht wieder.« Seine Stimme schwankte. Bestimmt hatte er die Siebzig überschritten, und die Furchen und Säcke unter seinen Augen deuteten an, dass er nicht gesund war. »Es war nur der Schreck.«
»Natürlich«, sagte Lewohlt ruhig, »das verstehe ich gut. Sind Sie wieder so weit, dass wir uns unterhalten können?«
»Ja, ich bin wieder – gefasst.« Das war er nicht, dachte Lewohlt, aber er hatte sich etwas gefangen. Bevor Lewohlt zu fragen begann, schaute er sich den hinteren Teil des Gartens an. Lange Beete mit Gemüse und Stangenbohnen, wenige Blumen, aber viele kleine Vierecke mit Kräutern. In der äußersten Ecke bemerkte er einen Komposthaufen, der mit Kürbissen bewachsen war. Die Hecke und eine niedrige Bretterwand verbargen ihn zum größten Teil.
»Dann erzählen Sie mal der Reihe nach, Herr Brecker.«
»Ja, Herr Kommissar. Also, ich bin heute Morgen in den Garten gekommen, so gegen – elf Uhr vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, ich hab’ nicht auf die Uhr geguckt, weil – ja, so gegen elf Uhr.«
Ohne ein Zeichen von Ungeduld nickte Lewohlt.
»Und da lag sie. Neben der Hecke. Zuerst hab’ ich gedacht, sie schläft, wissen Sie, sie sah so – na ja, friedlich aus, und ein bisschen wütend war ich schon, weil sie sich so einfach in meinen Garten … – verschwinden Sie, habe ich gesagt, aber sie hat sich nicht gerührt, und deswegen bin ich hingegangen …« Er verschluckte sich und rang nach Luft, die Adern an seinem Hals traten dick hervor. »Ihr Kopf war so auf die Seite gerollt, und da wusste ich, dass sie tot war.«
»Woher wussten Sie das, Herr Brecker?«
»Woher? Früher, bevor ich – also früher war ich Krankenpfleger und bin jahrelang in einem Unfallwagen gefahren, vom Roten Kreuz, und da habe ich viele Unfälle gesehen. Und viele, die dabei umgekommen sind.«
Lewohlt fischte das Zigarettenpäckchen aus der Hemdtasche und bot dem alten Herrn an. Brecker dankte automatisch und ließ sich Feuer geben, ohne in die Gegenwart zurückzukehren. Es war ein Unterschied, ob man in einem Unfallwagen fuhr und wusste, dass man gleich Verletzte oder Tote sehen würde, oder unvorbereitet über eine Leiche stolperte.
»Danach bin ich sofort zum Vereinshaus gelaufen.«
»Welches Vereinshaus, Herr Brecker?«
»Na, das vom Kleingartenverein.« Dort traf er auf mehrere Leute, die gerade aufräumten, und zuerst hatten sie ihm nicht glauben wollen. Lewohl hörte unverändert gleichmütig zu, merkte sich aber den bitteren Unterton. Dann war Wolter mit ihm …
»Wolter?«
»Harald Wolter. Der Vereinsvorsitzende.« Wolter war mit ihm zurückgelaufen und hatte beim Anblick der Leiche schwer nach Luft geschnappt, sich aber rasch wieder auf seine Funktion besonnen und das Kommando übernommen. Brecker sollte vor seinem Garten wachen und niemanden hineinlassen; er alarmierte die Polizei. Zuerst kamen zwei uniformierte Polizisten; einer hatte Posten vor der Pforte bezogen, der andere vom Streifenwagen aus die Kripo benachrichtigt.
»Kennen Sie die Tote, Herr Brecker?«
»Nein, nein.«
»Haben Sie sie schon mal hier in der Kleingartenanlage gesehen?«
»Ich glaube – nein, Herr Kommissar.«
Lewohlt musterte ihn unschlüssig, weil er bezweifelte, dass sich der alte Herr die Tote wirklich genau angesehen hatte. Aber Brecker schüttelte heftig den Kopf: »Bestimmt nicht, Herr Kommissar.«
Eigentlich spielte es auch keine Rolle. »Wann haben Sie denn gestern Ihren Garten verlassen?«
»Um sieben Uhr.« Um sieben Uhr abends läutete St. Hubertus, dessen plumpen Turm man von dieser Stelle aus eben noch ausmachen konnte, und während des Läutens hatte Brecker sein Gartentor abgeschlossen. »Sonst wäre ich ja geblieben, hier ist’s nachts kühler als in meiner Wohnung, aber gestern war das Fest, und das wollte …«
»Welches Fest?«
»Das Sommerfest vom Verein.«
Unwillkürlich musste Lewohlt schmunzeln: »Sie sind kein Freund des Sommerfestes?«
»Nein, überhaupt nicht! Ein Sommerfest! Ich gehöre noch zur alten Sorte. Man hat einen Garten, um was anzubauen, Gemüse, Obst, Kartoffeln meinetwegen. Aber diese jungen Leute – was verstehen die noch von einem Garten! Rasen und Blumen und nutzlose Zierpflanzen. Terrassen, auf denen die Frauen sich im Bikini sonnen. Können Sie mir verraten, wozu Rasen gut ist? Die Hände wollen sie sich nicht schmutzig machen. Und dann beschweren sie sich, dass mein Komposthaufen stinkt. Stinkt! Aber Feste feiern, das können sie, Tanzen und laute Musik und Herumpoussieren. Nein, das ist nichts für mich, aber wir von der alten Sorte sterben ja sowieso aus.«
»Gut, bis gleich, Herr Brecker.« Lewohlt stand rasch auf und ging um das Gartenhäuschen herum. Die Männer von der Spurensicherung arbeiteten immer noch, von Andy Schätzle kritisch beobachtet. Zum Glück hatte die Hitze selbst ihm den Mund geschlossen. Stelling verglich seine diversen elektronischen Thermometer miteinander und trug die Ergebnisse in ein schwarzes Buch ein. Arme und Beine der Leiche waren jetzt gestreckt, der Kopf zurechtgelegt, sodass sie noch mehr wie eine Schlafende aussah.
»Ich brauche Pola-Bilder«, sagte Lewohlt leise zu Andy. »Sieh zu, dass ein paar Mann von der Streife sofort damit losziehen.«
»Wird gemacht!« Andy schlenderte davon, und Lewohlt hockte sich neben Stelling: »Nun, was ist los?«
»Nicht viel. Todesursache ist eindeutig ein Genickbruch.«
»Und wie?«
»Kann ich noch nicht sagen. Quer über den Nacken verläuft eine kaum sichtbare Strieme – übrigens gibt’s auch auf dem Kragen der Bluse solch einen Abdruck – es könnte eine dünne, scharfkantige Eisenlatte gewesen sein. Mit ziemlicher Wucht geschlagen.« Lewohlt nickte. »Aufgetroffen ist das Eisen ziemlich parallel zu den Schultern.« Genaueres würde die Obduktion ergeben. »Und wann? Tja, vor Mitternacht gestern und nach einundzwanzig Uhr, ich muss mir noch die Nachttemperaturen vom Wetteramt besorgen, aber so etwa in diesem Zeitraum.«
»Genauer geht’s im Augenblick nicht?«
»Nee, Richard. So von 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr.« Er zwinkerte.
»Gut. Noch was?«
»Ja.« Stelling hatte die Bluse ein Stück aus den Jeans gezogen und wies mit dem Kugelschreiber auf dunkle Flecken gerade über dem Hosenbund. »Die Leichenflecken sind eindeutig hier entstanden, nachdem die Leiche über die Hecke befördert worden war. Das muss höchstens eineinhalb Stunden nach Todeseintritt geschehen sein. Die Leichenstarre war voll entwickelt, als ich sie untersuchte.«
»Wegen des warmen Wetters?«
»Sehr wahrscheinlich.« Vorsichtig hob er den Kopf der Toten an. »Siehst du, hier, unter dem linken Auge?«
»Ein Veilchen.«
»Und was für eins! Sie hat’s mit flüssigem Make-up oder so was ganz gut kaschiert, aber es muss trotzdem aufgefallen sein.«
»Sehr schön.« Das war es wirklich; an ein hübsches Mädchen mit einem Bluterguss würden sich die Leute eher erinnern. »Wie alt ist das Hämatom?«
»Über den Daumen gepeilt würde ich sagen, dass es zwölf bis sechzehn Stunden vor ihrem Tod entstanden ist.«
»Mit ihrem Tod hat es also nichts zu tun?«
»Nein.«
»Na dann vielen Dank. Und guten Appetit beim Schmorbraten.«
Nach einem Blick auf die Uhr sprang Stelling auf: »Ich kann’s gerade noch schaffen, Richard.«
Lewohlt grinste ihm nach, richtete sich auf, damit der Fotograf die Sofort-Bilder knipsen konnte, und trat zu Andy: »Wissen wir, wer sie ist?«
»Nicht die Spur.« Auf dem Rasen lagen mehrere durchsichtige Plastiktüten, alle verschlossen und mit weißen, beschrifteten Anhängern versehen. »Die Uhr könnte uns weiterhelfen. Ziemlich teuer, jedenfalls kein Massenartikel. Dann haben wir in der linken Brusttasche eine Eintrittskarte vom Bahnhofskino gefunden. Ist zwar ein Non-Stopp-Laden, aber vielleicht hilft die Seriennummer weiter. Sonst ist nämlich Sense, Richard, keine Brieftasche, keine Handtasche, nichts Schriftliches.«
»Die Leute sollen durch die angrenzenden Gärten gehen und nach einer Handtasche suchen. Sie muss doch …«
»Schon angeordnet, verehrter Chef.« Wenn Andy gekränkt war, wurde er besonders höflich, und Lewohlt lachte ihn aus: »Okay, geh nach hinten und lass dir die Anschrift des alten Herren geben. Ich kümmere mich mal um die Vereinsmannschaft.«
»Die Bilder, Herr Hauptkommissar.« Der Fotograf musterte ihn düster und drohend, als wolle er sich jede Kritik verbitten, aber Lewohlt überraschte ihn, indem er lobte: »Sehr gut.« Auch der geschickteste Fotograf konnte das Porträt einer Toten nicht zum Bild einer Schlafenden machen, aber dadurch, dass er sie schräg von der Seite aus aufgenommen hatte, war der Eindruck der unnatürlichen Starre abgemildert. »Sehr schön, Herr Grill.« Geschmeichelt und zugleich enttäuscht, dass er um einen Anlass zu gerechtfertigter Empörung gebracht worden war, schnaufte der Fotograf. Als Andy ihm die restlichen Fotos aus der Hand riss, zuckte er nur resigniert die Achseln.
Draußen wichen die Neugierigen zurück und bildeten für Lewohlt eine Gasse. Das Gemurmel erstarb. Er schaute sie unfreundlich an: »Wenn Sie jetzt schon einmal hier sind, bleiben Sie auch noch. Meine Kollegen werden Ihnen gleich Bilder von der Toten zeigen. Wir müssen wissen, wie sie heißt und ob sie hier in der Anlage schon einmal gesehen worden ist.« Zögernd und sichtlich unwillig nickten sie. Niemand sagte etwas, aber alle sahen ihm nach. Er kannte diese mit Furcht gemischte Abneigung und wusste, dass sie nicht ihm galt, sondern dem Einbruch von Gewalt in eine geschlossene Gruppe.
2. Kapitel
Das Vereinshaus lag mitten in der Anlage. Der Hauptweg verbreiterte sich zu einem kleinen Platz, der ringsum von Hecken eingefasst war. In der Mitte, unter alten Bäumen, waren mehrere Menschen beschäftigt. Auf der einen Seite gab es eine glatte Fläche, die sicherlich zum Tanzen gedient hatte. Der Rest des Schattenrunds war mit Tischen und Stühlen vollgestellt. Eine junge Frau in Jeans und Bikini-Oberteil räumte Gläser und Aschenbecher zusammen, hielt aber inne, als sie Lewohlt bemerkte. Die Tür und alle Fenster des grau verwitterten Holzhauses standen weit offen. Neben der Tür stapelten sich Bier- und Sprudelkästen; im Haus spülte eine Grauhaarige. Zwei Männer packten Plastikteller und -bestecke in blaue Müllsäcke; ein dritter verstaute leere Weinflaschen in bereitstehende Kartons. Einen Moment glaubte Lewohlt, den fettigen Duft von Bratwürstchen zu riechen. Jemand hatte angefangen, den gemauerten Grill rechts neben dem Haus zu reinigen und die Asche zusammenzukratzen. Zwei vom Ruß schwarze Wischtücher trockneten in der Sonne.
Ein breitschultriger Mann trat ihm entgegen, das Gesicht grau vor Müdigkeit.
»Guten Tag«, grüßte Lewohlt höflich. »Mein Name ist Lewohlt, Kriminalpolizei. Ich suche Herrn Harald Wolter.«
»Der bin ich«, antwortete der Mann bedrückt. »Guten Tag, Herr Kommissar.«
»Sie wissen, weshalb ich komme?«
»Ja, wir haben’s schon gehört. Wegen der Lei… der Toten in Breckers Garten. Schreckliche Geschichte. Wie konnte das nur geschehen?«
»Das versuche ich gerade herauszufinden«, gab er freundlich zurück. »Können wir uns einen Moment unterhalten?«
»Natürlich, bitte, nehmen Sie doch Platz. Etwas zu trinken?«
»Einen Sprudel würde ich gerne nehmen.«
»Ja, sicher. Martha!«, rief er ins Haus hinein, und die Grauhaarige, die wie alle zugehört hatte, nickte. »Wir bleiben besser draußen, im Haus ist es entsetzlich stickig. Stört es, wenn wir …«
»Nein.« Er schüttelte zwei Ehepaaren die Hände. Ratjens hieß das ältere Paar, Grimm das jüngere; Ratjens führte die Kasse des Vereins, Grimm bezeichnete sich als Schriftführer. Lewohlt notierte sich ihre Namen und Anschriften und registrierte, dass alle unwillkürlich ernster wurden. Seine Sprudelflasche war vor Kälte beschlagen. Die Männer tranken Bier und sahen auch so aus, als hätten sie es nötig. Die beiden Frauen teilten sich eine Flasche Wein, und er beobachtete schmunzelnd, dass die Grauhaarige erst kleine Zettel für die Kasse schrieb, bevor sie Getränke und Gläser holte.
»Wir hatten unser Sommerfest«, entschuldigte sich Wolter. »Es ist sehr spät geworden.«
»Und feucht«, ergänzte Helga Grimm. Trotz ihrer luftigen Bekleidung glänzten Schweißperlen auf Schultern und Ausschnitt.
»Das hab’ ich schon gehört«, sagte Lewohlt geduldig. »War’s voll?«
»Und wie. Bestimmt 300 Leute.«
»Alles Mitglieder dieses Kleingarten-Vereins?«
»O nein. Jeder durfte Freunde und Bekannte mitbringen. Oder auch …« Er grinste breit. »… Freundinnen und Bräute.«
»So können Sie mir gar nicht sagen, wer alles gestern hier gefeiert hat?«
»Nein, leider nein. Zumindest nicht auf Anhieb«, verbesserte er schnell. »Wir müssten herumfragen, wer wen mitgebracht hat.«
»Hm. Aber es wäre auch möglich, dass später Wildfremde mitgefeiert haben?«
»Sicher, später schon. Gegen Mitternacht, da hätte dazukommen können, wer wollte.«
»Haben Sie denn fremde Gesichter gesehen?« Alle nickten, und Helga Grimm lachte plötzlich auf, wobei sie Lewohlt zuzwinkerte: »Nicht nur gesehen, auch getanzt.«
»Wann ging’s gestern los?«
»Offiziell um 20 Uhr, aber ich würd' denken, der Hauptschwung kam zwischen neun und halb zehn.«
»Und wie lange hat es gedauert?«
»Also, die Musik hat um drei Uhr aufgehört.« Zwei Mitglieder, so erfuhr Lewohlt, hatten ihre Stereo-Anlagen aufgebaut. Nach drei Uhr bauten sie die Geräte wieder ab und packten sie in einen Lieferwagen.
»Konnten Sie die Anlage nicht über Nacht stehen lassen? Oder in das Haus bringen?«
Ohne zu zögern widersprach Wolter: »Ausgeschlossen, Herr Kommissar. Verstehen Sie, wir können das Gelände ja nicht abschließen, wir haben immer wieder Fremde hier, und das Haus ist schon mehrmals aufgebrochen worden. Wir raten allen unseren Mitgliedern, keine Wertsachen in den Lauben zu lassen. Wir haben auch das eingenommene Geld nicht hiergelassen, nichts von Wert.«
»Sie waren also die letzten?«
»Ja, wir fünf.«
»Und wann sind Sie gegangen?«
»Kurz nach vier Uhr, würde ich meinen.«
Die anderen stimmten zu.
»Um Viertel nach vier waren die Gärten also leer?«
»Nein, gar nicht«, meinte Wolter überrascht. »Bei diesem schönen Wetter übernachten viele in den Lauben. Hier ist es angenehmer und vor allem kühler als in dem Backofen von Innenstadt.«
»Ich verstehe«, murmelte er und trank den Sprudel aus. »Herr Wolter, wie kommt man eigentlich in die Anlage? Wie viele Eingänge hat sie?«
»Es gibt zwei Haupteingänge, im Westen an der Armhäuserstraße und im Osten an der Walddorfallee. An den beiden Eingängen laufen die beiden Hauptwege zusammen – Sie müssen sich die Anlage wie ein langgestrecktes Rechteck vorstellen, die Schmalseiten im Osten und Westen.«
»Wer dort die Eingänge benutzt, wird nicht kontrolliert?«
»Nein, Sie wissen vielleicht, dass wir nach dem Gesetz die Anlagen öffnen mussten.« Einen Moment funkelte er Lewohlt aufgebracht an, als sei der dafür verantwortlich. »Seitdem treiben sich hier – nun ja, nein, es gibt keine Kontrolle.«
»Andere Aus- und Eingänge gibt es also nicht?«
»Doch, doch. Im Norden können Sie einen Gehweg benutzen, der am Rand der Anlage vorbeiführt. Hinter den Gärten der Häuser an der Nockenstraße vorbei. Den kennen aber die wenigsten.«
»Und im Süden?«
»Da gibt’s einen Ausgang direkt in den Rothenbruch.«
»Haben Sie einen Plan der Anlage? Und eine Liste der Mitglieder, aus der hervorgeht, wer welchen Garten gepachtet hat?«
»Schon, aber nicht hier.« Wolter schien ärgerlich. »In dieser Bruchbude kann ich ja nichts aufheben. Aber in meinem Büro hab’ ich alles.«
»Gut, das erledigen wir dann morgen.« Leise stöhnend holte er die beiden Bilder aus der Tasche. »Kennt jemand von Ihnen diese junge Frau? War sie gestern auf dem Fest?«
Die Bilder machten die Runde, zögernd nahm sie jeder entgegen, und keiner konnte ein leichtes Erschrecken unterdrücken, obwohl das Gesicht wenig verriet – eine schlafende Frau mit einer Platzwunde unter dem linken Auge, einer kleinen Wunde, die nicht nach Gewalttätigkeit aussah. Als erster schüttelte Wolter den Kopf; die anderen schlossen sich irgendwie erleichtert an, und Frau Ratjens urteilte schließlich: »Ich kann’s natürlich nicht beschwören, aber ich würde sagen, sie war gestern nicht auf dem Fest. Oder was meinst du, Heinz?«
Ihr Mann stimmte zu: »Nein, Herr Kommissar, gefeiert hat sie nicht mit uns. Und sonst …« Hilflos brach er ab. Auch Helga Grimm verneinte: »Sie wäre aufgefallen.«
Lewohlt sammelte die Bilder ein. »Wenn sie hier nicht gefeiert und sich nicht zufällig in die Anlage verirrt hat, bleibt noch eine dritte Möglichkeit.«
Wolter nickte widerwillig: »Die Freundin eines Mitglieds, nicht?«
»Sie haben selber gesagt, dass bei diesem schönen Wetter viele hier übernachten.«
»Ja.« Ärgerlich hob er die Bierflasche, aber die war leer. »Ja. Wir sehen das nicht gerne, aber verhindern können wir das nicht.«
»Na schön.« Lewohlt klappte sein Notizbuch zu. »Von Ihnen bekommen wir eine Liste der Mitglieder. Unser Fotograf wird bessere Abzüge machen, die wir herumzeigen können.«
»Wenn Sie wollen, hängen wir sie ans schwarze Brett«, bot Wolter an. »Wenn sie wirklich häufiger hier war …«
»Danke«, murmelte Lewohlt. Es war wirklich unerträglich heiß, selbst im Schatten. Unvermittelt sagte Helga Grimm leise: »Dabei war es so ein schönes Fest.«
»Auf Wiedersehen«, grüßte er alle. Was sollte er der jungen Frau schon sagen? Sie zupfte wieder an ihrem Träger und schaute an ihm vorbei. Dass sie um die unbekannte Tote trauern würde, hatte er nicht erwartet. Gewalt verbreitete Unbehagen, selten Mitleid.
Die Neugierigen harrten noch immer aus. Der junge Polizist grüßte übertrieben höflich und schwitzte, nicht nur wegen der Hitze.
Andy stand auf dem Plattenweg und beobachtete stumm die beiden Männer, die gerade die Leiche in die Wanne legten. Zwei Leute von der Spurensicherung maßen noch den Garten aus, die anderen hatten schon eingepackt, die Nummernschilder waren herausgezogen.
Lewohlt stellte sich neben Andy. »Was Neues erfahren?«
»Nichts.« An ihren knappen Sätzen nahmen sie keinen Anstoß, dazu kannten sie sich zu gut. Jenseits der Hecke entstand Bewegung, als die beiden Träger auf dem Weg erschienen; laute Stimmen erhoben sich, der junge Beamte polterte los, bis sich seine Stimme überschlug. Protest, dann herrschte plötzlich Ruhe. Lewohlt träumte vor sich hin; Andy trat vor Ungeduld von einem Fuß auf den anderen, aber wagte nicht, die Techniker anzutreiben, die in aller Gemütsruhe ihr Werkzeug zusammenpackten. Im ganzen Präsidium war Andy bekannt wie ein bunter Hund und in den meisten Abteilungen unbeliebt, weil er ohne Hemmungen herumschimpfte und in Ehren grau und langsam gewordene Kollegen beleidigte.
»So, wir sind fertig«, rief der eine herüber; Andy wollte etwas Bissiges antworten, aber Lewohlt räusperte sich rechtzeitig, und deswegen zogen sie ohne Streit ab.
»Was ist mit der Handtasche?«
»Nichts gefunden.«
»Und die Bilder?«
»Keiner kennt sie. Oder will sie kennen. Komischer Verein, diese Wühlmäuse.« Andy rümpfte die Nase.
»Lass das bloß keinen von den Gärtnern hören! Die vergraben dich glatt im Komposthaufen.«
»Damit meine verrottete Seele den schönen Kompost verdirbt?« Andy kicherte und stieß Lewohlt in die Seite. »Komm, gehen wir, bevor wir Wurzeln schlagen und geerntet werden.«
Lewohlt seufzte. »Aus welchem Bett haben wir dich denn geholt?«
»Du kennst sie noch nicht, Chef. Süßer Käfer. War sehr beeindruckt, als ich ihr erklärte, ich müsste eben mal dafür sorgen, dass der Laden läuft und die Leiche richtig verpackt wird.«
»Aha!« Lewohlt hatte sich längst abgewöhnt, die starken Sprüche seines Adlatus ernst zu nehmen. »Ist sie wenigstens volljährig?«
»Will ich doch stark hoffen. Aber sehr geduldig ist sie nicht.«
»Schon gut, ich hab’ die Glocke läuten hören. Hau ab, du Unverbesserlicher! Aber morgen früh pünktlich!«
»Das hängt nicht nur von mir ab!« Andy konnte noch aus ganzem Herzen lachen, und Lewohlt grinste unwillkürlich. So unbekümmert war er auch einmal gewesen.
Er hatte noch eine gute Stunde zu tun, Namen und Anschriften zu notieren, mit den Polizisten zu sprechen, die sich in der Anlage umgesehen hatten – nichts Auffälliges, kein Hinweis –, und sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Der Fundort der Leiche war nicht der Tatort, aber weit konnte sie nicht getragen worden sein: Bei den vielen Menschen, die sich gestern Abend hier herumgetrieben hatten, wäre das für den Täter ein unvertretbares Risiko gewesen. Sie war auch nicht mit einem Auto transportiert worden. Die beiden Hauptwege, die an den Haupteingängen Ost und West zusammenliefen, waren wohl breit genug für einen Personenwagen, aber an der Armhäuserstraße wie an der Walddorfallee durch je drei umlegbare Pfosten gesperrt.
Für alle Fälle ging er noch einmal zum Vereinshaus zurück; die fünf arbeiteten immer noch und richteten sich halb dankbar für die Unterbrechung, halb besorgt auf. Nein, Wolter war sich seiner Sache sicher: Die Pfosten hatten gestanden, fest verschlossen, »den einzigen Schlüssel habe ich in der Tasche«, und waren nur ganz kurz umgelegt worden, damit die Lieferwagen hinein- und herausfahren konnten. Ja, weil er seine Pappenheimer kannte, hatte er an der Armhäuserstraße selbst aufgeschlossen und sogar für die kurze Zeit, in der die Autos entladen wurden, den Mittelpfosten aufgerichtet.
»Sehr schön, vielen Dank, Herr Wolter.«
Der Rothenbruch war ein feuchtes, stellenweise sumpfiges Tal, durch das sich der Rothenbach schlängelte. Von den deutlich höher gelegenen Gälten sah er auf Weiden, krumme Birken und graubraunes Schilf; das Tor in den Bruch war verrostet und klemmte.
Im Norden fand er den Ausgang erst nach einigem Suchen. Einen Weg konnte man das kaum nennen, eher eine Lücke zwischen Zäunen und Hecken, höchstens einen Meter breit und stellenweise noch enger. In der Nockenstraße herrschte um diese Tageszeit kein Verkehr. Zwei- und dreistöckige Villen aus den zwanziger Jahren, nicht gerade ärmlich, aber auch nicht glanzvoll, dafür alle auf heute unbezahlbar großen Grundstücken. Von hier bis zu Breckers Garten waren es wenigstens vierhundert Meter. Und wenn er die Leiche nur loswerden wollte, hätte der Täter sie viel früher in einen Garten werfen können. Im Moment sah es so aus, als liege der Tatort innerhalb der Anlage.
Lewohlt gähnte und rieb sich das schlecht rasierte Kinn. Gestern Nacht hatte er zu lange gelesen; ausgehen konnte er nicht, weil er freiwillig die Bereitschaft übernommen hatte. Sechs seiner Leute, Familienväter mit schulpflichtigen Kindern, hatten Urlaub. Die Schule begann am Montag wieder, wenn es nicht gleich hitzefrei gab. Für die Rückkehrer hatten sich am Freitag drei andere in den Urlaub verabschiedet. Eigentlich waren nie alle Leute an Deck, aber mehr Planstellen wurden ihm nicht zugebilligt. Zwar jammerte er darüber wie alle Referatsleiter, aber so ganz ehrlich war er nicht dabei: Personalmangel war eine feine Ausrede dafür, dem Schreibtisch zu entfliehen und draußen zu recherchieren. Das gefiel ihm ohnehin besser, und für richtiger hielt er es auch. Manche Hauptkommissare leiteten ihre Referate nur noch vom Schreibtisch aus und hatten seit Monaten keinen Tatort mehr gesehen.
Nachdenklich schaute er sich um. Es musste unbedingt bald regnen.
Über das Polizeipräsidium ärgerte sich Lewohlt jedes Mal, wenn er in die Tiefgarage fuhr: ein moderner Hochbau, gerade sechs Jahre alt, viel Glas und noch mehr Beton, im Sommer heiß und im Winter kalt. An der Fassade bröckelte es bereits sichtbar. Aufgeteilt war dieses Prachtwerk, an dessen Entwurf kein Polizist mitgearbeitet haben konnte, in winzige Zimmerchen nach dem Fenster-Achsen-Prinzip. Eine Sekretärin hatte zum Beispiel Anspruch auf eine Achse, ein Sachbearbeiter (Gruppe IV, vorwiegend selbständig arbeitend) auf zwei, er als »Referatsleiter« auf vier. So oder so blieben es entsetzliche Schläuche mit grau gestrichenen Betonwänden (Bilder mussten geklebt werden), Einbauschränken mit scharfen Kanten neben den Türen und Neonleuchten. Natürlich gab es keine Verbindungstüren, nach dem Motto: Jeder für sich in seiner Klause, und der zu schmale Flur für uns alle. Der allgemeine Protest hatte wenigstens in diesem Punkt gefruchtet: Noch während des Baus begann der Umbau, wurden einige Verbindungstüren durchgestemmt. Nicht ändern ließ sich freilich der Geburtsfehler dieses Bastards, die vielen Innenräume ohne Tageslicht, in denen die Klimaanlage pausenlos rauschte. In einem ebenso hartnäckigen wie beschimpfungsreichen Streit mit der Belegabteilung hatte Lewohlt durchgesetzt, dass seine Mitarbeiter alle Zimmer mit Fenstern bekamen und dass sich diese Fenster tatsächlich auch öffnen ließen. Dafür wurden die Vernehmungszimmer nach innen verlegt, und das Gefühl des Eingeschlossenseins hatte manchen hartnäckigen Kunden zermürbt. Die mit mattweißen Blechen verkleideten Innenwände züchteten Klaustrophobien. Optimal untergebracht waren von Anfang an nur die Computer und Terminals; das ganze Haus steckte voller Elektronik, und nach deren Bedürfnissen hatten sich alle zu richten.
Einige wenige – unter ihnen Lewohlt – taten es nicht.
Im Präsidium hielt sich hartnäckig das Gerücht, eine Schweizer Firma, spezialisiert auf Management-Consulting, habe nicht nur den Bau entworfen, sondern auch das Organisationsschema der Polizei. Daran glaubte Lewohlt nicht: Die Organisation musste von der Firma stammen, die den gesamten elektronischen Schmutz geliefert hatte. Ihre Monteure waren mittlerweile ein fester Bestandteil des Hauses geworden. Die Systeme stürzten immer noch ab oder produzierten Blödsinn, was auch daran liegen mochte, dass ständig Neues eingebaut und erprobt wurde.
Vom zehnten Stock aus hatte man einen ungestörten Blick auf die ganze Innenstadt, über deren Dächern nun schon seit Wochen die Hitze flimmerte. Wenn er nichts zu tun hatte, stand er oft am Fenster und träumte vor sich hin; das lebhafte Gewimmel war dann weit weg, das ununterbrochene Rauschen des Verkehrs sank herab, bis er es nicht mehr vernahm, und in diesen Minuten gehörte er nicht mehr dazu.
Ein Kaffee wäre gut. Er brauchte jetzt unbedingt einen Kaffee!
Jürgen Fischer kam eine halbe Stunde später in das Zimmer gehinkt. Er sah älter aus als fünfundvierzig. Vor sieben Jahren war er bei einer irrsinnigen Verfolgungsfahrt schwer verunglückt; die Ärzte amputierten ihm das linke Bein unterhalb des Knies und die linke Hand. Sein immer noch volles Haar war restlos ergraut, sein Gesicht zerfurcht. Personalabteilung, Vertrauensärztlicher Dienst und die allmächtige PK, die sich überall einmischende Personalkommission, wollten ihn vorzeitig pensionieren. Mehrere Wochen musste Lewohlt kämpfen, um ihn zu seinem Stellvertreter zu machen. Sie verstanden sich seitdem ohne viele Worte. Fischers einzige Tochter war wenige Monate nach seinem Unfall tot in einer Bahnhofstoilette aufgefunden worden, neben ihr das zerbrochene Spritzbesteck, mit dem sie sich den goldenen Schuss verpasst hatte. Der schweigsame Fischer wurde wortkarg. Er war ein gläubiger Katholik, der sich in seiner knappen Freizeit um straffällige Jugendliche kümmerte. Seine Frau mochte Lewohlt nicht leiden und hasste die ganze Polizei.
»Was ist los, Richard?«
Er berichtete kurz, und Fischer stellte keine Fragen.
»Wer kommt noch?«
»Pedder und Heppel.«
»Gut, dann koche ich mal Kaffee.« Fischer lächelte nur kurz. Überall wurde Personal eingespart, die Kaffee-Küche blieb über das Wochenende geschlossen, und eine Sekretärin für den Sonntagsdienst stand jenseits aller Möglichkeiten.
Jens Peter Peddersen war eine Marke für sich. Bis heute blieb es Lewohlt ein Rätsel, wie Pedder die diversen Prüfungen geschafft hatte, wie er überhaupt zum Polizeidienst angenommen worden war. Die Natur hatte ihn mit 1,95 Meter Körperlänge und jackensprengenden Schultern gesegnet, außerdem mit einer weizenblonden Lockentolle, vor der jeder Friseur kapitulierte, dunkelblauen Augen und einem länglichen, kräftigen Gesicht. Wenn man ihn ansprach, zwinkerte er überrascht, weil man ihn aus anderen Sphären auf die Erde zurückholte. Zehn Sekunden schien er richtig zuzuhören, dann begann er wieder zu träumen. Noch nie hatte es ein Vorgesetzter fertiggebracht, Pedder zur Eile anzutreiben. Auf der Straße war er so unauffällig wie eine Giraffe mit zwei Köpfen, und wenn er dann seine langen Beine vorsichtig, wie auf einem schwankenden Boot, bewegte, drehten sich die Passanten nach ihm um. Nur seine friedlich-verträumte Miene hinderten die Leute daran, ihn nach dem ersten Blick für dumm zu halten, obwohl Pedder alles tat, diesen Eindruck hervorzurufen.
Andy hatte das lange Ende angestaunt: »Mein Gott, ein echter Ostfriese!«
Worauf Pedder verträumt lächelte. »Willst du etwa bei uns arbeiten?«
»Ich weiß nicht …«
»So, du weißt nicht.« Andy stemmte die Fäuste in die Seite und musste den Kopf in den Nacken legen. »Du weißt nicht. Is ja prächtig! Wir werden wunderbar Zusammenarbeiten.«
»Meinst du?« Pedder sprach bedächtig und laut, als reiße ihm der Wind die Silben von den Lippen.
»Das meine ich! Weißt du, früher hatte ein ordentlicher Mann seinen Sklaven. Dann seinen Neger. Heute seinen Türken. Ich werde der erste sein, der seinen Ostfriesen hat.«
»Ja?« Pedder war im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen, hatte die See im Alter von achtzehn Jahren zum ersten Mal gesehen und wusste nicht einmal genau, wie Lewohlt später herausfand, wo Ostfriesland liegt. Aber er schmunzelte breit und musterte von oben herunter den vorlauten Andy mit sichtlichem Wohlwollen. Und die beiden verstanden sich. Wann immer sie vor Zeugen zusammentrafen, hackte Andy auf ihm herum, kommandierte, schimpfte oder klagte lautstark über die Langsamkeit seines Kollegen. Pedder zwinkerte fröhlich und hob manchmal ehrlich erstaunt die Augenbrauen, wenn sich Andy eine neue Beschimpfung ausgedacht hatte. Er redete nicht gerne und selten in vollständigen Sätzen. Alles in allem schien er das Musterbeispiel dafür abzugeben, wie ein Kriminalbeamter nicht beschaffen sein sollte, doch hinter dieser Teddybären-Gemütlichkeit verbarg sich etwas, das vielen fehlte, nämlich die Fähigkeit, sich in die Gedanken anderer Menschen hinein zu versetzen. Schon mancher ihrer Kunden hatte geglaubt, das todsichere Versteck oder die unschlagbare Masche gefunden zu haben, bis Pedder nachzusinnen begann.
Kriminaloberinspektor Heppel meldete sich zum Dienst, ein unauffälliger, etwas dicklicher Enddreißiger, der sich gerne in seinem Zimmer mit den Terminals, Bildschirmen und sonstigen Geräten vergrub.
Lewohlt brummte: »Wollen Sie einen Kaffee?« und schob ihm seine Notizen hin.
Eine halbe Stunde geschah gar nichts. Die Routine war angelaufen, und zur Routine gehörten auch die langen Pausen. Dann steckte Pedder den Kopf ins Zimmer und gab in seiner silbensparenden Art bekannt: »Alles eingegeben – gleich.«
Widerwillig stand Lewohlt auf, nahm seinen Kaffeetopf mit und schlich in Heppels Zimmer, der sofort murmelte: »Es dauert noch.«
Lewohlt blies geistesabwesend auf seinen heißen Kaffee und döste vor sich hin. So viel friedliche Ruhe gab es selten, und mit jeder Minute kroch die Müdigkeit höher. Dann blinkte ein hellgrünes Viereck auf dem Bildschirm. Heppel tippte eine Zahlenkombination, drückte eine Taste und sagte halblaut: »Es kommt.« Sekunden später erschienen die Daten auf dem Bildschirm, und in solchen seltenen Momenten war auch Lewohlt bereit, die Elektronik gut zu finden.
»Größe 171 cm – Gewicht 58 Kilogramm – geschätztes Alter: 18-20. Blut gr. o pos. – Obdkt. Term. Mont., io.3oUhr, Raum 1, Staatsanw. benachricht. – rieht. Erlbns. beantr.«
»Sieh mal an«, brummte Lewohlt, »sie sah älter aus.«
Heppel nickte stumm, hielt mit einer neuen Zahlenkombination die von der Medizinischen Aufnahme übermittelten Daten fest, tippte erneut und fugte damit die Liste der äußeren Merkmale hinzu, die er nach Lewohlts Notizen bereits in den Computer eingegeben hatte, drückte neue Tasten, die Angaben verschwanden, eine Zieladresse tauchte auf, blinkte kurz, bevor sie sich auflöste, ein winziges »wait« erschien links oben, und dann starrten sie auf das dunkle Glas. Im Moment verglich der zentrale Rechner ihre Angaben mit den gespeicherten Daten der als vermisst gemeldeten Personen – zuerst aus der Stadt, dann aus dem Land, zuletzt bundesweit.
»Wir haben sie, Chef.« In Lewohlts Gegenwart sprach Heppel immer leise, aber das war keine Schüchternheit, sondern gegenseitige Abneigung, und weil sie beide darum wussten, behandelten sie sich höflicher als sonst unter Kollegen üblich. Neue Reihen wurden blitzschnell von links nach rechts geschrieben: »Kleinmann, Martina. Hessenstraße 13 …« Der Drucker begann zu rasseln, und Lewohlt lehnte sich wieder an die Fensterbank. Der Kaffee vertrieb die Müdigkeit nicht.
Ein anderer Bildschirm wurde hell. Mit Elektronik waren sie phantastisch ausgerüstet, konnten Bilder digital abspeichern und jederzeit abrufen, seit einigen Monaten sogar in Farbe, konnten elektronisch Ausschnitte vergrößern und über einen Apparat, dessen Technik Lewohlt nie kapiert hatte, in Sekundenschnelle als fertige Bilder auf den Tisch zaubern. Neugierig schaute er hin. Ja, das war die junge Frau aus der Kleingartenanlage Rothenbruch.
»Brauchen Sie Positive?«
»Nein, danke.«
Das Drucker-Protokoll beschäftigte ihn. Martina Kleinmann, siebzehn Jahre alt – verblüfft rieb er sich über das Kinn –, kaufmännischer Lehrling. Am Samstag, also gestern, von den Eltern Herbert und Anna Kleinmann als vermisst gemeldet, weil sie in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht nach Hause gekommen war. Abgezeichnet vom Revier 18, um 17.15 Uhr. Unterwegs mit einem weißen Damenfahrrad, Marke Ferrier, Gestellnummer 16 A 534. Bekleidet mit weinroten Jeans, einer weißen Bluse und hellbeiger Strickjacke. Hellbraune Lederhandtasche mit langem Tragriemen. Zuletzt gesehen am Freitag gegen 19.10 Uhr, als sie die elterliche Wohnung verließ, um zu einer Freundin zu fahren, Roswitha Zoller, Hohe Fuhre 26. Dort laut Aussage der Eltern, die sich erkundigt hatten, gegen 19.35 Uhr eingetroffen und kurz nach 20 Uhr wieder abgefahren. Seitdem vermisst.
Er nahm das Protokoll und ging quer durch das Sekretariatszimmer in Fischers Raum. »Wir haben sie«, knurrte er verlegen, und Fischer warf ihm ein schräges Lächeln zu, während er mühsam aufstand. »Danke, Jürgen.«
Das war etwas, was er nie gelernt hatte: Angehörigen eine Todesnachricht zu überbringen. Keiner tat das gern, auch Fischer nicht, aber Fischer wusste aus leidvoller Erfahrung, was Eltern empfanden, und konnte die richtigen Worte finden. Er und Pedder, der über seine seltsame Hellsichtigkeit für die Gedanken und Gefühle anderer Menschen verfügte.
Lustlos bummelte er nach Hause. In seine Zwei-Zimmer-Wohnung zog ihn nichts, aber er hatte auch keine Lust, sich allein in eine Kneipe zu hocken. Vor neun Wochen war er umgezogen, in ein Hochhaus, und die meisten Kisten standen noch immer unausgepackt in der Wohnung. Die Spedition schrie inzwischen Zeter und Mordio und drohte mit Säumnisgebühren. Zwei-, dreimal die Woche nahm er sich vor, endlich seinen Kram auszuräumen, aber jedes Mal packte ihn ein lähmender Ekel vor dieser Aufgabe. Dann schob er die Kisten wieder zur Seite, ließ sich in den zart quietschenden Ohrensessel fallen und begann zu lesen. Das Fernsehgerät war immer noch nicht angeschlossen, das zweite Telefon stand auf einem Kistenstapel; das erste war schon am dritten Tag heruntergefallen und zersplittert. Einen Teil der Diele bedeckte ein Haufen schmutziger Wäsche; wenn sich die Tür des Garderobenschrankes nicht mehr aufziehen ließ, brachte er alles zur Wäscherei. Wer die Wohnung hätte sehen können, würde sofort die Diagnose stellen: Richard Lewohlt, 46 Jahre alt, geschieden, Kriminalhauptkommissar und Leiter des Fachreferats (FR) in, verkam. Aber bis jetzt hatte noch kein Fremder die Wohnung betreten, selbst Andy nicht, der geduldig unten auf der Straße wartete, wenn er seinen Freund und Chef abholte.
Aber »verkommen« war der falsche Ausdruck. Er verkam nicht, obwohl ersieh mit dem Junggesellenleben immer noch schwertat. Er hatte einfach keine Lust mehr, zu nichts, und flüchtete sich in die Welt von Biografien und Romanen. In der Filiale der Stadtbücherei gleich um die Ecke kannte man ihn mittlerweile gut, und die Große mit den aschblonden Haaren und dem korrekten Mittelscheitel störte sich wenig an seinem mürrischen Ton.
Er schaffte einen ganzen Band der »Memoiren des Herzogs von Saint-Simon« und lebte einige Stunden in der Welt des französischen Hofes. Seit er sich zufällig in einem historischen Roman festgelesen hatte, war er fast süchtig nach dieser Art Lektüre geworden.
Die Woche begann mit einem Treffen aller Referats-Mitarbeiter, offiziell »Konferenz« genannt, in Wahrheit eher ein letzter Versuch, sich bei Kaffee und Klatsch vor der anstehenden Arbeit zu drücken. Die zurückgekehrten Urlauber zeigten demonstrativ ihre Bräune und bewiesen mit Farbfotos, wo sie gewesen waren und was sie gesehen hatten. Es wurde viel herumgealbert und geflaxt, bevor die laufenden Fälle besprochen wurden, Urlaubspläne, Termine für Lehrgänge, Probleme, Schwierigkeiten. Lewohlt schwieg meistens und achtete höchstens darauf, dass auch die Sachbearbeiter zu Wort kamen. In diesen dreißig oder vierzig Minuten durfte und musste jeder offen reden. Über das, was tagsüber passiert war, verständigten sich die Chefs der Gruppen am späten Nachmittag, kurz vor dem offiziellen Dienstschluss. Aber im FR m gab es keine festen Dienstzeiten, und keiner, der darauf bestanden hätte, wäre länger als einen Monat in diesem Haufen geblieben.
Ruhender Pol dieser Runde war Jürgen Fischer, dem nach einem ungeschriebenen Gesetz Lewohlts Schreibtisch-Sessel zustand. Lewohlt saß auf der Fensterbank und war mehr Zuhörer als Chef. Jeder wusste, dass Fischer – wegen seiner Behinderung fast immer an seinem Schreibtisch zu finden – die wichtigen Entscheidungen traf und dass Lewohlt seinem Stellvertreter unbesehen vertraute, dass Fischer auf der anderen Seite nie etwas tun würde, dem Lewohlt nicht zustimmen konnte. Aber wer Ärger mit Lewohlt hatte, was nicht selten vorkam, weil Lewohlt viel zu mürrisch und ungeduldig war, um immer gerecht zu sein, wandte sich an Fischer. Und Fischer, unbestechlich, geduldig und gerecht, kümmerte sich darum. Seit er Lewohlt dazu gebracht hatte, sich öffentlich in dieser Montagsrunde bei Mitgliedern des FR 111 zu entschuldigen, herrschte Vertrauen. Und seit sich herumgesprochen hatte, dass Lewohlt nach außen diejenigen seiner Leute kompromisslos verteidigte, die er intern gerüffelt hatte, gab es über das gegenseitige Vertrauen hinaus so etwas wie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. »Lewohlts Bande«, wie sie im Präsidium durchaus nicht wohlwollend bezeichnet wurde, hielt durch Dick und Dünn zusammen.
Lewohlt gähnte verstohlen und betrachtete Karin Rösch, die wie immer in der entferntesten Ecke saß. »Assistentin zur Anstellung« war ihre Dienstbezeichnung, richtiger wäre gewesen: Lehrling. Persönlich hatte er nichts gegen sie, ihn störte nur, dass seinem Referat eine solche Stelle zudiktiert worden war. Ausgerechnet in der Mordkommission sollte ein Anfänger ausgebildet werden, in einer Kommission, die früher stolz darauf gewesen war, die besten Kriminalisten zu versammeln. Wer dorthin berufen wurde, hatte sich anderswo schon ausgezeichnet und besaß das, was er nun blutigen Anfängern beibringen sollte: Menschenkenntnis, Erfahrung, Zähigkeit, Geduld und die Fähigkeit zu kombinieren. Mit ihr kam er noch halbwegs aus, weil sie ein wenig schüchtern war – oder farblos, wie er oft fand dagegen hatte es mit anderen z. A.’s schon einigen Zirkus gegeben.
In einer melancholischen Stunde hatte er sich gestanden, dass ihn am meisten ärgerte, wie wenig sie aus sich machte, äußerlich und im Umgang mit ihm. Denn sie war weder unansehnlich noch dumm, mit achtundzwanzig Jahren auch zu alt, ihre Fähigkeiten falsch einzuschätzen.
Über den Fall Kleinmann wurden nicht viele Worte verloren. Alle Fälle begannen schwierig, und die Bande war stolz darauf, dass ihre Aufklärungsquote weit über 90 Prozent lag.
Jeden Montag um neun Uhr versammelten sich die Referatsleiter der Fachdirektion I (Kriminalpolizei), der Direktor und die Abteilungsleiter im Großen Sitzungssaal. Ständige Gäste waren die Vertreter der FD ü (Schutzpolizei) und FD üI (Besondere Kriminalität), der Leiter der Abteilung S0K0 (Sonderkommissionen, von denen es nach Lewohlts Geschmack viel zu viele gab), ein Vertreter des Polizeipräsidenten, des Vizepräsidenten, dem dienstrechtlich die »Kriminaltechnische Untersuchung« und der Fachbereich »Elektronik und Dokumentationen« unterstanden, und ein Mitglied der dem Präsidenten direkt zugeordneten Abteilung »Presse und Information«. Wenn Lewohlt diese Menge sah, erfüllte ihn regelmäßige kalte Wut: Offiziere gab’s weiß Gott genug, und von ihren Gehältern hätten die Truppen bezahlt werden können, die ihnen fehlten.
Unter der doppelflügeligen Tür hielt ihn der Krimirat am Ärmel fest: »Gibt’s was Neues, Herr Lewohlt?«
Lewohlt schluckte seinen Ärger hinunter. Mit Dr. Georg Wesseling, Kriminalrat und Leiter der Abteilung »Gewaltkriminalität«, verband ihn eine innige Abneigung. Das hatte etwas mit dem Altersunterschied zu tun; der Krimirat – wie sein im ganzen Haus bekannter Spitzname lautete – war zehn Jahre jünger als Lewohlt. Das hatte schon mehr damit zu tun, dass Wesseling äußerlich das genaue Gegenteil seines Untergebenen darstellte – sportlich, muskulös, immer makellos angezogen, lebhaft, energisch und von jener nichtssagenden Freundlichkeit, die Lewohlt völlig abging. Das hing aber vor allem damit zusammen, dass Wesseling hundertprozentig hinter der modernen Organisation, der Elektronik und dem neuen Stil stand, während Lewohlt das alles verabscheute.
»Nein«, knurrte er endlich, »nur ein Todesfall gestern.«
»Sehr schön«, freute sich der Krimirat. Opfer interessierten ihn nicht, nur der gute Ruf seiner Abteilung, womit in erster Linie sein eigener Ruf gemeint war. In seiner Gegenwart musste Lewohlt immer die Zähne fest zusammenbeißen.
Wie in neun von zehn Fällen hätte man sich auch diese Konferenz schenken können. Eines der höheren Tiere bedauerte, sie hätten jetzt wohl doch organisierte Schutzgeld-Erpressung im westlichen Teil der Innenstadt. Das hätte Lewohlt ihm schon vor Monaten verraten können, aber auch er huldigte insoweit dem neuen Stil, als er sich nur noch um seine Sachen kümmerte und nichts tat, diese nutzlosen Sitzungen durch Beiträge zu verlängern. Als sich die Runde auflöste, hatte er kein Wort gesprochen.
Fischer hatte eine gute Nachricht für ihn: »Das Fahrrad ist gefunden worden. Auch über eine Hecke in einen Garten geworfen. Andy und Pedder sind rausgefahren.«
Der Täter besaß anscheinend wenig Phantasie. »Die Handtasche ist noch nicht aufgetaucht?«
»Nein. Andy und Pedder sehen sich noch einmal in den benachbarten Gärten um.«
Karin Rösch las das Protokoll der Vermisstenmeldung, als er zu ihr ins Zimmer polterte. »Interessant, was?«, schnappte er in dem missglückten Versuch, mit ihr einmal freundlich zu reden.
Gleichmütig antwortete sie: »Sehr sogar. Die Eltern wissen ungewöhnlich gut Bescheid über den Inhalt der Handtasche. Für eine Siebzehnjährige eigentlich zu gut.«
Das war ihm noch nicht aufgefallen. »Was schließen Sie daraus?«
»Dass sie ihre Tochter scharf kontrolliert haben. Außerdem trauen sie ihr nicht ganz.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Sie haben, bevor sie zum Revier 18 fuhren, festgestellt, dass Martina ihren Pass, ihr Postsparbuch und ihre Sparbüchse nicht mitgenommen hatte.«
»Gut«, lobte er ehrlich. »Dann mal auf!«
Die Hessenstraße war lang und gesichtslos, weder hässlich noch schön, weder laut noch leise. Die winzigen Bäumchen zwischen den Parkbuchten schienen zu verdursten. Endlose Reihen von vierstöckigen Rotziegel-Häusern erschlugen mit ihrer Monotonie. Die eng beieinander liegenden Haustüren verrieten, dass es sich um winzige Wohnungen handeln musste.
Herbert Kleinmann öffnete die Tür. Er war ein auffallend großer, hagerer Mann mit einem länglichen Gesicht, in das sich Mutlosigkeit und Verbitterung eingegraben hatten.