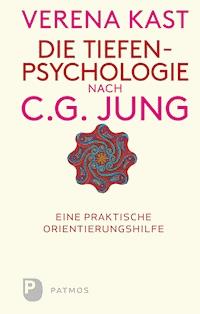Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wenn wir schöpferisch werden, können wir Lebensprobleme besser bewältigen. Wir lernen etwa, mit Ängsten und Krisen gelassener umzugehen, oder entdecken hinter unserer Verletzlichkeit unsere robuste Seite. Eine schöpferische Haltung ermöglicht aber vor allem die Entfaltung unserer Persönlichkeit. So können wir die Spannung zwischen Erinnerung und Sehnsucht für die eigene Entwicklung kreativ nutzen oder durch den Lebensrückblick neue und auch heilende Impulse bekommen. Die renommierte Jung'sche Analytikerin Verena Kast ermutigt in diesem Buch dazu, die bereichernde Kraft eines schöpferischen Lebensstils zu entdecken und zu erfahren, welche ungeahnten Möglichkeiten eine kreative Grundhaltung für den lebenslangen Wachstums- und Reifungsprozess des Menschen birgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Leseempfehlung
Verena Kast
Schöpferisch leben
Patmos Verlag
Inhalt
Vorwort
Vom gelassenen Umgang mit Angst und Krisen
Die Krise und die Zeitsituation
Krisen
Vom Umgang mit der Angst
Beidäugiges Sehen
Nehmen wir es mit Humor!
Der Mensch: verletzlich und robust
Die Pietà – symbolisch verstanden
Ein Traum, der die Verletzlichkeit zeigt
Mein Verständnis von „robust“
Psychologische Konzepte
Entwicklungspsychologische Überlegungen
Wurzeln und Flügel – zur Psychologie von Erinnerung und Sehnsucht
Die Erinnerung
Die Sehnsucht
Die Verklammerung von Erinnerung und Sehnsucht
Angst vor der Sehnsucht – Mut zur Sehnsucht
Die heilende Kraft des Lebensrückblicks
Geschichten erzählen
Erinnern
Lebensrückblick als Therapie
Erinnern und Vergessen, Erinnern und Loslassen
Angeleitete Biographiearbeit
Lebensrückblick als Therapie – praktisch
Aspekte der Freudenbiographie
Ziele der Lebensrückblickstherapie
Schöpferisch werden: Individuation und Kreativität
Eine schöpferische Haltung entwickeln
Der Individuationsprozess
Symbole als Wegmarken des Individuationsprozesses
Der schöpferische Prozess
Durch schöpferische Methoden zu einer schöpferischen Haltung
Kreativität archetypisch: die Hoffnung und die Angst
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Zitatnachweis
Bildnachweis
Quellenverzeichnis
Vorwort
Das Leben ist gerade in wichtigen Ereignissen nicht vorhersagbar. Das erfüllt uns manchmal mit Angst, und manchmal wissen wir einfach nicht mehr weiter, wir geraten in eine Krise. Dann spitzt sich das Leben auf den Konflikt zu, der die Krise hervorrief, und wir können in der Folge nicht mehr über unsere Kompetenzen verfügen, sind nur noch von einigen wenigen Emotionen bestimmt, vielleicht nur noch von Angst, und wir befürchten, unser Leben nie mehr in den Griff zu bekommen. Und dann geschieht etwas, vielleicht durch ein Gespräch mit einem anderen Menschen, durch einen plötzlichen Einfall, einen Traum – und man weiß schlagartig wieder, was zu tun ist. Man hat einen Einfall, oder Einfälle. Diese Einfälle wahrzunehmen und sie in die Tat umzusetzen, das ist schöpferisch. Das Lebensgefühl hat sich verändert, es gibt wieder eine Zukunft.
Warum geht das? Leben verändert sich immer wieder, Neues wird erlebt, gesehen, erfunden. Das Leben als solches ist dynamisch, faltet sich aus, faltet sich ein, verdichtet sich. C. G. Jung war der Ansicht, dass ein schöpferischer Drang durch alles Existierende geht und dass die Menschen, wenn sie an diesen schöpferischen Drang angeschlossen sind, heil werden können, gesund werden.
Wenn wir immer wieder solche Erfahrungen machen, dass in Situationen der Einengung, der Angst, der Ungewissheit sich doch plötzlich wieder Wege auftun, Auswege vielleicht, dass wir neu wieder Einfälle zur Veränderung bekommen und dadurch das Leben sich plötzlich wieder weitet, dann können diese Erfahrungen nach und nach einen Lebensstil begründen: Im Vertrauen darauf, dass immer auch etwas Neues, etwas anderes möglich ist, gerade auch im Austausch mit anderen Menschen, können wir schöpferisch leben. Bei aller Verletzlichkeit und Angst spüren wir dann, dass wir auch mutig sind, belastbar, neugierig darauf, wie das Leben weitergeht. Schöpferisch zu leben – als Haltung – bedeutet, dass wir die Probleme nicht ausblenden, sondern sie nüchtern und präzise sehen – Konflikte in der Außenwelt, Konflikte, die wir eher psychisch erleben in unserer Innenwelt –, wobei wir die Schwere zwar durchaus erleben, aber nicht im Klagen stecken bleiben. Schöpferisch zu leben gründet auf der Zuversicht, dass sich eine Lösung finden wird, vielleicht nicht gerade die, die wir uns vorgestellt haben, vielleicht eine unerwartete, vielleicht auch eine zunächst etwas sperrige. In Situationen, in denen wir von heftigen Emotionen bestimmt sind, ist immer auch unser Unbewusstes am Werk – oft in überraschender Form.
Um schöpferisch zu sein, brauchen wir unsere Vorstellungskraft. Diese gehört zur Grundausstattung des Menschen, wir alle können uns etwas vorstellen; wir können die Vorstellungskraft aber auch besonders wertschätzen und sie üben. Wir nehmen nicht nur die Welt draußen wahr, wir stellen uns die Welt auch vor. Mit geschlossenen Augen können wir uns zurückversetzen in eine Zeit unseres Lebens, in der etwas Entscheidendes geschehen ist; wir können uns auch „sehen“ und spüren in der Begegnung mit einem Menschen, den es schon lange nicht mehr gibt; wir können uns freuen an einer Freude, die wir „damals“ hatten und die wir in der Erinnerung uns in die Vorstellung zurückrufen können. Wir erinnern nicht nur, sondern indem wir uns in diese Situationen noch einmal mit allen Sinnen hineinversetzen, erleben wir sie erneut; die verschiedenen Gefühle, die damals erlebt worden waren, werden wieder aktiviert. Unsere Vorstellungskraft ist eine wesentliche Ingredienz unseres Schöpferischseins. Wir fühlen uns lebendig – und auch das hilft uns, mit schwierigen Situationen umzugehen.
Nicht nur im Zusammenhang mit unserem gelebten Leben und den Reichtümern darin ist uns die Vorstellungskraft von großem Nutzen, sondern auch im Vorstellen der Zukunft. Leider geschieht es oft nur so, dass wir Befürchtungsphantasien haben, Phantasien, was alles Schlimmes geschehen könnte. Wir können aber auch unseren Sehnsüchten nachgehen, und die stammen oft aus dem Unabgegoltenen in der Vergangenheit – aus dem, was noch aussteht und dennoch unbedingt zu unserem Leben gehört. Welchen Wünschen möchten wir noch nachgehen, wo sind gerade jetzt meine Interessen? Das Leben kann auch anders sein!
Schöpferisch zu leben ist eine Haltung, die vielen Menschen unbewusst zu eigen ist. Wer neugierig auf sich selbst ist, wer wissen möchte, was denn die eigene Identität immer wieder neu ausmacht, wer weiß, dass er oder sie immer für eine Überraschung gut ist, wer immer wieder etwas Neues versucht, ist schöpferisch. Nun kann man natürlich noch in einer ganz anderen Art schöpferisch sein: indem man etwas gestaltet, malt, schreibt. Viele Menschen werden nur dies als „schöpferisch“ bezeichnen. Das ist in meinen Augen aber nur die Ausweitung eines schöpferischen Lebensstils überhaupt. Man kann das eigene Leben schöpferisch gestalten, man kann auch die Materie schöpferisch gestalten, und man kann das eigene Leben gestalten, indem man die Materie schöpferisch gestaltet.
Für C. G. Jung war es wichtig, dass die Emotionen und die benannten Emotionen, die Gefühle, die die Menschen oft stören und blockieren, ausgedrückt und dargestellt werden – in einem Bild, in einer Skulptur, in einem Text. So kann die psychische Spannung wahrgenommen, dargestellt und die Energie, die in ihr steckt, aufgenommen werden. Man ist dann nicht mehr das Opfer der Umstände und der damit verbundenen Emotionen, sondern erlebt sich wieder in einer gewissen Selbstwirksamkeit – und damit ist das Selbstwertgefühl wieder besser. Wir sind dem Leben wieder gewachsen.
In diesem Buch sind diese mir grundsätzlich wichtigen Themen, die ich hier jetzt kurz angesprochen habe, in verschiedenen Aufsätzen näher dargestellt – und ich hoffe, diese Aufsätze können Anregung geben für eine schöpferische Haltung, für schöpferisches Leben.
Christiane Neuen danke ich sehr herzlich für die Idee zu diesem Buch und die immer wieder sehr erfreuliche Zusammenarbeit.
St. Gallen, im Mai 2016
Verena Kast
Vom gelassenen Umgang mit Angst und Krisen
Um mit Angst und Krisen gelassen umgehen zu können, braucht es eine bestimmte Einstellung zum Leben, die ich hier kurz benenne:
1. Krisen und Angst sind unvermeidbar, also ein normales Vorkommnis. Krisen sind keine Strafen des Schicksals, keine persönliche Beleidigung – sie gehören zum Leben. Mit Krisen und Angst ist immer einmal zu rechnen, und sie können ausgesprochen sinnvoll sein. Die Angst als eine Emotion, die uns zeigt, dass wir von einer Gefahr ergriffen sind, aber auch in Gefahr sind, etwas für uns ganz Wesentliches in unserem Leben zu verpassen. Die Krise als die Situation der möglichen Umstrukturierung, bei der dieses Wesentliche ins Leben integriert wird – oder verpasst.
2. Wir nehmen uns meistens zu wichtig. Leben wir zu sehr in einer großen Selbstbezogenheit – eine Folge davon, dass wir nicht mehr das Schicksal für vieles verantwortlich machen, sondern unseres eigenen Glückes Schmied sind –, nehmen wir besonders Krisen zu persönlich: Sie werden dann zu einer persönlichen Kränkung. Wir fühlen uns aber deshalb auch verpflichtet, sie allein und rasch zu lösen, mitunter bevor wir sie verstanden haben, fallen in Aktionismus und vergessen, dass es auch eine Dynamik der Selbstregulierung im Leben gibt. Andere Menschen haben auch gute Ideen. Manchmal ergibt das Zusammenspiel von Ideen ganz erstaunliche Lösungen. Die Haltung des Märchenhelden oder der Märchenheldin wäre angebracht: tun, was in der eigenen Kraft liegt, und dann auf hilfreiche Kräfte vertrauen.
3. Um gelassen zu sein, muss man den Tod akzeptieren. Wir nehmen uns auch wichtig, indem wir unserem individuellen Leben eine sehr große Bedeutung zuschreiben. Natürlich sind wir alle einmalig, aber wir sind auch Vorübergehende im Strom des Lebens. Vor uns waren Menschen, nach uns kommen Menschen, alle Lebensträger und Lebensträgerinnen, wie wir auch. Nehmen wir ernst, dass wir sterben müssen, dann muss das Leben angesichts des Todes abschiedlich gelebt werden: Wir müssen immer bereit sein, Abschied zu nehmen, uns der Angst zu stellen, uns zu verändern, uns neu einzulassen. Wenn Abschiedlichkeit einem Leben, das den Tod akzeptiert, angemessen ist, muss sie ergänzt werden durch Offenheit für alles, was das Leben an einen heranträgt, auch Offenheit für Unvorhersehbares, und durch Verantwortlichkeit für das, was gerade ist, durch Engagement, durch das sich Einlassen auf das, was uns wichtig ist.
Das Denken an den Tod und dabei intensiv zu leben, gehört zur Lebenskunst. Leugnen wir den Tod, dann geraten wir in eine übertriebene Selbstbezogenheit, die uns so aufgeregt reagieren lässt, wenn Widriges allzu stark auf uns eindringt. Das Denken an die Abschiedlichkeit der Existenz mag uns melancholisch stimmen, aber aus der Melancholie heraus entsteht die Gelassenheit. Dass alles vergänglich ist im Leben, ist das sicher Bleibende, darauf kann man vertrauen. Und wenn es denn so ist, können wir uns auch wieder einlassen, unseren Interessen nachgehen, spüren, dass es etwas gibt in unserem Leben, das uns mit Lebendigkeit erfüllt, dass anderes Denken Raum hat,1 und auch loslassen. Man kann sich gelassen dem Fluss des Lebens überlassen.
Das fällt uns dann nicht leicht, wenn wir in Situationen geraten, in denen wir uns ängstigen, wenn wir in einer Krise stecken. Kann man da lernen, gelassen zu sein, Abstand zu wahren und dann aus diesem Abstand heraus in einer gewissen Besonnenheit das tun, was uns sinnvoll erscheint, lassen, was notwendig ist?
Die Krise und die Zeitsituation
Identität und Flexibilität
Menschen mit ihren Krisen stehen immer auch in einer bestimmten historischen und gesellschaftlichen Situation. Die Postmoderne ist unter anderem dadurch definiert, dass die sinnstiftenden, großen, zusammenhängenden Erzählungen von Religion und Wissenschaft durch fragmentarische, vorläufige Wissenschaftsmodelle ersetzt worden sind. Ein Orientierungsverlust hat stattgefunden,2 aber auch ein Aufbruch an Freiheit – beides eine Ursache für vielfältige Ängste und Krisen.
Vieles an Festgefügtem ist nicht mehr fest, die Berufsrollen verändern sich, die Rollen von Frau und Mann sind nicht mehr festgeschrieben, die Werte sind nicht mehr allgemein verbindlich. Was aber nicht mehr fest steht, muss immer wieder miteinander ausgehandelt werden. Immer neu müssen wir uns auf uns zunächst noch fremd anmutende Situationen einstellen. Die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Kompetenzen, die wir uns erarbeitet haben, sind vielleicht plötzlich nicht mehr gefragt. Man kann heute gebildet und erfolgreich sein und dennoch vorübergehend erwerbslos werden. Langfristige Bindungen scheinen kaum mehr möglich zu sein, so wird zumindest beklagt, und dennoch trifft man sie bei vielen Menschen immer wieder an. Ohne Zweifel ist die Fähigkeit gefragt, sich immer wieder neu einzulassen und aber auch immer wieder loszulassen, ohne dass man weiß, was kommen wird. Und das macht auch Angst.
Und dann: Es wird viel geklagt heute. Wir bringen uns unnötigerweise in eine Opferposition und geben zu verstehen, dass wir ein besseres Leben haben wollen. Wen klagen wir eigentlich an? Wer soll uns das bessere Leben geben? Eine gewisse Wehleidigkeit greift epidemisch um sich.
Die Klagen
Zu flexibel müsse man heute sein, meinen einige. Der flexible Mensch ist gefragt. Das ist aber nicht neu. Heinrich Pestalozzi, der Schweizer Pädagoge, weltbekannt durch seine Ideen, allen Menschen durch Bildung zu einem erfüllten Leben zu verhelfen, forderte schon 1780 zusammen mit der besseren Ausbildung „Gewerbsamkeit und Biegsamkeit“ – „Effizienz und Flexibilität“ würden wir heute sagen.3
Die Forderung nach Flexibilität ist also nicht neu. Und auch nicht alle leiden heute unter der geforderten Flexibilität. Frauen, so scheint es mir, mussten schon immer flexibel sein, wenn sie ihre verschiedenen Rollen unter einen Hut bringen wollten. Man kann die Probleme auch herbeireden. Auch heute müssen nicht alle so ungeheuer flexibel sein. Vielen schadet die Forderung nach Flexibilität nicht, im Gegenteil. Peggy Thoits4 fand in mehreren Untersuchungen heraus, dass multiple Rollenengagements, wie sie dem flexiblen Menschen entsprechen, die Ressourcen einer Person stimulieren und dass dadurch sowohl das Selbstwertgefühl als auch das Gefühl der existenziellen Sicherheit und auch der Kontrollfähigkeit, das heißt der Gewissheit, kompetent mit dem eigenen Leben umgehen zu können, erhöht werden.5 Es gelingt den meisten Menschen, viele verschiedene Lebenssituationen immer wieder auf sich selbst zu beziehen, viele mögliche Identitäten, die das Ich erlebt und die ihm von außen auch zugeschrieben werden, als zu sich gehörig zu verstehen. Es gelingt, durch alle Fährnisse hindurch ein kohärentes Selbst zu bewahren und auszubauen, eine Mitte zu haben, so etwas wie einen Kern, und damit verbunden das Gefühl, in sich verwurzelt zu sein, eine tragende Festigkeit zu haben. Auch wenn die Veränderung gegenüber dem Gleichbleibenden heute zu dominieren scheint: Es kann gelingen, sich dennoch das Gefühl der sicheren Identität zu bewahren. Dieses Gefühl bewirkt ein stabileres Selbstwertgefühl, das wiederum einen besseren Umgang mit der Angst ermöglicht.6 Dieses Gefühl der Identität bewirkt auch eine Seelenfestigkeit,7 ein kohärentes Selbst, gründend auf einem Tiefenselbst, das erlaubt, auch Beunruhigendes ruhiger anzugehen. Dieses Gefühl der Identität immer wieder neu zu erfahren, ist Ziel verschiedener Therapierichtungen, unter anderem auch Ziel des Individuationsprozesses, wie ihn C. G. Jung beschrieben hat.
Die Beschleunigung
Erschwerend kommt zur Forderung nach Flexibilität weiter dazu, dass die Anforderungen an den Einzelnen immer mehr werden. Und alles soll immer schneller erledigt werden; so nehmen es zumindest viele Menschen im Erwerbsleben wahr. Menschen mit Krisen klagen weniger darüber, dass ihr Leben so unübersichtlich geworden ist, sondern darüber, dass sie unter großem Zeitdruck arbeiten müssen, nicht mehr „zur Besinnung“ kommen.
Aus Untersuchungen an Angstträumen weiß man, dass bei der Beschleunigung von Traumszenen die Angst größer wird;8 werden die angstmachenden Szenen verlangsamt, dann wird die Angst weniger. Diese Verlangsamung geschieht oft schon während des Träumens, denn in den Träumen wird viel Angst verarbeitet. Da wird etwa ein schnelles Fallen im Traum plötzlich verlangsamt, die Träumerin kann zudem noch dem Fallen zuschauen, und die Angst, die vorher fast unerträglich war, wird bedeutend weniger. Was in den Träumen erfahrbar ist, scheint mir auch im wachen Alltag zu gelten: Wenn alles für unser Empfinden zu schnell geht, reagieren wir mit Angst. Können wir die Situationen verlangsamen, „entschleunigen“, wird die Angst weniger.
Bedrohungen in der ganzen Welt
Zu den allenthalben beklagten großen Anforderungen kommen die Probleme in der Welt, über die wir dank Telekommunikation oberflächlich gut informiert sind. Überall auf der Welt sind Krisenherde, wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit, Hunger. Die Sorge, ob die Politiker und Politikerinnen mit Weitblick darauf reagieren, wächst. Die Naturkatastrophen scheinen auch häufiger und schlimmer zu sein als früher. Es gibt viel Bedrohliches in dieser Welt. Viele Menschen leben zudem ahistorisch. Studiert man die Geschichte der Menschen, wird einem bald klar, dass wir nicht die einzigen Generationen sind, die die Welt als bedrohlich empfinden. Aber die eigene aktuelle Angst ist immer die größte.
Es ist schwer zu sagen, ob die einzelnen Menschen mehr unter Krisen leiden als in früheren Zeiten. Menschen suchen eher Hilfe in Krisen, besonders in Beziehungskrisen, und das ist gut so. Menschen wissen heute, dass man in psychischen Notlagen Hilfe in Anspruch nehmen kann, und sie nehmen sie auch in Anspruch. Dadurch ergeben sich doch oft gute Wendungen in einem Leben.
Die Krisen des Einzelnen scheinen sich mir wenig von den Krisen von früher zu unterscheiden: Menschen, die wirklich eine Krise erleben, eine psychische Notsituation, haben wie auch früher das unabweisbare Gefühl, das Leben nicht mehr bewältigen zu können, und reagieren mit großer Angst und Panik. Die Krisen haben auch eine Tendenz, sich über fast alle Lebensbereiche zu legen, sie erscheinen uns komplex, und es gehört zu einer Krisenintervention, dass wir die wichtigsten Lebensbereiche, die in der Krise sind, herausdifferenzieren und sie einer Bearbeitung zugänglich machen.
Wenn so viel Angst unter den Menschen ist, dann muss der Umgang mit den Krisen und der Angst bedacht werden.
Krisen
In Krisensituationen fühlen wir uns vom Leben in die Zange genommen: Die Anforderungen, die an uns gestellt werden, und unsere subjektiv erfahrbaren Möglichkeiten, die sich uns stellenden Schwierigkeiten bewältigen zu können, stimmen nicht mehr überein. Ein Ungleichgewicht herrscht. Unsere üblichen Gegenregulationsmittel, mit denen wir normalerweise wieder unser Wohlbefinden einigermaßen herstellen können, greifen nicht mehr. Es sind zu viele Anforderungen, die man mit den inneren und den äußeren Möglichkeiten, Probleme zu lösen, nicht mehr bewältigen kann. Von Krisen sprechen wir in der Psychologie dann, wenn dieses Ungleichgewicht vorübergehend und mit heftigen Emotionen verbunden ist – ein Durchgangsstadium also. Solange die Herausforderungen des Lebens und die Möglichkeiten der Bewältigung übereinstimmen, sprechen wir nicht von einer Krise, sondern eben von einer Herausforderung. Stimmen Anforderung und die Möglichkeit zur Bewältigung dieser Anforderungen nicht mehr überein, reagieren wir Menschen mit Angst, mit Stress; eventuell wehren wir die Angst auch mit Wut ab. Die Angst generalisiert sich zum einen über verschiedene Lebensthemen hinweg: Das ganze Leben erscheint einem plötzlich krisenhaft, nicht mehr zu meistern. Die Angst generalisiert sich aber auch über die Zeit hinweg: Man stellt sich vor, dass man das Leben nie wieder in den Griff bekommen wird und es vielleicht auch überhaupt nie im Griff hatte. Man ist alles andere als gelassen.
Die Orientierung im Leben, die Kontrolle über das eigene Leben, zumindest in einem bestimmten Maß, ist aber ein Grundbedürfnis des Menschen. Wird dieses Grundbedürfnis erfüllt, vermittelt das existenzielle Sicherheit.
Werden nun in der Krise die Angst und die damit verbundenen Befürchtungsvorstellungen generalisiert, vergisst der Mensch, dass Aspekte seines Lebens von der Krise ausgenommen sein können, aber auch, dass er ja eigentlich auch Krisenkompetenz hat, dass er oder sie schon viele Krisen im Leben gemeistert hat und dass er oder sie auch weitere Ressourcen hat in Form von hilfreichen Beziehungen, von Handlungskompetenz, von Ideen, von freudigen Erfahrungen, von Träumen, die uns neue Perspektiven eröffnen. Diese und andere Ressourcen, die wir auch haben, helfen das Leben zu bewältigen.
Krisen gab es schon immer und wird es auch immer geben. Menschen verändern sich, haben Lebensübergänge zu bestehen, auch glückliche, haben Schicksalsschläge zu verkraften. Beziehungen werden angeknüpft und bringen das gewohnte Leben in Unordnung, oder sie werden schwierig, können sogar zerbrechen. Eine Krise ist aber auch eine bedeutsame Situation, in der es unausweichlich um uns selbst geht; eine Gelegenheit, das Leben, das vielleicht schon viel länger aus dem Ruder gelaufen ist, nicht mehr stimmig war, wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Ein wichtiges Problem in unserem Leben muss gelöst werden, etwas noch Ausstehendes, ein noch ausstehender Aspekt unseres Selbst muss wahrgenommen und ins Leben hereingeholt werden, sonst hätten wir keine Krise. Nicht selten geht es dabei um Leben und Tod. Aber auch wenn die Krise nicht diese existenzielle Dimension berührt, so drückt sich in ihr dennoch aus, dass der Mensch in der Krise eine neue Passungsleistung zwischen sich und der Welt, zwischen Innenwelt und Außenwelt vornehmen muss, damit das Leben wieder in ein Gleichgewicht kommt. Notwendige Veränderungen, notwendige Entwicklungen stehen an und müssen realisiert werden.
Die Dynamik der Krise und die Angst9
Krisen markieren Übergänge, ereignen sich auch oft an Lebensübergängen; sie sind Phasen der Labilität, mit Angst, Spannung und Selbstzweifeln verbunden; Konflikte, die habituell zu unserem Leben gehören, Schwierigkeiten, die wir schon immer hatten, werden reaktiviert. Labilität und erhöhte Konfliktanfälligkeit verstärken sich gegenseitig. So macht uns nicht nur die jeweilige Lebensanforderung zu schaffen, zusätzlich können alte Konflikte, alte Lebensthemen neu aufflackern, dadurch aber natürlich auch bearbeitet werden. Es ist eine vulnerable Phase.
Die labile Phase auf der Höhe der Krise
Die Krise kann Verkrustetes, Gewohntes, zur Normalität gewordene Schwierigkeiten aufbrechen. Die Krise kann die Motivation zur Veränderung ersetzen. Warum?
Die Angst, die mit der Krise verbunden ist – vordergründig meistens eine Angst zu scheitern, mehr in der Tiefe eine Angst der Persönlichkeit, sich nicht verwirklichen zu können10 – zeigt, dass die normalen Abwehrmechanismen, mit denen wir in der Regel mittlere Ängste bewältigen, nicht mehr funktionieren. Durch den dadurch ausgelösten psychophysiologischen Stress können alte Bahnungen leichter gelöscht werden, neue werden eher möglich. Auf dem Höhepunkt der Krise kann also besser als sonst verlernt und neu gelernt werden.
Auf dem Höhepunkt der Krisensituationen können auch die Träume leichter verstanden werden als sonst, wegen der verminderten Abwehr und weil das Leben so sehr auf ein Thema hin ausgerichtet ist.
Der wachsende Zweifel an sich selbst und am eigenen Leben, verbunden mit der Selbstreflexion, die wir erstmals in der Adoleszenz so richtig wahrnehmen,11 geben die Möglichkeit, die anstehenden Probleme zu reflektieren, neu einzuordnen, und ermöglichen eine neue Beziehung zu sich und zur Welt, also auch Verhaltensänderungen. Dabei wird die eigene Identität im jeweiligen Kontext neu formuliert (wer bin ich jetzt?), wir werden wieder stimmiger mit uns selbst, haben klarere Ziele, werden meistens auch eigenständiger und gewinnen wieder mehr Selbstvertrauen. Dieser Prozess kann allerdings auch scheitern.
Es stellt sich die Frage, wann denn eine Krise zu einer Chance wird, wann zu einer Falle.