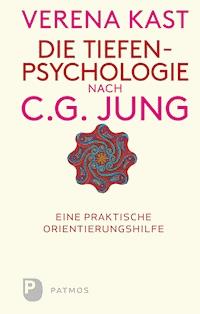Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Keine Frage: Alle Menschen altern. Durch manche schwierige Veränderungen, die damit verbunden sind, gibt es viele neue Herausforderungen zu meistern. Wir müssen flexibel auf Situationen reagieren lernen, die wir nicht oder nur wenig beeinflussen können. Verena Kast, selbst Anfang siebzig, zeigt: Gerade im Alter gilt es, die Überraschungen, die das Leben so mit sich bringt - darunter auch freudige -, anzunehmen und kreativ mit ihnen umzugehen. Wie dies gehen könnte, beschreibt die renommierte Jung'sche Analytikerin in diesem neuen Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Leseempfehlung
Verena Kast
Altern – immer für eine Überraschung gut
Patmos Verlag
Inhalt
Einleitung
Das Wohlbefindensparadox
Flexibilität
Flexibilität und Starrsinn
Flexibilität als schöpferische Haltung
Bedürfnis nach Kontrolle
Vor-Sorge
Fantasien des Vertrauens
Die Fähigkeit des Hinnehmens
Flexibilität und Kontrolle
Das Bedürfnis nach Kontrolle als Grundbedürfnis
Umgang mit Angst
Äußere Kontrolle – innere Kontrolle
Emotionen und Gefühle als Möglichkeit der Orientierung
Angst als Macht
Lebensqualität trotz Angst
Schamangst
Humor
Freude
Vorfreude
Interesse
Die Simultaneität positiver und negativer Emotionen
Distanzierung von Spannungen
Trauern und Einsamkeit
Annäherung an den eigenen Tod
Erinnerung als Ressource
Nähe durch erzählte Erinnerungen
Persönliches und kulturelles Gedächtnis
Vom Umgang mit den großen Sorgen
Selbstständigkeit und Abhängigkeit
Der alternde Körper
Dankbarkeit als Gegengewicht
Mitsorgende und Mittragende
Was wird besser im Alter?
Lob der Vorstellungskraft
Die Erinnerung an gute Erfahrungen
Die Wirksamkeit von Placebos
Vertrauende Erwartung auf überraschende Prozesse
Abschiedlich leben
Loslassen
Hoffnung
Ars moriendi als Lebenskunst
Schöpferische Einsamkeit
Dank
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Einleitung
Ich werde älter. Noch spüre ich nicht allzu viel davon, noch kann ich vieles. Aber ich werde immer einmal von meinen Mitmenschen auf mein Alter und mein etwas eigenwilliges Umgehen damit hingewiesen. „Arbeitest du noch? Wie lange willst du denn noch arbeiten? Willst du dir das noch antun? Das ist doch Stress!“ Und irgendwie klingt an: Du könntest damit mutwillig dein Leben verkürzen. Ich wehre mich energisch dagegen, ins Alter „geredet“ zu werden, mit diesen und ähnlichen Bemerkungen auf ein bestimmtes Altersmodell festgelegt zu werden. Meine Befürchtung besteht wohl darin, dass ich es selbst auch noch „glauben“ und dass ich meine Art des Alterns plötzlich als fragwürdig einstufen könnte. Ich will selber entscheiden, was ich noch mache in meinem Alter, was mir noch Freude macht, was ich noch will – das ist doch die Freiheit des Alters, die ich hoch schätze, und die werde ich mir zu erhalten wissen.
Menschen altern unterschiedlich, Menschen gestalten auch unterschiedlich ihr Alter. Natürlich spüre ich auch selber, dass ich älter werde, das ist ja auch nicht neu. Seit einigen Jahren ertappe ich mich dabei, wie ich mir auf Reisen sehr deutlich sage: „Da werde ich nie mehr hinkommen …“ Natürlich könnte ich noch einmal dahin gehen, aber es sind zu viele Orte, die ich noch sehen möchte. Es gibt viele Orte in der Welt, die mich fasziniert haben, ich bin dennoch nicht mehr dahin zurückgegangen, aber ich habe es mir früher nicht gesagt. Denn da war ja noch so viel Zeit, so viele Möglichkeiten. Und jetzt gibt es zwar immer noch genug Zeit, auch genug Möglichkeiten, aber nicht mehr für alles. Auch das Wörtchen „noch“ gebrauche ich viel öfter als früher. Ich bewege mich immer noch gerne, aber dennoch weniger rasch als früher. Ich mache mehr Pausen als früher, nehme mir mehr Zeit, mache nur noch eine Sache auf einmal – aber warum sollte ich nicht weiter das machen, was mir bis jetzt in meinem Leben Freude gemacht hat?
Wenn ich mir in diesem Buch Gedanken zum Altern mache, meine ich überhaupt nicht, dass diese für alle Menschen zutreffen könnten. Auch bin ich noch eine „junge Alte“, eine Angehörige des dritten Lebensalters, das man etwa von 65 bis 84 ansetzt, dem dann das vierte Lebensalter folgt, etwa von 85 bis zum Tod. Schwieriger, so wird geschrieben, wird das Leben in diesem vierten Lebensalter; auf dieses sehr hohe Alter werde ich nur gelegentlich einen Blick werfen.
Das dritte Lebensalter indessen, das kann man heute an vielen Orten lesen, ist ein sehr gutes Alter: Körperlich und geistig noch fit, befreit von Erwerbsarbeit, viel unterwegs. Die siebte Dekade, das Alter zwischen 70 und 80, gilt als die emotional befriedigendste Phase des Lebens, auch wenn das zunächst überraschen mag. Von dieser Warte aus schreibe ich – ich bin jetzt 72. Ob das emotional wirklich die beste Dekade ist, kann ich noch nicht beurteilen, werde es aber wohl auch nicht beurteilen können. Wie soll ich das vergleichen, ist da überhaupt etwas Vergleichbares? Die Vergleiche sind statistisch. Dennoch: Mich freut es, wenn solche Altersbilder – gestützt von robusten Untersuchungen – in die Welt gesetzt werden. Die Bilder, die wir vom Altern haben, beeinflussen in hohem Maße unsere Sicht dieses Prozesses und haben so einen Einfluss darauf, mit welchen Erwartungen und Befürchtungen wir an diesen Lebensabschnitt herangehen. Ich selber bin mit einem sehr geliebten alten Großvater aufgewachsen, den ich heute auch als ein wenig weise bezeichnen würde, war aber auch umgeben von anderen alten Menschen, die Wert darauf legten, dass ich in ihrer Umgebung spielte, die mir das Kartenspiel beibrachten, damit sie weiter ihrem Hobby frönen konnten, nachdem einer der alten Männer gestorben war. Auch das lernte ich: Menschen sterben.
Ich sehe das Altern als einen Prozess mit Entwicklungsaufgaben, die uns herausfordern. Als Prozess fängt gutes Altern meines Erachtens schon früh an. Schon früh war mir die Idee, dass Leben „abschiedlich“1 gelebt werden muss, weil es den Tod gibt, zentral wichtig. Diese Idee schien und scheint mir richtig zu sein und bestimmend für mein Leben – wohl auch für das Leben überhaupt: loslassen und immer wieder sich einlassen; enden lassen und wieder neu beginnen. Dieses Thema wird nun aber im Alter viel existentieller, muss deshalb noch einmal neu in seinen Implikationen bedacht werden.
Was ist mit der damit verbundenen Flexibilität und Kreativität im Alter? Darum geht es mir in diesem Buch. Wie kann man einwilligen ins Älterwerden und sich dabei nicht nur nicht verlieren, sondern auch immer wieder neu mit sich selbst in Kontakt kommen, immer wieder neu das Leben gestalten, trotz der Verluste, sich eine gute Lebensqualität bewahren, eine erfreuliche Zeitgenossin bleiben, in Verbindung mit anderen Menschen? Aus der eigenen Erfahrung, aus vielen Gesprächen mit Altersgenossinnen und Altersgenossen, die zum Teil scharf den Problemen des Alterns ins Auge blicken, habe ich zudem die Themen gefunden, mit denen ich mich hier auseinandersetze.
Ich schreibe als Psychotherapeutin, halte das Alter aber in keiner Weise für eine Krankheit. Die Jung’sche Psychotherapie hat schon immer die zweite Lebenshälfte als eine wichtige Periode im Leben verstanden, in der der Mensch sich nach innen wendet, bis jetzt Ausgespartes im Leben aufnimmt und dadurch mehr zu sich selbst kommt. Heute weiß man viel über die Veränderungen, die sich im Alterungsprozess manifestieren; aus einer psychotherapeutischen Perspektive, die nach Ressourcen fragt, kann man zum einen die Sicht des Alters neu bestimmen, aber auch einfach aufzeigen, was denn bleibt, wie man den Kontakt zu den Ressourcen halten kann, wenn man denn will.
Das Wohlbefindensparadox
Es ist ja keine Frage, wir alle altern: Die Entwicklungen in unserem Körper bewirken, dass wir unselbstständiger werden – das ist das Schicksal, das zu akzeptieren ist. Es verkürzt sich nicht nur unser Zeithorizont, wir bewegen uns auch immer mühsamer auf ihn zu. Die Treppen scheinen steiler zu werden, kleine Knöpfe an Blusen und Hemden entwickeln ein Eigenleben, die Menschen sprechen noch schneller und leiser als bisher, die Zähne werden länger, die Muskeln schwächer, wir können nicht mehr so rasch gehen, wie wir es gewohnt waren, kommen schneller außer Atem, alles geht zunehmend etwas langsamer, das Hörvermögen nimmt ab, wir sehen nicht mehr so gut, reagieren zunehmend langsamer – und Stellen am Körper können plötzlich schmerzen, von denen wir bisher nicht einmal wussten, dass es sie gibt. Hinzu können ernsthafte Erkrankungen kommen.
Dennoch: Altern – so wie es sich halt abspielt – halte ich nicht für eine Krankheit, sondern für eine ganz normale Lebensphase mit speziellen Herausforderungen, so wie jede Lebensphase ihre Herausforderungen hat. Wir werden im Alter aber nicht nur schwächer und sterben dann. Trotz all dieser vielfältigen Verluste ist unser Wohlbefinden erstaunlicherweise so gut wie in jüngeren Jahren, zum Teil sogar besser. Staudinger hat dafür den Ausdruck „Wohlbefindensparadox“2 geprägt. Wir werden auch glücklicher – statistisch gesehen –, sagen uns andere Studien3: Mit 20 sind wir glücklich, dann nimmt das Gefühl der Lebenszufriedenheit ständig etwas ab, nach 45 geht es wieder aufwärts. In der zweiten Lebenshälfte, oder man könnte auch sagen: im dritten Lebensalter, nimmt das Wohlbefinden zu, wird allerdings geringer bei den Hochbetagten.4 Blanchflower und Oswald5 meinen, wir könnten – immer statistisch gesehen – erwarten, dass wir in unseren frühen 80er-Jahren so glücklich sind, wie wir mit 20 waren. Wichtiger noch als diese Prognose, die ja durchaus erfreulich ist, ist die Bemerkung, dass dieses Wohlbefinden nicht primär mit glücklichen Lebensereignissen zu tun habe, sondern mit einer tiefen, spezifisch humanen Veränderung im alternden Menschen. Was könnte das sein?
Diese Veränderung erinnert an die Theorie des Individuationsprozesses, den C. G. Jung beschrieben hat.6 Jung war der Ansicht, dass in der Mitte des Lebens vermehrt Depressionen auftreten, und dass hinter diesen Depressionen Leben verborgen sei, das auch gelebt werden könnte – das bis jetzt ausgespart worden sei. Er versuchte nachzuweisen, dass nach der Mitte des Lebens die innere Welt wichtiger wird, mehr belebt wird, und damit auch die Frage nach dem Sinn. Diese neue Entwicklung wird möglich, indem man sich auch mit dem Unbewussten – über Träume, Imaginationen, gemalte Bilder – in Verbindung setzt. Stone7 vermutet den Grund, warum Menschen in der Mitte des Lebens wieder glücklicher zu werden beginnen, in Umweltbedingungen (etwa mehr Zeit), in psychologischen Einflüssen, etwa dadurch, dass man im Alter die Welt anders wahrnimmt, weil man viel Erfahrungen hat, Kompetenzen ansammeln konnte, oder sogar in biologischen Einflüssen, etwa in den veränderten endokrinen Ausschüttungen.
Carstensen8, die wohl die bedeutendsten und auch robustesten Forschungen zum Thema Wohlbefinden bei jüngeren und bei älteren Menschen durchgeführt hat, ist der Ansicht, die Zufriedenheit und die emotionale Stabilität im Alter habe damit zu tun, dass der wahrgenommene Zeithorizont sich verkürzt, und sie weist nach, dass dadurch eine Veränderung in der Motivation entsteht: Weil nicht mehr viel Lebenszeit ansteht, suchen Menschen nach dem, was für sie emotional bedeutsam ist, und das pflegen sie dann auch.
Viele verschiedene Forscher scheinen sich also darin einig zu sein, dass sich mit dem Altern auch etwas eher Überraschendes einstellt, dass eine Harmonisierung, Bereicherung und Belebung des emotionalen Lebens erfahrbar ist, was zu mehr Wohlbefinden führt, trotz aller Schläge, die beim Altern ja auch einzustecken sind. Also nicht notwendigerweise die Altersdepression, die Verbitterung, sondern wir sind auch zufriedener im Alter, glücklicher als vorher – obwohl Einbußen unabwendbar sind. Ein Paradox eben – oder vielleicht doch nicht. Natürlich kann das Altern bei den verschiedenen Menschen auch ganz unterschiedlich aussehen. Wer schon immer eher verbittert war, wird es eher auch im höheren Alter sein. Wer eher vertrauensvoll war, wird dieses Vertrauen auch ins Alter mitnehmen können. Wer mental und körperlich wenig beeinträchtigt ist, wird sich leichter an Umstellungen anpassen. Es gilt also weder, das Altern zu idealisieren noch es zu verteufeln – es ist eine Entwicklungsaufgabe, und um diese Herausforderungen soll es in diesem Buch gehen. Was hilft uns, diese Herausforderung anzunehmen?
Flexibilität
Flexibilität und Starrsinn
Wenn der Boden schwankt, muss man flexibel werden oder flexibel bleiben. Im Alter schwankt der Boden in mancherlei Hinsicht. Und das nicht nur, weil sich gelegentlich Schwindelanfälle einstellen, sondern auch, weil so vieles, was sicher und verlässlich schien, worauf man glaubte, bauen zu können, bei sich und bei anderen ins Schwanken gerät. Sich auf das Schwanken einstellen, innerlich mitgehen, sich nicht dagegen auflehnen, flexibel sein – so lassen sich viele der unvermeidlichen Imponderabilien des Alters ausbalancieren.
Stellen wir uns vor: Wir sind in einem nicht allzu großen Boot auf dem Wasser, wir wollen aufstehen, vielleicht den Platz wechseln oder auch aussteigen – das Wasser ist bewegt. Das Boot schwankt. Wenn wir dieses Schwanken wahrnehmen, wir uns darauf einstellen, es uns gelingt, mit unserem Körper mit diesen Bewegungen mitzugehen, sie als gegeben anzunehmen – dann können wir sie ausbalancieren, fallen wir nicht ins Wasser. Wer dagegen ängstlich stocksteif in diesem Boot steht, wird mit hoher Sicherheit über Bord gehen, ins Wasser fallen. Kann dieses Bild Hinweise geben, wie mit den Schwankungen im Alter umzugehen wäre?
Flexibilität heißt hier, sich anzupassen an das, was ist, und das, was einem zustößt; mitzugehen mit dem Fluss des Lebens – und dennoch nicht die Form, die eigene Identität zu verlieren. Flexibel meint ursprünglich, biegsam zu sein, um nicht zu zerbrechen, und immer wieder in die alte Form zurückspringen zu können. Mitzugehen mit den Anforderungen des Lebens, sich dabei aber doch nicht zu verlieren, bei sich selbst zu bleiben, ist gefragt. Leben ist im Fluss, der Veränderungen sind viele, besonders wenn wir älter und alt werden: Veränderungen im äußeren Leben, Veränderungen im Umgang mit sich selber, dem alternden Körper, der alternden Seele, den Mitmenschen, dem Verlust von Mitmenschen. Viele dieser Veränderungen sind nicht vorauszusehen – und deshalb brauchen wir eine Haltung der Flexibilität, denn zu kontrollieren sind viele davon nicht.
Nun verbindet man das Alter nicht gerade mit Flexibilität. Da spricht man doch eher vom Starrsinn der Alten, einer Form der ängstlichen oder auch trotzigen Kontrolle. Und es mag ja auch sein, dass es alte Menschen gibt, die etwas starrsinnig werden, vielleicht trifft auch zu, dass alle Menschen in gewissen Belangen als starrsinnig erlebt und bezeichnet werden können, weil sie einfach nicht von einer Haltung, die ihnen wichtig ist, abzubringen sind, weil sie mit einer übertriebenen Festigkeit dem sie Ängstigenden zu trotzen hoffen. Ich behaupte nicht, dass es keinen Starrsinn gäbe, sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Menschen. Gebrauchen wir allerdings den Ausdruck Starrsinn, dann heißt das auch, dass wir mit dem Menschen, dem wir dieses Attribut zuschreiben, im Moment nicht umgehen können. Er steht starr im Getriebe des Lebens – unbeugsam – und das stört den Fluss des Lebens, denn wir können nicht mit ihm in Verhandlung treten, in einen Dialog treten. Ein schroffes Nein wird uns entgegengesetzt, mit dem wir in der Regel nicht flexibel umgehen können, mit dem nicht flexibel umzugehen ist. Man kann dann auch gemeinsam keine Lösung miteinander finden, man kann eine schwierige Situation auch nicht gemeinsam ausbalancieren.
Die Flexibilität im Alter ist dem gegenüber eine „wissende“ Flexibilität. Sie rechnet mit Schwächen und Unzulänglichkeiten, sie ist weit entfernt von Perfektionismus, sie weicht aus, wo es notwendig ist, riskiert zu stolpern und vertraut darauf, wieder festeren Tritt zu gewinnen. Sie weiß gelassen um die vielen Veränderungen im Leben und hofft dennoch auf Kontinuität, weiß um die Kontinuität in der eigenen Persönlichkeit, Kontinuität in der Veränderung.
Flexibilität als schöpferische Haltung
Wenn wir von Schöpferischsein sprechen, denken wir oft an ein Produkt: Jemand erfindet eine neue Theorie, schreibt einen Roman, malt ein Bild, komponiert eine Oper. Das, so sind wir uns einig, machen die schöpferischen Menschen. Schöpferisch zu sein ist aber auch eine Haltung mit einer Perspektive und als Haltung allen Menschen zugänglich. Es ist eine Haltung, die das, was interessiert, neu zu verstehen, zu durchdringen versucht und es in einen Zusammenhang mit Bestehendem bringt, so dass dieses Bestehende aus einer anderen Perspektive gesehen werden kann, sich auch anders anfühlt, also auch anders wird. In der schöpferischen Haltung nehmen wir nur wenig für gegeben hin, sondern werfen den Blick darauf, wie scheinbar Gegebenes auch verändert werden kann oder wie man mit einer neuen Einstellung auch eine andere Wahrnehmung des Gegebenen erreichen kann, eine Wahrnehmung, die lebenstauglicher und lebendiger ist. Alles kann auch anders sein, neu; alles, auch Störendes, ist in dieser Haltung interessant, ein Anlass, sich damit auseinanderzusetzen: in einer mehr lebenspraktischen Weise, indem man Wege sucht, wie man sich in vertrackten Lebenslagen doch noch vom Boden erheben kann, in einer mehr spirituellen Form, wie man einer Situation, die einem sinnlos erscheint – etwa der Tod eines geliebten Menschen vor der Zeit – doch noch Sinn abtrotzen kann oder sich auch entscheiden kann, zunächst ohne Sinn zu leben.
In einer schöpferischen Haltung sind wir davon überzeugt, dass wir Einfluss auf unser Leben haben, immer wieder Einfluss auf unser Leben nehmen können, dass eben nichts ein für alle Mal gegeben ist und daher auch verändert werden kann. Aber auch umgekehrt: Wenn wir Menschen mit einer schöpferischen Haltung sind, sind wir auch – meist unbewusst – davon überzeugt, dass nur wenig bleibt, wie es ist, und dass dieses Wissen dennoch nicht unserer Persönlichkeit und unserem Leben den Boden entzieht. Gerade darauf vertrauen wir: Was immer auch geschieht, es geschieht mir, und ich kann in irgendeiner Weise damit umgehen. In dieser Haltung befürchten wir nicht die ständig zu erwartenden Veränderungen, sondern wir können sie gelassen angehen, wenn sie denn eingetroffen sind. Gewiss gilt das nicht für alle Veränderungen: Ein plötzlicher Krankheitseinbruch oder der Verlust einer uns nahestehenden Person wird uns dennoch erschüttern und auch Ängste auslösen.
Bedürfnis nach Kontrolle
Vor-Sorge
Die Erfahrung, dass man öfter als früher die Kontrolle über den Körper, über die Alltagsbewältigung zu verlieren droht oder gar verliert, ruft nach Kontrolle. Eine besondere Form der Kontrolle im Alter und für das Alter ist die Vorsorge. Alte Menschen können sagen, sie hätten vorgesorgt, und jetzt sei es genug. So, wie der Winter kommt und man sich darauf einstellt und Vorräte an Heizmaterial anlegt, weiß man, kommt auch das Alter, und man kann sich nicht mehr auf alles so einstellen wie zuvor. Bei einigem kann man zwar auch vorsorgen: hinreichend Geld, um über die Runden zu kommen, eine geklärte Wohnsituation, eine Idee, wie man leben möchte, wenn man viel Hilfe braucht. Für existentielle Erfahrungen vorzusorgen, ist schwieriger: Natürlich wissen alle Menschen, dass im höheren Alter Freunde und Partnerinnen sterben werden, wichtige Bindungen, die Geborgenheit geben, verloren gegeben werden müssen – aber da kann man nicht wirklich vorsorgen. Es ist vielleicht möglich dafür zu sorgen, dass es noch Menschen gibt im Beziehungsnetz, die jünger sind. Aber auch das kann einen nicht vor Verlust schützen.
Eigentlich kann man gegen das Schicksal nicht vorsorgen. Aber möglich ist das Sammeln von guten Erfahrungen, von Freuden, die man erlebt hat, das Sammeln von psychischen Schätzen – für die härteren Tage. Aber auch die Vorsorge hat ein doppeltes Gesicht: Das Vorsorgen, die Sorge im Voraus, der Blick auf die härteren Zeiten sind sinnvoll, damit man sich dann nicht mehr zu sorgen braucht, wenn man es nicht mehr kann. Der besorgte Blick auf die Zukunft – Wie lange noch? – bedeutet aber auch: Jede kleine Schwäche, die man früher unter Stress abgebucht hätte, wird als Vorbote einer Zeit gesehen, in der immer weniger geht. Wie lange geht das noch gut? Wie lange kann das noch gutgehen? Kann ich das in einem Jahr noch? Und vor allem: Was kann ich tun, damit es noch möglichst lang gut geht? Keine Vorsorge ist das, sondern eine handfeste Sorge! Natürlich kommt einmal die Zeit, in der vieles nicht mehr gehen wird. Aber: Vor lauter Sich-Sorgen kann man das, was noch da ist, was das Leben reich macht, nicht mehr genießen. Davor warnte bereits Seneca: „Es ist ohne Zweifel töricht, weil du irgendwann einmal unglücklich sein wirst, jetzt schon unglücklich zu sein.“9
Die Beschäftigung mit dem Alter ist problematisch: Wir wollen „gut altern“, wissen, was im Alter wichtig sein könnte – und alles, was wir tun, hat in sich auch die Tendenz, das Defizit bereits vorwegzunehmen, sich jetzt schon im sehr hohen Alter zu sehen und dieses zu generalisieren und mit dem Alter als Ganzem, das ja sehr unterschiedliche Phasen umfasst, gleichzusetzen. Entweder wird das Alter ausgeblendet, oder man lässt sich gleich schon sehr alt sein und möglicherweise sogar sterben. Dadurch wird das Jetzt – und das Leben findet im Jetzt und Hier statt – überschattet. Dazu macht Seneca in seiner Schrift Über die Kürze des Lebens darauf aufmerksam, dass die Erwartung, die vom Morgen abhängig ist, das Heute zerstört.10
Aber auch umgekehrt gilt: Die Angst von heute kann in der Vorstellungskraft die Zukunft viel düsterer malen, als sie dann ist. Die Befürchtungen von heute lassen die Zukunft nicht offen sein, lassen keinen Raum für Flexibilität im Umgang mit den Schwierigkeiten, aber auch keinen Raum für überraschend gute Erfahrungen. Das Vorsorgen, das dazu führen soll, dass wir mit wenig Angst das hohe Alter erreichen, kann gerade bewirken, dass eine Periode des Lebens nicht in ihrem Wert gesehen und geschätzt wird, weil man sich zukünftiges Unheil möglichst vom Leib halten will, weil man noch so viel wie möglich kontrollieren will.
Fantasien des Vertrauens
Was befürchtet man nicht alles: Wir können uns schreckliche Szenarien vorstellen, für uns selber, für die Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen! Nicht selten sind es gerade diese aggressiven Fantasien, die Angst auslösen können:11 Da stellt sich der alte Mann vor, wie seine beiden Söhne mit ihren Autos Unfälle haben werden – diese Unfälle stellt er sich minutiös vor –, und die Söhne werden behindert sein, er kann nicht helfen, und ihm wird auch nicht mehr geholfen werden. Er hofft, dass das nicht geschehen wird. Denn wenn das geschähe, dann hätte er niemanden mehr, der ihm beistehen könnte. Seine Vorstellung regt ihn aber unmäßig auf. Warum muss er sich ein so aggressives Szenario vorstellen? Er würde dieses Szenario nicht aggressiv nennen, sondern besorgt. Dennoch ist diese Fantasie voll von destruktiven Szenen. Ist das eine Form, sich mit dem nahenden Tod zu beschäftigen, dem Tod verstanden als „unzerstörbarem Zerstörer“?12 Man will der Angst entgehen und schafft dadurch gerade Angst.
Das Bedürfnis nach Kontrolle betrifft nicht nur die Bewältigung des Alltags, der zunehmend schwieriger sein kann, sondern auch die beiden Grundängste, verlassen zu sein und ausgestoßen zu werden. Um nicht verlassen zu werden und sich nicht ausgestoßen zu fühlen, werden in der Fantasie Beziehungen „kontrolliert“, und zwar paradox, wie bei dem alten Mann, der fantasiert, was seinen Söhnen alles geschehen könnte, und der wohl hofft, mit seinen Fantasien genau das zu verhindern. Er macht sich dabei aber nur unglücklich, wird noch ängstlicher.
Manche versuchen es realer im Alltag, indem sie den Beziehungspersonen klarmachen, wie sehr sie sie brauchen. Gelingt das liebevoll freilassend, mit freundlichem Blick, mag das bestehende Beziehungen intensivieren und eine größere Innigkeit ermöglichen. Geschieht das jedoch ängstlich vorwurfsvoll fordernd und daher auch klammernd, wird gerade das Gegenteil erreicht: Es entsteht keine Nähe, man bleibt allein, fühlt sich vielleicht sogar ausgestoßen. Es ist wichtig, sich selber nicht auszustoßen, sondern sich selber immer noch als einen Teil der Mitwelt zu verstehen und sich auch immer wieder einmal einzubringen mit Ideen und Gedanken, so wie es halt möglich ist. Flexibel eben. Allein sein, sich den eigenen Gedanken und Fantasien überlassen, aber auch wieder in Beziehung treten, sich einbringen, wenn es passt.
Es wäre sicher besser, Fantasien des Vertrauens zu pflegen, für sich selber, für die anderen Menschen. Das würde dazu führen, dass man darauf vertraut, noch Einfluss auf das Leben zu haben. Was hat man noch zu geben? Fantasien des Vertrauens nähren auch das Selbstvertrauen, zudem das Vertrauen, auf Veränderungen des Lebens in einer guten Weise reagieren zu können – flexibel zu sein. Manche Menschen sind von Kindheit an vertrauensvoller, sie haben dem Leben schon immer auch gute Überraschungen zugetraut, sie trauen anderen Menschen Gutes zu, sich selber auch. Sie haben einen freundlichen Blick aufs Leben und auf sich selbst, auch auf die zunehmenden Schwächen und die zunehmenden Ängste.
Wer nicht so sehr begabt dafür ist, vertrauensvoll zu sein, könnte sich zumindest zum Vertrauen entschließen. Wer ein höheres Alter erreicht hat, hat das eigene Leben kompetent gelebt und auch erlebt, dass in vielen Situationen Grund zum Vertrauen vorhanden war, zum Vertrauen in sich selbst, aber auch zum Vertrauen in andere Menschen. Ein erinnerndes Zurückblicken13