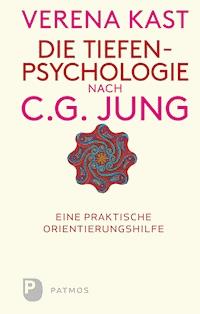Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Menschen sind immer aufeinander bezogen und voneinander abhängig - absolute Autonomie existiert nicht. Doch wer keine ausreichende Selbstständigkeit entwickelt, etwa weil die Bindung an die Eltern zu stark ist, bleibt psychisch unreif und kann seine Potenziale nicht entfalten. Die renommierte Jung'sche Analytikerin und Psychotherapeutin Verena Kast deutet fünf Märchen - darunter Der Eisen-Ofen, Die Blume des Glücks und Vom goldenen Vogel -, die Wege aufzeigen, wie man sich aus einer überstarken Vater- oder Mutterbindung lösen und Selbstunsicherheit und Resignation überwinden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Verena Kast
Die Blume des Glücks
und andere Märchen von Autonomieund Selbstbestimmung
Patmos Verlag
INHALT
Vorwort
Einführung
Zottelhaube
Die Blume des Glücks
Der Eisenofen
Die weißen Katzerl
Der goldene Vogel
Abschließende Bemerkungen
Anmerkungen
Vorwort
Die Märcheninterpretationen dieses Bandes wurden 1984 auf den Lindauer Psychotherapiewochen vorgetragen. Die Folge stand unter dem Thema »Wege zur Autonomie – dargestellt an Märchenverläufen«.
Ich freue mich sehr, dass dieses Bändchen unter einem neuen Titel wieder aufgelegt wird. Märchen veralten ja zum Glück nicht. Märcheninterpretationen bleiben Anregungen, um über die Entwicklungsthemen und Schwierigkeiten, die in den Märchen angesprochen sind, nachzudenken.
Ich bedanke mich bei Christiane Neuen für die Idee, das Bändchen wieder aufzulegen, und für das sorgfältige Lektorat.
St. Gallen im Juni 2012
Verena Kast
Einführung
Autonomie und das Streben nach Autonomie spielen im menschlichen Leben eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich darin, dass Selbstbehauptung und Abhängigkeit, Individuation und Beziehung, Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, und damit die Frage der Verantwortlichkeit, Themen sind, die uns tagtäglich beschäftigen, existentiell, emotional – und natürlich auch gedanklich. Autonomes Handeln ist begleitet von Gefühlen der Selbstwirksamkeit, des Schuldigseins, aber auch der Stimmigkeit. Mit dem Themenkreis der Autonomie ist die Thematik der Freiheit angesprochen, und die Freiheit ist immer erwünscht und bedroht.
Selbstständigkeit ist für uns zweifellos ein Wert. Die Erziehung der Kinder ist darauf ausgerichtet, diese selbstständig und eigenständig werden zu lassen, doch hintergründig wenden wir dann wieder viele Techniken an, die denselben Kindern das Selbstständigwerden schwer machen. Es zeigt sich hier bereits die Problematik aller Autonomieentfaltung: Autonomer zu werden ist zweifellos gefordert, als Ideal und als Anspruch unseres Lebens an uns. Da Autonomie in jeder Form aber immer auch mit Sich-Unterscheiden und Trennung von einem anderen verbunden ist, damit aber mit Verlust, mit Schuldgefühlen auf der einen, mit Gekränktsein auf der anderen Seite sowie mit Trennungsängsten auf beiden Seiten, versuchen wir auch, sie zu vermeiden.
Autonomie spielt nicht nur in den menschlichen Beziehungen eine Rolle: Wir wollen auch von unseren eigenen Komplexen, von unseren eigenen Trieben nicht so stark bestimmt werden, wir wollen auch – so weit das möglich ist – unserem Unbewussten gegenüber Autonomie erreichen, das ist das Ziel des Bewussterwerdens. Damit möchten wir aber auch Angst vermeiden, denn alles, was wir nicht durchschauen können, was uns bedroht und uns daher hilflos macht, macht uns zugleich auch Angst. Auf einer dritten Ebene wollen wir auch dem gegenüber autonom werden, was wir gelernt haben, gegenüber den gültigen Regeln, Weltanschauungen usw. Alles in allem soll dieses immer mehr Autonom-werden-Wollen, sollen diese verschiedenen Formen von Autonomie uns letztlich das leben lassen, was wir sind, d. h. uns authentisch machen.
Gerade die Thematik der Autonomie zeigt uns aber, wie sehr dieses Autonomwerden immer in Beziehung zu unserer Abhängigkeit von der Umwelt, vom Du, vom Unbewussten steht, dass diese Abhängigkeiten auch nötig sind, um zu unserer Autonomie zu finden. Autonomer zu werden ist natürlich ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Wir werden, da Autonomie so viele Ebenen berührt, nie autonom sein, sondern immer nur mehr autonom als bisher. Es ist daher auch richtiger, wenn wir vom Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit sprechen, uns sehen als Menschen, die sich immer in einem Feld von genauer zu umschreibender Autonomie und damit verbundener Abhängigkeit bewegen müssen. Letztlich geht es wohl darum, das für einen selbst jeweils stimmige Verhältnis von Autonomie und Abhängigkeit zu finden, von Autonomie und neuer Bezogenheit.
Autonomiestreben bezieht seinen Wert aus einem Denken, das dem Individuationsprinzip verpflichtet ist: Jeder Mensch hat eine bestimmte Aufgabe, die er erfüllen muss, die in seinem Leben angelegt ist, also letztlich sein Schicksal ist. Um diese seine Aufgabe erfüllen zu können, muss er sich immer wieder aus den notwendigen Abhängigkeiten, die ja immer auch eine Lebenshilfe bedeuten, lösen und sich aus ihnen herausentwickeln.
Die Gefahr des Autonomiestrebens besteht darin, dass die Rolle der Mitmenschen, der Welt und der Beziehungen als zu gering eingeschätzt wird. Darin kann sich allerdings schon eine Verfallsform des Autonomiestrebens ausdrücken: Da wird Ablösung von überfälligen Abhängigkeiten als ein totales Sich-Trennen erlebt; der Prüfstein jeder gelungenen Autonomieentwicklung ist aber, dass wir uns in jenen Beziehungen, die uns Anlass zu einem Stück Autonomieentwicklung gaben, schließlich als autonomer gewordene Partner bewegen und bewähren können. Wenn Autonomie nicht zu Autismus werden soll, gilt es, menschliche Beziehungen daraufhin wahrzunehmen, ob sie unseren Entwicklungsprozess in Gang setzen und befördern oder ihn erschweren und hemmen; wir werden aber auch feststellen, dass erst die Beziehung zum Du auch wirklich den notwendigen Anreiz gibt, zu einem authentischen Ich zu werden.
Diesem Menschenbild, bei dem es wesentlich darum geht, man selbst zu werden, zu individuieren, oder anders ausgedrückt: sich vertrauensvoll auf den Weg zu machen und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sind die Märchen verpflichtet. Es bietet sich also an, unsere Fragestellung an Märchen heranzutragen, zu sehen, welche Probleme den Märchenhelden und -heldinnen auf ihren Wegen zur Autonomie begegnen, und auch die Situationen etwas näher zu betrachten, die Anreiz geben, sich in die autonomere Entwicklung hineinzuwagen, um dies dann auf unsere Erlebnisse im Bemühen um Autonomie zu übertragen. Mehr als bei anderen Fragestellungen, unter denen ich Märchen schon betrachtet habe, scheint es mir, als wäre jeder Mensch bei dieser Thematik vom Märchen direkt angesprochen, und so erübrigt es sich, lange Beispiele anzuführen.
Es bleibt die Frage, weshalb das Problem der Autonomieentwicklung im Spiegel der Märchen gesehen werden soll. Wie schon erwähnt, sind Märchenheldinnen und Märchenhelden immer auf dem Weg zu mehr Autonomie, vermittelt das Märchen geradezu eine Sicht des Lebens, in der Autonomerwerden als ein Sinn des Lebens herausgestellt wird. Dann gilt aber grundsätzlich, dass Märchen in ihrem Erzählverlauf immer auch einen Entwicklungsweg aus der Krise heraus zeigen, wodurch auch wir Wege aus Autonomiekrisen finden können.
Märchen sind getragen von der Hoffnung auf Veränderung, auf die Wandelbarkeit des Lebens, getragen aber auch von dem Bewusstsein, dass genügend Kräfte vorhanden sind, um die Situation jeweils zum Besseren zu wenden – man muss diese Kräfte nur suchen und finden. Das mag ein Grund dafür sein, dass Märchen heute wieder stärker beachtet werden. Ein anderer ist der, dass die Märchen in Bildern sprechen, also auch in uns Bilder anregen, unsere imaginativen Fähigkeiten hervorlocken; Märchen sprechen nicht so sehr unser logisches als vielmehr unser ganzheitliches Denken an, unsere Fähigkeit, Zusammenhänge zu erschauen und zu erfühlen, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu erleben. Sie sprechen unsere rechte Gehirnhälfte an und entsprechen einem Bedürfnis nach Ganzheitlichkeit, aber auch einem Bedürfnis nach dem nicht ganz Durchschaubaren, Geheimnisvollen, das viele Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt. Insofern ist die Beschäftigung mit Märchen eine möglichst ganzheitliche Beschäftigung mit existentiellen Fragen, mit Fragen nach der Entwicklung, wie sie sich allen Menschen stellen. Ganzheitlich wird die Beschäftigung vor allem dann, wenn wir die Bilder als Bilder auf uns wirken lassen, sehen, was sie in uns hervorrufen, und uns auch auf die mit ihnen verbundenen Emotionen einlassen.
In Bildern zu erleben regt aber auch an, diese Bilder zu deuten, und das wird mit den verschiedenen Märcheninterpretationen versucht. Dabei können Märchen von sehr verschiedenen Perspektiven angegangen werden: tiefenpsychologisch, soziologisch, volkskundlich, germanistisch usw. Jeder Zugang sieht einen Aspekt schärfer, vernachlässigt dafür andere Aspekte. Das gilt auch von meinem Zugang, dem tiefenpsychologischen. Meine Intention ist zum einen, durch die Bilder des Märchens beim Leser oder der Märchenhörerin eigene innere Bilder auszulösen, zum anderen aber auch, die Bilderfolge des Märchens mit psychischen Prozessen in Zusammenhang zu bringen. Bei den vorliegenden Märchen geht es mir vor allem um Prozesse, die zur Autonomie führen. Zusammenfassend ist zum methodischen Hintergrund meiner Arbeit mit Märchen Folgendes zu sagen: In der Jung’schen Schule betrachten wir die Märchen als symbolische Darstellungen von allgemeinmenschlichen Problemen und von möglichen Lösungen dieser Probleme. Das Märchen handelt immer von etwas, das den Fortgang des Lebens bedroht – meistens dargestellt in der Ausgangssituation des Märchens –, und es zeigt, welcher Entwicklungsweg aus diesem Problem heraus- und in eine neue Lebenssituation hineinführt. Wir wissen alle, dass dieser Entwicklungsweg jeweils auch noch Umwege, Gefahren, Scheitern usw. in sich birgt. Das sind, ins Psychische übersetzt, Gefahren, die uns selbst auf unseren Entwicklungswegen ebenso drohen wie dem Helden, der Heldin im Märchen. Wir betrachten Held und Heldin gleichsam als Modellfiguren, die durch ihr Verhalten eine Problemsituation aushalten und den Weg beschreiten, der nötig ist, um das Problem zu lösen. Dabei hat es sich bewährt, die »subjektstufige« Deutungsform, wie wir sie von der Trauminterpretation her kennen, mitzuverwenden. Subjektstufige Deutung heißt: Jede Figur, die auftritt, kann auch als Persönlichkeitszug des Träumers oder der Träumerin, hier im Märchen als Persönlichkeitszug der Heldenfigur, aufgefasst werden. Wenn im Märchen eine Hauptfigur zum Beispiel auf einen Fuchs trifft, dann trifft sie auf ihre eigenen füchsischen Züge.
Wir beachten bei der Interpretation zum einen die Entwicklungsverläufe, die Wege, die innerhalb eines Märchens zurückgelegt werden, die Situationen, in denen der Held, die Heldin sich aufhält oder aufgehalten wird, zum anderen beachten wir natürlich auch die Symbole. Um herauszufinden, was ein Symbol bedeutet, wenden wir die Methode der Amplifikation an: Wir versuchen, zu einem Märchenmotiv Parallelen zu finden, dann auch zu sehen, wo in der Menschheitsgeschichte dieses Symbol etwa schon eine Rolle gespielt hat und in welchem Bedeutungszusammenhang es gestanden hat. Über diese Amplifikation wird die allgemeinste Bedeutung eines Symbols evident.1 Bilder sind nie eindeutig, und je vielschichtiger, je märchenhafter sie werden, desto schwieriger ist es, eine eindeutige Bedeutung zu sehen. Diese Mehrdeutigkeit ist andererseits aber gerade das Spannende, das Anregende an der Märcheninterpretation. Man kann ein Märchen immer jeweils auch anders deuten. Kriterium einer gelungenen, vertretbaren Interpretation ist für mich, dass die Deutung in sich einen Sinn hat, dass alle Einzelaspekte unter dem gewählten Gesichtspunkt ein stimmiges Ganzes ergeben bzw. dass die Deutung zumindest anregend ist oder zum Widerspruch herausfordert. Eine »richtige« Interpretation gibt es nicht.
Die Märcheninterpretation ist weder der einzige noch der wichtigste Umgang mit dem Märchen. Das Ausphantasieren, das Meditieren und das Gestalten der Märchenbilder scheinen mir mindestens ebenso wichtige Methoden des Umgangs mit Märchen zu sein.
Wie sehr wir uns auch um das Märchen bemühen, ein Teil des in ihm verborgenen Schatzes lässt sich heben, ein Teil bleibt uns verborgen und regt zu immer neuer Auseinandersetzung an. Jede Deutung bleibt An-Deutung.
Zottelhaube
Es waren einmal ein König und eine Königin, die bekamen keine Kinder, und darüber war die Königin so betrübt, dass sie kaum jemals eine frohe Stunde hatte. Beständig klagte sie, dass es so einsam und still im Schloss sei: »Wenn wir nur Kinder hätten, so gäbe es Leben genug da.« Wo sie in ihrem ganzen Reich hinkam, da fand sie Kindersegen, sogar in der armseligsten Hütte; wo sie hinkam, da hörte sie die Hausfrau auf die Kinder schelten, sie hätten wieder das oder jenes angestellt; das fand die Königin vergnüglich und wollte es auch so haben. Zuletzt nahmen der König und die Königin ein fremdes kleines Mädchen zu sich; das wollten sie im Schloss bei sich haben und aufziehen und es zanken wie ihr eigenes Kind.
Eines Tages sprang das kleine Fräulein, das sie angenommen hatten, unten im Hof vor dem Schloss herum und spielte mit einem goldenen Apfel. Da kam eine arme Frau des Wegs; sie hatte auch ein kleines Mädchen bei sich, und es dauerte nicht lange, da waren das Mädchen und das kleine Fräulein gute Freunde und fingen an, zusammen zu spielen und sich den goldenen Apfel zuzuwerfen. Das sah die Königin, die oben im Schloss am Fenster saß; da klopfte sie ans Fenster, dass ihr Pflegetöchterchen heraufkommen sollte. Sie kam auch, aber das Bettelmädchen blieb dabei, und als sie in den Saal zur Königin kamen, hielten sie einander bei der Hand. Die Königin schalt auf das kleine Fräulein: »Das gehört sich nicht für dich, mit so einem lumpigen Bettelkind zu spielen!«, sagte sie und wollte das Mädchen hinunterjagen.
»Wenn die Frau Königin wüsste, was meine Mutter kann, so würde sie mich nicht jagen«, sagte das kleine Mädchen, und als die Königin sie genauer ausfragte, erzählte sie, dass ihre Mutter der Königin Kinder verschaffen könnte. Das wollte die Königin nicht glauben, aber das Mädchen blieb dabei und sagte, jedes Wort sei wahr, und die Königin sollte nur versuchen, die Mutter dazu zu bringen. Da ließ die Königin das kleine Mädchen hinuntergehen und sie holen.
»Weißt du, was deine Tochter sagt?«, fragte sie die Frau. Nein, die Bettlerin wusste es nicht.
»Sie sagt, dass du mir Kinder verschaffen kannst, wenn du willst«, sagte die Königin wieder.
»Das schickt sich nicht für die Königin, darauf zu hören, was einem Bettelkind in den Sinn kommt«, sagte die Frau und ging wieder hinaus.
Die Königin wurde zornig und wollte beinahe das kleine Mädchen hinunterjagen, aber sie versicherte, es sei alles aufs Wort wahr. »Die Königin sollte meiner Mutter nur einschenken, dass sie auftaut, dann wird sie Rat genug wissen«, sagte das Mädchen. Das wollte die Königin probieren; die Bettlerin wurde noch einmal heraufgeholt und mit Wein und Met traktiert, so viel sie haben wollte, und da dauerte es nicht lange, bis ihr die Zunge gelöst war. Da kam die Königin wieder mit ihrem Anliegen.
Einen Rat wüsste sie wohl, sagte die arme Frau: »Die Königin soll am Abend, wenn sie sich legen will, zwei Schüsseln mit Wasser hereintragen lassen. Darin soll sie sich waschen und sie dann unters Bett ausschütten. Wenn sie dann am anderen Morgen nachsieht, so sind da zwei Blumen gewachsen, eine schöne und eine hässliche. Die schöne soll sie verspeisen, die hässliche soll sie stehen lassen. Aber vergesst das Letzte nicht!«, sagte die Frau.
Die Königin tat, wie die Frau ihr geraten hatte. Sie ließ Wasser in zwei Schüsseln heraufbringen, wusch sich darin und schüttete es unters Bett aus, und als sie am Morgen nachsah, standen zwei Blumen da; die eine war hässlich und garstig und hatte schwarze Blätter, die andere aber war hell und schön, dass sie niemals so etwas Schönes gesehen hatte, und die aß sie schnell auf. Aber sie schmeckte ihr so gut, dass sie nicht anders konnte, als die andere auch essen; es wird weder schaden noch nützen, dachte sie.
Nach einer Weile kam die Königin ins Kindbett. Zuerst brachte sie ein Mädchen zur Welt, das hatte einen Rührlöffel in der Hand und ritt auf einem Bock; es war hässlich und garstig, und kaum war es auf der Welt, so rief es: »Mama!«
»Gott helf’ mir, wenn ich deine Mama sein soll«, sagte die Königin. »Mach dir keine Sorgen deswegen, es kommt gleich noch eines, das ist schöner«, sagte das, das auf dem Bock ritt. Und darauf brachte die Königin noch ein Mädchen zur Welt, das war so schön und lieblich, dass man nie ein so schönes Kind gesehen hatte; und man kann sich vorstellen, dass die Königin sich darüber besonders freute. Die Älteste nannten sie Zottelhaube, weil sie so schlampig und hässlich war und eine Kappe hatte, die ihr in Zotteln ums Gesicht hing; die Königin wollte nichts von ihr wissen, und die Zofen versuchten, sie in ein anderes Zimmer einzusperren. Aber das half nichts; wo die Jüngste war, wollte sie auch sein, und sie waren durchaus nicht zu trennen. Wie sie beide halbwüchsig waren, geschah es am Weihnachtsabend, dass sich ein ganz fürchterlicher Lärm und Trubel auf dem Hausgang vor der Stube der Königin erhob. Zottelhaube fragte, was das sei, das auf dem Gang so knurre und poltere.
»Das ist der Mühe nicht wert, dass du fragst«, sagte die Königin. Aber Zottelhaube gab nicht nach, sie wollte endlich Bescheid darüber, und so erzählte ihr die Königin, das seien die Trollweiber, die da draußen ihre Julfeier hielten. Zottelhaube sagte, sie wolle hinaus und sie jagen; und wie sie auch baten, sie möchte das doch nicht tun, das half gar nichts, sie wollte und musste hinaus, um die Trollweiber zu jagen. Nur bat sie, die Königin sollte alle Türen wohl verriegelt halten, so dass nicht eine einzige auch nur angelehnt sei, sagte sie. Damit ging sie hinaus mit ihrem Rührlöffel und machte sich daran, die Trollweiber zu jagen und zu hetzen, und da war ein solcher Lärm auf dem Hausgang, wie ihr niemals einen gehört habt; es knarrte und krachte, als ob das Haus aus allen Fugen gehen wollte. Aber wie es nun gekommen sein mochte, die eine Türe stand nur angelehnt; jetzt wollte die Schwester hinausschauen und sehen, wie es Zottelhaube ging, und steckte den Kopf durch den Türspalt. Ratsch, da kam eine Trollhexe, riss ihr den Kopf ab und setzte ihr statt dessen einen Kalbskopf auf, und stracks ging die Prinzessin hinein und brüllte. Als Zottelhaube wieder hineinkam und die Schwester erblickte, da zankte sie und wurde böse, dass man nicht besser auf sie aufgepasst hatte, und fragte, ob sie es für schön hielten, dass die Schwester in ein Kalb verwandelt worden sei. »Aber ich will doch sehen, ob ich sie nicht erlösen kann!«, sagte sie. Sie verlangte vom König ein Schiff, wohl ausgerüstet und reisefertig, aber einen Steuermann und Mannschaft wollte sie nicht haben, sie wollte mit ihrer Schwester ganz allein fortgehen, und schließlich mussten sie ihr den Willen lassen.
Zottelhaube fuhr fort und steuerte gleich auf das Land zu, wo die Trollhexen wohnten, und als sie in den Hafen gekommen war, sagte sie ihrer Schwester, sie solle auf dem Schiff bleiben und sich ganz still verhalten; aber Zottelhaube selbst ritt auf ihrem Bock hinauf zum Schloss der Trollhexen. Wie sie hineinkam, war ein Saalfenster offen, und da sah sie den Kopf ihrer Schwester auf dem Fensterbrett stehen; da ritt sie in vollem Schwung in den Hausgang, packte den Kopf und machte sich mit ihm davon. Die Trollhexen waren hinterdrein und wollten den Kopf wiederhaben, und sie kamen so dicht in ihre Nähe, dass es nur so schwärmte und schwirrte, aber der Bock knuffte und stieß mit den Hörnern, und sie selbst schlug und hieb mit dem Rührlöffel drein, und so musste der Trollschwarm sich besiegt geben. Zottelhaube kam zum Schiff zurück, nahm der Schwester den Kalbskopf ab und setzte ihr ihren eigenen Kopf wieder auf, so dass sie wieder ein Mensch wurde wie vorher. Und so fuhren sie weit, weit fort in ein fremdes Königreich.
Der König dort war ein Witwer und hatte nur einen einzigen Sohn. Wie er das fremde Schiff zu Gesicht bekam, sandte er Leute an den Strand, um zu hören, wo es her sei und wem es gehöre. Aber als sie an den Strand hinunterkamen, sahen sie keine lebende Seele auf dem Schiff außer Zottelhaube, sie ritt auf dem Deck hin und her auf ihrem Bock, dass die Haarsträhnen ihr um den Kopf flogen. Die Leute vom Hof waren höchst verwundert über den Anblick und fragten, ob denn sonst niemand an Bord sei. Doch, sie hätte eine Schwester bei sich, sagte Zottelhaube. Da wollten die Leute sie sehen, aber Zottelhaube sagte Nein: »Es bekommt sie keiner zu sehen außer dem König«, sagte sie und ritt auf ihrem Bock herum, dass das Deck dröhnte. Wie nun die Diener wieder zum Schloss kamen und berichteten, was sie von dem Schiff gesehen und gehört hätten, da machte sich der König stracks auf den Weg, um die zu sehen, die da auf dem Bock ritt. Als er kam, führte Zottelhaube ihre Schwester heraus, und sie war so schön und lieblich, dass der König sich sogleich auf der Stelle in sie verliebte. Er nahm sie beide mit auf sein Schloss, und die Schwester wollte er zu seiner Königin machen, aber Zottelhaube sagte, der König könne ihre Schwester auf gar keinen Fall bekommen, wenn nicht der Königssohn sie, die Zottelhaube, nehme. Begreiflicherweise wollte der Königssohn höchst ungern einen so hässlichen Kobold wie Zottelhaube heiraten, aber der König und alle im Schloss redeten ihm so lange zu, bis er endlich nachgab und versprach, er werde sie zur Frau nehmen, aber er tat es nur gezwungen und war sehr traurig. Nun wurde die Hochzeit vorbereitet mit Backen und Brauen, und als alles fertig war, sollten sie zur Kirche ziehen; aber der Prinz empfand das als schwersten Kirchgang, den er je in seinem Leben getan hatte. Zuerst fuhr der König mit seiner Braut; sie war so wunderschön, dass alle Leute stehen blieben und ihr nachsahen, solange sie sie noch erspähen konnten. Dahinter kam der Prinz geritten neben Zottelhaube, die auf ihrem Bock dahertrabte mit dem Rührlöffel in der Faust, und er sah mehr danach aus, als ob er zu einem Leichenbegängnis sollte als zu seiner eigenen Hochzeit. So betrübt war er und sprach nicht ein Wort. »Warum sagst du denn nichts?«, fragte Zottelhaube, als sie ein Stück Wegs geritten waren.
»Was soll ich denn sagen?«, antwortete der Prinz.
»Du kannst ja fragen, warum ich auf dem hässlichen Bock reite«, sagte Zottelhaube.
»Warum reitest du auf dem hässlichen Bock?«, fragte der Königssohn. »Ist das ein hässlicher Bock? Das ist das schönste Pferd, auf dem eine Braut je geritten ist!«, sagte Zottelhaube, und in dem Augenblick verwandelte sich der Bock in ein Pferd, wie der Königssohn seiner Lebtag kein prächtigeres gesehen hatte.
Jetzt ritten sie wieder ein Stück, aber der Prinz war ganz gleich traurig und konnte kein Wort herausbringen. Da fragte Zottelhaube noch einmal, warum er nicht rede, und als der Prinz zur Antwort gab, dass er nicht wisse, wovon er reden solle, da sagte sie: »Du kannst ja fragen, warum ich mit dem hässlichen Kochlöffel in der Hand reite?« »Warum reitest du mit dem hässlichen Kochlöffel?«, fragte der Prinz. »Ist das ein hässlicher Kochlöffel? Das ist der schönste Silberfächer, den eine Braut nur haben kann«, sagte Zottelhaube, und zugleich wurde er in einen Silberfächer verwandelt, so prächtig, dass es nur so blitzte. So ritten sie noch ein Stück, aber der Königssohn war ebenso traurig und sprach kein Wort. Bald fragte Zottelhaube ihn wieder, warum er nicht rede, und diesmal sagte sie, er solle fragen, warum sie die hässliche graue Haube aufhabe.
»Warum hast du die hässliche graue Haube auf?«, fragte der Prinz. »Ist das eine hässliche Haube? Das ist ja die blankste Goldkrone, die eine Braut nur haben kann«, gab Zottelhaube zur Antwort, und in dem gleichen Augenblick geschah die Verwandlung. Nun ritten sie wieder eine lange Weile, und der Prinz war so traurig, dass er dasaß, ohne ein einziges Wort zu mucksen, wie vorher; da fragte ihn seine Braut wiederum, warum er nicht rede, und nun sollte er fragen, warum sie so grau und hässlich von Angesicht sei. »Ja, warum bist du so grau und hässlich von Angesicht?«, fragte der Königssohn.
»Bin ich hässlich? Du meinst, meine Schwester sei schön, aber ich bin noch zehnmal schöner«, sagte die Braut, und als der Königssohn sie ansah, fand er, es könne kein ebenso schönes Frauenzimmer mehr geben in der Welt. Also ist es begreiflich, dass der Prinz seinen Mund wiederfand und nicht länger den Kopf hängen ließ. So feierten sie Hochzeit schön und lange, und dann zogen der König und der Prinz, jeder mit seiner jungen Frau, zum Vater der Königstöchter, und da feierten sie aufs Neue Hochzeit, so dass das Fest kein Ende nehmen wollte. Lauf geschwind aufs Schloss, da ist immer noch ein Tropfen vom Brautbier übrig.
Dieses norwegische Märchen2 gehört zu dem selten vorkommenden Typus der Märchen von den ungleichen Zwillingsschwestern. Es handelt sich dabei im weiteren Sinne um eine Parallele zu den Brudermärchen, in denen thematisiert wird, dass sich zwei junge Männer miteinander verbrüdern, um den Gefahren des Lebens besser begegnen zu können, da sie einander Schutz geben. Sie werden durch ihre Verbrüderung mutiger, können Grenzerfahrungen bestehen. Im Märchen Zottelhaube geht es dementsprechend darum, dass diese Schwestern zusammen dem Leben besser begegnen können, darum, was sie miteinander Neues ins Leben hineinholen. Unter der besonderen Fragestellung dieses Buches werden wir uns damit befassen, welche Form von Autonomie hier gezeigt und gelebt wird, mit welchen Problemen sie verbunden ist und welches Ziel sie hat.
Die Hauptgestalt dieses Märchens ist zweifellos Zottelhaube. Sie wird uns als hässlicher Kobold geschildert; in ihrer lebendigen, forschen Art aber, in ihrem Besonderssein, in ihrer Autonomie, die sich dadurch auszeichnet, dass sie das tut, was für sie eben dran ist, was getan werden muss, in ihrem entschlossenen Draufgängertum wirkt sie auf mich eher lustig, anregend, als hässlich. Fast erscheint es mir, als würden ihre problematischen Seiten überspielt werden. Aber bedenken wir: Gleich auf einem Bock geboren zu werden, immer den Kochlöffel in der Hand zu halten, eine Zottelhaube tragen zu müssen, das alles dürfte, wenn es für immer ist, nicht einfach zu ertragen gewesen sein. Die Unbekümmertheit von Zottelhaube, ihr klares Wissen um ihr Schicksal, vielleicht sogar ihre Ahnung, dass sie es schon irgendwie schaffen wird, lässt uns etwas darüber hinwegsehen, dass Zottelhaube eigentlich am ehesten mit den Kindern im Märchen vergleichbar ist, die in Tierhäuten geboren wurden. Sie wird also erlöst werden müssen, sie wird aber auch selbst als Erlösende tätig. Dieses Mädchen, das sich so forsch und entschlossen in der Welt behauptet, sich mit Trollen schlägt, Schiffe steuert, das sich so autonom und aggressiv gebärdet und schließlich seine Schwester erlöst – es ist selber auch erlösungsbedürftig, und indem es seine Schwester erlöst, erlöst es sich selbst. Diese Erlösungsbedürftigkeit entspricht dem Bedürfnis und der Notwendigkeit, Lebensmöglichkeiten zu entbinden und mehr Freiheiten in der Lebensgestaltung zu erreichen. Erlösungsbedürftigkeit heißt aber auch, dass etwas gelöst werden muss, dass also eine Bindung besteht, die nicht mehr weiterbestehen soll. Im Märchen wird eine solche überfällige Bindung eine Verzauberung genannt, manchmal auch ein Fluch. Das ist wichtig im Zusammenhang mit Autonomie: Autonomie gewinnen hat immer auch etwas mit einer schrittweisen Erlösung zu tun; was gebunden ist, wird in die Freiheit entlassen.
Es stellt sich natürlich die Frage: Was ist der Sinn dieser Autonomie, dieses immer mehr Autonomwerdens? Geht es nur darum, dass ein Mensch sich selbst verwirklichen kann, dass der Individuationsdrang – der ja nach Jung ein Trieb ist – befriedigt wird, oder wird durch diesen Autonomiedrang auch kollektiv etwas verändert? Wird für die Entwicklung der Menschheit etwas verändert, in dem Sinne etwa, dass mehr Lebensmöglichkeiten, mehr Möglichkeiten des Handelns und Denkens zustande kommen oder neue Formen der Beziehung entstehen, die weniger auf Macht und Ohnmacht gründen, sondern auf mehr Partnerschaft? Im Märchen stellt sich die Frage einfacher: Ist Zottelhaube zum Schluss nur eine schöne junge Frau geworden, ist sie bloß ihre Verzauberung los, oder hat sich an ihrer ganzen Lebenssituation etwas geändert?