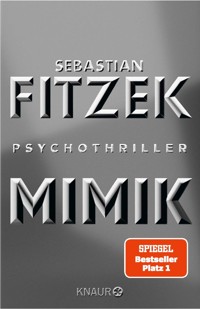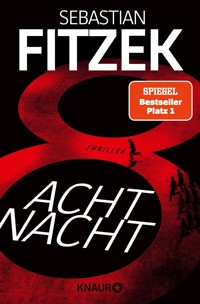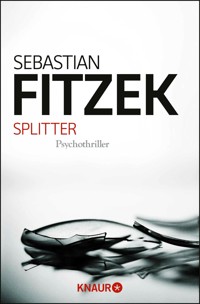14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
ACHTUNG: Dieses Buch kann neben einer extrem spannenden Handlung auch Spuren von Humor enthalten. Der neue Bestseller für alle, die Sebastian Fitzek gern auf neuen Wegen begleiten! Carl Vorlau, mysteriöser Patient einer psychiatrischen Privatklinik, behauptet, vor Monaten die siebenjährige Pia entführt und an einen geheimen Ort verschleppt zu haben. Über seine Tat will Vorlau nur mit einem einzigen Menschen reden - dem ebenso humorvollen wie unkonventionell arbeitenden Literaturagenten David Dolla, dem Vorlau ein diabolisches Angebot macht: Der Agent soll ihm einen Verlagsvorschuss von einer Million Euro verschaffen, für einen Thriller mit dem Titel "Ich töte was, was du nicht siehst". Ein Geständnis in Form eines True-Crime-Romans über das Schicksal der kleinen Pia! Als Belohnung verspricht Vorlau, Dolla zu einem Helden zu machen, der das Mädchen in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod rettet. Sollte Dolla den Auftrag jedoch ablehnen, will Vorlau nicht nur Pia sterben lassen, sondern auch das Leben des Agenten für immer zerstören … Klingt nach einem typischen Psychothriller? Stimmt. Aber auch wieder nicht. Denn die Hauptfiguren von "Schreib oder stirb" sind noch außergewöhnlicher als das neue Autorenduo selbst: Sebastian Fitzek & Micky Beisenherz. "Wir wollten etwas schreiben, was es so noch nie gab: eine Geschichte, über die man auf der einen Seite herzhaft lachen kann - und beim Umblättern bleibt einem genau dieses Lachen vor Spannung im Halse stecken!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sebastian Fitzek / Micky Beisenherz
Schreiboderstirb
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Carl Vorlau, mysteriöser Patient einer psychiatrischen Klinik, behauptet, die siebenjährige Pia entführt und an einen geheimen Ort verschleppt zu haben. Über seine Tat will der Patient nur mit einem einzigen Menschen reden – dem Literaturagenten David Dolla, dem Vorlau ein diabolisches Angebot macht: Dolla soll ihm einen Verlagsvorschuss von einer Million Euro verschaffen, für einen Thriller über das Schicksal der kleinen Pia! Gelingt das, so wird Dolla zu einem Helden, der das Mädchen vor dem sicheren Tod rettet. Sollte Dolla den Auftrag jedoch ablehnen, will Vorlau nicht nur Pia sterben lassen, sondern auch das Leben des Agenten zerstören …
Inhaltsübersicht
Motto
Vorwort von Sebastian Fitzek
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
All meinen Besitz gegen einen
einzigen Moment mehr Zeit.
Letzte Worte Elizabeths I.,
Königin von England
Vorwort von Sebastian Fitzek
Vorsicht! »Schreib oder stirb« unterscheidet sich von den bisherigen Fitzek-Psychothrillern.
Logisch. Wär ja auch blöd, wenn hier das Gleiche drinstehen würde, was es irgendwo sonst schon mal zu lesen gab. Aber ich (Sebastian) habe mir sagen lassen, dass es da draußen Menschen gibt, die davon ausgehen, dass überall, wo Fitzek draufsteht, ein abgedrehter Psychoschocker drin sein muss: mit verrückten Psychopathen, um ihr Leben kämpfenden Opfern, hier und da etwas Blut und jeder Menge unerwarteter Wendungen, bei denen sich der Leser am Ende selbst wie die arme Hauptfigur im Buch fühlt, die nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden kann.
Schön, in »Schreib oder stirb« gibt es auch einen verrückten Psychopathen, ein um sein Leben kämpfendes Opfer, hier und da etwas Blut und jede Menge (hoffentlich) unerwarteter Wendungen. Aber das Figurenensemble fällt doch etwas aus dem vertrauten Rahmen, insbesondere der »Held« dieser Geschichte: David Dolla hat nicht nur einen komischen Namen, er ist – wie wir finden – auch ein witziger Zeitgenosse, der uns beim Schreiben sehr oft zum Lachen gebracht hat. Wobei wir hoffen, dass es Ihnen beim Lesen hin und wieder ähnlich ergehen wird.
Und mit »uns« und »wir« meine ich Micky Beisenherz und mich. Auch das ein deutlich sichtbarer Hinweis schon auf dem Cover: Ich habe diesen Thriller nicht allein geschrieben, sondern zusammen mit dem, wie ich finde, derzeit besten Comedy-Autor Deutschlands – wobei die Schublade »Comedy« für Micky zu klein bemessen ist. Das wäre in etwa so, als würde man Elon Musk einen Autoverkäufer nennen. Oder »Schreib oder stirb« einen Ratgeber für kreatives Schreiben. Wir haben wirklich lange überlegt und sind auf keinen passenden Namen für das Genre gestoßen, in das man dieses Buch pressen könnte, das (unserer bescheidenen Meinung nach) auf der einen Seite ein echter Psycho-Fitzek ist, auf der anderen Seite aber von dem typischen Beisenherz-Humor geprägt wird.
Die Idee, etwas gemeinsam zu machen, hatten Micky und ich übrigens schon vor Jahren, als uns auffiel, dass wir uns nicht nur optisch und sportlich kaum unterscheiden (mein BMI liegt nicht mal fünf Punkte über seinem), sondern dass wir auch noch ein ähnliches Thriller- und Humorverständnis haben. So interpretiere ich es jedenfalls, wenn mir jemand sagt, er habe eines meiner Bücher gelesen, und sich Mühe gibt, nach einem meiner Witze die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Und ja, ich gebe es zu, vielleicht hat man mir nach meinen Lesungen einmal zu oft gesagt, ich solle mich doch auch mal an etwas »Lustigem« versuchen, wann immer ich auf der Bühne für den einen oder anderen Lacher gesorgt habe. Zum Beispiel, wenn ich davon erzähle, wie ich 2006 vergessen habe, einer Bekannten mein Debüt »Die Therapie« mitzubringen, und es kurzerhand selbst im Laden kaufte. Und wie stolz ich war, dass die Buchhändlerin mich damals an der Kasse fragte: »Sind Sie Sebastian Fitzek, der Autor?« Und wie ich geschmeichelt nachfragte: »Ja, der bin ich. Woher wissen Sie denn das?« Ihre Antwort: »Na, Ihr Name steht auf der EC-Karte, mit der Sie gerade bezahlen wollen.« Wie peinlich, was muss die Buchhändlerin gedacht haben? Fitzek kauft seine eigene Auflage! Aber das ist eine andere Geschichte. Wobei: In »Schreib oder stirb« spielen Debütromane, Buchhandlungen und Buchhändlerinnen ja auch eine wichtige Rolle.
Um ehrlich zu sein: Dieser Text hier sollte eigentlich viel früher fertig sein, weshalb der Verlag fast irrewurde, weil ich mir zu viel Zeit mit dem Vorwort gelassen habe. Und damit die Damen und Herren in der Herstellung am Ende nicht wirklich noch einen Herzkasper bekommen, verzichte ich jetzt am Ende dieses Buches auf die Ausarbeitung meiner üblichen Zwanzig-Seiten-Danksagung (ja, auch das ist anders in diesem Buch) und hebe an dieser Stelle nur die Person hervor, der wir am meisten zu Dank verpflichtet sind: SIE.
Autoren wie wir sind nichts ohne Leserinnen und Leser.
Danke, dass Sie sich auf den folgenden Seiten auf etwas Neues einlassen.
Auf Wiederlesen
Ihre
Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz
Berlin, im Winter 2021
PS: Sorry, Micky, dass du jetzt nicht mehr zu Wort kommst, weil ich den gesamten Platz verbraucht und (wie gesagt) meinen Text zu spät abgegeben habe.
PPS: Heul doch!
Prolog
Als ich wieder zu mir kam, stellte ich zwei Dinge fest:
Ich war vollkommen am Arsch. Seelisch und körperlich.
Auf den Typen, in dessen Gewalt ich mich befand, traf das auch zu.
Zuerst zu mir: Ich lag nackt in einer mit lauwarmem Wasser gefüllten Badewanne, die mitten in einem weiß gefliesten Raum stand. Die Wanne hatte zu beiden Seiten Haltegriffe, vermutlich um älteren Menschen den Ausstieg zu erleichtern. Für mich waren sie nutzlos. Denn der Typ, der mir aktuell noch den Rücken zudrehte (zu ihm komme ich gleich), hatte sie dafür benutzt, um an ihnen meine Handgelenke mit schwarzen Kabelbindern zu fixieren. Mir staute sich das Blut in den Armen, aber das war wohl mein geringstes Problem.
Mein größtes drehte sich gerade um und grinste mich an. Er trug eine Einhornmütze. Bei Vorschulkindern im Fasching ist das süß. Er war aber kein Kind.
»Tut mir leid, dass ich Sie töten muss«, war sein erster Satz. Was man eben so zur Begrüßung sagt, wenn man zufällig in einem schlachthausgleichen Kerker auf einen Unbekannten trifft, der nackt und gefesselt in einer Badewanne zittert.
Okay, jetzt wollen Sie sicher wissen, wie es weitergeht. Gut, dann sollten wir die Uhr um einige Stunden zurückdrehen, damit Sie die Zusammenhänge begreifen.
Um knapp zwei Tage etwa, als ich Engin besuchte, diesen Wahnsinnigen. Denn mit ihm, so fürchte ich, fing bei dieser katastrophal aus dem Ruder gelaufenen Geschichte alles an …
Kapitel 1
»Batteriesäure.«
»Aha.«
»Oder altmodisch, mit dem Hammer.«
»Gute Wahl.«
»Waterboarding?«
»Willst du denn ein Geständnis?«
»Nee, ich will ihn ganz langsam zu Tode foltern«,
… sagte Engin, und nichts in seinem Blick gab mir Anlass, an dieser Aussage zu zweifeln. Schön, das Outfit, in dem er mir in seiner Penthousewohnung im zweiundzwanzigsten Stock des Europa-Centers gegenübersaß, entsprach nicht gerade dem eines Auftragskillers: Badelatschen, Pyjamahose und ein viel zu knappes XXL-T-Shirt, das sich über dem behaarten Bauch spannte wie der Darm einer aufgeplatzten Currywurst. Damit bekam man in Berlin kein Geständnis, aber sofort Theaterförderung. Der Spruch auf dem Shirt – »Frag lieber, wie der andere aussieht!« – passte hingegen ganz gut zu meiner eigenen Erscheinung. Denn für einen nicht eingeweihten Beobachter machte ich an diesem Morgen wohl tatsächlich den Eindruck, als hätte Rocky mich zum finalen Sparring ins Kühlhaus gehängt – was so fernab von der Wahrheit nicht war.
»Ich werde ihn als Erstes mit dem nackten Arsch auf einen Aktenvernichter setzen und seine Eier bei zweitausend Umdrehungen mal so richtig durcheinanderquirlen«, fuhr Engin fort und rieb sich über die Bartstoppeln. Offenbar hatte er keine Ahnung, wie Aktenvernichter funktionieren.
»Wie du meinst«, kommentierte ich Engins für diese Uhrzeit ungewöhnlich martialischen Ausbruch. Normalerweise lief er erst gegen zweiundzwanzig Uhr zur Höchstform auf; wenn seine ADHS-Pillen nicht mehr wirkten oder er sie, was häufig geschah, über den Tag hinweg einzunehmen vergaß. Doch jetzt war es erst kurz nach halb acht Uhr morgens, ich war überrascht, dass er mir so früh überhaupt die Tür aufgemacht hatte.
Gut, er hatte mich mit den Worten »Es geht um Leben und Tod« aus dem Bett geklingelt, doch so etwas bedeutet bei ihm kaum mehr als ein »Guten Morgen, mein Herz«. Jürgen Klopp an der Seitenlinie nach Rückstand war im Vergleich zu ihm ein Ausbund an Gelassenheit.
»Scheiße, Mann, ich werde ihm sein Abc aus dem Kopf prügeln, bis er aussieht wie …, wie …«
»Wie ich?«, gab ich ihm verbale Hilfestellung.
»Ja, Mann, wie du.« Er sah mich schräg an. »Was ist eigentlich passiert? Bist du mit dem Kopf auf den U-Bahn-Gleisen eingepennt?«
»Sparring«, sagte ich, und er nickte, als würde es das gemischte Hack auf meinen Schultern erklären.
Nach langer Pause hatte ich vor zwei Wochen wieder mit dem Boxtraining begonnen, und vorgestern war ich als Sparringspartner für ein siebzehnjähriges Nachwuchstalent eingesprungen, das ich vor zehn Jahren noch mit einem angebundenen Arm vermöbelt hätte. Heute, mit achtunddreißig Jahren auf dem Buckel und nach einer jahrelangen Fitnessabstinenz, war ich froh, dass meine Wohnung barrierefrei war. Physisch fühlte ich mich irgendwo zwischen Frührente und Pflegestufe 3.
Den Entschluss, mal wieder etwas für meine Figur zu tun, hatte ich übrigens in einer grell ausgeleuchteten Umkleidekabine bei P&C gefasst, in die ein sadistisch veranlagter Raumausstatter eine Glühbirne der Marke »bleich machendes Fettlicht« hineingeschraubt hatte, dazu einen konkav gewölbten Spiegel, in dem selbst Toni Garrn ausgesehen hätte wie das, was Privatsender sich in die Primetime kippen. Ich verstehe es nicht – jeder Bordellbesitzer ist in der Lage, seine verkeimte Bude wie eine First-Class-Lounge auszuleuchten, in der die Rettungsringe der Mädchen wie die Wölbungen eines Waschbrettbauchs aussehen. Aber in einer Umkleidekabine steht man in einem Licht, das eine winzige Speckwelle an der Hüfte zum Kreidefelsen werden lässt! Was war nur los mit den Bekleidungshäusern, wollten die Klamotten verkaufen oder Therapiestunden für posttraumatische Belastungsstörungen. Nicht mal die inTouch vermittelt ein so gestörtes Körpergefühl.
Ich merkte, wie meine Gedanken abschweiften, aber in Anbetracht der Tatsache, dass Engin gerade sagte, »… und danach lass ich ihm die Luft ausm Kopp«, hatte ich offenbar nicht viel von unserer Unterhaltung verpasst.
»Du magst ihn also nicht?«, fragte ich ihn während einer kurzen Unterbrechung seiner Hasstirade.
»Nein.«
»Anton Mildner?«
»Genau den.«
»Und du hast den Aktenhäcksler schon bestellt?«
»Hmhm.«
»Schön. Den würde ich dann aber vielleicht nicht hier im Wohnzimmer anwerfen«, schlug ich mit einem Blick auf den schneeweißen Teppich vor, der so dick war, dass man darauf eine Bowlingkugel aus zwei Metern Höhe hätte abwerfen können, ohne den Aufprall zu hören. Er war in der gesamten Etage ausgelegt, eine Dreihundert-Quadratmeter-Wollmatratze, von den Fahrstühlen am Kopfende bis zu den gläsernen Schiebetüren vor der Terrasse, von der man einen fantastischen Ausblick auf die City-West hatte.
Man kam sich in jedem Winkel dieser Wohnung vor wie der Junge aus der Unendlichen Geschichte, der sich klein und unbedeutend in den Flausch dieses gewaltigen weißen Flugdackels krallt.
»Guter Tipp«, sagte Engin und klang wirklich dankbar. Er seufzte, kratzte sich die Stelle, an der bei anderen Menschen das Kinn sitzt, bei ihm jedoch schon der Hals begann, und schloss die Augen. Mit seiner olivbraunen Haut und dem Rasierschatten konnte ich bei seinem Anblick nicht anders, als an die Panzerknacker-Zeichnungen in den Lustigen Disney-Taschenbüchern zu denken. Manchmal war der Rasierschatten schon da, bevor der Pinsel wieder in der Halterung hing.
Ich wartete eine kurze Weile, um ihm die Zeit zu geben, gedanklich eine Liste möglicher Hinrichtungsstätten durchzugehen, angefangen bei seinem Zweithaus am See in Mecklenburg-Vorpommern bis zu der Tiefgarage sechzig Meter unter uns.
»Die Tiefgarage«, sagte er und riss die Augen auf.
Bingo.
»Okay, gute Wahl. Kameraüberwacht macht es ja doppelt Spaß. Aber bevor du in den Baumarkt fährst, um die Plastikplanen und die Phil-Collins-CD zu kaufen, könntest du mir vielleicht noch einen klitzekleinen Gefallen tun«, sagte ich und brachte Daumen und Zeigefinger in eine Position, mit der Frauen sich gerne über das beste Stück ihrer Ex-Männer lustig machen.
»Welchen?«
»Beantworte mir nur eine winzige Frage.«
»Ob es im Baumarkt Phil-Collins-CDs gibt?«
»Wer zum Geier ist Anton Mildner?«
Engin glotzte mich an, als hätte ich ihn gefragt, wie man eine Toilette benutzt. »Das ist jetzt nicht dein Ernst.«
Ich zuckte bedauernd mit den Achseln.
»Du kennst A.M. nicht?«
Er schob seine massige Gestalt mit der Eleganz einer Endmoräne vom Sofa und stand auf. Mit knapp einem Meter achtzig war er gut einen Kopf kleiner als ich – das hatte er aber seiner Waage nie erzählt.
»Nenn mich verkalkt, aber ich hab keinen blassen Schimmer«, sagte ich und beobachtete Engin, wie er sich den Sack kratzend vor einen Fernseher stellte, dessen Bildschirmoberfläche größer war als ein SUV-Parkplatz. Auf der Mattscheibe spiegelte sich die Gedächtniskirche, die an diesem klaren Sommermorgen wie ein hohler Zahn in der Sonne glänzte.
»Was bist du denn für ein Literaturagent?«, ätzte Engin, als hätte ich ihm gerade erzählt, dass ich es nicht geschafft hatte, seinen nächsten Roman bei einem A-Verlag unterzubringen, was in der Tat lächerlich wäre. Engin war einer meiner Hotshots. Vier Romane in drei Jahren. Alle auf Platz eins der SPIEGEL-Liste. Dreiunddreißig Auslandslizenzen, Bestseller in acht Ländern, drei goldene Schallplatten für die Hörbücher, ein Theaterstück und zwei Verfilmungen in Planung.
Das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich meine Fähigkeiten als Agent loben wollen, aber: Genauso ist es. Allein von dem Vorschuss, den ich für seine nächsten fünf Bücher ausgehandelt hatte, hätte er seine Penthouse-Maisonette zweimal bezahlen können und noch genügend Geld für den Innenausstatter übrig.
»Ich meine, wie lange bist du schon im Geschäft?«, fragte er mich.
Zwölf Jahre, dreiundzwanzig Tage und knapp acht Stunden, wäre die korrekte Antwort gewesen, aber ich war mir sicher, dass mein Autor keine Antwort auf seine rhetorische Frage erwartete.
»Und du kennst A.M. nicht? Mann, der Idiot hat ein Hall-of-Fame-Ranking.«
Aha. Daher also wehte der Wind.
Ich zog mein Handy aus der Jeans, das in Engins Penthouse keinen Netzempfang hatte (der Innenarchitekt meinte, die vierfach isolierten Scheiben würden alles abschirmen). Ernsthaft? Was ist die schönste Wohnung wert, wenn man kein Netz hat? So wie der beste Tisch im Restaurant heute nicht mehr der am Fenster ist, sondern der mit der Steckdose. Immerhin wählte sich das Telefon in einem Akt der Gnade automatisch ins WLAN ein. Mit drei Tatschern auf das Display war ich im Netz, mit zwei weiteren hatte ich die Ursache seiner Mordgelüste gefunden.
»Okay, dann fasse ich es einmal zusammen«, sagte ich, nachdem ich den jüngsten Eintrag überflogen hatte. »Du willst Anton Mildner umbringen, weil er eine schlechte Rezension zu deinem neuen Buch geschrieben hat?«
Engin machte eine Kopfbewegung, die mich an den irren Killer mit dem Bolzenschussgerät aus diesem Coen-Film erinnerte. Dann ging er zu einem Esstisch, neben dem der Fernseher kaum größer als ein Gameboy wirkte. Wenn das gläserne Ungetüm einmal ausgemustert werden sollte, konnte man seine Tischplatte als Landebahn für eine 747 benutzen.
»Du findest meine Reaktion vielleicht übertrieben …« Engin langte nach einem iPad, das sich unter einem Berg von Prospektbeilagen und Werbebriefen versteckt gehalten hatte.
Ich winkte ab.
»… aber hier, sieh nur, was die Drecksau über mich geschrieben hat!« Engin wedelte mit dem Tablet.
Da ich nicht aufgestanden war, konnte ich aus der Entfernung nicht mal die Überschrift lesen, doch das war auch nicht erforderlich, hatte ich die beißende Kritik doch erst vor wenigen Sekunden auf meinem Handy studiert.
»Sein Roman ›Die letzte Waise‹ müsste eigentlich ›Die letzte Scheiße‹ heißen«, zitierte Engin.
Ich zählte bis drei. Dann sagte ich mit der Mimik einer frisch gemangelten Apothekerfrau in Kampen: »Du hast recht. Dafür hat er den Tod verdient.«
Engin schöpfte Verdacht. »Machst du dich über mich lustig?«
Ich bemühte mich noch mehr, mein Grinsen zu unterdrücken. Nicht, weil ich Angst hatte, Engins Gefühle zu verletzen. Sondern, um diesen Mildner zu schützen.
Das Problem war nämlich, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der Engin seinen Mitmenschen schon bei weitaus geringeren Anlässen die Kniescheibe atomisiert hätte. Die Zeit, bevor er sich aus seiner »Familie« freigekauft und dem Rotlichtmilieu den haarigen Rücken gekehrt hatte, um – jetzt kommt es – keine Thriller, sondern Liebesromane zu schreiben mit Titeln wie »Fremde Haut« oder »Kuss des Himmels«.
Selbstredend veröffentlichte er diese Schmachtfetzen unter dem Pseudonym »Heide West« und nicht unter seinem bürgerlichen Namen.
Hätte er das getan, hätte Anton sich vermutlich gar nicht getraut, eine schlechte Kritik zu schreiben, schon gar nicht unter seinem Klarnamen. Es sei denn, er fand Vergnügen an Hobbys wie Käfigkampf oder einer Tour mit dem Hollandrad durch IS-Territorium, wo mit ähnlichen Blessuren zu rechnen war wie bei einer Begegnung mit Engin.
»Dieses Arschloch hat seine Kotzschmiere auch noch auf Thalia.de, Hugendubel, Dussmann, Osiander, Libri, Weltbild, genialokal.de und was weiß ich noch wo gepostet. Mein Verkaufsrang ist seitdem um zwei Plätze gesunken.«
Engin hämmerte mit dem Zeigefinger wie ein Specht auf Steroiden auf die Bildschirmoberfläche ein, und ich rechnete jeden Moment damit, dass er auf der anderen Seite hindurchstieß.
»Hier lies nur, der Fotzkopp schreibt: ›Noch abgedroschener als die hölzernen Phrasensätze Heide Wests, wie: Seine Lenden vibrierten vor Leidenschaft oder Der blutrote Sonnenuntergang war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, ist nur noch das Ende, wenn die Bindungsangst des adligen Schlossherrn mal wieder mit seiner schlimmen Kindheit erklärt wird.‹«
Engin schmiss das iPad quer durch den Raum in die offene Küche. Zum Glück waren seine Frau und seine beiden Kinder noch im oberen Stockwerk, sonst hätte das Gerät wie ein Frisbee das Gesicht seiner nächsten Verwandten getroffen. So prallte das iPad nur gegen einen Messingkochtopf, der über dem Herdblock hing. Ein Scheppern. Papa läutet unten mal wieder zum Jüngsten Gericht. Er war jetzt mehr Kanye als Heide West.
»Scheiße, Mann, ›als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst‹. Da siehst du mal, wie blöd dieser Mildner ist. Der Satz ist nicht von mir, den hab ich von Eichendorff geklaut. Der kritisiert also Weltliteratur!«
Ich schaffte es, mir ein »Na ja, dann kritisiert er eher ein Plagiat« zu verkneifen. Engins Kopf wurde derweil so rot wie der von ihm beschriebene Sonnenuntergangshimmel. Ein kräftiges Hoeneß-Purpur.
»Wie kann ein Drei-Zentner-Koloss aus dem türkischen Clan-Milieu nur derart kitschige Herz-Schmerz-Schmonzetten verfassen?«, ist wohl die meistgestellte Frage der (wenigen) Menschen, die bislang hinter Engins gut gehütetes Geheimnis gekommen sind (und noch leben), angefangen vom Verlagsleiter bei Droemer bis zu Penelopé, meiner rechten Hand in der Agentur. Dabei ist das überhaupt nicht merkwürdig. Viele Autoren leben ihre dunkle Seite auf dem Papier aus und können im wahren Leben vergnügt und unbeschwert durch die Gegend ziehen. Bei Engin ist es umgekehrt; er offenbart beim Schreiben seine helle Seite. Und augenscheinlich fehlte ihm im Augenblick der gewalttätige Ausgleich für solche pilcheresken Eskapaden, den ihm sein früherer Alltag geboten hatte. Wobei es bis heute nicht klar war, was mehr wehtat: ein Zimmermannshammer gegen die Kniescheibe – oder seine seitenlangen Beschreibungen dessen, was er für Liebe hielt.
»Dem Schwanzlutscher werde ich mal zeigen, wie schlimm meine Kindheit war und was das bei ihm für Folgen auslösen kann. Der wird Rote Bete pissen, ohne das Unkraut vorher essen zu müssen.«
Engin zog sein Handy hervor, und ich ahnte, welche Nummer er wählte.
»Engin?«, rief ich scharf und stand auf.
»Was?«
»Du musst das nicht tun.«
»Was nicht tun?«
»Slappy anrufen.«
»Woher …«
Verblüfft nahm er das Handy vom Ohr.
»Woher ich weiß, dass du den Bekloppten anklingelst?«, fragte ich.
»Slappy ist nicht bekloppt, er ist …«
»… dein Mann fürs Grobe, aber es besteht keine Veranlassung, diesen Psychopathen einzuschalten.«
»Er ist kein Psychopath.«
»Ach nein? Wie nennt man denn sonst neuerdings Menschen, die eine Erektion bekommen, wenn sie sich Foltervideos ansehen?«
Engins Kinnlade klappte herunter. »Woher weißt du das?«
»Weil es in deinem ersten Entwurf zu ›Blut und Liebe‹ stand. Schon vergessen?« Engin hatte in seinem zweiten Herzschmerz-Bestseller einen geistesgestörten Killer einbauen wollen, was ich ihm glücklicherweise ausreden konnte. »Du wolltest Slappy einmal als Vorbild für einen Serienmörder nehmen.«
»Hmm.« Engin grunzte ertappt und steckte das Handy wieder ein. Traurig sah er mich mit seinen dunklen Retriever-Augen an, die zwar hervorragend zu seinen herabhängenden Wangen passten, nicht aber zu seinem Image, das er sich als ehemals berüchtigtster Türsteher Berlins über Jahre hinweg aufgebaut hatte.
»Scheiße, ich bin ein sensibler Künstler«, sagte der Mann, der in seiner Sturm-und-Drang-Zeit mehr Knochen als Strohhalme zerknickt hatte.
»Ich weiß«, erwiderte ich einfühlsam. Ich ging langsam auf ihn zu, breitete die Arme aus. Auftakt für die David-Dolla-Show.
Ja, Sie haben richtig gelesen. David Dolla. Mein Name. Geben Sie sich keine Mühe. Es gibt keinen Witz über ihn, den ich nicht schon kenne. Je olla, je dolla; Doppel D, Dolla-Buster … Ha, ha. Was glauben Sie denn, weshalb ich mit acht Jahren angefangen habe zu boxen? Ich war zwar nie Berliner Meister, aber zumindest hat es mir Respekt auf dem Pausenhof verschafft. Lieber wär mir natürlich gewesen, meine Eltern, die ich über alles liebe, hätten etwas weniger Spaß an Alliterationen gehabt, aber mittlerweile mochte ich meinen Namen sogar, zumal mich der Buchreport nach einem großen Abschluss den »Dolla-Maker« getauft hatte und ich einen Tag nach dem Artikel drei Anfragen von namhaften Autoren auf dem Tisch hatte, die alle wollten, dass ich ihre Verträge neu verhandelte. Spätestens da wurde aus der drögen, ellbogenflickigen Cordsakkodiaspora Literaturbetrieb ein knalliges Dollapalooza, und ja, der war jetzt mal neu.
Dabei war der Papierkram der geringste Teil meiner Arbeit. Gerade für die etablierten Schriftsteller war ich eher eine Mischung aus Priester und Psychiater, jemand, der sich ihre Probleme anhörte und mit guten Ratschlägen versuchte, den Zusammenbruch zu verhindern, was mir allerdings nicht immer gelang. Bei Engin bestand aber noch Hoffnung, dass ich nicht den Krankenwagen rufen musste wie letztens, als einer meiner Autoren die Sat1-Verfilmung seines historischen Romans vorab sehen durfte und danach den Regisseur mit einem zerschlagenen Weinglas bedrohte.
Oft ging es ja auch nur darum, dass gern alles andere zerbrechen durfte – halt nur nicht der Klient.
»Was ist dein Lieblingsbuch?«, fragte ich Engin.
»Muss ich das sagen?«
»Es bleibt unser Geheimnis.«
Er blickte etwas verlegen auf seine Badelatschen und wackelte mit den Zehen. Wobei ich mir sicher bin, dass er das Wackeln nicht sehen konnte.
»Okay«, gestand er schließlich. »Harry Potter, siebenter Teil.«
»Schön. Okay, sieh mal hier.«
Ich unterdrückte einen Schwall plötzlich eingehender WhatsApps, um »J. K. Rowling« ins Suchfenster einzugeben, und wurde fündig.
»Selbst bei Harry Potter, einem Buch, das du liebst, gibt es zweiundzwanzig Ein-Sterne-Bewertungen.«
»Waaas?« Engin nahm mir das Handy weg. »Was sind denn das für Idioten?«, wollte er von mir wissen. »Wie kann man Harry Potter nicht mögen?« Aus seinen Augen sprach pure Fassungslosigkeit. Bevor er auf den Gedanken kommen konnte, dass sich neben Anton Mildner auch noch zweiundzwanzig Harry-Potter-Kritiker von ihren Gonaden würden trennen müssen, sagte ich schnell: »Es gibt kein Werk, das allen gefällt. Nicht ein einziges.«
Ich versuchte, ihm vor Augen zu führen, was ich allen Autoren sagte, vor allen Dingen denen, die neu im Geschäft waren und oftmals mit der Wucht der Kritik, die ihnen im Netz entgegensprang, nicht zurechtkamen. »Wahre Kunst polarisiert. Sie ist geradezu dafür geschaffen, dass man sich an ihr reibt, sich mit ihr auseinandersetzt.«
»Hmm«, grunzte Engin, nicht sehr überzeugt, gab mir aber mein Telefon zurück. Gerade noch rechtzeitig, bevor es wie sein iPad zur Drohne werden würde.
»Überhaupt hab ich dir verboten, auf Online-Portale zu gehen. Bücher kauft man im Laden!«, sagte ich abschließend.
Vielleicht eine etwas antiquierte Einstellung, für die mich viele meiner Agentenkollegen belächeln, aber gehen Sie mal in einer x-beliebigen Kleinstadt in die Fußgängerzone und zählen Sie die Buchhandlungen. Und damit meine ich nicht die verkappten systemgastronomischen Frappuccinopuffs für Tinder-Dates im Büchereimantel, sondern, na ja, halt so richtige Bookstores. Muss ja nicht gleich Hugh Grant hinterm Tresen stehen wie in Notting Hill. Wenn Sie überhaupt einen Buchladen finden, dann vermutlich den, der vor einem Jahr pleitegegangen ist, weil wir Menschen irgendwann auf die Idee gekommen sind, nicht mehr vor die Tür gehen zu wollen, sondern uns alles nach Hause liefern zu lassen. Und für diese Haltung gibt es keine gute Entschuldigung. Pandemien mal ausgenommen. Nun ja, ich gebe es zu, vielleicht würde ich nicht so altmodisch denken, wenn meine Freundin Isolde keine Buchhändlerin wäre.
Ich wollte den Bildschirm meines Handys gerade ausschalten, da summte mein Handy erneut. Diesmal waren es keine WhatsApp-Nachrichten. Ein aufgepopptes Nachrichtenfenster bedeckte die Bildschirmoberfläche des Online-Buchhändlers. »Eilmeldung«. Ich las die durchlaufende Überschrift:
Neuigkeiten im Fall
der verschwundenen Pia K. (7)
Sofort kribbelte es in meiner Nase, was es lästigerweise manchmal tat, wenn ich nervös wurde.
»Alles okay mit dir?«, fragte Engin.
Um meinen Stimmungswandel zu spüren, musste man kein Körpersprache-Experte sein. Es reichte, dass man Freude von einem drohenden Schlaganfall unterscheiden konnte.
»Ja.« Irgendetwas schnürte mir die Kehle zu, und es war nicht die Schlagzeile:
Führt die Spur
in diese psychiatrische Anstalt?
Oder etwa doch?
Ich bin Berliner. Jede Nacht werden in der Rechtsmedizin der Hauptstadt im Schnitt (ähm, kein Wortwitz beabsichtigt) sechs Leichen eingeliefert, bei denen der Verdacht eines unnatürlichen Todes besteht.
Ich weiß das so genau, weil ich erst kürzlich das Sachbuch eines bekannten Rechtsmediziners bei Ullstein untergebracht habe. Meldungen über Gewaltverbrechen in der Hauptstadt konnten mich schon lange nicht mehr schocken.
Es sei denn, es waren Kinder involviert.
»Es kann sein, dass sie Pias Entführer haben«, sagte ich zu Engin.
»Scheiße, wird auch Zeit. Wie lange war die Kleine jetzt verschwunden?«
»Ist noch verschwunden«, korrigierte ich ihn. »Seit über drei Monaten. Ein Informant der Zeitung behauptet, ein Patient in der Schlachtensee-Klinik hätte die Tat gestanden.«
»Ist das die Privatklapse in Zehlendorf?«
»Ich fürchte, sie bevorzugen dort die Bezeichnung Psychiatrie. Aber ja.«
Eine von mir angeklickte Nachrichtenmeldung gab nur wenig Aufschluss. Typische Mutmaßungsberichterstattung. Gerücht auf Gerücht.
Über den Verdächtigen, der sich angeblich vor etwa drei Wochen selbst einliefern ließ, ist nichts Genaues bekannt. Kein Name, kein Alter, keine Diagnose. Nur das Gerücht, dass er von sich behauptet, die kleine Pia K. (7) entführt zu haben.
Der Fall des verschwundenen Mädchens hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Zumindest für die üblichen drei Stunden, bis sich die allgemeine Empörung auf das nächste Aufmerksamkeitsfeld richtete.
Wäre die Welt fair und gut, hätte ich Pias Bild mit ihrem Zahnlückenlächeln im Fotorahmen auf dem Kamin ihrer Eltern gesehen und nicht bei Aktenzeichen XY. Zusammen mit den Bildern eines pinkfarbenen Tinkerbell-Ranzens und der rosa Rüschenbluse, die sie am Tag der Entführung getragen hatte.
»Zeig mal sein Foto«, befahl mir Engin, dessen Patschezeigefinger bestimmt schon wieder auf der Kurzwahl für Slappy lag, um seine Dienste nicht länger für ungeständige Kindesentführer zu mieten.
»Gibt kein Foto«, klärte ich ihn auf. Dafür las ich einen mir sehr vertrauten Namen.
Groß, in Versalien geschrieben, schrie er mich an. Aus dem Ticker.
»Was hast du?«, fragte Engin, den die Tatsache, dass mir mein Handy entglitten und zu Boden gefallen war, bestimmt ähnlich irritierte wie mein tumb offen stehender Mund.
»Der Typ ist völlig irre«, krächzte ich.
»Vielleicht ist das der Grund, warum er in der Klapse sitzt?«
Ich räusperte mich erfolglos. Der Kloß im Hals wollte nicht abschwellen. »Der Patient sagt wohl, Pia lebt noch.«
»Ooookay.« Engin trat näher und legte den Kopf schief wie ein Kunstsachverständiger, der aus nächster Nähe ein Gemälde nach Hinweisen auf eine Fälschung begutachtet. »Das ist doch eine gute Nachricht?«
»Ja«, murmelte ich.
»Und wieso siehst du dann aus, als hätte dir dein Klempner gerade ein Dick Pic geschickt?«
Ich schluckte. »Weil der Patient in der Schlachtensee-Klinik laut Quelle der Zeitung nur mit einer einzigen Person auf der Welt reden will.«
»Mit seinem Anwalt?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Mit mir!«
Kapitel 2
Meine Literaturagentur liegt im Dachgeschoss eines Gründerzeitaltbaus in Charlottengrad. So bezeichnen Hauptstädter, die sich für besonders kreativ halten, das Charlottenburger Gebiet rund um den Ku’damm, in dem – das muss man den Spaßvögeln lassen – der Einfluss russischer Neuberliner nicht zu übersehen ist. Im Grunde genommen wie Baden-Baden. Nur nicht so schön tot.
Nicht nur in Pelz- und Schmuckgeschäften ist ein Russisch sprechender Angestellter mittlerweile Pflicht, selbst beim Lidl wird man mit »Добрый день« begrüßt und auf dem Kundenparkplatz mitleidig angeschaut, wenn man seine Einkäufe nicht standesgemäß im Cayenne verstaut. Würde ab und an mal ein putinkritischer Kunde im Starbucks vergiftet, man käme sich glatt vor wie in Moskau. Ich selbst fahre keinen SUV – mein Geltungsdrang braucht weniger Quantität als Qualität –, sondern einen Karmann Ghia, ein uraltes VW-Cabrio, das so aussieht, als hätte Godzilla auf seiner Haube ’ne Raucherpause eingelegt und ihn zu einem halben Porsche platt gequetscht.
Dank meines Oldtimerkennzeichens darf ich ihn sogar in der Innenstadt von Baustellenstau zu Baustellenstau rollen. Streifenpolizisten hassen diesen Trick. Um ehrlich zu sein: Der Verkehr in der Stadt ist so beschissen – manch einer ist mit einem neuen Auto losgefahren und in einem Oldtimer bei seinem Termin angekommen. Heute aber bin ich den kurzen Weg vom Europa-Center zur Uhlandstraße zu Fuß gegangen, und zwar halb im Stechschritt, halb joggend, was dafür sorgte, dass ich mit hochrotem Kopf am Empfang vor meiner Assistentin Penelopé aufschlug.
Wenn Sie bei diesem Namen jetzt eine Vollblut-Latina mit Modelmaßen und Tipp-Ex-Lächeln erwarten, die mich allmorgendlich mit einem sinnlich gehauchten »Wunderschön, Sie zu sehen, Herr Dolla« begrüßt, dann unterliegen Sie gerade einem ähnlich großen Denkfehler wie Dick Rowe von Decca Records, der 1961 mit dem Argument »Die Zeit der Gitarrenbands ist vorbei« die Beatles ablehnte.
Penelopé Karlslowski ist eine kettenrauchende Mittfünfzigerin mit schon sprichwörtlich schlechter Laune.
»Was willst du Vogel denn jetzt schon hier?«, blaffte sie mich an und blies mir den Rauch einer frisch angesteckten Zigarette ins Gesicht.
Das ist mir komplett egal, bei der fantastischen und loyalen Arbeit, die sie seit Jahren für mich leistet, könnte sie meinetwegen drei Cohiba-Zigarren im Büro gleichzeitig rauchen, auch wenn das bedeuten würde, dass ich mit einem Nachtsichtgerät am Schreibtisch sitzen müsste. Abgesehen davon, dass sie Empfangssekretärin und Buchhalterin in Personalunion ist, ist sie nämlich das Trüffelschwein der Dolla-Agentur. Und ja, auch ich wünschte, dass es Einhörner wären, die in der Lage sind, Trüffel zu erschnuppern.
Bevor ich einen neuen Autor unter Vertrag nehme, gebe ich ihr das Manuskript zu lesen, und sie lag noch nie falsch. Jedes von ihr mit »Daumen hoch!« bewertete Werk wurde zum Bestseller. Jede ihrer Ablehnungen, die ein anderer Agent unter Vertrag nahm, sorgte bei dem für so viel Freude wie ein britisches Auto. Sieht erst gut aus – und kostet dich am Ende Tausende.
»Hast du die Nachrichten gelesen?«, fragte ich Penelopé und hustete. Sie konnte erst fünf Minuten vor mir gekommen sein, andernfalls hätte ich sie in dem von ihr produzierten dichten Zigarettenqualm gar nicht mehr erkennen können. Helmut Schmidt wäre im Vergleich zu ihr ein unbeirrbarer Gesundheitsapostel gewesen. Was für ein Glück, dass der Hausmeister bestechlich war und die Rauchmelder in unserem Büro deaktiviert hatte.
»Na klar. Ich bin um halb vier aufgestanden, hab Günther (Anm.: So heißt ihr Mann) mit dem Kissen erstickt, damit er mich nicht ablenkt, hab nicht geduscht, nicht gefrühstückt und trag den Schlüppi von gestern, damit ich genügend Zeit habe, SÄMTLICHE Nachrichten auf der GANZEN WELT zu konsumieren.«
»Ein Nein hätte gereicht.«
»Eine präzisere Frage hätte mich nicht genervt.«
Ich atmete tief durch, was mich bei der Luft im Raum locker zwei Lebensjahre kosten würde.
»Aber ich nehme an, deine Frage bezieht sich auf den Irren aus der Anstalt«, sagte sie.
»Also hast du doch die Nachrichten gelesen.«
»Nein. Aber ein halbes Dutzend Reporter abgewimmelt, die dich alle interviewen wollen. Hab ich was verpasst? Akquirieren wir unsere Autoren jetzt aus der Klapse? Normalerweise sind die doch reif für die Anstalt, nachdem du mit ihnen durch bist.«
»Pen, ich weiß genauso viel wie du. Irgendein Verrückter, der vielleicht ein kleines Mädchen entführt hat, sitzt in der Psychiatrie und will mit mir sprechen.«
Sie bedachte mich mit einem mitleidigen Blick. »Falsch.«
»Wieso falsch?«
»Falsch, weil du nicht genauso viel weißt wie ich – sondern weniger.«
Ich seufzte. »Dann klär mich auf.«
Sie drückte ihre Zigarette aus, um sich sofort eine neue aus der Marlboro-Packung zu fingern, immerhin Lights ohne Zusatzstoffe, man will ja achtsam an Lungenkrebs sterben.
»Keine Zeit, ich muss die neuen Verträge rausschicken, damit mal wieder Geld reinkommt. Du gehst zu deinem Termin, da erfährst du alles.«
Ich zog die Augenbrauen hoch. »Welcher Termin?«
Sie sah mich an, als hätte ich sie gefragt, ob sie kurz für mich tanzen würde. »In einer Stunde in der Schlachtensee-Klinik, Station 3, Zimmer 211. Aber geh durch den Hintereingang. Die Presse wird schon auf der Lauer liegen, wenn du auf den Kindermörder und seinen Anwalt triffst.«
Kapitel 3
Schlagen Sie mich, aber ich finde es seltsam, wenn sich Krankenhäuser mehr und mehr bemühen, nicht wie Kliniken, sondern eher wie Hotels auszusehen. Natürlich möchte ich mich nicht wie im Hannibal-Lecter-Keller im »Schweigen der Lämmer« fühlen, wenn ich eine Psychiatrie betrete, aber eine Tapete aus Moos und echten Pflanzen an den Wänden? Kronleuchter unter dem Kuppeldach und ein Springbrunnen in der Lobby? Euer Ernst? Wer würde da nicht freiwillig beim Rorschachtest erzählen, dass er mit seiner toten Mutter pennen will, nur um in diese Nobelklapse zu kommen?
Gut, wer Tapeten aus Moos sieht, bleibt vermutlich auch schlicht aus dem Grund dort, weil er annimmt, dass er mal wieder der Einzige ist, der das sehen kann.
Privatklinik hin oder her, einer meiner Lieblingsklienten, ein zweiundzwanzigjähriger Comedy-Autor mit starken Depressionen, hätte für die illuminierte Fotokunst bei seiner Einweisung im Ernstfall keinen Blick übrig. Vermutlich wollte man nicht die Patienten, sondern eher die Angehörigen beeindrucken, auf deren schwarze Amex man bei der Anmeldung spekulierte. Immerhin hatte ich dank eines direkten Zugangs von der Tiefgarage in den abgeriegelten Hochsicherheitsbereich nicht durch die Hintertür einfallen müssen und noch keinen der von Penelopé angedrohten Reporter zu Gesicht bekommen.
»Müsste er nicht in einer staatlichen Einrichtung untergebracht sein?«, fragte ich Empfangsdame Tatjana, die von der Klinikleitung offenbar nach anderen Prioritäten ausgewählt worden war als denen, die ich bei der Einstellung von Penelopé hatte walten lassen.
»Wen meinen Sie?«
»Mister X. Der Patient, mit dem ich eine Verabredung habe. Wie ich Ihnen vor, ähh …«, ich sah auf die Uhr, »… dreizehn Sekunden gesagt habe.«
»Ich verstehe«, sagte sie und lächelte verständnislos, wie sie da auf ihrem Drehstuhl in dem Kasten saß, den man in herkömmlichen Einrichtungen »Pförtnerbude« nennt, hier aber natürlich Rezeption. Papageienhaft wiederholte sie: »Bitte gehen Sie in den dritten Stock, Zimmer 211.«
»Ich bringe Sie zu ihm«, erscholl es hinter mir.
In der Erwartung, einen Zwei-Meter-Mann mit Bierfasswampe vor mir zu sehen, drehte ich mich um und war erstaunt, dass eine so tiefe, bräsige Stimme aus einem so schmalen Körper kommen konnte. »Professor Wohlfeldt«, stellte sich mir der weiß bekittelte Arzt vor, ohne mir die Hand zu geben, was in Krankenhäusern seit Corona wohl nicht mehr so hip war. Mit dem dunklen Teint sah er aus wie eine Mischung aus Pep Guardiola und Jack Nicholson. Alles, was dem Mann an Kopfbehaarung fehlte, musste in einer Art Migrationsbewegung über Nacht über seine Augen gewandert sein. Brauen, die wie tote Stinktiere über den Augenhöhlen ruhten.
»Sie sind der Chefarzt?«
»Mir gehört die Klinik«, stellte er klar und nickte nach links.
Oha. Monsterbraue gibt den Silberrücken.
»Kommen Sie, die Fahrstühle sind gleich da vorne.«
Ich tat wie mir befohlen und ordnete mich in seinem Windschatten ein.
»Wir sind über die Entwicklung ebenso erstaunt wie Sie«, sagte er und vergewisserte sich mit einer Kopfdrehung, die einen Fahrschullehrer in Ekstase versetzt hätte, dass ich in seinem toten Winkel hing. »Wissen Sie, derartige Medienöffentlichkeit ist unserem Hause gar nicht recht.«
Hmmh. Und ein Lambo-Fahrer ist eine introvertierte Poetenseele.
»Natürlich nicht!« Ich quittierte diese Lüge mit einem sarkastischen Lächeln.
»Normalerweise legen unsere Patienten großen Wert auf Ruhe und Diskretion. Hätten wir gewusst, welche Komplikationen uns dieser mysteriöse Patient einbringt, hätten wir niemals seiner Behandlung bei uns zugestimmt.«
Aber natürlich nicht. Kostenlose PR. Wie widerlich …
Mir kam langsam eine Idee, wer die anonyme Quelle gewesen sein konnte, die das Gerücht über den Insassen hatte durchsickern lassen.
»Hat dieser, äh, mysteriöse Patient auch einen Namen?«
»Nein. Nicht für Sie.«
Wir hatten die Fahrstühle erreicht, neumodische Dinger ohne Drückknopf, dafür mit einem Tastenfeld, auf dem man das gewünschte Stockwerk eingeben musste, bevor der Lift kam.
»Wie Frau Schulz Ihnen schon sagte, darf ich Ihnen keine Informationen geben, solange er uns nicht von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden hat.«
»Gut, lassen Sie es mich anders formulieren: Kennen Sie den richtigen Namen des Patienten?«
Der Klinikleiter schüttelte den Kopf.
»Und da Anonymus trotz seines Geständnisses noch immer bei Ihnen und nicht hinter Gittern sitzt, hält die Polizei ihn anscheinend nicht für verdächtig?«
Wohlfeldts genervter Seitenblick traf mich wie ein Schnipsgummi. »Bei uns ist er sicherer untergebracht als in einer U-Haft-Zelle. Ich kann Ihnen versichern, die Abteilung 3 im Schlachtensee-Klinikum übererfüllt alle Standards einer forensischen Psychiatrie, auch wenn wir auf solche Patienten keinen Wert legen.«
Der Aufzug öffnete sich, und wir traten ein. In ihm roch es, wie es in Krankenhausfahrstühlen immer roch. Etwas mehr Desinfektionsmittel und jemand wie Karl Lauterbach würde das Ding als Wohnung mieten.
»Okay, Professor Wohlfeldt«, sagte ich. »Lassen Sie mich zwei und zwei zusammenzählen, und Sie schütteln den Kopf, wenn ich etwas anderes sage als vier, ja?«
Er legte den Kopf schräg, was Zustimmung bedeuten mochte. Oder eine Nackenverspannung.
»›Der Patient hat keinen Namen‹ heißt im Klartext: Er hat Sie bei der Anmeldung über seine Identität getäuscht. Folglich hat er bar bezahlt, sonst wäre er schon bei der Vorlage seiner Versicherungskarte aufgeflogen. Jetzt, nachdem er hat durchblicken lassen, dass er an der Entführung eines Mädchens beteiligt sein könnte, sitzt er in Ihrem klinikeigenen Hochsicherheitstrakt, aus dem Sie ihn am liebsten schneller wieder loswerden wollen als ein Cafébetreiber eine fünfköpfige Gruppe von Müttern mit Kleinkindern, was leider nicht geht, da die Ermittler Mister X für einen unverdächtigen Spinner halten, Sie aber von der Öffentlichkeit gegrillt werden, wenn Sie einen mutmaßlichen Kindermörder einfach so aus der Klinik schmeißen.«
Ping! Ein Geräusch, das nicht signalisieren sollte, dass ich die Top-Antwort gegeben hatte, sondern lediglich auf das Erreichen des gewünschten Stockwerks hindeutete.
Die Fahrstuhltüren öffneten sich nahezu geräuschlos.
»Ich verstehe, weshalb er mit Ihnen sprechen will«, sagte Wohlfeldt auf dem Weg links den Gang hinunter.
»Wegen meiner brillanten Kombinationsgabe?«
Wir stoppten vor einer Tür mit Milchglasscheibe, deren Gläser in etwa so dick waren wie die Brillengläser von Torsten Tremmser. Ich weiß, Sie kennen Torsten Tremmser nicht, aber wenn, dann wüssten Sie, dass ihn schon deshalb kein Mädchen in der siebten Klasse küssen konnte, weil seine Panzerglas-Brille wie ein Abstandshalter fungierte. Der Kerl hatte schon in den Achtzigern alles durch den Insta-Filter gesehen.
»Wegen Ihrer oberflächlichen Naivität«, sagte Wohlfeldt mit rezeptfreier Ungerührtheit, während er sich die Augen von einem Irisscanner an der Wand neben der Tür abtasten ließ. Dann erlaubte er einem flachen Handerkennungsgerät, seine Fingerabdrücke zu checken, schließlich musste er noch einen sechsstelligen Code eingeben. Es wunderte mich, dass er keine Stuhlprobe hatte abgeben müssen, damit der Türsummer ansprang.
»Sie halten sich für klug, Herr Dolla. Sie sind leichte Beute für diesen Psychopathen.«
»Das schließen Sie aus meinen Fragen?«, fragte ich, während wir in einer Art Schleuse standen. Kaum war die Tür hinter uns ins Schloss gefallen, wiederholte Wohlfeldt die Prozedur an einer zweiten Panzertür. Alles andere als der Hulk oder ein T. rex konnte jetzt nur noch eine Enttäuschung sein.
»Ich schließe das vor allem aus dem Umstand, dass Sie sofort der Einladung des Anwalts unseres Patienten in meine Klinik gefolgt sind. Es ist nicht das Geld, das Sie antreibt, nicht einmal Ihre Sucht nach Aufmerksamkeit.«
Wir liefen einen Gang hinunter, bei dem die Innenarchitekten sich keine Mühe mehr gemacht hatten, ihn optisch irgendwie so zu pimpen, dass er nicht wie der Zellenflur eines Gefängnisses aussah. So wie bei meinem Steuerberater und guten Kumpel Enno. Nicht dass Enno in einer Psychiatrie wohnte, ich meine das Prinzip: unten hui, oben Ikea. Wenn man Ennos Köpenicker Villa betrat, war man von den teuren Möbeln im Eingangsbereich überwältigt. Livin’ la Vitra Loca. Der Rest war das Prinzip Mount Everest: Je weiter man nach oben kam, desto dünner wurde die Luft. Die Einrichtung wurde immer billiger, was man aber – und hier setzt die Psychologie ein – nicht mehr wahrnahm, weil das Gehirn beim Eingang auf »teuer« programmiert worden war und sich im Folgenden keine Gedanken mehr über die Pressspanhölle machte, durch die man da lief.
Wobei man aber schon eine Lobotomie hinter sich haben musste, um den Unterschied zwischen der Lobby unten und dem Hochsicherheitstrakt hier oben nicht wahrzunehmen. Keine Mietpalmen, keine sanften Pastellfarben an den Wänden, dafür grauer Putz, in den nackte Metalltüren mit schwarz eingravierten Zimmernummern eingelassen waren. Ich meinte, jemanden weinen zu hören, aber das war bestimmt nur Einbildung. Wäre ich Horrorfilm-Regisseur, würde ich hier einen Klinikschocker drehen, nachdem ich das Neonlicht über unseren Köpfen zum Flimmern gebracht hätte. (Womit geklärt ist, weshalb ich diesen Beruf Menschen überlasse, die weniger klischeehaft denken.)
»Aufmerksamkeit haben Sie laut Google schon genug«, fuhr Wohlfeldt fort. »Sie sind von einer unstillbaren Neugierde getrieben, und die wird Ihnen irgendwann zum Verhängnis.«
»Bei der nächsten Weissagung müssen Sie unbedingt noch eine weiße Katze auf dem Schoß streicheln«, sagte ich und hätte beinahe geklatscht, war aber etwas irritiert, weil wir Zimmer (oder sollte ich sagen, Zelle?) 211 achtlos passierten und auf eine Tür am Kopfende des Ganges zuliefen, die als einzige nicht mit einer Nummer versehen war.
»Meine jahrelange Expertise lässt mich bei Menschen schnell hinter die Fassade schauen«, stellte Wohlfeldt klar.
»Sagen Sie das besser nicht zu laut.« Ich lachte. »Sonst spricht es sich rum, und Ihre Patienten sind nicht länger bereit, monatelang fünfhundert Euro die Stunde zu zahlen, wenn der Hokuspokus auch in zwei Minuten geht.«
Wieder tippte der Arzt eine Zahlenkombination in das Tastenfeld eines elektronischen Türschlosses, und wieder brummte der Summer wie eine Fliege unter Glas. Ich war mir ziemlich sicher, gleich das Bernsteinzimmer zu betreten.
»Was ist mit Ihnen?«, fragte ich, als Wohlfeldt mir mit einem Kopfnicken zu verstehen gab, dass ich zuerst eintreten sollte.
»Ich darf da nicht mit rein.«
»Kein Backstage-Pass?« Ich sah ihn verdutzt an und wartete auf eine Erläuterung, die aber nicht kam.
Hm.
Vielleicht hätte es mir zu denken geben sollen, dass Wohlfeldt bei seinem letzten Satz sehr erleichtert geklungen hatte. Und dass ein wissendes Lächeln seine Lippen umspielte, während er sich von mir abwandte, um zu den Fahrstühlen zurückzugehen.
Kapitel 4
Ich betrat einen Vorraum, der mich an meinen schrecklichsten Urlaub mit Isolde erinnerte.
Isolde ist die beinahe beste Verlobte der Welt, wobei ich auf das beinahe später noch zu sprechen komme. Hier und jetzt nur so viel, damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie heftig es mich mit ihr erwischt hat: Isolde ist nicht meine bessere Hälfte. Sie ist wenigstens mein besseres Dreiviertel.
Man sagt ja, dass all das, was man zu Beginn einer Beziehung am anderen als liebenswerte Außergewöhnlichkeit empfindet, später genau das ist, was man an seinem Partner hasst. Wenn das stimmt, dann hätte ich irgendwann einmal enorm viele Scheidungsgründe zur Auswahl angesichts der Vielzahl von Macken und Eigenarten, die ich an Isolde so liebe. Da ist zum einen ihre Widersprüchlichkeit. Sie schafft es, selbst gebastelten Plastikmodeschmuck in ihre langen braunen Haare zu nesteln und dieses Zwei-Euro-fünfzig-Haarteil mit einer Tiffany-Halskette zu kombinieren, und sieht damit auch noch gut aus. Nicht im Sinne einer instagramgefilterten Influencer-Botox-Barbie-Schönheit, sondern eher wie das 893 in der Kantstraße, an dem man beim ersten Mal vorbeilatscht, weil man nicht damit rechnet, dass sich hinter einer graffitibeschmierten Westsozialbau-Schaufensterfront einer der besten Japaner der Stadt verbirgt. Wobei das Beispiel hinkt, wie ich gerade merke, denn Isolde ist weder graffitibeschmiert noch ein Sozialbau. Eher eine einzigartige Dornröschenvilla, die es, anders als der aufgepimpte Luxusarchitekten-Bau daneben, nicht nötig hat, abends mit Halogenspots in Szene gesetzt zu werden; einfach, weil sie von innen heraus leuchtet. Hm, das klingt jetzt, als wäre sie etwas altbacken und verschroben, womit ich jedem Freudianer ein Leuchten in die Psychiateraugen treiben würde, denn das würde bedeuten, dass ich mich in meine Mutter verliebt hätte. Ich denke, worauf ich hinauswill, ist, dass Isolde einfach cool ist in dem Sinne, dass sie keine Statussymbole braucht, weil sie selbst eines ist. Auf jeden Fall für mich. Belesener als Reich-Ranicki in seinen besten Jahren, ist sie mein intellektuelles Gütesiegel in der Öffentlichkeit.
Während ich zum Beispiel auf Veranstaltungen meist dröge Unterhaltungen über E-Book-Flatrates und Audiostreamings führe, schafft sie es mit ihrem außergewöhnlichen Humor, die Zuhörer, die sich rasch um sie gruppieren, emotional zu begeistern.
Ich selbst lernte Isolde auf dem Sommerfest der Bahnhofsbuchhändlerinnen und -händler kennen, und schon nach den ersten Small-Talk-Minuten war ich schockverliebt, plante Urlaube, Kinder und ein Eigenheim im Grünen mit ihr, mit einem weißen Zaun, Kletterwand im Garten und Solarlampions, die an von Baum zu Baum gespannten Leinen hingen. Jede Rama-Reklame war ein Ausbund nüchternen Realismus gegen meine Visionen. Isolde hingegen plante eher den vorzeitigen Abgang, um dem Idioten zu entkommen, der jeden Satz mit einem nervösen Räuspern einleitete und mit einem hysterischen Kiekserlachen abwürgte. Ich klang wie ein alter Lada Niva. Und für mich gab es nicht einmal eine Abwrackprämie.
»Hm, ich bin … bin David, hä, hä.«, »Ähm, schön, dass du da bist, hä, hä, ich ähm, ich bin Literaturagent, hä, hä.«
»Im Ernst?«, sagte sie. »Lass dich mal umarmen.«
Schon in diesem Moment fühlte ich mich wie im siebten Himmel. Doch was dann kam (und ich schwöre, genauso hat es sich abgespielt), signalisierte meinem Endorphinausstoßzentrum im Gehirn, dass ich meine seelenverwandte Traumfrau getroffen hatte. Denn Isolde zog mich zu sich heran, drückte sich fest an mich, vergrub ihr Gesicht in meinen damals noch etwas längeren Haaren und hauchte mir ins Ohr: »Du riechst irgendwie anders, wenn ich nachts neben deinem Bett stehe und dich beobachte.«
(Das meinte ich mit: Sie hat Humor!)
Damit ließ sie mich stehen. Ich brauchte drei Tage, um das schwachsinnige Grinsen aus dem Gesicht zu bekommen. Vier Tage, um sie wieder anzurufen. Vier Monate, um, egal … das ist eine andere Geschichte. Und der schrecklichste Urlaub meines Lebens im Übrigen auch, denn der fand nie statt, sondern endete jäh am Kontrollterminal des Flughafens Tegel. (Ich hatte zu lange in einer Vertragskonferenz mit Random House gesteckt, wir waren zu spät losgekommen, und die Schlange bei der Handgepäcksdurchleuchtung war länger als in Wacken vor dem Dixi-Klo gewesen.)
Und an eben so ein Flughafenkontrollterminal erinnerte mich der Vorraum. Für diese Assoziation brauchte man allerdings nicht viel Fantasie. Woran sollte man sonst denken, wenn man vor einem Röntgenband stand und ein blau uniformierter Pseudopolizist einem mit grimmiger Miene zurief: »Taschen, Handy, Schlüssel, Brieftasche und Gürtel ablegen!«, bevor er dich aufforderte, durch die Piepsschleuse zu gehen?
Nachdem meine Neugierde (ja, in diesem Punkt hatte Wohlfeldt recht) mich auch diesen letzten Türsteher hatte passieren lassen, betrat ich, erleichtert um Gürtel und Handy, das »Mandantenzimmer«, wie mir der Wachmann beim Öffnen der Tür zu dem fensterlosen, quadratischen Raum zuraunte.