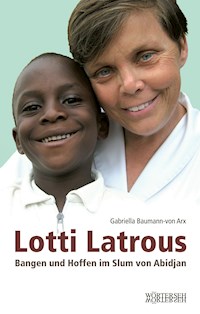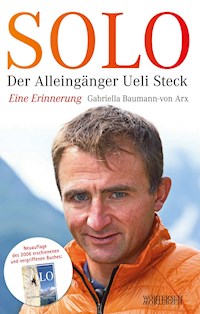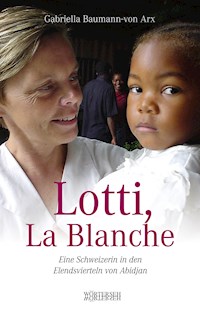9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch erzählt Evelyne Binsack, die am 23. Mai 2001 als erste Schweizerin auf dem Mount Everest stand, wie sie den Aufstieg zu diesem mit 8848 Metern höchsten Gipfel der Erde meisterte. Ihr Ziel war es schon damals, später noch zwei weitere Pole, den Süd- und den Nordpol, zu erreichen, was ihr in den Jahren 2007 und 2017 auch gelang. In "Schritte an der Grenze" gibt die charismatische Abenteurerin unter anderem Antworten darauf, weshalb es sie dazu drängt, immer schwierigere Ziele zu verfolgen, und reflektiert darüber, ob Frauen anders an den Berg gehen als Männer. Zudem erzählt sie, was sie antrieb, außer Bergführerin auch noch Helikopterpilotin zu werden, und wie ein Fläschchen Weihwasser in der Todeszone des Mount Everest Leben rettete. "Die Ernte von Erfahrungen ist Erkenntnis." Evelyne Binsack
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
Wörterseh-Bestseller als Taschenbuch
Die Originalausgabe erschien als Hardcover im Werd-Verlag und als Taschenbuch im Verlag Frederking & Thaler
© 2017 Wörterseh, Lachen SZ
Lektorat: Regula WalserKorrektorat: Andrea LeutholdUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaFoto Umschlag vorne: Bruno PetroniFoto Umschlag hinten: Robert BöschFotos Bildteil: Robert Bösch (gekennzeichnet), alle anderen Privatarchiv Evelyne BinsackLayout, Satz und herstellerische Betreuung: Beate Simson
ISBN 978-3-03763-320-5 (Taschenbuch) ISBN 978-3-03763-741-8 (E-Book)
www.woerterseh.ch
INHALT
Zum Buch
Die Personen hinter dem Buch
1 »In die Berge gehen«
Raymond Binsack, Vater
2 Muttergöttin der Erde
Remo Zberg, Leichtathletik-Trainer
3 Bergführer
4 Patagonien
5 Puja-Zeremonie
6 Der Wunsch, Bergführerin zu werden
Ruedi Kaufmann, Bergführer
7 Everest. Mount Everest.
8 Advanced Base Camp
9 Flughelferin
10 Ferdi
11 Neu anfangen. Jeden Tag.
12 Dem Berg begegnen
13 Akklimatisation
14 Helikopterpilotin
Erika Binsack, Mutter
15 Warten
Dr. Jürg Marmet, erster Schweizer auf dem Mount Everest
16 Die Kletterei
17 »Gott beschütze dich!«
18 Beziehungen
19 Gipfeltag
20 Der Berg bekommt seine Ruhe
Bildteil
Nachwort der Verfasserin
Zwanzig Jahre später – ein Rückblick von Evelyne Binsack
Literaturverzeichnis
ZUM BUCH
In diesem Buch erzählt Evelyne Binsack, die am 23. Mai 2001 als erste Schweizerin auf dem Mount Everest stand, wie sie den Aufstieg zu diesem mit 8848 Metern höchsten Gipfel der Erde meisterte. Ihr Ziel war es schon damals, später noch zwei weitere Pole, den Süd- und den Nordpol, zu erreichen, was ihr in den Jahren 2007 und 2017 auch gelang. In »Schritte an der Grenze« gibt die charismatische Abenteurerin unter anderem Antworten darauf, weshalb es sie dazu drängt, immer schwierigere Ziele zu verfolgen, und reflektiert darüber, ob Frauen anders an den Berg gehen als Männer. Zudem erzählt sie, was sie antrieb, außer Bergführerin auch noch Helikopterpilotin zu werden, und wie ein Fläschchen Weihwasser in der Todeszone des Mount Everest Leben rettete.
»Die Ernte von Erfahrungen ist Erkenntnis.«
Evelyne Binsack
DIE PERSONEN HINTER DEM BUCH
Evelyne Binsack, geb. 1967, verstand schon früh, dass es für das Überleben in der Steilwand essenziell ist, die Gesetze der Natur zu respektieren und die physischen sowie die mentalen Fähigkeiten unermüdlich zu trainieren. 1991 absolvierte sie als eine der ersten Frauen Europas die Ausbildung zur diplomierten Bergführerin und bestieg zehn Jahre später als erste Schweizerin den Mount Everest. Im September 2006 startete sie vor ihrer Haustür Richtung Süden, war unterwegs mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit Skiern und dem Schlitten und kam nach 484 Tagen am Südpol an. Aber erst 2017 erfüllte sich ihr lang gehegter Traum, aus eigener Muskelkraft auch noch zum Nordpol zu gelangen. Über das Erreichen dieser drei Pole sind folgende Bücher erschienen: »Schritte an der Grenze«, »Expedition Antarctica« und »Grenzgängerin«. Evelyne Binsack, die im Berner Oberland lebt, arbeitet als Bergführerin und ist eine gefragte Referentin. In ihren Vorträgen geht es um Themen wie Risikomanagement, Selbstführung und Zielverwirklichung ebenso wie um ihr Leben und ihre Passion. Einen neuen Weg beschreitet sie, indem sie andere Menschen nicht mehr nur als Bergführerin auf Berge, sondern auch als Beraterin und Mentorin begleitet. Mehr dazu unter: binsack.ch
© Gianni Pisano
Gabriella Baumann-von Arx, , geb. 1961, ging es in ihren journalistischen Texten immer um Menschen und deren Geschichten. Bald war ihr die Länge eines Zeitungsartikels zu kurz für all die Facetten, die sie in ihre Texte einarbeiten wollte, und so begann sie, Bücher zu schreiben. Bücher über außergewöhnliche Menschen. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung – »Lotti, La Blanche« – erschien 2003 im Werd-Verlag. Da der Nachfolgeband »Madame Lotti« dort ein Jahr später keinen Platz fand, gründete Gabriella Baumann-von Arx den Wörterseh-Verlag, für den sie später auch »Lotti Latrous« schrieb. Außerdem »Solo«, eine Nahaufnahme des damals knapp dreißigjährigen Ausnahmeathleten Ueli Steck, der am 30. April 2017 im Himalaja tödlich verunglückte. Gabriella Baumann-von Arx fand zwar neben ihrer neuen Aufgabe als Verlegerin schon bald keine Zeit mehr, um selbst zu schreiben, doch eines blieb auch dabei zentral: Es sind Menschen und deren Geschichten, die sie interessieren. woerterseh.ch
1»In die Berge gehen« – das brachte ich lange Zeit in Verbindung mit Knickerbockerhosen und roten Socken. Mit von Fett glänzenden, ungewaschenen Haaren und Schweißrändern unter den Achseln. Und mit in verfilzte Schnurrbärte triefenden Rotznasen.
In die Berge zu gehen, war mir als Kind ein Gräuel. Ich ging trotzdem. Weil ich musste. Denn in Hergiswil, im Kanton Nidwalden, wo ich, am Fuße des Pilatus, aufgewachsen bin, sind sonntägliche Familienspaziergänge immer gleich Wanderungen. Die Berge sind nah. Zu nah, fand ich damals. Heute können sie mir nicht nah genug sein. In Beatenberg, wo ich lebe, sehe ich, wenn ich morgens aus dem Bett steige, Eiger, Mönch und Jungfrau. Abends sind die Gipfel von der untergehenden Sonne in pastellfarbenes Rosa getaucht. Manchmal sind sie besonders schön, weil der Himmel darüber vor lauter Kälte leuchtend blau ist. Und mit blau meine ich dieses spezielle Blau, dieses Blau, das ich in Gletscherspalten finde. Hell ist es, eisig schimmernd, fast durchsichtig. Wenn ich es sehe, dann denke ich an das Wort »rein«. Ja, ein reines Blau. Eines, das kein Künstler je so malen könnte. Weil nichts wirklicher ist als die Wirklichkeit. Fassbar gewordene Natur.
Ich könnte hier auch von Gott sprechen. Ich rede mit ihm. Oft. Ich spüre ihn, sehe ihn. In jedem einzelnen Windhauch, in jedem Eiskristall, in Blumen, die da wachsen, wo es gar kein Wachsen mehr gibt. An Felswänden. Meine Mutter vermittelte mir Religion auf eine ganz besondere Weise. Eines unserer Rituale war das Kreuzeszeichen, das sie mir unzählige Male mit geweihtem Wasser auf die Stirn zeichnete.
Seit wann ich mich zum Mount Everest hingezogen fühlte, weiß ich nicht mehr – nur daran erinnere ich mich: Meine Mutter hat mir – in einem Gedicht – zu meinem zwanzigsten Geburtstag Glück für den Achttausender gewünscht. Dass mein Wunsch einmal in Erfüllung gehen würde, davon konnte ich lange Zeit nur träumen. Als ich eines Tages nicht mehr träumen, sondern meinen Traum in die Tat umsetzen wollte, ging ich auf Sponsorensuche. Und fand einen Geldgeber, der bereit war, die finanziellen Mittel von 35 000 Dollar für mich aufzubringen.
Als ich mich zu meinem Abenteuer Mount Everest aufmachte, gab mir meine Mutter ein Fläschchen Weihwasser mit auf den Weg. Es hat – auf 8700 Metern über dem Meer, in der Todeszone – geholfen zu überleben. Nein, nicht mir. Aber davon später.
Mich hat der Mount Everest verschont, mehr noch, er war gütig zu mir, hat mir zwar alles abverlangt, aber auch alles gegeben. Zwischen meinem Abflug aus der Schweiz am 31. März 2001 und meiner Rückkehr am 4. Juni 2001 liegen nicht nur viele Nächte im Zelt, sondern unzählige bereichernde Erfahrungen, großes Glück, neue Freundschaften und die Gewissheit, dass Mut nichts mit der Abwesenheit von Angst zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, diese zu erkennen, um sie zum eigenen Vorteil nutzen zu können.
Wäre der Mount Everest mit seinen 8850 Metern nicht der höchste Berg der Erde, wäre es dort oben ruhiger. Es lägen keine leeren Sauerstoffflaschen herum und kein Müll. Der Berg hätte seinen Frieden. Und die Sherpas und Yak-Männer hätten keine Arbeit.
Der Mount Everest wird am häufigsten über die Süd- und die Nordroute bestiegen. Die Südroute liegt in Nepal und ist – trotz der Mehrkosten – die beliebteste Variante, um zum Gipfelerfolg zu kommen. Sie birgt jedoch eine große Gefahr: den Khumbu-Gletscher, eine Eiswüste mit sich ständig verschiebenden Spalten und haushohen Eistürmen, die jederzeit zusammenbrechen können. Es sind die Sherpas, die diesen Gletscher überhaupt begehbar machen, da sie Jahr für Jahr neue Wege ins Eis schlagen und durch Fixseile und Leitern ein Vorwärtskommen überhaupt erst ermöglichen.
Die Route im Norden liegt in Tibet, ist ursprünglicher, alpinistischer und interessanterweise nicht so beliebt. Weshalb, das kann ich nur schwer erklären. Zugegeben, sie ist windiger und kälter als die Südroute, aber so eisig kalt ist sie nun auch wieder nicht. Der Wind hingegen ist ein Problem, immer Wind, ständig Wind, das ist sehr Energie raubend.
Die Nordroute birgt weniger Gefahren als die Südroute: keinen bedrohlichen Gletscher, keinen Eisschlag, keine Spalten und weniger Lawinen. Die Lawinengefahr besteht erst ab 8100 Metern und auch dann nur, wenn es viel Neuschnee gegeben hat. Die Route hat – wie könnte es anders sein – auch einen Nachteil: einen langen, flachen Grat. Er beginnt auf 8600 Metern. Um ihn meistern zu können, wird das letzte Biwak auf 8400 Metern errichtet. So hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Links und rechts dieses Grates wird man von einer unendlich scheinenden Tiefe begleitet. Auf der einen Seite bricht die Nordwand 2000 Meter gegen Tibet ab, auf der andern Seite die Ostwand 3000 Meter gegen Nepal. Man geht buchstäblich auf Messers Schneide. Auf den glatten Kalkplatten finden die Steigeisen keinen festen Halt, und man gewinnt kaum an Höhe. Auf 8600 Metern ist das äußerst kräftezehrend.
Meine Entscheidung für die Nordroute hing vor allem damit zusammen, dass ich mich der Expedition des Neuseeländers Russell Brice, der in Chamonix lebt, anschloss. Russell organisiert seine Expeditionen auf den Mount Everest immer von Norden her. Nie von Süden. Warum, weiß ich nicht, ich habe ihn nie danach gefragt. Aber seit ich selbst in Tibet war, kann ich es mir vorstellen. Tibet hat eine fesselnde Magie. Die Kultur des Landes, seine Menschen und seine Religion sind von einer unglaublichen Intensität. Das Land ist 2,5 Millionen Quadratkilometer groß und hat sechs Millionen tibetische Einwohner. Unter ihnen leben 7,5 Millionen Chinesen als Folge der Besetzung Tibets, die im Sommer 1949 durch die chinesische Volksbefreiungsarmee begann. Sie brachte weit über einer Million Tibetern den Tod und führte zur mutwilligen Zerstörung von mehr als 6000 Heiligtümern. Die Tibeter haben sich der Besatzungsmacht nicht gebeugt, haben die chinesischen Werte nicht übernommen, leben ihre Kultur und vor allem ihre Religion, den Buddhismus. Allen Repressionen und Demütigungen zum Trotz träumt das stolze Volk ihn noch immer, den Traum, eines Tages wieder autonom leben zu dürfen.
Es ist vielleicht die Geschichte Tibets, die Russell fasziniert und ihn immer wieder von Norden her an den Berg gehen lässt. Die Sherpas und Yak-Männer, die jedes Jahr für ihn arbeiten, nennt er liebevoll »meine Familie«.
Russell organisiert zum elften Mal eine Expedition zum Mount Everest, hat also eine langjährige Erfahrung, die Gold wert ist. Er ist ein Mensch mit einer Energie, die der von fünf Männern entspricht. Woher er sie nimmt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass er seit elf Jahren immer wieder nach Tibet reist, dass er immer wieder an den Fuß dieses gewaltigen Berges, in diese unendliche Ruhe zurückkehrt. Vielleicht ist es das, was ihn so stark macht.
Russell hat eine fixe Idee: Er möchte im Basislager am Fuß des Mount Everest eine Lodge samt Krankenstation bauen. Dieses Projekt ist unter Alpinisten und Naturschützern sehr umstritten, und seit ich die Pläne kenne, bin ich mit ihnen in einem Punkt einverstanden: Eine Lodge würde in diesem Gebiet eine touristische Entwicklung in Gang bringen, die wohl nur schwer zu bremsen wäre, denn die Chinesen träumen, das ist eine traurige Tatsache, vom großen Geld des Massentourismus. Eine Krankenstation hingegen würde helfen, Leben zu retten.
Russell ist 47 Jahre alt und hat Ähnlichkeiten mit einem »lonely wolf«, der in der freien Natur lebt, sich ab und zu gerne im Rudel aufhält, aber auch immer wieder Reißaus nimmt, um alleine durch die Gegend zu streifen. Russell hat die Berge gewählt, er hätte sich aber ebenso für die hohe See entscheiden und ein Seebär werden können. Die Verantwortung, die er sich immer wieder von neuem auf die Schultern lädt, ist für ihn Business. Damit verdient er sein Geld. Bei den elf Expeditionen, die er bisher am Mount Everest leitete, hatte er keinen einzigen Verlust zu beklagen.
Wie jedes Jahr hat er für sein Expeditionsteam die Logistik erledigt, all die nötigen Bewilligungen eingeholt, für professionelle Führer, Sherpas, Yak-Männer, Yaks, Zelte, Essen und für den besten Koch gesorgt. Kurz, er hat für seine Kunden eine Infrastruktur organisiert, die das Leben in dieser Höhe erleichtert.
Auch ich habe von dieser Infrastruktur profitiert. Zusammen mit meinem Kletterkollegen Robert Bösch. Bei einem Treffen mit Russell vor unserer Abreise besprachen wir das Vorgehen am Berg. Robert und ich würden die Hochlager von Russells Expedition benutzen können. Die Sherpas würden uns viele Lasten abnehmen und in die einzelnen Lager tragen. Aber die Entscheidungen am Berg würden Robert und ich autonom fällen. Russell erklärte sich damit einverstanden.
Robert Bösch ist ein sehr guter Alpinist und, wie ich, Bergführer. Wir kennen uns schon lange, haben manche Tour miteinander unternommen. Darüber hinaus ist er ein ausgezeichneter Fotograf, einer, der schon Bilder von mir machte, als mich noch fast niemand kannte. So auch bei einer Besteigung der Eigernordostwand und beim Durchklettern der Lancelot-Route in den Wendenstöcken. Es war nur logisch, dass ich meinen Sponsor darum bat, dass Robert mich begleiten dürfe, nicht nur, um mich für die Schweizer Medien zu fotografieren und für das Schweizer Fernsehen zu filmen. Nein, Robert und ich waren uns einig, dass oberhalb von 8000 Metern auch noch anderes auf ihn warten würde: Bilder von Schnee und Eis und Kälte. Von unendlicher, sich wölbender Weite. Von Tagen, an denen sich das Blau des Himmels im Eis spiegelt. Und von Nächten, deren tiefes Schwarz sich im Weiß der eisbedeckten Giganten bricht.
Bilder aus über 8000 Meter Höhe gibt es nur wenige, worüber ich mich allerdings nicht mehr wundere. Auf 8000 Metern betritt man einen neuen Raum, man nennt ihn die Todeszone. Kein Mensch überlebt diese Zone, wenn er sich darin zu lange aufhält, und jede zusätzliche Anstrengung wird zu einer extremen Belastung. Robert schleppte bei seinem Gipfelversuch die Fotoausrüstung mit, was das Ganze für ihn schwieriger machte. Auch konnte er durch das Fotografieren keinen eigenen Schritt-Rhythmus finden: stehen bleiben – auspacken – Handschuhe ausziehen – einen Meter nach rechts, einen nach links gehen, um die beste Einstellung zu finden – abdrücken – einpacken – Handschuhe wieder anziehen – weitergehen. In dieser Höhe eine ungeheure körperliche Anstrengung.
Als ich meinen Eltern bei einem gemeinsamen Abendessen mitteilte, ich wolle zum höchsten Punkt unserer Erde aufbrechen, wolle den Mount Everest besteigen und nähme das Risiko eines Scheiterns, wie auch immer dieses aussehen würde, in Kauf, schauten sie mich lange an. Und begannen schließlich, mich aufzuklären. Sie erklärten mir – der Bergführerin –, dass Menschen dort oben schwarze Füße kriegten und ebensolche Nasen, dass Kälte »amputieren« könne und dass ich meine Hände vielleicht nie mehr würde gebrauchen können wie heute. Das heißt, all dies sagte meine Mutter. Mein Vater schwieg.
Raymond Binsack, Vater
Als uns Evelyne von ihrem Vorhaben erzählte, auf den Mount Everest zu steigen, wusste ich sofort, auszureden war ihr dieses Ziel nicht. Sie war schon immer ein »Zwängigrind«, ein liebes zwar, aber auch eines, das ganz schön Nerven kostete. Natürlich fragte ich mich, ob der Everest tatsächlich sein müsse. Gleichzeitig aber wusste ich ja schon längst, dass man Evelyne nicht anbinden kann. Also habe ich auch gar nicht erst versucht, sie von ihrer Idee abzubringen. Und darum habe ich mir, als sie am Mount Everest war, auch nicht so viele Gedanken gemacht wie meine Frau.
Ich bin früher auch geklettert, besuchte im Militär sogar einige Hochgebirgskurse, mehr als ein Hobby war die Kletterei aber nie. So hoch hinaus wie Evelyne – das hat mich nie interessiert. Und als ich dann heiratete und die beiden Töchter auf der Welt waren, habe ich das Seil in eine Ecke gelegt. Ich wollte keine Risiken mehr eingehen, sondern meine Aufgabe als Familienvater wahrnehmen.
Rückblickend muss ich sagen, ich war ein strenger Vater, forderte viel von meinen Kindern, dachte immer: Später sind sie mir dankbar, dass sie eine Linie haben. Meine Philosophie, die ich zu vermitteln suchte, war: Tue recht und scheue niemand!
Früher überließen wir Männer es den Frauen, unsere Kinder zu trösten. Heute sind die Väter zärtlicher geworden, das finde ich schön.
Unsere ältere Tochter, Jacqueline, wurde Lehrerin, Evelyne wollte an die Sportschule Magglingen, um Sportlehrerin zu werden, warum das dann nicht geklappt hat, weiß ich nicht mehr. Sie hatte offensichtlich andere Pläne, lernte Sportartikelverkäuferin – wie gesagt, sie wusste sich durchzusetzen. Meine Frau hatte immer mehr Verständnis für sie als ich.
Nachdem Evelyne auf dem Mount Everest gestanden hatte, wurde ich von Journalisten immer wieder gefragt, ob ich stolz sei auf meine Tochter. Eine Frage, die mir nicht gefällt, das heißt, eigentlich gefällt mir nur dieses eine Wort nicht: stolz. Stolz bedeutet für mich »eingebildet sein«, »den Kopf zu hoch tragen«, »sich brüsten«, »mit hohlem Kreuz gehen«.
Lieber wäre mir die Frage gewesen, was ich an Evelyne schätze, dann hätte ich sagen können: ihre Aufrichtigkeit, ihre fröhliche Natur, ihr Vermögen, frisch von der Leber weg zu erzählen. Etwas, was ich nicht kann. Für all ihre Leistungen – nicht nur für die der Mount-Everest-Besteigung – empfinde ich aufrichtige Hochachtung.
Einmal führte Evelyne eine Gruppe auf eine Skitour und nahm uns Eltern mit. Die Tour ging über Gletscher und durch steiles Gelände, das mit etlichen Gletscherspalten durchsetzt war. Sie machte das richtig gut, so gut, dass ich nicht mal protestierte, als ich dachte, sie hätte den falschen Weg eingeschlagen. Halte dich zurück, sagte ich mir, so selbstsicher, wie sie hier auftritt, wird sie es schon richtig machen. Und tatsächlich, sie führte uns die 3000 Höhenmeter bestens hinunter.
Beeindruckt hat sie mich vollends, als wir mit ihr auf einen Helikopterflug durften. Als Pilotin erlebte ich sie als einen anderen Menschen. Ernst und hochkonzentriert, wenig mitteilsam. Ich fühlte mich absolut sicher. Und bekam erst dann ein flaues Gefühl im Magen, als sie ganz nah an verschiedenen Nordwänden vorbeiflog. Nicht, weil ich Angst gehabt hätte, sondern weil sie uns sagte, die meisten habe sie ohne Seil bestiegen.
Zuerst zeigte sie uns die kalten, abweisenden, grauen Nordwände des Rottalkessels, flog dann weiter zur Nordwand des Großen Fiescherhorns und verschonte uns auch nicht mit dem Anblick der Nordostwand des Eigers. Nichts als Schnee, Stein, Eis. In dieser Wand war meine Tochter geklettert? Ohne Sicherung! Ich schaute Evelyne von der Seite an. Sie sprach, bevor ich etwas sagen konnte. »Überwältigend, diese Flanke, nicht?«, fragte sie und sah dabei so entspannt und glücklich aus, dass ich nur nickte.
Die einzige schlaflose Nacht, die sie mir und meiner Frau mit ihrer Kletterei bescherte, war jene, als sie vor Jahren eine große Klettertour in den Ostalpen unternahm. Sie verabschiedete sich schon am Vorabend von uns, weil sie die Nacht in einer Hütte verbringen wollte, um am folgenden Tag in aller Frühe losgehen zu können. Der nächste Morgen begann strahlend schön, doch im Verlaufe des Nachmittags schlug das Wetter um. Es begann regelrecht zu gießen, und schon bald peitschte der aufkommende Sturm die Bäume. Abends um neun war Evelyne noch immer nicht zu Hause. Sie kam auch nicht um Mitternacht, und als morgens um sechs ihr Bett noch immer leer war, telefonierte ich mit der Rettungsflugwacht und meldete meine Tochter als vermisst.
Um nicht zu Hause rumhocken zu müssen, gingen meine Frau und ich in das Tal, zu dem Evelyne zwei Tage zuvor aufgebrochen war. Die Stunden, bis der Heli endlich landete und Evelyne, völlig erschöpft und durchfroren, ausstieg, möchte ich nie mehr erleben müssen. Wir nahmen sie in die Arme. Das heißt, nicht nur meine Frau nahm Evelyne in den Arm, auch ich. Ich drückte sie ganz fest. Damals hat sie wohl auch gemerkt, dass ich meine Gefühle für sie bis anhin gut versteckt hatte. Seither weiß sie, wie gern ich sie habe.
2Die Tibeter nennen den Mount Everest nicht Mount Everest, sondern Chomolungma. Übersetzt heißt das »Göttinmutter der Erde«. Es gibt jedoch auch die Übersetzung »Muttergöttin der Erde«, die mir persönlich besser gefällt. Wer auf ihrem Haupt stehen will, braucht Zeit. Viel, viel Zeit. Eine gute Akklimatisation dauert vier bis sechs Wochen und beginnt für uns schon in Lhasa, der tibetischen Hauptstadt, auch »die verbotene Stadt« genannt. Wir erreichen sie – nach einem Zwischenhalt in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals – am 2. April 2001. Meine Akklimatisation kann beginnen.
Lhasa heißt übersetzt »der Ort der Götter«. Es ist ein heiliger Platz, der auf 3600 Metern über dem Meer liegt. Höher, auf 3700 Metern, liegt nur noch La Paz in Bolivien. Die dünne sauerstoffarme und vor allem trockene Luft löst bei mir einen starken Husten aus. Ich ignoriere ihn, so gut es geht, schließlich will ich nicht das Bett hüten, sondern auf den Markt gehen, mit Menschen sprechen und das Symbol der tibetischen Eigenständigkeit besuchen: den »Potala«. Ein unglaublich beeindruckendes Bauwerk, das, seit Brad Pitt als Heinrich Harrer im Film »Seven Years in Tibet« auf seinen Stufen stand, neue Popularität erlangt hat. Der Palast liegt auf dem »Roten Hügel« und ist in seiner vollkommenen Schönheit schwer zu beschreiben. 130 000 Quadratmeter groß, 117 Meter hoch, gebaut aus Stein und Holz, mit über tausend Räumen, unzähligen Fresken und Statuen, erhebt er sich hoch über die Stadt. Der Potala gilt als die offizielle Residenz des religiösen und weltlichen Oberhauptes der Tibeter, des Dalai-Lama. Der vierzehnte Dalai-Lama lebt infolge der chinesischen Besetzung jedoch nicht im Potala in Lhasa, sondern im Exil im nordindischen Dharamsala.
Im Morgenlicht erstrahlt der Palast in seiner ganzen märchenhaften Mystik, die nicht in Worte zu fassen ist. Ich schöpfe hier neue Kräfte – die Heilung meines Hustens allerdings hole ich mir aus dem Medikamentenschrank. Es ist wichtig, ihn loszuwerden, bevor die Luft noch trockener wird. Das Antibiotikum macht mich müde, aber es hilft. Ich fühle mich sehr viel besser, als wir uns mit dem Jeep in Richtung Basislager aufmachen. Als wir das Dorf Tingri passieren, sehe ich sie zum ersten Mal, die Muttergöttin der Erde. Ich schaue sie lange an, frage mich, ob sie mich wohl mögen oder abweisen wird – ich spüre Zuversicht.
Am 9. April 2001 erreichen wir nach einer äußerst unangenehmen Fahrt über Geröll und Eis Rongbuk, das höchstgelegene Kloster der Welt. Nun trennen uns noch fünfzehn Minuten Jeepfahrt vom Basislager, das auf 5200 Metern liegt.
Endlich! Es ist ein schönes Gefühl, im Basislager anzukommen und nicht mehr fahren zu müssen. Ich stelle mein Zelt auf und richte mich so gut wie möglich häuslich ein.
Es ist kalt hier oben. Der Wind bläst unablässig, die Gegend ist äußerst karg, eine Steinwüste. Kein Blümchen, kein Grün, nur Grau. Und immer kalte Füße. Ich frage mich, was ich hier tue. Und doch würde ich um kein Geld der Welt von hier wegwollen.
Für Russells Team wurden sieben Tonnen Material ins Basislager geschleppt. Mannschaftszelt, Küchenzelt, Nahrungsmittel für zehn Wochen, Satellitentelefon, Sauerstoff, Computer. Wir sind nicht die Einzigen im Basislager. Ich bin erstaunt, wie viele Expeditionen hier sind. Wir treffen auf Gruppen aus Indien, Venezuela, Russland, Frankreich, Kolumbien, Asien, Schottland und Spanien; auf einen bunt gemischten Haufen also. Wir erfahren, dass eine amerikanische Expedition, unter der Leitung von Dave Hahn, bereits in Richtung Lager II unterwegs ist. Dave Hahn und seine Leute sind wieder auf der Suche nach Spuren der 1924 am Mount Everest verschollenen Engländer George Mallory und Andrew Irvine.
Wir bleiben, wo wir sind, auf 5200 Metern. Unsere Körper brauchen Zeit für die komplexen Vorgänge der Akklimatisation. Unter vielem anderem geht es dabei auch darum, die Zahl der roten Blutkörperchen zu erhöhen, die den Sauerstoff von den Lungen in alle Körperteile transportieren.
Die Rechnung ist einfach: Je mehr rote Blutkörperchen das Blut enthält, desto mehr Sauerstoff kann im Körper gebunden werden. Ein gesunder erwachsener Körper verfügt über rund 25 000 Milliarden rote Blutkörperchen. In einer Höhe von 4500 Metern erhöht sich dieser Wert um circa zehn Prozent. Es ist erstaunlich, welche Fähigkeiten der menschliche Organismus besitzt, um sich an veränderte Bedingungen anzupassen.
Ich fühle mich abhängig. Die Sherpas schleppen für uns das Material, mein Körper sorgt dafür, dass ich zu mehr Sauerstoff komme, nur ich – ich kann nicht mehr tun als abwarten. Und ab und zu mit den andern in unserem Mannschaftszelt sitzen, einen Whisky trinken, schwatzen, zuhören. Erfahren, wer schon wie viele Male am Mount Everest war und wer schon wie oft gescheitert ist. Immerhin würde ich in zwei Tagen damit beginnen können, auf die umliegenden Sechstausender zu steigen, um mich an die dünne Luft zu gewöhnen.
Trotzdem ist die Akklimatisation eine Verbannung ins Nichtstun. Es ist schwer auszuhalten und erinnert mich an meine Schulzeit, als ich vor lauter Energie, die ich nicht zu kanalisieren wusste, immer überbordete. Keine Rauferei auf dem Pausenplatz, bei der nicht mindestens mein freches Mundwerk mit im Spiel gewesen wäre. Und im Schulzimmer interessierte mich das, was hinter oder neben mir geschah, viel mehr als das, was vorne, an der Wandtafel, erzählt wurde. Ich war unruhig. Eine Stunde still zu sitzen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war nervig, und höchstwahrscheinlich war ich hyperaktiv. Dass all dies nicht nur für Lehrer und Eltern schwierig, sondern dass meine überschäumende Energie auch für mich selbst ein Problem war, das realisierte ich erst viel später.
Mein Körper allerdings reagierte schon früh. Auf einer unserer unzähligen sonntäglichen Familienwanderungen startete er durch. Mutter, Vater und Schwester gingen den Berg hinauf – ich jedoch, ich rannte. Das kam ganz plötzlich, ohne äußeren Anlass, aus einem inneren Antrieb heraus. Ich rannte und rannte, wurde nicht müde, rannte weiter. Und als ich oben war, fühlte ich mich ausgepumpt und vollkommen glücklich. Von da an rannte ich, wenn die andern wanderten. War ich oben angekommen, wartete ich.
Als ich ungefähr dreizehn war, wurde ich von Remo Zberg, dem Leiter des Turnvereins Hergiswil, gefragt, ob ich nicht in seinem Verein mitmachen wolle. Ich wollte. Und wie. Remo war der Leichtathletik sehr zugetan, war ein guter Läufer und verwandelte den Hergiswiler Turnverein bald schon in einen regional erfolgreichen Leichtathletik-Club.
Ich entschied mich für die Mittelstrecke, lief 800 Meter, und zwar so, dass ich im Ziel jeweils glaubte, sterben zu müssen. Das Rennen selbst war nicht sehr anstrengend, aber der Zieleinlauf überstieg das Erträgliche. Ich war jeweils einer Ohnmacht nahe, alles schmerzte, meine Muskeln waren total übersäuert, ich meinte, erbrechen zu müssen.
Nach mir traten noch zwei Mädchen in den Club ein, die Jungs akzeptierten uns. Ich fühlte mich aufgehoben, fand Kollegen, mit denen ich nicht nur in der Freizeit viel unternahm, sondern mit denen ich mich auch messen konnte. Nicht in sinnlosen Raufereien, sondern auf der Tartanbahn.
Remo Zberg war ein guter Trainer, voller Enthusiasmus und mit einer unglaublichen Fähigkeit, uns die Freude am Laufen zu vermitteln.
Um Schnelligkeit zu üben, rannten wir bergab. Auf einer Asphaltstraße. 200 Meter. Unten angekommen, joggten wir wieder hinauf. Das machten wir zwanzig Mal hintereinander. Immer mit dem einen Ziel, dass der letzte der zwanzig Läufe nicht langsamer war als der erste. Drill. Aber einer, der mir entsprach. Ich war das absolute Trainingstier. Endlich konnte ich meine Energie kanalisieren. Vier Jahre lang gab ich mein Bestes, nein, ich gab alles. Mehr noch, ich gab zu viel. Kriegte eine Knochenhautentzündung samt Achillessehnenentzündung und stieg am Morgen aus dem Bett wie eine sehr, sehr alte Frau, dabei war ich gerade mal achtzehn Jahre jung. Ich hatte Wasser in den Beinen, die Füße schmerzten, es vergingen Minuten, bis ich, ohne zu hinken, gehen konnte. Aber aufhören, das wollte ich auf keinen Fall. Unmöglich. Denn ohne Laufen war sie wieder da, die Unruhe.
Ich hatte damals einen Kollegen, der ruderte. Und zwar so gut, dass er an der Olympiade teilnehmen durfte. Neben dem Training arbeitete er als Schreiner. Seine Tage waren ausgefüllt mit Ausdauertraining, Rudertraining und Geldverdienen. Außer montags, da arbeitete er ausschließlich in der Schreinerei, machte nicht das geringste Training, sondern ruhte sich aus. Ich begriff nicht, wie man einen Tag durchstehen konnte, ohne körperlich etwas zu tun.
Auch heute fühle ich mich erst dann richtig wohl, wenn ich physisch ausgepumpt bin. Dann habe ich die Ameisen – die roten, nicht die schwarzen –, die mir durch Arme und Beine kribbeln, unter Kontrolle. Ohne »Auslauf« werde ich unausstehlich. Das ist wie bei einem Schlittenhund. Sperrt man den Husky einen Tag lang ein, kann man ihn am nächsten Tag nicht mehr bremsen. Zwei Tage hintereinander kein Auslauf, und er verliert das Feuer in den Augen. Dass ich mein Feuer behalten konnte, verdanke ich unter anderem Remo Zberg, der mir nicht nur Lauftechnik vermittelte, sondern auch die Philosophie des Laufens.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er gab mir noch mehr. Er war für mich – ohne es zu wissen – ein Fallschirm. Seine Frage, ob ich im Verein mitmachen wolle, bedeutete mir unendlich viel. Ich wurde wahrgenommen. Da war einer, der glaubte, dass ich etwas leisten konnte.
Wäre Remo Zberg nicht gewesen, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Ich war damals in einer unglaublich schwierigen Phase. Hochpubertär, wie ich war, wollte ich alles sein, bloß eines nicht: angepasst. Ich wollte nicht so ernsthaft, pflichtbewusst, organisiert und verplant sein wie die Erwachsenen. Ich wollte frei sein. Und frei sein bedeutete für mich nächtelang mit älteren Kollegen in dunklen Schuppen herumhängen, rauchen, trinken und Spielsalons aufsuchen. Letzteres war das Faszinierendste, weil ich – gerade mal dreizehn Jahre alt – dank meiner Größe überall problemlos reinkam. Meinen Eltern log ich in dieser Zeit das Blaue vom Himmel herunter. Und wurde dabei nicht mal rot. Sie glaubten, ich verbringe die Abende bei Freundinnen, um für die Schule zu lernen. Remo Zberg schenkte mir in einer Zeit der Orientierungslosigkeit nicht nur Vertrauen in mich selbst, er eröffnete mir auch Perspektiven und gab mir das Wichtigste überhaupt: Ziele.
Remo Zberg, Leichtathletik-Trainer
Evelyne fiel mir im Schulsport auf. Ein Mädchen, das immer in Bewegung war, selbst dann, wenn es nichts tat. Evelyne war die Unruhe selbst und darüber hinaus ein aufgestelltes, immer fröhliches Wesen, dessen Lachen aus dem Innersten kam. Sie war ein Mädchen, das man einfach gern haben musste. Ich hatte das Gefühl, sie passe in unseren Verein, und fragte sie, ob sie bei uns mitmachen wolle. Sie wollte. Und wie.
Ich hatte weder vorher noch nachher ein solch talentiertes junges Mädchen unter meinen Fittichen, keines, das so diszipliniert und trainingseifrig war wie sie. Evelyne war – zumindest anfangs – absolut unproblematisch und für ihr Alter von einer geradezu bemerkenswerten Zuverlässigkeit. Und erst noch äußerst kollegial.
Mit ihren Leistungen war sie nie zufrieden. Immer orientierte sie sich nach oben, wollte besser werden, wollte so gut sein wie die älteren Läuferinnen in der Elite.
Ich erkannte bald, dass sie keine explosive, schnell kräftige Athletin war, sondern eine, deren Stärke in der Ausdauer lag. Sie war die geborene Langstreckenläuferin, doch mit ihren dreizehn Jahren war sie dafür noch zu jung. Also trainierte ich sie auf der Mittelstrecke, auf 800, 1000 und 1500 Metern. Schließlich musste sie zuerst eine gewisse Schnelligkeitsbasis entwickeln.
Bald schon brillierte sie in ihrer Alterskategorie bei den Schweizer Meisterschaften und wurde – über 1500 Meter – sogar mal Fünfte. Ich bin mir sicher, ihr Potenzial hätte gereicht, um in die Weltspitze vorzudringen.
Sie setzte die Techniken, die ich ihr beibrachte, schnell um und begriff bereits in jungen Jahren, dass Leistung im Kopf beginnt. Allein mit Körperkraft und Ausdauer ist im Sport noch keiner groß geworden, der Geist, das Wollen, das Sich-zurücknehmen-Können in die Ruhe, kurz, das Mentale spielt eine sehr große Rolle. Man kann es auch anders ausdrücken: Einen langfristigen Erfolg haben nur Sportler, deren Geist und Körper harmonieren. Und das taten sie bei Evelyne von Anfang an. Dass aus ihr trotz dieser Voraussetzungen keine erfolgreiche Läuferin geworden ist, ist einzig und allein ihrem Bewegungsdrang zuzuschreiben. So seltsam es klingt, sie trainierte ganz einfach zu viel.
Evelyne genügte das Training, das ich für sie ausgearbeitet hatte, bald nicht mehr. Sie hielt keine Ruhepausen ein und machte mir dauernd Striche durch die Rechnung. Kaum hatte sie eine freie Minute, rannte sie auf alle möglichen und unmöglichen Berge, und zwar in einem, selbst für mich, Schwindel erregenden Tempo. Und weil ihr das noch immer nicht genügte, fuhr sie zusätzlich mit dem Bike.
Später, in der Lehre, die sie in Engelberg absolvierte, fuhr sie mit dem Fahrrad jeden Abend von Engelberg nach Hergiswil. Immerhin 26 Kilometer. Als ich ihr dies als »definitiv zu viel des Guten« ausreden wollte, erklärte sie, sie verzichte nicht auf diese Fahrten, schließlich sei sie mit dem Rennvelo schneller zu Hause als mit dem Zug. In der Lehre begann sie auch, im Winter exzessiv Ski zu fahren und im Sommer zu klettern. All das hat nicht dazu beigetragen, dass sie in der Mittelstrecke schneller geworden wäre. Falsches Training, weil unkontrolliert. Ihr Körper reagierte entsprechend, machte Entzündungen. Sie litt unter starken Schmerzen – doch nicht mal diese konnten sie bremsen.
1986 hatte ich genug davon, ich stellte sie vor die Entscheidung. Entweder sie trainiere wie eine Leichtathletin und würde eine Topsportlerin auf der Langstrecke, oder sie tue weiterhin, was sie wolle, und suche ihr Glück woanders.
Evelyne entschied sich für den Alpinismus, und ich versuchte, ihr meine Enttäuschung nicht allzu sehr zu zeigen. Ich wusste damals längst, dass sie ihren Weg gehen würde.
Jahre später, sie hatte bereits das Bergführerinnenpatent in der Tasche, organisierte der Schulrat Hergiswil einen Kletter-Event und fragte sie, ob sie uns an der Kletterwand betreuen würde. Als wir ein paar Wochen später wie die Fliegen an der Wand klebten, holte sie das Letzte aus uns heraus. Sie begeisterte alle. Ohne Ausnahme. Frauen genauso wie Männer.
Evelyne wurde zwar keine Spitzenläuferin, eine Ausnahmeerscheinung ist sie auf jeden Fall geblieben. Ihr Charisma ist einzigartig.
3Russells