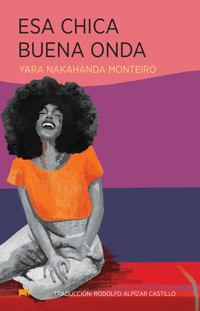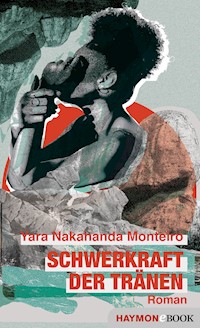
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Angola und Portugal, zwischen Rebellion und Tragödie findet ein Bruch statt – einer, der eine neue Welt eröffnet, der zeigt, was uns ausmacht. Die intimste Wahrheit ist diese: Vitória kann ihre Mutter nicht für sich beanspruchen. 1965. Angola. Der Freiheitskrieg gegen die portugiesische Vorherrschaft nimmt seinen Lauf. Mittendrin: Rosa Chitula und ihre Familie. Viele suchen Sicherheit und Stabilität in Lissabon, verlassen das Land. Doch Rosa rebelliert, will kämpfen – und wird das Gesicht der Unabhängigkeitsbewegung. Die zweijährige Vitória, Rosas Tochter, flieht mit ihren Großeltern nach Portugal und dann – nichts. Ein Schnitt, der nicht heilen wird. 2003. Lissabon. Vitória Queiroz da Fonsecas Leben besteht aus Erinnerungen: Da sind Bilder, Gerüche, der Geschmack von Sauermilch. Da sind die Säulen eines Traumas, das Vitória nicht überwinden kann: zu wissen, dass ihre Mutter ein Land mehr liebte als ihre Tochter. Denn wie damit umgehen, wenn da niemand ist, der Antworten auf die eigenen Fragen geben kann ... Wie sieht das Leben aus, wenn man in einen Kampf um Freiheit hineingeboren wird, der nicht der eigene ist? Wie verstehen, dass die Geschichte übermächtig geworden ist, sich hineingedrängt hat zwischen sich selbst und die Möglichkeiten, die man vielleicht gehabt hätte? Vitória kennt ihre Mutter nicht, kennt ihren Kampf nicht. Aber sie trägt die Revolte in sich, genauso wie Rosa. Sie lässt Lissabon, ihren Verlobten und Job hinter sich, getrieben von dem Drang, sich selbst zu begegnen. Doch das Luanda des 21. Jahrhunderts besteht aus Kontrasten, ist abweisend und Heimat zugleich. Hier gehören die Menschen einem Land, das nicht immer das ihre war, das nicht immer das ihre ist. Als Vitória in Huambo die Einzigartigkeit von Angola entdeckt, sich selbst auf der Spur, trifft sie auf die Geister einer fremden Vergangenheit und muss lernen, dass es Risse gibt, die zu tief sind, um noch geflickt zu werden. Wir schreiben Formen der Gewalt. In einer klaren Sprache erzählt Yara Monteiro von der Gewalt der Geschichte. Einer Gewalt, die wir spüren, aber nicht aufhalten können. Die vergangen ist, aber für immer bestehen bleiben wird. Wie fühlt es sich an, nach Wurzeln zu greifen, ohne zu wissen, ob man sie fest im Boden verankern oder ausreißen will? Und was bedeutet Freiheit, wenn sie alles ist und gleichzeitig nicht das, was wir für uns gefordert haben? Ein Debüt, das fesselt: kompromisslos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yara Nakahanda Monteiro
Schwerkraft der Tränen
Roman
Meiner Ururgroßmutter Nakahanda,
meiner Urgroßmutter Feliciana,
meiner Großmutter Júlia,
meiner Mutter,
meiner Tante Wanda.
Meinem Großvater Fernando Garcia,
meinem Vater
und meinem Mann.
Das Schicksal hat es mit mir übertrieben. Es hat mich ganz durcheinandergebracht.
Es hat mich hierher verpflanzt und von hier weggerissen.
Und nie mehr konnten mich Wurzeln in einem Land halten.
Miguel Torga – Diário – Bd. XIII bis XVI,
1
Das Erste, an das ich mich erinnere, ist ein Baum; dann eine Welle. Ohne Schatten zu werfen, schwebe ich zwischen den Wurzeln hindurch, die den Meeresgrund halten. Davor gab es mich nicht und es gibt mich auch nicht darüber hinaus. Bilder, die in meine Träume einbrechen und mich aus dem Schlaf schrecken lassen.
Manchmal kommt auch ein intensiver Geruch nach saurer Milch auf. Und der salzige Geschmack von Schweiß haftet auf meiner Zunge. Ein Teil von mir findet sich damit ab, der andere will es nicht dabei belassen, dass diese Leere alles ist, das mir als Erinnerung an meine Mutter geblieben ist. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht einmal wirklich Anspruch auf sie. Mehr als mich hat sie, meine Mutter, Rosa Chitula, Angola geliebt, ist für ihr Land in den Kampf gezogen. Ich heiße Vitória Queiroz da Fonseca. Ich bin eine Frau. Ich bin Schwarz.
2
Die erstgeborene Tochter von Elisa Valente Pacheco Queiroz da Fonseca und António Queiroz da Fonseca kam am 31. März 1944 zur Welt. Zu Ehren der Mütter ihrer beiden Großväter wurde sie auf den Namen Rosa Chitula getauft.
Von Anfang an stur, kam meine Mutter nicht mit Disziplin klar und flog wegen Aufsässigkeit von der Nonnenschule in Silva Porto. Großvater António sah, dass sie nicht einfach sein würde und zu seinem Leidwesen nicht das geringste Interesse an Familie und Haushalt entwickelte. Je mehr er versuchte, sie in diese Richtung zu lenken, desto mehr widersetzte sie sich. Irgendwann gab er es auf.
Um sie trotzdem im Auge zu haben, nahm er Mutter mit auf die Kaffeeplantage, zum Vieh, ins Geschäft. In der Zeit entstand zwischen ihnen eine enge Vertrautheit und Nähe.
Nach und nach übertrug Großvater seiner Tochter einiges an Verantwortung im Geschäft. Bald hatte sie auch die Oberaufsicht über die Arbeiter, die zwar wohl nicht den vom Großvater erhofften Respekt vor ihr hatten, dafür aber Angst vor der Waffe, die sie gut sichtbar trug. Ihre Art, sich zu kleiden und das Haar unter dem Hut zu verstecken, verbarg ihre feinen Gesichtszüge. Sie wirkte oft mehr wie ein kerniger Bursche. Sogar Großvater fiel manchmal darauf herein.
Die Zeit verging und bestätigte ihn darin, dass es richtig gewesen war, seine Tochter in die Belange der Landwirtschaft einzuweihen. Jedenfalls glaubte er das, bis sich Anfang der Sechzigerjahre die Stimmung im Land zuspitzte.
In Luanda stachelten aufständische Gruppen die einheimische Bevölkerung zur Revolte auf. Trotz anfänglicher Versuche der Zentralregierung, keine Gerüchte aufkommen zu lassen, verbreitete sich die Nachricht so schnell wie der Lauf der Gazellen im ganzen Land. Großvater António betrachtete sich als assimiliert und in erster Linie als Portugiese. Im Zusammenbruch des Nationalismus sah er einen hinterhältigen Angriff auf die bewährte Kolonialordnung. Dass sich Portugal schließlich ganz aus der Sache heraushielt, erstaunte ihn. Für ihn war man dort schlicht nicht mehr in der Lage, mit der furchtbaren Situation, die entstanden war, umzugehen.
Meine Mutter Rosa, schon immer freiheitsliebend, rebellisch und gegen jede Form von Unterdrückung, bestärkte dies in ihrer Auflehnung gegen den Imperialismus, erst recht als Radio und Zeitungen damit aufhörten, Plünderungen, Vergewaltigungen, Entführungen und die zunehmenden Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen zu verschweigen.
Einmal konfrontierte sie ihren Vater beim Abendessen mit der geringen Bezahlung seiner afrikanischen Arbeitskräfte.
„Was wollen denn diese Schwarzen mit ihren kommunistischen Ideen?“, brüllte Großvater António drohend und schlug mit der Faust auf den Tisch.
Damit war das Gespräch beendet, Großvater aber war gewarnt.
Wer sucht, findet auch. Nur einen winzigen Schritt brauchte es, bis Großvater schließlich alles herausbekam. Eines Morgens blieb er entgegen seiner Gewohnheit zu Hause, ohne jemandem etwas zu sagen, und fand unter der Matratze der Tochter die Flugblätter, die er, nachdem er sie ihrer Mutter gezeigt und ihr alle Schuld an Rosas ungebührlicher Einstellung gegeben hatte, vernichtete. Auseinandersetzungen wollte er wenn es ging vermeiden und sagte zu Rosa kein Wort.
Denn tatsächlich macht Liebe meist etwas kurzsichtig und Großvater versuchte, das Verhalten seiner Tochter so lange nicht wahrzunehmen, bis es schließlich Gesprächsthema war am Kaffeetisch im Klub.
„Niemand hat bisher etwas unternommen, denn sie ist Ihre Tochter. Aber irgendwann wird man nicht anders können“, warnte man ihn.
So war die Familienangelegenheit zu einer Schmach in der Öffentlichkeit geworden und fortan behielt Caculeto, Großvaters treuer Gefolgsmann, meine Mutter im Auge. Da war es allerdings lange zu spät.
Noch in derselben Woche, am Samstag, klopfte Caculeto an Großvaters Tür, Großvater saß gerade vor einem Teller pirão mit Pilzen, und verlangte, dringend mit ihm zu sprechen. Er hatte unter dem Arm etwas, das aussah wie eine Zeitung. An der Aufregung seines Vorarbeiters erkannte Großvater, wie wichtig und unaufschiebbar ihm die Sache war. Er schob seinen Teller beiseite und bat Caculeto herein. Dieser blieb allerdings, um seinen Chef nicht zu überrumpeln, in der Tür stehen, faltete die Zeitung auf Seite acht auseinander und las erst nervös die in großen Lettern gedruckte Überschrift vor: „Friedliche Kundgebung gegen das Kolonialregime“. Er wollte weiter vorlesen, den ganzen Text, da war Großvater schon aufgesprungen und verlangte:
„Gib her, ich kann selber lesen!“
Der Schock brachte Unruhe in die Gedanken des Patriarchen. Unter der Überschrift prangte ein Bild von der Demonstration. Meine Mutter, seine Tochter, war da in vorderster Reihe zu sehen, in der Hand ein Plakat mit der Losung „Angola den Angolanern“.
„Die Tochter des assimilado als Aushängeschild der Revolte“, befand der Großvater. Diese Niedertracht machte ihn blind vor Wut. Er war noch nicht an der Haustür, da hatte er schon seinen Hosengurt in der Hand. Großmutter und die Tanten versuchten vergeblich, ihn aufzuhalten.
Am selben Tag, nach der Tracht Prügel, verschwand meine Mutter. Sie kam nicht wieder und Großvater ließ auch nicht nach ihr suchen.
Ein paar Monate später brach der Kolonialkrieg aus. Der Widerstandsbewegung in der Stadt war es gelungen, Milizen im ganzen Land aufzubauen, und die Barbarei zwischen Schwarzen und Europäischstämmigen nahm ihren Lauf: Es rollten Köpfe, Frauen wurde der Bauch aufgeschlitzt, Kinder wurden verstümmelt. Wer sich dem Aufstand nicht anschließen wollte, wurde niedergemetzelt.
Noch vor der Regenzeit floh meine Familie mit allen Hausangestellten aus Silva Porto. Zurück blieben die Pflanzungen, die verbrannt wurden, die sich selbst überlassenen Tiere, und alles, was sich nicht mitnehmen ließ.
Kaum in Nova Lisboa, dem heutigen Huambo, traf sich Großvater mit dem Gouverneur und anderen assimilierten Landbesitzern und Geschäftsleuten. Man war sich einig: Die Lunte des Krieges brannte. Alle fürchteten um ihr Leben und Eigentum. Aus der Hauptstadt Luanda waren schon ganze Familien nach Lissabon abgereist. Großvater António glaubte dennoch das Glück weiter auf seiner Seite und entschloss sich, seine Geschäfte und das Fuhrunternehmen, das er in Nova Lisboa besaß, zunächst nicht aufzugeben.
Es gelang ihm, aus seiner misslichen Lage Kapital zu schlagen und mit beiden Konfliktparteien zusammenzuarbeiten. So konnte es weitergehen, solange die Vorsehung sein Geheimnis nicht preisgab. Seine nicht eindeutige Hautfarbe hatte ihn in eine Zwischenwelt katapultiert. Für die einen war er nicht schwarz genug, für die anderen hätte er weißer sein müssen. Er verehrte die Portugiesen, gegen die anderen hatte er auch nichts. Es gab Weiße und Schwarze, die ihn ehrfurchtsvoll grüßten.
3
Mehr als fünfzehn Jahre lang blieb Mutter weg. Als sie wieder auftauchte, übergab sie mich meinen Großeltern. Ich war noch keine zwei Jahre alt. Danach habe ich nie mehr von ihr gehört.
Am 1. August 1980 verbringt mein Großvater die Nacht schlaflos in seinem Büro. Er schreibt letzte Anweisungen nieder, zum Umgang mit allem, was ihm an Besitz noch geblieben ist.
Auf liniertem Papier verfasst er mit Durchschlag in zweifacher Ausfertigung eine Vollmacht. Das Haupthaus, den Grundbesitz, die Geschäfte, die Lastwagenflotte überlässt er dem Schicksal. Gemeint ist damit die entgeltlose Nutzung aller Güter der Queiroz da Fonseca durch Caculeto, seine rechte Hand seit Silva Porto. „Kümmere dich gut darum – bis auf Weiteres“, schließt er. Das ist alles, was er von Caculeto als Gegenleistung erwartet.
Die militärischen Auseinandersetzungen im Hochland hatten an Intensität zugenommen und mit der Bombardierung des wichtigsten Zwischenpostens hatte sich die Knappheit an Lebensmitteln und Treibstoff zum dramatischen Mangel gesteigert. Nicht einmal die Verbindungen meines Großvaters in höchste Kreise des Militärs hatten es ihm ermöglicht, die Vorräte so weit aufzufüllen, dass sie für die Versorgung der Familie gereicht hätten. Meiner Großmutter Elisa gegenüber klagte er, man ernähre sich nur noch vom „Staub des Krieges“.
Die Hoffnung, dass Rosa zurückkommen würde, war längst vergeblich, vielleicht sogar lebensgefährlich geworden. Die Gewehrschüsse auf die Schaufenster seines Geschäfts vor gerade einmal acht Tagen hallten Großvater noch in den Ohren. Resigniert fügte er sich in die Einsicht, dass Gefühle für undankbar gewordenes Fleisch und Blut nun dem Umzug der Familie nach Lissabon nicht mehr im Weg stehen durften. Sollte ihm etwas zustoßen, hätte Elisa niemanden mehr. Fünf Jahre nach Ausbruch des Bürgerkriegs waren die wenigen nahen Bekannten, die sie überhaupt noch in Angola hatten, längst in die Hauptstadt Luanda geflohen.
Wie er es sich an eiskalten, frühen Augustmorgen zur Gewohnheit gemacht hatte, öffnet Großvater das Bürofenster. Er sieht gern den dichten Nebel des cacimbo hereinziehen und sich mit dem Zigarettenrauch mischen, den er in die Luft bläst.
„Eine Unverschämtheit!“, ruft er empört aus. „Ich mache, was ich will, und nicht, was andere von mir verlangen. Ich mache nicht, was andere von mir verlangen“, wiederholt er noch drei Mal mit kräftiger Stimme und spürt, wie sich vor Wut seine Muskeln verhärten. Immerhin, seinen Stolz haben die Schüsse ihm nicht nehmen können.
„Das ist eine Kampfansage. Diese Hurensöhne. Wofür halten sie sich?!“, fragt er, ohne darauf eine Antwort zu finden.
Mühsam setzt er sich wieder hin und sagt nichts mehr.
Mit seiner eckigen großen Hand streicht er sich über den Bart, drückt befangen den rechten Daumen aufs Kinn und kneift die Augen zu. Gleichzeitig drückt er mit dem Zeigefinger gegen den Steg seiner Hornbrille mit den großen Gläsern. Der Finger versucht – als sei dies irgendwie möglich – auf die Schwerkraft der Tränen zu wirken, die ihm nun übers Gesicht fließen. Er zieht ein Taschentuch aus der Hosentasche, wischt sich die Augen trocken. Dann versucht er, ebenfalls mit dem Taschentuch, die blauen Farbspuren vom Durchschlagpapier von seiner Hand zu entfernen.
Nach und nach wird er ruhiger. Er bleibt kurz still auf dem Stuhl sitzen, die Augen starr auf den Standaschenbecher gerichtet. Kippen der Marke AC, halb geraucht, liegen darin zwischen der Asche verbrannter Papiere. Er greift nach dem Benzinfeuerzeug, klappt es auf, dreht mit dem Finger das Zahnrad über dem Feuerstein, richtet die Flamme noch einmal auf den Teil der vertraulichen Unterlagen, der sich bis dahin noch geweigert hatte zu verbrennen. Als alles zu Asche geworden ist, nimmt er einen letzten Schluck aus dem Whiskyglas und wischt über den Schreibtisch.
„Gleich geht es los“, denkt er mit einem Blick auf die Uhr. Es ist zwanzig vor sieben. Die nächtliche Ausgangssperre ist schon vorbei.
Er steckt das Feuerzeug, die Zigaretten, den Füllfederhalter in seine linke Hemdtasche. Dann schließt er das Fenster, nimmt seine Aktentasche und sein Magnum-Gewehr. Er steckt den Schlüssel von außen ins Schloss der Bürotür und lässt ihn dort stecken.
Durch die Stille im Haus hallt sein militärischer Schritt noch lauter. Als er das große Zimmer betritt, packt dort Großmutter Elisa gerade die letzten Sachen ein. Großvater hat den Eindruck, sie habe abgenommen; mager ist sie wie ein Kleiderhaken. In den siebenunddreißig Jahren, in denen sie jetzt verheiratet sind, sieht er Elisa zum ersten Mal ohne Ehering. Er sagt nichts. Es ist nicht der Augenblick für Empfindlichkeiten.
„Liebe Elisa, in zehn Minuten müssen alle beim Jeep sein“, befiehlt er und schlägt die Tür wieder zu.
Als Großmutter mit mir und ihren Töchtern, meinen Tanten, beim Jeep ist, stehen die Koffer schon da, alle warten in ihren Autos. Wir sollen eskortiert werden, von acht Männern in drei Geländewagen.
Dass alles so lange braucht, liegt an den Schatten, die uns verfolgen. Es sind Dona Bia, Hermínia und Cândida. Sie gehen hinter uns, den Kopf tief auf die Brust gesenkt, mit erhobenen Armen, die Handflächen offen zum Himmel. Sie weinen und stimmen ein trauriges Singen an. Sie hoffen noch auf ein Wunder.
In einer letzten Umarmung zum Abschied wechseln Arme die Körper, Gesichter die Augen und wiederum diese die Seele.
Trotz aller gut gemeinten Beteuerungen meines Großvaters ist den Frauen klar, dass es kein Wiedersehen geben wird. Man nimmt nur mit, was man auch tragen kann. Dona Bia, Hermínia und Cândida wären Übergepäck für die Queiroz da Fonseca. Auf dem Aufbruch unserer Familie lastet der Tod derer, die uns das Leben gaben und die wir zurückließen.
Großvaters capangas hatten vereinbart, die Fahrzeugkolonne über Schneisen abseits der großen Straßen zu führen, um Hinterhalte und die gefürchteten Claymore-Antipersonenminen zu meiden. Als wir schon unterwegs sind, kommt von Großvater über das Funkgerät und zum Erstaunen aller die Anweisung, auf die Hauptstraße einzubiegen.
„Wir fahren ins Dorf des soba“, sagt er und alle wundern sich. Seine Anweisung nicht zu befolgen oder nach Gründen zu fragen wagt niemand.
Je näher wir dem Dorf kommen, desto deutlicher wird, dass das offensichtlichste Zeichen des Krieges die Stille ist, die sich über alles gelegt hat. Selbst das trockene Gras rechts und links der Straße hält den Atem an.
Im Auto bleibt hartnäckig nur mein Weinen zu hören. Mit weit aufgerissenem Mund schüttelt mein Kopf hin und her, sucht vergeblich nach Hermínias Ammenbrust. Meine Tanten und Großmutter versuchen, mich zu beruhigen, meine Verzweiflung bringen sie nicht zum Verstummen. Hermínia und ihre Brust sind nicht mitgekommen.
Es ist zwanzig nach acht. Der Morgennebel hat sich um diese Zeit schon verzogen. In der Ferne sieht man, was von dem mächtigen Afrikanischen Feigenbaum, der mulemba, des soba noch übrig ist. Das einst üppige grüne Blätterdach ist nur noch eine dürre Krone.
„Der Krieg verschlingt unsere Würde, lange bevor wir ihn selbst spüren“, denkt António mit Blick auf den Baum.
Großvater steigt als Erster aus dem Geländewagen. Er macht den Kofferraum auf und zieht einen schweren Leinensack heraus. Er sagt uns, wir sollten ebenfalls aussteigen und mit ihm kommen. Großmutter, Tante Francisca und Isaltina gehorchen. Caculeto will eifrig – „Die Damen sind bei mir sicher“ – mitkommen, das Schießgewehr in der Hand, aber Großvaters Zeigefinger malt augenblicklich eine Art Kreis in die Luft. Caculeto versteht die einfache Geste – „Wer hat gesagt, dass du etwas tun sollst?“ –, macht kehrt und setzt sich wieder hinters Steuer.
Soba Katimba kommt seinem Freund lächelnd entgegen. Noch bevor er Großvater mit einer Umarmung begrüßt, verleiht er seiner Freude Ausdruck:
„Oh kizua kia kufua kimoxi.“
Großvater erwidert das Sprichwort:
„Man stirbt nur an einem Tag, zwei Mal stirbt niemand.“
Sie umarmen sich und küssen sich rechts und links auf die Wange.
„Diese cabíris werden getötet“, versichert der soba.
„Ich bin wie das Kudu, die Antilope. So schnell kriegen sie mich nicht.“, erklärt Großvater.
Mein Schreien wird lauter und nun auch von wildem Gestrampel begleitet.
„Das Kind will die Erde spüren“, sagt Katimba und deutet auf den Boden.
Es stimmt. Kaum hat man mich ins Gras gesetzt, höre ich auf zu weinen.
Katimba blickt voraus und sieht Widrigkeiten auf seinen Freund zukommen:
„Die Tochter gerät nach der Mutter …“, knurrt er mit zusammengebissenen Zähnen und meint mich.
Nach ausgiebiger Begrüßung begeben sich Großvater und Katimba unter den Feigenbaum. Der massive Ebenholzstuhl des soba steht nicht mehr da. Auch keine Sitzgelegenheiten mehr für die Besucher.
Großvater geht wie Katimba in die Hocke und lehnt sich gegen den Stamm des mulemba.
Diesmal geht es bei seinem Besuch nicht um die übliche Schachpartie mit dem soba.
„Haka!“, ruft Katimba aus und setzt sich nun ganz auf den Boden. „Es ist so ermüdend“, fährt er mit seinem Lamento fort. „Kinder von unterschiedlichen Vätern, aber doch aus dem gleichen Bauch. Sie kämpfen gegeneinander, vergewaltigen ihre Schwestern. Versorgen die Nichten und Neffen mit Waffen. Wir sind verhext worden, haka!“
Großvater weiß nicht, was er antworten soll, und versucht, seinen Freund zu trösten, indem er ihm eine Zigarette ansteckt. Dann steckt er sich selbst eine an. Nun sitzen sie beide nur da, sagen nichts mehr. Im Krieg können Worte wie Munition sein: wertvoll. Man soll sparsam mit ihnen umgehen und sie nur einsetzen, wenn es sein muss. Sie rauchen schnell bis zum Filter. Fast gleichzeitig drücken sie ihre Kippen am Baumstamm aus.
Katimba steht wieder auf. Er geht zu seiner Hütte. Dort ruft er nach seiner Frau. Die Frau erscheint und läuft nach einem kurzen Wortwechsel eilig davon.
Großvater António ruft seinerseits nach den Frauen. Die Neugier treibt Großmutter und meine Tanten herbei. Ich werde sitzen gelassen. Ob absichtlich oder ob sie mich einfach vergessen haben, weiß ich nicht.
„Zieht eure Schuhe aus und wartet“, bittet Großvater.
Die Frauen wundern sich, aber fast wie im Chor antworten sie:
„Ja.“
Dann sagt Großvater:
„Lukas 17, Vers 32: Denkt an Lots Weib“, und macht eine längere Pause, als wolle er sich vergewissern, dass auch allen klar ist, was er damit meint, und fährt fort: „Wir wollen doch nicht zur Salzsäule werden, nicht wahr?“
„Nein“, antwortet erst nur die Großmutter.
„Ich höre nichts“, brummt der Patriarch.
„Nein!“, rufen nun alle drei.
„Was in Angola zurückbleiben muss, soll hier bleiben. Wir schauen nie mehr zurück“, erklärt Großvater.
Katimba kommt zu mir. Er deutet mit seinem Stock auf meinen Kopf und erklärt:
„Die hier ist noch nicht gekeimt. Sie ist noch nicht angewachsen. Taucht dort, wo ihr hingeht, das Kind unter Wasser. Es erwacht dann mit neuem Geist.“
Meine Tanten schauen ihren Vater verstört an. Wechseln Blicke, als würden sie an Großvaters Verstand zweifeln.
Als die in bunte Tücher gekleidete Frau des soba mit dem kimbanda Tikukulu wiederkommt, wirbeln die Gedanken von Großmutter und meinen Tanten wild durcheinander. Sie fragen sich, was als Nächstes geschehen soll.
Die Frau des soba verschwindet in ihrer Hütte. All das hier geht sie nichts an.
Tikukulu, der traditionelle Heiler, setzt sich mit Großvater und dem soba zusammen. Worüber sie sprechen, ist nicht zu hören. Alle drei schütteln den Kopf, und dann ist das Gespräch beendet, der Pakt, den sie gerade besprochen haben, besiegelt.
Die Ehrfurcht gebietet es den Frauen, keine Fragen zu stellen und auch nicht zu klagen. Sie beobachten nur.
Großmutter Elisa sieht, wie ihr Mann seine Schuhe auszieht und dann die Socken. Sie muss zweimal hinschauen und rückt ihre Brille zurecht, um ganz sicher zu sein, dass sie sich das alles nicht einbildet. Nicht einmal im Schlafzimmer hat sie António je barfuß gesehen. Sie kann nicht anders und ruft erstaunt:
„Hoko!“, und schlägt sich hastig die Hand vor den Mund, damit ihr nicht noch mehr Verräterisches über die Lippen kommt.
Wieder unter dem Mulemba-Baum, geht Großvater neun Mal um den mächtigen Stamm und murmelt etwas. Als er fertig ist, zeichnet kimbanda Tikukulu ihm weiße Striche in den Nacken, auf die Stirn und auf die Brust.
„Elisa, geh. Zieh die Schuhe aus und geh neun Mal um den mulemba. Sag bei jeder Runde: ‚Was hierbleibt, soll hierbleiben‘“, befiehlt er.
Den Rosenkranz fest in der Hand, geht Großmutter neun Mal um den Baum und sagt immer wieder den Satz vor sich hin. Allerdings nicht überzeugend. Weder will sie ihre Tochter Rosa vergessen noch Angola. Nach Großmutter Elisa sind Tante Isaltina und Tante Francisca dran.
Katimba beendet die Zeremonie mit den Worten:
„Was nicht mit euch fortgeht, wird hierbleiben. Wer nicht bei euch ist, wird hier sterben“, und dann klopft er drei Mal mit seinem Stock auf die trockene Erde.
Aus dem Leinensack holt Großvater António nun ein Schachspiel heraus, eine Stange Zigaretten, Krawatten und ein großes Stück Trockenfleisch. All das überreicht er dem soba, und auch sein Magnum-Gewehr und drei Schachteln Munition.
Katimba bedankt sich für die Geschenke, gibt das Gewehr und die Munition aber gleich zurück. Auch Tikukulu will sie nicht. Das Trockenfleisch und die Whiskyflaschen nimmt er gern.
Als wir, die Familie Queiroz da Fonseca, alle wieder ins Auto steigen, sind die dunklen Wolken, die noch eben am Himmel standen, vom Wind weggeweht. Endlich fahren die Geländewagen ihrem eigentlichen Ziel entgegen. Zuerst über den trockenen Boden, dann mit der gebotenen Vorsicht die Pfade entlang.
Die chitakas, früher fruchtbares Kaffee- und Zuckerrohrland, sind nur noch verbrannte Erde. Das Leben tut sich schwer mit dem Neuanfang. Ab und zu fährt die Fahrzeugkolonne an Hütten vorbei. Dann laufen Bauern auf uns zu. Verzweifelt halten sie ihre Kleinkinder hoch. Sie betteln nicht um Essen oder Geld. Sie wollen uns ihre Kinder geben, um sie zu retten. Hier droht ihnen der sichere Tod. Wenn nicht durch eine Kugel, dann durch Verhungern. In den Autos schaut man verlegen zu Boden und versucht, nicht hinzusehen. Kein Blick aus dem Fenster. Kein Wort wird gesagt, jedenfalls kaum eines, bis wir in Huambo am Flughafen sind. Nur Großmutter betet leise und dankt Gott für unser Glück.
Am Eingang zum Flughafen fahren Autos in alle Richtungen. Verabschieden sich hupend. Unser Jeep hält an.
Chaos überall. Verzweifelte Gesichter. Von der Unsicherheit über die Zukunft gezeichnet. Blutleere Schatten ihrer selbst.
Wer eine Bordkarte hat, kämpft, um ins Flugzeug zu kommen. Wer keine hat, aber Geld braucht, hält die Hand auf, um sich die Scheine zu sichern, die manche Abreisende noch versehentlich in der Tasche haben. Unsere Koffer sind schon aufgegeben. Caculeto verabschiedet sich von uns. Er weint wie ein kleines Kind.
Wie vorgesehen landen wir in Luanda. So wie viele andere Reisende auch küsst Großmutter noch auf der Rollbahn den Boden.
Ein paar Stunden müssen wir auf den Flug der angolanischen Fluggesellschaft TAAG nach Lissabon warten. Jetzt erst scheint Großvater ruhiger zu werden. Er spielt mit mir Verstecken, hält sich mit beiden Händen die Augen zu und ich soll sagen, ob er noch da ist. Wir spielen, bis wir ins Flugzeug steigen.
Wir dürfen als Erste einsteigen. Großvater hinter uns. Er will sichergehen, dass niemand von uns zurückbleibt.
4
Das Flugzeug ist voll, als es in der Luft ist, werden die Passagiere ganz still. Großmutter schläft ein, die Tanten auch. Großvater raucht, macht sich Notizen, blättert in Dokumenten und trinkt Whisky aus der kleinen Flasche, die er innen in seiner Jacke hat. Dann steckt er die Papiere zurück in die Aktentasche und steht auf. Er geht den Gang entlang. Er muss sich die Beine vertreten. Er spürt den Schmerz wieder aufsteigen. Er nimmt eine Zigarette aus der Packung. Beim Rauchen verquickt er die Vergangenheit mit der Zukunft. Er atmet den Rauch ein, hält die Luft lange an und stößt ihn dann wieder aus. Seine Hände zittern, als hätten sie auch Angst.
Am Flughafen Portela in Lissabon nehmen uns Onkel Damião und seine Frau, Großmutters Schwester, mit großem Hallo in Empfang. Doch kaum sind wir in Malveira, bricht sich das Weinen, das sich über die ganze Zeit angestaut hat, hemmungslos Bahn, rinnt über die Wände des Hauses. Ins kleine Fernsehzimmer haben sich Großvater und Onkel Damião zurückgezogen, nicht etwa, damit man sie nicht weinen sieht, sondern zu einer Besprechung unter Männern, wie sie sagen. Es geht um die Logistik und die nächsten Schritte im Leben der Familie Queiroz da Fonseca.
„Das Leben geht weiter, António“, tröstet Damião seinen Schwager.
„Es geht ja nicht anders.“
„Das sind einfache Leute hier. Verhalte dich unauffällig.“
„Ich weiß. Wir sind hier nicht zu Hause.“
„Ein bisschen rassistisch, aber im Grunde ganz nett.“
„Sie sind Leute mit dunklerer Haut nicht gewohnt?“
„Nein. Aber es stört sie nicht.“
„Seid ihr gern hier?“
„Es geht mir wie dir, António. Was soll ich machen? Willst du einen Whisky?“
„Ich brauche jetzt einen.“
Während Onkel Damião den Whisky ausschenkt, zählt er die Termine und Besprechungen auf, die er für Großvater schon arrangiert hat. Als Erstes werden sie mit dem Leiter des Banco Nacional Ultramarino sprechen, am nächsten Tag haben sie einen Termin bei der Rechtsanwältin, die sich für alle um die Staatsangehörigkeit kümmert.
„Wirklich dringend brauchen wir Winterkleidung“, sagt Großvater und reibt sich frierend die Hände.
„Es ist Sommer, António!“, sagt Onkel Damião überrascht.
„Wann können wir das Haus sehen?“
„Wann immer du willst. Die Quinta das Aroeiras ist keine zwei Schritte von hier entfernt.“
Onkel Damião gibt ihm das Whiskyglas und sagt:
„Trink, dann wird dir schon warm.“
5
Weiter geht es im Kalender und im Mai ist endlich der Umzug auf die „Quinta das Aroeiras“. Ein kleines Grundstück mit einem zweistöckigen Häuschen, dessen Dach nach vier Seiten abfällt, weiß getüncht mit ockerfarbenen Fensterumrandungen. Einzelne Kalksteinquader in der Fassade geben ihm einen Anflug von Herrenhaus. Von der Haustür schaut man einen von Mastixsträuchern gesäumten Pfad entlang bis zum Grundstückstor. Sonst überall Weiden, Pinien, Eukalyptus. Gleich hinter dem Brunnen neben dem Haus stehen Beerensträucher und Obstbäume. Dahinter der frühere Kuhstall.
Am Umzugstag herrscht geschäftige Stimmung. Heiterkeit. Nach dem Abendessen drehen meine Tanten mit mir eine Runde im Ort. Die Großeltern bleiben, sitzen auf der Bank vor dem Haus und lauschen dem Wind und dem Rauschen der Blätter. Großvater sucht nach seiner Zigarettenpackung. Dann gibt er es auf, eine rauchen zu wollen.
Es war keine Liebe auf den ersten Blick gewesen am Anfang seiner Beziehung mit Elisa. Was ihr an Schönheit vielleicht gefehlt hatte, glich sie durch Eleganz aus. António faszinierte ihre makellos helle Haut, der Kontrast zu seiner eigenen dunklen Hautfarbe. Mit den Jahren hatte sich daraus Liebe entwickelt. Nach Rosas Verschwinden und dann mit dem Krieg war das Eheleben ein wenig abgekühlt. Aber António liebt sie bis heute. Ob dies auf Gegenseitigkeit beruht, weiß er nicht.
„Elisinha“, flüstert er zärtlich Großmutters Namen und fasst beinahe ängstlich nach ihrer Hand.
„Was willst du, Mann?“
Großvater nimmt ihr Gesicht zwischen beide Hände. Er küsst sie auf die Stirn. Dann legt er ihr den Arm um die Schulter. Er schaut in den mit Sternen übersäten Himmel, nimmt Großmutters Hand und fragt leise, die Lippen fast schon am Ringfinger seiner Frau:
„Bist du jetzt, wo wir alt sind, zur Junggesellin geworden?“
„Ich habe ihn Dona Bia geschenkt“, erklärt sie.
Dann küssen sie sich lang. Versöhnt gehen sie ins Haus und aufs Zimmer.
6
Das Flugzeug im Landeanflug auf Luanda. Der Himmel ist grau und wolkenverhangen. Es ist sechs Uhr früh. Seit ich aus Malveira weg bin, habe ich kein Auge mehr zugetan. Meine Lippen sind trocken. Meine Kiefergelenke verkrampfen sich wieder einmal. Der Weg, den ich gehe, ist der, den ich gehen muss. Ich habe den Hunger nach meiner Mutter nicht mehr ausgehalten. Ich darf sie nicht aufgeben. Aber auch diese Gewissheit nimmt mir nicht die Angst. Ich spüre sie bis in die Zehenspitzen. Meine Füße sind eingeschlafen. Sie haben Angst davor, loszugehen. Füße, die Angst haben, sich auf den Weg zu machen. Die Leute um mich herum machen Lärm und das nervt mich. Auch die Kleinkinder, die nicht aufhören wollen zu schreien.
Weit unter mir tauchen immer mehr Häuser auf wie von einem Flächenbombardement über die Gegend verstreut. Immer zu mehreren entlang einer Linie und scheinbar so hart auf den Boden geprallt, dass eine Staubschicht sich über alles gelegt hat. Kaum auseinandergefallen, wurden sie blind wieder zusammengezimmert, zu einem Gerippe aus rotem Lehm, alten Brettern und Wellblech. Sie überleben im Durcheinander der neuen Umgebung. Ducken und breiten sich aus. Wände, die Raum schaffen sollen. Häuser in allen möglichen Größen. Unverputzt, ohne Anstrich, durchlässig für Gut und Böse. Zusammen bilden sie einen gigantischen monochromatischen Flickenteppich, durchzogen von Gassen, die sich in alle Richtungen durch die Stadt verzweigen. Gänge, die nirgendwohin führen. Grob in die Erde gegrabene Straßen, die irgendwann an den offiziellen Verkehrswegen enden. Der Asphalt ist die imaginäre Grenze. Die Grenze dessen, was man noch sein oder haben darf.
Größere Umrisse kommen in Sicht: grau, weitläufig, aufragend. Die Fenster der Wohnungen sind wie Vogelnester in Baumstämmen aus Beton. Das Grau breitet sich aus und versucht, bis zum Himmel zu kommen und bis zum Wasser, die Umgebung nimmt eine andere Handschrift an.
Ich spüre mein Herz rasen. Das, was mich erwartet, ist roh und rau. Ich dringe in einen Uterus voller Staub und Zement ein. Bereite mich vor auf das Chaos.
Es fängt an zu regnen. Nun wirkt die Stadt trist. Mit dem Regen ist Wind aufgekommen. Die Turbulenzen machen es schwierig zu landen. Wir steigen aus, in unsere eigenen Körper gehüllt. Völlig durchnässt drängeln wir uns in einem Bus, der uns zum Flughafengebäude bringt. Die Luft ist stickig und alles um mich herum scheint von einer schmierigen Feuchtigkeit überzogen. Erfolglos versuche ich, niemanden und möglichst auch keine Handläufe zu berühren.
Die Tür geht auf. Passagiere stürmen durcheinander, versuchen, den Weg abzukürzen, um sich in die richtige Schlange zu stellen. Ich sehe ein Schild „Ausländer“ und stelle mich dort an.
In der Schlange stehen vor allem Weiße Männer. Sie klammern sich an ihre Aktentaschen oder an die Riemen ihrer Rucksäcke, die sie auf dem Rücken tragen. Mit großen Augen scheinen sie alles um sich herum abzuscannen. Von rechts nach links und wieder zurück. Die meisten sind angespannt und leicht vorgebeugt. Immer und immer wieder schauen sie ihre Papiere durch. Einige legen völlig ungeniert Geldscheine in ihren Reisepass. Ich frage mich, ob ich es auch tun sollte.
Ich bin das erste Mal hier. Mir fehlt die Unbefangenheit derer, die in ihr Heimatland zurückkehren.
Die Schlange rückt vor. Ich bin an der Reihe. Ich trete über die gelbe Linie. Der Mann vom Zoll verzieht keine Miene. Er setzt sich hinter seinem Schalter gerade und wird ein kleines Stück größer. Mit schüchternem Lächeln sage ich guten Tag. Mein Gruß wird nicht erwidert. An seinem Blick sehe ich, dass ich zu nah bin. Ich trete einen Schritt zurück. Er richtet sich noch einmal auf. Dann stützt er seinen rechten Ellenbogen auf die Tischplatte, als suchte er einen festen Punkt für seinen Unterarm. Der Arm bewegt sich auf mich zu. Seine offene Hand verlangt nach meinem Pass. Als er ihn hat, zieht er ihn zu sich, behält ihn in der Hand, stützt den Ellenbogen wieder auf die Tischplatte.
Ich bin nervös.
Die andere Hand, bis dahin unbeteiligt und fern, kommt nun vor und greift ebenfalls nach dem Pass. Der Beamte wiegt das Dokument in den Händen. Gemächlich blättert er Seite für Seite um. Er schaut mich an, dann wieder das Foto in meinem Pass. Seine Lippen bewegen sich nicht. Nur seine Augen. Das Spiel heißt Erkenne die Unterschiede. Mir kommt es vor, als versuche er absichtlich, Zweifel an meiner Identität aufkommen zu lassen.