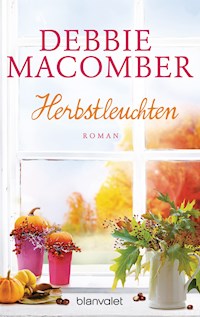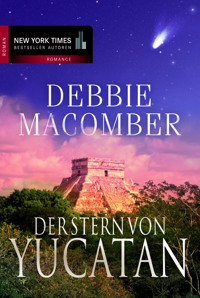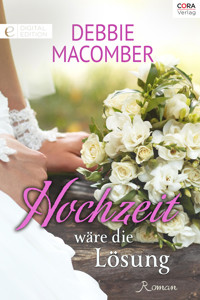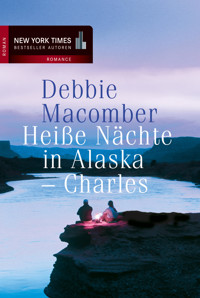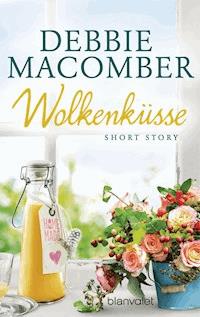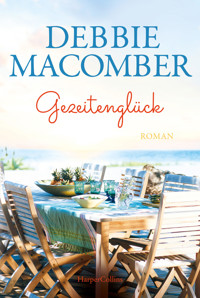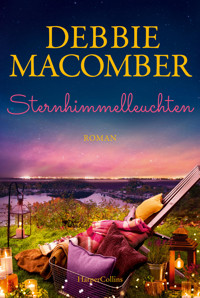9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cedar Cove
- Sprache: Deutsch
Liebe, Freundschaft und Familie - ein Roman, der Mut macht Noch vor einigen Jahren war das Leben, das Teri jetzt führt, nur ein ferner Traum. Jetzt ist sie mit ihrer großen Liebe, dem Schachchampion Bobby Polgar, verheiratet, arbeitet in dem kleinen Schönheitssalon in Cedar Cove und lebt in einem wunderschönen Haus mit Blick auf das Meer. Doch sie spürt, dass Bobby ihr etwas verschweigt. Er wirkt besorgt und gedankenversunken. Doch als sie ihn danach fragt, ist seine einzige Antwort: »Ich muss meine Königin beschützen!« Irgendetwas sagt Teri, dass er nicht von seinem Schachspiel spricht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zitat aus dem Buch:
Es fiel ihr immer noch schwer zu glauben, dass Bobby sie lieben konnte. Sie arbeitete in einem Kosmetiksalon und betrachtete sich selbst als das Gegenteil von intellektuell. Bobby erklärte immer, sie besitze eine sehr wirklichkeitsnahe Intelligenz, eher eine praktische und intuitive, während seine auf reiner Logik beruhe. Sie liebte ihn dafür, dass er das sagte, und glaubte allmählich sogar, dass er es tatsächlich so meinte. Im Grunde liebte sie alles an ihm. Das Glück, das sie in seiner Nähe empfand, war ihr immer noch neu und machte ihr ein wenig Angst.
Zur Autorin:
SPIEGEL-Bestsellerautorin Debbie Macomber hat weltweit mehr als 200 Millionen Bücher verkauft. Sie ist die internationale Sprecherin der World-Vision-Wohltätigkeitsinitiative Knit for Kids. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Wayne lebt sie inmitten ihrer Kinder und Enkelkinder in Port Orchard im Bundesstaat Washington, der Stadt, die sie zu ihrer Cedar Cove-Serie inspiriert hat.
Lieferbare Titel:
Leuchtturmnächte
Rosenträume
Winterglühen
Frühlingsmagie
Gezeitenflüstern
Mondlichtzauber
Seesternwünsche
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel 74 Seaside Avenue bei MIRA Books, Toronto.
© Debbie Macomber Deutsche Erstausgabe © 2023 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./SÀRL Covergestaltung von buerosued unter Verwendung von Shutterstock Coverabbildung von living4media / Nordstrom, Annette E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749905461www.harpercollins.de
Widmung
Für Susan Plunkett, Krysteen Seelen, Linda Nichols und Lois Dyer, allesamt begabte Schriftstellerinnen und meine hochgeschätzten Freundinnen
Liebe Freunde, …
Liebe Freunde,
es wird wieder einmal Zeit für einen Besuch in Cedar Cove. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, kann ich euch versprechen, dass ihr euch sehr schnell zurechtfinden werdet. Kommt, und verbringt ein paar Stunden mit Grace, Olivia und ihren Familien, mit Rachel, Nate und Bruce sowie mit Bobby und Teri Polgar … und mit Hunderten anderen. Natürlich sind es nicht wirklich Hunderte, aber manchmal fühlt es sich so an.
Weil für Cedar Cove die sehr reale Stadt Port Orchard in Washington Pate gestanden hat, haben einige von euch uns hier besucht. Ihr seid uns willkommen. Eine Reihe von Geschäften und Straßen in Cedar Cove lehnen sich verhältnismäßig eng an tatsächlich vorhandene Orte in Port Orchard an, und ich habe einen Stadtplan von Cedar Cove erstellt. Wer mag, kann der örtlichen Handelskammer von Port Orchard einen Besuch abstatten. Dort gibt es kostenlose Exemplare.
Inzwischen wisst ihr vermutlich schon, dass ich gern von meinen Lesern höre. Erreichen könnt ihr mich über P. O. Box 1458, Port Orchard, WA98366, oder über meine Website. Und jetzt lehnt euch zurück, macht es euch bequem, und viel Spaß beim Lesen!
Liebe Grüße
Debbie Macomber
Die Hauptpersonen
Die Hauptpersonen
Olivia Lockhart Griffin: Familienrichterin in Cedar Cove, Mutter von Justine und James. Verheiratet mit Jack Griffin, Chefredakteur des Cedar Cove Chronicle. Das Paar wohnt in der Lighthouse Road Nummer 16.
Charlotte Jefferson Rhodes: Verwitwete Mutter von Olivia und Will Jefferson, noch recht frisch verheiratet mit dem Witwer und pensionierten Marineoffizier Ben Rhodes. Ben hat zwei Söhne, David und Steven, die beide nicht in Cedar Cove wohnen.
Justine (Lockhart) Gunderson: Tochter von Olivia. Verheiratet mit Seth Gunderson, Mutter von Leif. Den Gundersons gehörte das Lighthouse Restaurant, das bei einem Brand zerstört wurde. Die Familie lebt im Rainier Drive Nummer 6.
James Lockhart: Sohn von Olivia, Justines jüngerer Bruder. James dient in der US-Marine und lebt mit seiner Frau Selina, seiner Tochter Isabella und seinem Sohn Adam in San Diego.
Stanley Lockhart: Von Olivia geschieden, Vater von James und Justine. Lebt in Seattle.
Will Jefferson: Olivias Bruder, Charlottes Sohn. Lebte lange in Atlanta. Inzwischen geschieden und im Ruhestand, hat er beschlossen, wieder nach Cedar Cove zu ziehen.
Grace Sherman Harding: Olivias beste Freundin. Verwitwet. Bibliothekarin, Mutter von Maryellen Bowman und Kelly Jordan. Verheiratet mit Cliff Harding, einem Ingenieur im Ruhestand, der sich der Pferdezucht gewidmet hat. Das Paar lebt in der Nähe von Cedar Cove in Olalla. Grace gehört das Haus in der Rosewood Lane Nummer 204, in dem sie vorher gelebt und das sie jetzt vermietet hat.
Cal Washburn: Pferdetrainer, angestellt bei Cliff Harding.
Vicki Newman: Ortsansässige Tierärztin, in einer Liebesbeziehung mit Cal Washburn.
Maryellen Bowman: Älteste Tochter von Grace und Dan Sherman. Mutter von Katie und Drake. Verheiratet mit Jon Bowman, einem Fotografen.
Joseph und Ellen Bowman: Vater und Stiefmutter von Jon Bowman, Großeltern von Katie und Drake. Sie leben in Oregon.
Kelly Jordan: Maryellens jüngere Schwester. Verheiratet mit Paul. Mutter von Tyler.
Zachary Cox: Steuerberater. Geschieden von und wiederverheiratet mit Rosie Cox. Vater von Allison und Eddie Cox. Der Wohnsitz der Familie befindet sich im Pelican Court Nummer 311. Allison besucht die Universität von Seattle, ihr Freund Anson Butler ist zum Militär gegangen.
Cecilia Randall: Ehefrau des Marinesoldaten Ian Randall und Mutter von Aaron. Die Familie wohnte in Cedar Cove, bevor Ian nach San Diego versetzt wurde.
Rachel Pendergast: Arbeitet im Frisier- und Kosmetiksalon Get Nailed. Befreundet mit Bruce Peyton und seiner Tochter Jolene. In einer Liebesbeziehung mit dem Marineoffizier Nate Olsen.
Bob und Peggy Beldon: Beide im Ruhestand. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Dem Ehepaar gehört das Thyme and Tide, eine Pension im Cranberry Point Nummer 44.
Roy McAfee: Pensionierter Polizist aus Seattle, jetzt Privatdetektiv. Verheiratet mit Corrie McAfee, die als Assistentin sein Büro führt. Sie haben drei erwachsene Kinder, Gloria Ashton, Mack und Linnette. Roy und Corrie wohnen in der Harbor Street Nummer 50.
Linnette McAfee: Tochter von Roy und Corrie, wohnte eine Weile in Cedar Cove und arbeitete dort als Assistenzärztin im neuen Gesundheitszentrum. Verlässt die Stadt und macht sich auf den Weg nach North Dakota. Ihr Bruder Mack macht eine Ausbildung zum Feuerwehrmann und zieht nach Cedar Cove.
Gloria Ashton: Hilfssheriff in Cedar Cove, leibliche Tochter von Roy und Corrie McAfee. Wurde nach der Geburt zur Adoption freigegeben und ist als Adoptivtochter der Ashtons aufgewachsen.
Troy Davis: Sheriff von Cedar Cove. Vater von Megan. Seine Frau Sandy ist kürzlich verstorben. Wohnt im Pacific Boulevard Nummer 92.
Faith Beckwith: Ehemalige Highschool-Freundin von Troy Davis, inzwischen verwitwet.
Bobby Polgar und Teri Miller Polgar: Er ist internationaler Schachmeister, sie Friseurin im Get Nailed. Beide wohnen in der Seaside Avenue Nummer 74.
Dave Flemming: Methodistenpastor. Verheiratet mit Emily. Sie haben zwei Söhne. Das Ehepaar wohnt im Sandpiper Way Nummer 8.
1. Kapitel
An einem späten Donnerstagnachmittag schlenderte Teri Polgar durch die Gänge des Lebensmittelgeschäfts. Sie entschied, zum Abendessen ihre Spezialität zuzubereiten: einen Makkaroni-Käse-Auflauf. So mancher hätte das vermutlich eher als geeignet für den Winter betrachtet, also nicht unbedingt das Richtige für Mitte Juli, aber Teri liebte dieses Gericht zu jeder Jahreszeit. Und Bobby – nun ja, der nahm sowieso kaum wahr, welche Jahreszeit gerade war. Oft genug bekam er nicht einmal die Uhrzeit mit.
Als sie nach Hause kam, saß ihr Mann hoch konzentriert vor seinem Schachbrett. Das an sich war völlig normal. Anders als sonst stand das Schachbrett jedoch auf dem Küchentisch, und Bobby gegenüber saß ihr jüngerer Bruder – beides war gleichermaßen ungewöhnlich.
Johnny grinste verlegen, als sie mit ihren Einkäufen die Küche betrat. »Ich wollte nur mal schnell vorbeischauen, und Bobby hat darauf bestanden, mir Schach beizubringen«, erklärte er.
Bobby murmelte irgendetwas, vermutlich, um sie zu begrüßen. Er murmelte oft etwas vor sich hin, tief versunken in seine eigene Welt der Schachzüge und Strategien. Ihren Mann als unkonventionell zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Bobby Polgar war eine internationale Schachsensation, einer der weltbesten Spieler überhaupt.
»Wie läuft’s denn?«, wollte sie wissen und stellte die Einkaufstüten auf dem Küchentresen ab.
Johnny zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Frag Bobby.«
»Hallo, Schatz«, sagte sie und trat an ihren Mann heran, schlang ihm die Arme um den Hals und küsste ihn auf die Wange.
Er umfasste ihre Hand und drückte sie, dann schaute er Johnny an. »Schütze deine Königin immer gut«, riet er ihrem Bruder. Der nickte geduldig.
»Magst du zum Essen bleiben?«, fragte Teri. Ein Besuch ihres Bruders, vor allem unter der Woche, war eine schöne Überraschung. Sie war stolz auf Johnny, fühlte sich aber auch genötigt, ihn zu beschützen. Vermutlich ist das ganz natürlich, dachte sie. Im Grunde hatte sie ihn aufgezogen. Ihre Familie war genauso unkonventionell wie Bobby, wenn auch in ganz anderer Hinsicht. Soweit sie wusste, war ihre Mutter insgesamt sechsmal verheiratet gewesen. Oder sogar siebenmal? Teri hatte den Überblick verloren.
Ihre Schwester war ihrer Mutter ähnlicher, als Teri es je gewesen war, aber immerhin war Christie vernünftig genug, keinen der Loser zu heiraten, die in ihr Leben hinein- und wieder hinausgestolpert waren. Nicht, dass Teri alle schmerzlichen Lektionen des Lebens erspart geblieben wären. Sie hatte es vor allem mit Männern zu tun gehabt, die ihre Partnerinnen ausnutzten und misshandelten.
Es fiel ihr immer noch schwer zu glauben, dass Bobby sie lieben konnte. Sie arbeitete in einem Kosmetiksalon und betrachtete sich selbst als das Gegenteil von intellektuell. Bobby erklärte immer, sie besitze eine sehr wirklichkeitsnahe Intelligenz, eher eine praktische und intuitive, während seine auf reiner Logik beruhe. Sie liebte ihn dafür, dass er das sagte, und glaubte allmählich sogar, dass er es tatsächlich so meinte. Im Grunde liebte sie alles an ihm. Das Glück, das sie in seiner Nähe empfand, war ihr immer noch neu und machte ihr ein wenig Angst.
Darüber hinaus gab es durchaus reale Gründe, sich Sorgen zu machen, auch wenn sie diese lieber herunterspielte. Erst vor Kurzem war sie von zwei Männern bedroht worden, Leibwächtertypen, die so aussahen, als wären sie einer Episode der Fernsehserie Die Sopranos entsprungen. Ihr gesamtes Erscheinungsbild schrie »Gangster«. Immerhin hatten die beiden ihr nichts getan, sie hatten ihr nur für ein paar Minuten Angst eingejagt.
Teri wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Das Auftauchen der beiden Schlägertypen sollte anscheinend als Warnung für Bobby dienen. Kern der Botschaft war wohl, dass ihr Boss, wer auch immer er sein mochte, jederzeit an sie herankommen konnte. Von wegen! Teri hatte gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Sie musste allerdings zugeben, dass die beiden ihr zu denken gaben.
Wenn Bobby wusste, wer hinter der Drohung gegen sie steckte, verriet er es ihr nicht. Aber ihr war aufgefallen, dass er an keinem einzigen Schachturnier teilgenommen hatte, seitdem die beiden Typen sie belästigt hatten.
»Ich muss zurück«, erklärte Johnny und beantwortete damit ihre Frage, ob er zum Essen bleiben wolle.
»Bleib doch noch ein paar Stunden«, versuchte sie, ihn zu überreden. »Ich mache meinen speziellen Makkaroni-Käse-Auflauf.« Damit konnte sie ihren Bruder noch am ehesten ködern, immerhin war das sein Lieblingsgericht.
»Schachmatt«, verkündete Bobby triumphierend. Anscheinend hatte er nichts von der Unterhaltung mitbekommen.
»Gibt es noch einen Ausweg?«, fragte Johnny und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Schachbrett.
Bobby schüttelte den Kopf. »Nein. Du bist im Schwarzen Loch.«
»Im was?«, fragten Teri und Johnny gleichzeitig.
»Im Schwarzen Loch. Wenn ein Spieler sich in dieser Lage befindet, kann er unmöglich gewinnen.«
Johnny zuckte mit den Schultern. »Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich geschlagen zu geben.« Er legte seinen König hin und seufzte. »Im Ernst, es bestand nie der geringste Zweifel daran, wie dieses Spiel ausgehen würde.«
»Du spielst gut für einen Anfänger«, sagte Bobby.
Teri verwuschelte ihrem Bruder die Haare, obwohl sie wusste, wie sehr er das hasste. »Betrachte das als Kompliment.«
Johnny lächelte. »Das tue ich.« Damit schob er seinen Stuhl zurück und schaute seine Schwester an. »Ter, meinst du nicht, es wäre an der Zeit, Bobby mit Mom und Christie bekannt zu machen?«
Bobby wandte sich ihr ebenfalls zu. »Ich würde deine Familie wirklich gern kennenlernen«, erklärte er unschuldig.
»Nein, das würdest du nicht.« Abrupt drehte sie sich um und machte sich daran, ihre Einkäufe auszupacken. Den Hüttenkäse – eine Hauptzutat für ihre Käse-Makkaroni – stellte sie auf die Arbeitsplatte, dazu eine Packung Schmelzkäse.
»Mom hat mich über Bobby und dich ausgefragt«, erklärte ihr Bruder.
»Ist sie noch mit Donald zusammen?« Das war der aktuelle Ehemann. Teri hatte es bisher in voller Absicht vermieden, mit Bobby über ihre Familie zu reden. Sie waren noch nicht lange verheiratet, und sie wollte ihn nicht so schnell desillusionieren. Wenn er ihre Familie kennenlernen würde, kämen ihm womöglich ernste Zweifel an ihr, und Tatsache war, dass sie ihm das nicht einmal verübeln könnte.
»Die Situation ist etwas heikel.« Johnny warf Bobby einen kurzen Blick zu. »Donald hat sozusagen ein Alkoholproblem.«
»Donald!«, rief Teri. »Und was ist mit Mom?«
»Sie trinkt weniger.« Johnny hatte ihre Mutter schon immer in Schutz genommen.
Zu Anfang hatte Donald durchaus vielversprechend gewirkt. Ihre Mutter hatte ihn bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker kennengelernt. Leider unterstützten sie sich nur kurz dabei, trocken zu bleiben, und wandelten sich schnell zu Trinkkumpanen. Weder er noch sie schafften es, längere Zeit einen Job zu behalten. Wie sie finanziell über die Runden kamen, war Teri ein Rätsel, aber sie hatte nicht vor, die beiden genauso zu unterstützen, wie sie es bei Johnny tat. Schließlich war sonnenklar, dass sie jeden Dollar, den sie ihnen gab, sofort in eine Flasche Schnaps oder einen Abend in der örtlichen Bar investieren würden.
Sie verschränkte die Arme und lehnte sich gegen den Küchentresen. »Mom trinkt also weniger? Wer’s glaubt …«
»Trotzdem solltest du Christie einladen, damit sie Bobby kennenlernt.« Er wandte sich an Bobby. »Christie ist unsere Schwester.«
»Warum hast du mir nicht gesagt, dass du eine Schwester hast?«, wollte Bobby wissen. Er schien verblüfft, dass Teri nie ein Wort über Christie verloren hatte. Natürlich wusste er von ihrer Schwester, denn er hatte Teris Hintergrund durchleuchten lassen – eine Tatsache, die er ihr völlig ungerührt offenbart hatte, wie es seine Art war.
Sie hatte Gründe dafür, ihre jüngere Schwester nicht zu erwähnen, und Johnny wusste das. Anklagend richtete sie ihren Zeigefinger auf ihn. »Ich will nichts von Christie hören, klar?«
»Was ist bloß los mit euch beiden?«, brummte Johnny.
»Du bist zu jung, um das in allen Einzelheiten zu verstehen«, wehrte sie seine Frage ab. Im Grunde hatten Christie und sie sich zerstritten, auch wenn Teri ihr gegenüber in der Öffentlichkeit eine oberflächliche Höflichkeit wahrte.
»Komm schon, Ter, du und Bobby, ihr seid verheiratet. Er sollte die Familie kennenlernen.«
»Das sehe ich nicht so.«
»Du willst nicht, dass ich deine Familie kennenlerne?« Bobby schaute sie sichtlich verletzt an. Offenbar erkannte er nicht, dass diese Unterhaltung sich nicht gegen ihn richtete, sondern sich allein um ihre Mutter und ihre Schwester drehte.
»Doch, das will ich … irgendwann.« Sanft tätschelte sie Bobbys Arm. »Ich dachte, wir richten uns hier erst einmal fertig ein, bevor ich sie einlade.«
»Wir haben uns eingerichtet.« Bobby deutete auf die glänzenden Küchengeräte und den polierten Eichenboden.
»Das meinte ich nicht. Wir laden sie später zu uns ein.« In vier oder fünf Jahren, dachte sie. Oder noch später, wenn sie damit durchkam.
»Mom und Christie würden Bobby wirklich sehr gern kennenlernen«, drängte Johnny erneut.
Jetzt begriff Teri, warum ihr jüngerer Bruder unangemeldet bei ihnen aufgekreuzt war. Er war als Botschafter im Auftrag ihrer Mutter und ihrer Schwester hier, um den Weg dafür zu ebnen, dass sie dem reichen und berühmten Bobby Polgar vorgestellt würden, der so dumm gewesen war, Teri zu heiraten.
»Früher oder später müssen sie ihn kennenlernen«, erklärte Johnny. »Du kannst das nicht ewig verhindern, das weißt du.«
»Ja, das weiß ich«, gab sie seufzend zu.
»Dann kannst du es auch gleich hinter dich bringen.«
Teri begriff, dass sie dem Familientreffen, vor dem ihr so sehr graute, einfach nicht entkommen konnte, also nahm sie den Rat ihres Bruders an. »Schon gut, schon gut, ich lade sie alle zum Abendessen ein.«
»Großartig.« Johnny grinste sie breit an.
»Das werde ich noch bereuen«, murmelte sie.
»Warum?«, wollte Bobby wissen, offenbar immer noch verwirrt von ihrer Reaktion.
Sie wusste nicht, wie sie ihm das erklären sollte.
»Sind deine Mutter und deine Schwester so wie du?«
»Ganz und gar nicht!« Teri hatte alles, wirklich alles getan, sich in jeder Hinsicht anders zu entscheiden als die beiden – mit eingeschränktem Erfolg. Zwar trank sie nie übermäßig, aber sie hatte in Bezug auf Beziehungen zu Männern mehr als einen Fehler gemacht. Bis sie Bobby begegnet war …
»Ich werde sie mögen, oder?«, fragte Bobby als Nächstes und lächelte sie in kindlicher Gutgläubigkeit an.
Sie zuckte mit den Schultern. Ihre Mutter und ihre Schwester ähnelten einander in ihrem Verhalten und ihren Ansichten – in Teris Augen hatten sie beide versagt. Allerdings glaubte sie, dass Christie weniger ein Alkoholproblem hatte als vielmehr ein Männerproblem. Sie brauchte nur einem Mann zu begegnen, ganz gleich, was für einem, und sie konnte nicht widerstehen.
»Ist Christie noch mit …« Verflixt, ihr wollte partout nicht einfallen, wie der letzte Typ hieß, mit dem ihre Schwester zusammengelebt hatte.
»Charlie«, half Johnny ihr aus.
»Ich dachte, er heißt Toby.«
»Toby war der Typ vor Charlie«, erklärte ihr Bruder, »und nein, Charlie hat sie vor einem Monat sitzenlassen.«
Na toll, das hieß, dass ihre Schwester auf der Jagd war. Schlimmer konnte es kaum noch kommen.
»Christie wird sich an Bobby heranmachen«, sagte sie.
Johnny schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, das wird sie nicht. Ihr zwei seid verheiratet.«
»Warum sollte sie das davon abhalten? Das hat es noch nie getan. Glaub mir, sie wird sich an ihn heranmachen.«
»Hat Christie was für Schach übrig?«, fragte Bobby aufgeregt dazwischen.
Ganz offensichtlich verstand er nicht, wovon Teri und ihr Bruder gerade redeten. »Nein, Bobby. Aber meine Schwester wird dich für den genialsten, bestaussehenden Mann der Welt halten.«
Er grinste fröhlich. »So wie du.«
Trotz ihrer Ängste nickte Teri. »Nur noch mehr«, gab sie finster zurück.
»Du bist eifersüchtig«, meinte Johnny.
»Teri doch nicht«, widersprach Bobby und stand vom Tisch auf. »Sie weiß, dass ich sie liebe.«
Sie schlang ihre Arme um ihn und drückte ihn fest an sich. »Danke«, flüsterte sie.
»Wofür?«
»Dafür, dass du mich liebst.«
»Das ist einfach«, versicherte Bobby ihr.
»Hört mal, ihr Turteltauben. Ich wünschte, ich könnte bleiben, aber ich muss zurück nach Hause. Ich muss noch eine Facharbeit fertigstellen, die ich morgen abgeben muss.« Weil Teri ihn dazu ermuntert hatte, hatte Johnny sich für einen Sommerkurs eingeschrieben, um das nächste Schuljahr mit einem Lernvorsprung beginnen zu können. Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Du meldest dich also bei Mom?«
»Sieht so aus«, seufzte Teri, die sich bereits in das Unvermeidliche ergeben hatte.
»Und bei Christie auch«, drängte ihr Bruder. »Sie ist schließlich unsere Schwester.«
»Lass dir gesagt sein: Bobby ist vor ihr nicht sicher.« Und meine Ehe auch nicht, dachte sie bedrückt.
Teri wollte ihre Schwester nicht schlechtmachen, aber sie wusste aus Erfahrung, was sie von ihr zu erwarten hatte. Es war so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Christie sich Bobby sofort an den Hals werfen würde. Dass er verheiratet war, spielte dabei keine Rolle. Nicht für Christie. Bisher hatte sie versucht, jeden von Teris Freunden zu verführen. Bobby würde da keine Ausnahme sein, und gerade weil er Teris Mann war, würde Christie ihn vermutlich als besondere Herausforderung betrachten.
Armer Bobby. Er hatte keine Ahnung, was auf ihn zukam. Einer Familie wie ihrer war er mit Sicherheit noch nie begegnet.
»Am nächsten Wochenende?«, fragte Johnny hoffnungsvoll.
»Nein«, wehrte Teri ab. Sie brauchte Zeit, um sich darauf vorzubereiten. »Gib mir eine Woche, um mich darauf einzustellen. Samstag in zwei Wochen.«
Johnny ließ es sich nicht anmerken, ob ihre Antwort ihn enttäuschte. »Bis dann«, sagte er und küsste sie auf die Wange, bevor er ging.
Bobby legte ihr den Arm um die Schultern, und Teri rief sich erneut in Erinnerung, dass sie ihren Mann liebte und er sie. Trotzdem konnte sie ihre Befürchtungen nicht ganz abschütteln.
Auch wenn Bobby vollkommen anders war als jeder Mann, den sie kannte, er war trotzdem immer noch ein Mann. Er würde genauso empfänglich für Christies Schönheit und ihren unbestreitbaren Charme sein wie Teris Ex-Freunde.
»Ich freue mich darauf, deine Familie kennenzulernen«, sagte er, nachdem Johnny fort war.
Das Lächeln fiel ihr schwer. Armer Bobby, dachte sie erneut. Er wusste wirklich nicht, worauf er sich da einließ.
2. Kapitel
Seit fast siebzehn Jahren war Troy Davis der Sheriff von Cedar Cove. Er war in der Stadt aufgewachsen, hatte seinen Abschluss an der örtlichen Highschool gemacht und war anschließend wie viele seiner Freunde zum Militär gegangen, wo er als Militärpolizist diente. Eine Zeit lang arbeitete er als Ausbilder im Presidio von San Francisco, und unmittelbar vor seiner Versetzung auf einen Stützpunkt in Deutschland nutzte er einen dreitägigen Urlaub, um sich die Stadt in aller Ruhe anzusehen. Dabei begegnete er an einem nebligen Junimorgen des Jahres 1965 Sandy Wilcox.
Sie verbrachten den Tag miteinander, tauschten ihre Adressen aus und schrieben einander, während er seinen Dienst in Deutschland ableistete. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst bat er Sandy, seine Frau zu werden. Zu der Zeit ging sie aufs College. Nach ihrem Abschluss besuchten sie beide die Universität von San Francisco. 1970 heirateten sie und ließen sich in Troys Heimatstadt Cedar Cove nieder, wo er einen Job bei der Polizei gefunden hatte. Er arbeitete als Hilfssheriff, bis er für das Amt des Sheriffs kandidierte und die Wahl gewann. Das Leben hatte es gut mit ihm gemeint, mit ihnen beiden. Und dann war Sandy krank geworden …
»Dad?«
Troy saß im Wohnzimmer und starrte auf den Teppich. Als er die Stimme seiner Tochter hörte, blickte er auf. »Pastor Flemming ist da«, sagte Megan leise. Sie war vorbeigekommen, um ihm zu helfen, Sandys Sachen zu ordnen – zu entscheiden, was wohin gehen sollte.
Tief in Gedanken versunken hatte Troy die Türklingel nicht einmal gehört. Er stand auf, als der Pastor das Wohnzimmer betrat.
»Ich wollte mich erkundigen, wie ihr zurechtkommt«, sagte Dave Flemming. Der Pastor der Methodistenkirche von Cedar Cove war ein Mann der leisen Töne, dem seine Mitmenschen sehr am Herzen lagen. Er hatte Sandys Begräbnis-Gottesdienst geleitet, voller Mitgefühl und Aufrichtigkeit. An so manchem Nachmittag hatte Troy den Pastor bei sich zu Hause angetroffen, wo er mit Sandy zusammengesessen, ihr aus der Bibel vorgelesen, mit ihr gebetet oder manchmal einfach nur mit ihr geplaudert hatte. Die ehrliche Anteilnahme, die Dave erst Sandy und nun Megan und ihm entgegenbrachte, berührte Troy zutiefst.
Er wusste nicht recht, wie er auf die besorgte Frage des Pastors antworten sollte. »Wir kommen zurecht, so gut es geht«, sagte er schließlich.
Kein Tod war leicht, und obwohl Troy geglaubt hatte, auf den Verlust seiner Frau vorbereitet zu sein, musste er feststellen, dass dem nicht so war. Als Sheriff war ihm der Tod nichts Fremdes, und trotzdem würde er sich nie daran gewöhnen. Dieses Mal war es dennoch anders, denn es erschütterte die Grundfesten seines Lebens. Niemand war jemals wirklich bereit, seine Frau oder seine Mutter zu verlieren, und Sandys Tod hatte Megan und ihn hart getroffen.
»Wenn du irgendetwas brauchst, sag es einfach.«
»Das werde ich.« Troy deutete auf das Sofa. »Möchtest du dich nicht setzen?«, fragte er.
»Ich habe frischen Kaffee aufgebrüht«, fügte seine Tochter hinzu. »Nehmen Sie eine Tasse?«
Troy war stolz darauf, was für eine gute Gastgeberin sie geworden war. Seitdem Sandys Multiple Sklerose sich so drastisch verschlimmert hatte, übernahm Megan häufig diese Rolle für ihn. Selbst nach ihrer Hochzeit hatte sich daran nichts geändert, wofür er ihr unendlich dankbar war. Megan war bereitwillig für ihre Mutter eingesprungen und hatte ihn zu verschiedensten Anlässen begleitet und gelegentlich Freunde der Familie zum Essen eingeladen. Nachdem Sandy vor zwei Jahren in ein Pflegeheim umgezogen war, hatten seine Tochter und er einander besonders den Rücken gestärkt.
»Nein danke«, erklärte Dave. »Ich kann leider nicht bleiben. Aber ich würde gern helfen, wo immer ich kann. Wenn es für euch zum Beispiel zu schmerzlich ist, Sandys Sachen zu sortieren, bitte ich gern einige Damen aus der Gemeinde, euch zur Hand zu gehen.«
»Nein, nein, wir kommen schon zurecht«, versicherte Troy ihm.
»Wir haben alles im Griff«, setzte Megan hinzu. Sie hatte bereits begonnen, die Kleidung und andere persönliche Besitztümer ihrer Mutter zusammenzupacken.
»Dann lasse ich euch beide jetzt allein«, sagte Dave, schüttelte Troy die Hand und ging.
»Wir werden doch darüber hinwegkommen, Dad, nicht wahr?«, fragte seine Tochter zaghaft. Ihr Ton erinnerte ihn daran, wie sie als Kind geklungen hatte.
Er nickte und legte ihr den Arm um die schmalen Schultern. Normalerweise gelang es ihm, seinen Schmerz zu verbergen, und um Megans willen versuchte er sogar zu lächeln. Sie hatte schon genug an ihrer eigenen Trauer zu tragen.
»Natürlich werden wir darüber hinwegkommen.« Zusammen betraten sie das Schlafzimmer, das er über dreißig Jahre mit seiner Frau geteilt hatte. Auf dem Boden standen etliche Kartons mit bereits eingepackten Kleidungsstücken von Sandy. Die Hälfte des Schrankinhalts lag aber noch auf dem breiten Ehebett – Kleider, Pullover, Röcke und Blusen, die überwiegend schon seit Jahren unberührt im Schrank gehangen hatten.
Zwei Jahre lang hatte Sandy im Pflegeheim gelebt. Als sie dort zur Betreuung einzog, war ihm klar gewesen, dass sie nicht wieder nach Hause kommen würde. Dennoch war es ihm schwergefallen, sich damit abzufinden, dass die Multiple Sklerose sie schließlich das Leben kosten würde.
Das war auch nicht geschehen, jedenfalls nicht unmittelbar. Wie bei den meisten, die an dieser Krankheit litten, war ihr Immunsystem zuletzt so geschwächt gewesen, dass sie an einer Lungenentzündung gestorben war. Allerdings hätte auch jedes andere Virus, jede andere Infektion ihr Ende bedeuten können …
Um ihretwillen hatte Troy immer so getan, als glaubte er, sie würde eines Tages wieder nach Hause zurückziehen, aber in Wirklichkeit hatte er es immer gewusst. Er brachte ihr, worum auch immer sie ihn bat. Im Laufe der Monate hörte Sandy auf, um Dinge zu bitten. Sie hatte im Pflegeheim alles, was sie brauchte: ihre Großdruckbibel, ein paar Fotos, die ihr sehr viel bedeuteten, eine Reisedecke, die Charlotte Jefferson ihr gestrickt hatte, noch vor ihrer Hochzeit mit Ben Rhodes. Sandys Bedürfnisse waren bescheiden, sie brauchte nur wenig. Im Laufe der Wochen und Monate wurde dieses Wenige immer weniger.
Troy hatte alles im Haus ganz genau so belassen wie an dem Tag, an dem er sie ins Pflegeheim gebracht hatte. Zu Anfang schien das für Sandy wichtig zu sein. Und auch für ihn. Es half ihm, so zu tun, als könnte sie sich erholen. Sie musste daran glauben, bis sie es nicht mehr konnte, und er hatte am kleinsten Funken Hoffnung festhalten wollen.
»Ich weiß nicht, was ich mit Moms Kleidung machen soll.« Megan stand mitten im Schlafzimmer und ließ die Arme kraftlos hängen. Die Hälfte von Sandys begehbarem Kleiderschrank war ausgeräumt.
»Ich hatte keine Ahnung, dass Mom so viel Kleidung hatte«, fuhr Megan hilflos fort. »Sollen wir sie für einen guten Zweck spenden?«
Jetzt wünschte sich Troy, er hätte den Pastor danach gefragt. Vielleicht gab es in seiner Kirche ja ein Programm, in dem Dinge für Bedürftige gesammelt und verteilt wurden.
»Ja, das sollten wir.« Und doch, wenn es nach ihm gegangen wäre, würde er nichts ändern. Zumindest für eine ganze Weile nicht … Er verstand nicht, warum Megan es für wichtig hielt, die Überbleibsel des Lebens ihrer Mutter so schnell zusammenzupacken. Als sie mit den Kartons ankam, hatte Troy nicht widersprochen, aber er sah, offen gesagt, die Notwendigkeit für solche Eile nicht.
»Die meisten sind inzwischen aus der Mode gekommen.« Megan hielt einen rosa Pullover hoch, den Sandy ganz besonders gern getragen hatte.
»Lass einfach alles erst einmal hier«, schlug Troy vor.
»Nein!« Die Vehemenz, mit der seine Tochter reagierte, überraschte ihn.
»Megan, lass uns nichts tun, was wir später womöglich bereuen.«
»Nein«, wiederholte sie kopfschüttelnd. »Mom ist nicht mehr. Sie wird nie ihre Enkelkinder in den Armen halten. Sie wird nie wieder mit mir shoppen gehen. Sie wird mir nie wieder ein Rezept verraten. Sie … sie …« Tränen liefen ihr über die bleichen Wangen.
Troy fühlte sich völlig unfähig, sie in ihrer Trauer zu trösten. Er hatte noch nie gut mit Gefühlen umgehen können und konnte es jetzt erst recht nicht. Megan war ihr einziges Kind, und sie hatte ihrer Mutter sehr nahegestanden. Sandy und er hatten sich mehr Kinder gewünscht. Jahrelang bemühten sie sich um ein zweites Kind, aber nach der dritten Fehlgeburt entschied Troy, dass es genug war. Damals hatte er Sandy erklärt, sie sollten froh und dankbar sein, eine schöne Tochter zu haben, anstatt sich nach einer größeren Familie zu sehnen.
»Es ist erst zwei Monate her«, erinnerte er Megan so sanft wie möglich.
»Nein, Dad«, widersprach sie. »Es ist schon sehr viel länger her.«
Das verstand er wesentlich besser, als Megan bewusst zu sein schien. Zum Schluss hatte Sandy kaum noch Ähnlichkeit mit der Frau gehabt, die er geheiratet hatte. Ihr Tod, so tragisch er auch war, kam einer Erlösung von dem körperlichen Albtraum gleich, der zu ihrer Wirklichkeit geworden war. Mindestens dreißig Jahre lang hatte Sandy mit MS gelebt. Erst nach ihrer dritten Fehlgeburt war sie getestet worden, und erst dann hatten die Ärzte anhand der scheinbar zufälligen Symptome, an denen sie seit Jahren litt, eine Diagnose stellen können.
»Lass uns einfach nicht jetzt schon etwas spenden«, sagte Troy.
»Mom ist nicht mehr«, wiederholte Megan aufgebracht. »Wir müssen das beide akzeptieren.«
Er hatte gar keine andere Wahl, als die Tatsache zu akzeptieren, dass seine Frau tot war. Am liebsten hätte er Megan gesagt, dass es ihm sehr wohl bewusst war, dass Sandy nicht mehr lebte. Schließlich war er es, der Abend für Abend in ein leeres Haus zurückkehrte, Nacht für Nacht allein in einem großen Bett schlief.
Neunzig Prozent seiner Freizeit hatte er im Pflegeheim mit Sandy verbracht. Jetzt fühlte er sich leer, seines Lebensinhalts beraubt und wusste nichts mit sich anzufangen. Aber Megan litt genauso wie er und musste ihrer Trauer freien Lauf lassen, deshalb sagte er nichts.
»Ich helfe dir, alles einzupacken, und dann bringe ich die Kartons in den Keller«, murmelte er. »Wenn du dafür bereit bist … wenn wir beide es sind, hole ich sie wieder nach oben. Dann, erst dann, sollten wir darüber nachdenken, die Sachen deiner Mutter für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Wenn wir uns dazu entschieden haben, werde ich Pastor Flemming bitten, mir eine Organisation zu empfehlen. Vielleicht gibt es sogar so etwas in seiner Kirche.« Wenn nicht, konnte er zu St. Vincent de Paul oder zur Heilsarmee gehen, beides Organisationen, die Sandy unterstützt hatte.
Einen Moment sah es so aus, als wollte Megan widersprechen.
»Einverstanden?«, fragte er drängend.
Seine Tochter nickte widerwillig. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und kaute dabei auf der Unterlippe. Das zeigte ihm, wie nah sie einem Zusammenbruch war. »Craig wird jeden Moment nach Hause kommen. Ich sollte jetzt gehen.«
»Geh ruhig«, sagte er.
Megan zögerte. »Aber im Schlafzimmer herrscht völliges Chaos.«
»Darum kümmere ich mich schon.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist unfair, Dad. Ich … ich wollte nicht, dass du dich mit all dem belasten musst.«
»Ich werde nichts weiter tun, als alles ordentlich zusammenzulegen, es in die Kartons zu packen und sie in den Keller zu schaffen.«
»Willst du das wirklich tun?«, fragte sie unsicher.
Er nickte. Tatsächlich wollte er jetzt lieber allein sein.
Zögerlich machte sie sich auf den Weg ins Wohnzimmer und von dort zur Eingangstür. »Ich lasse dich nur äußerst ungern mit diesem Chaos allein …«
»Mach dir keine Sorgen deswegen.« Er war mehr als in der Lage, ein paar Kartons voller Kleidung wegzuräumen.
Langsam griff Megan nach ihrer Handtasche. »Hast du dir schon überlegt, was du zu Abend essen willst?«
Daran hatte er bisher noch keinen Gedanken verschwendet. »Ich werde mir eine Dose Chili warm machen.«
»Versprochen?«
»Natürlich.« Nicht, dass es ihm schaden würde, das Abendessen ausfallen zu lassen. Ihm war klar, dass er etwa neun Kilo zu viel mit sich herumschleppte. Die meisten überzähligen Pfunde hatten sich angesammelt, nachdem er Sandy ins Pflegeheim gebracht hatte. Von da an hatte er nur noch ziemlich planlos gegessen und war zum Stammkunden der örtlichen Fastfood-Ketten geworden. Von denen gab es nicht viele in Cedar Cove, aber die wenigen in der Stadt kannte er gut. Wegen seiner Arbeit und der Zeit, die sie ihn kostete, fiel häufig sein Frühstück und oft genug sogar sein Mittagessen aus. Dann kam er spät am Abend ausgehungert nach Hause und aß, was gerade schnell und leicht zu haben war. Das waren normalerweise kalorienreiche und industriell verarbeitete Lebensmittel. Er konnte sich nicht entsinnen, wann er sich zum letzten Mal einen bunten Salat zubereitet oder frisches Obst gegessen hatte.
Seit Sandys Tod hatte er sein emotionales Gleichgewicht verloren. Er fühlte sich leer. Wo seine Liebe zu Sandy gewesen war, gähnte ein Loch. Natürlich liebte er sie immer noch, aber die Pflichten und Verantwortlichkeiten, die mit dieser Liebe verbunden waren, gab es nicht mehr. In den letzten Jahren hatten sie einen Großteil seines Lebens ausgemacht.
Sandy war mit siebenundfünfzig Jahren gestorben – so sollte es einfach nicht sein. Er hätte derjenige sein sollen, der als Erster starb, schließlich hatte er einen gefährlichen Beruf. Praktisch jeden Tag kam ein Polizist im Dienst ums Leben. Er hätte vor seiner Frau sterben sollen. Sämtliche Statistiken sprachen dafür. Dann hätte Sandy bequem noch zehn oder zwanzig Jahre von seiner Pension leben können. Stattdessen war sie tot, und er stolperte ziellos durchs Leben.
»Ich rufe dich nachher an«, sagte seine Tochter auf dem Weg zur Haustür.
»In Ordnung.« Troy blieb auf der Veranda stehen und sah ihr nach, wie sie aus der Einfahrt fuhr. Er fühlte sich so ausgelaugt, dass es ihn unverhältnismäßig viel Energie kostete, ins Haus zurückzugehen und die Tür zu schließen.
Noch nie war ihm das Haus so leise vorgekommen. Er stand nahe der Türschwelle und staunte über die völlige Abwesenheit von Geräuschen. Die Stille um ihn herum war so drückend, dass sie regelrecht in den Ohren dröhnte. Im Allgemeinen schaltete er das Radio ein, um sie zu übertönen, oder, wenn es ganz schlimm war, sogar den Fernseher. Aber heute Abend schien das mehr Willenskraft zu fordern, als er aufzubringen vermochte.
Als er ins Schlafzimmer zurückging, in dem überall Sandys Kleidungsstücke verteilt lagen, kam ihm Grace Sherman in den Sinn. Grace Harding hieß sie jetzt, nachdem sie Cliff geheiratet hatte.
Komisch, dass er ausgerechnet jetzt an seine Freunde aus Highschoolzeiten denken musste. Und doch machte das durchaus Sinn. Ihm war etwas eingefallen, das sich kurz nach Dans Verschwinden ereignet hatte. Kaum zu glauben, dass das jetzt schon sechs Jahre zurücklag. Dan Sherman war ein Jahr nach seinem Verschwinden tot aufgefunden worden.
Troy hatte nie genau erfahren, was Dan in seine persönliche Hölle getrieben hatte, und er war auch nicht sicher, ob er das überhaupt wissen wollte. Vermutlich hatte es etwas mit Dans Erlebnissen in Vietnam zu tun. Der Krieg hatte ihn dauerhaft geschädigt. Nicht körperlich, aber geistig und seelisch. Dan wurde zu einem zurückgezogenen, unfreundlichen Einzelgänger, der nicht einmal mit anderen Vietnam-Veteranen wie Bob Beldon über seine Erinnerungen und Ängste reden mochte.
Als Dan verschwand, hatte Troy die Vermisstenanzeige aufgenommen. Ein paar Monate später wurde er von einer Nachbarin angerufen, die sich Sorgen um Grace machte. In ihrem Schmerz und ihrer Wut hatte sie Dans Kleidungsstücke in den Vorgarten ihres Hauses in der Rosewood Lane geworfen.
Während Troy nun in seinem Schlafzimmer stand, umgeben von Sandys Sachen, erinnerte er sich an den Anblick von Dans Kleidungsstücken, die kreuz und quer auf dem Rasen verstreut gelegen hatten – und er verstand die überwältigenden Emotionen, die Grace dazu gebracht hatten, sich auf für sie so untypische Weise auszutoben. Ein Teil von ihm wollte sich nicht mit den Nachwirkungen von Sandys Leben beschäftigen. Es war schon schmerzlich genug, sich von einem Tag zum nächsten zu schleppen.
Sein Blick fiel auf den rosa Pullover, den Megan ihm vorhin gezeigt hatte. Er nahm ihn in die Hand und drückte seine Nase in die weiche Wolle. Da war immer noch ein Hauch von dem Lieblingsparfüm seiner Frau, und er atmete ihn tief und gierig ein. Diesen Pullover hatte sie letztes Jahr an Ostern getragen. Troy hatte ihren Rollstuhl zu dem Gottesdienst unter freiem Himmel geschoben, der mit Blick auf die Bucht abgehalten wurde. Sandy war schon immer ein Morgenmensch gewesen, und sie war es bis zuletzt geblieben. Er hatte sie oft damit aufgezogen, dass sie mit einem Gute-Laune-Gen zur Welt gekommen sein musste.
Ihr Lächeln gehörte zu den Dingen, die er am meisten an ihr geliebt hatte. Ganz gleich, wie grummelig und mürrisch er morgens auch gewesen war, sie hatte stets fröhlich reagiert und ihn oft zum Lachen gebracht. Er schloss die Augen, als der Schmerz ihn durchzuckte. Nie wieder würde er Sandys Lächeln sehen, nie wieder ihre fröhliche Stimme hören.
Irgendwo im Haus klingelte das Telefon, und einen Moment war er versucht, den Anrufbeantworter anspringen zu lassen, damit der Anrufer eine Nachricht hinterließ – oder eben nicht. Aber die vielen Dienstjahre als Polizist machten es ihm unmöglich, ein klingelndes Telefon zu ignorieren.
Zu Troys Überraschung meldete sich seine Tochter.
»Dad«, sagte sie, »du hast recht. Behalte Moms Sachen erst einmal. Behalte sie alle.«
Er konnte hören, dass Megan geweint hatte.
»In Ordnung«, sagte er. »In Ordnung, Meggie.«
»Wenn du möchtest, komme ich morgen vorbei und packe noch den Rest zusammen.«
»Das mache ich schon«, versicherte er ihr. So schwer es ihm auch fallen würde, er konnte diese letzte Aufgabe besser bewältigen als seine Tochter. Megan hatte ihre innere Ruhe verloren, während er sich in einem Zustand von Benommenheit befand, die seinen Schmerz übertünchte.
3. Kapitel
Gegrilltes Hähnchen, grüner Salat, Knoblauchbrot – ein perfektes Abendessen für einen perfekten Sommertag. Als Dessert gemischte Beeren und Eis. Justine Gunderson genoss es, in aller Ruhe das Abendessen vorbereiten zu können.
Sie holte die zugedeckte Schüssel mit den Hähnchenbrustfilets in Sojasauce-Honig-Marinade aus dem Kühlschrank, wendete die Filets und stellte die Schüssel zurück. Wie viele ihrer Lieblingsrezepte stammte auch dieses von ihrer Großmutter Charlotte Jefferson Rhodes.
Leif, ihr inzwischen fast fünfjähriger Sohn, spielte unterdessen im Garten mit seiner Hündin Penny, einem Cockerspaniel-Pudel-Mischling. Die Hündin rannte hinter ihm her und bellte aufgeregt. Die ungetrübte Freude des Augenblicks brachte Justine zum Lächeln, als sie durch die Verandatür nach draußen trat. Schon bald würde Seth nach Hause kommen, und er würde das Hähnchenfleisch grillen, während sie letzte Hand an den Salat legte. Leif würde den Esstisch im Freien decken, denn er hatte große Freude daran, die Servietten und die bunten Tischsets auszulegen.
Bei der Vorstellung dieser kleinen häuslichen Szene erfüllte sie ein tiefer innerer Friede. Sogar jetzt, so viele Monate nach dem Brand, dem ihr Restaurant zum Opfer gefallen war, hatte Justine sich noch nicht ganz daran gewöhnt, einen ungestörten Abend zu dritt verbringen zu können.
Das Lighthouse hatte so viel ihres Lebens – ihrer aller Leben – in Beschlag genommen. Das Restaurant hatte ihre ganze Zeit und Energie beansprucht. Vor dem Brand sahen Justine und Seth einander kaum noch. Alles wurde stets in großer Hast und Eile erledigt, während sie sich gemeinsam den Pflichten widmeten, die ihnen der Restaurantbetrieb, der Haushalt und – ganz besonders wichtig – die Erziehung ihres Sohnes abverlangten. Glücklicherweise hatten sie sich bezüglich des neuen Restaurants, das sie eröffnen wollten, auf einen Kompromiss einigen können.
»Mommy, sieh mal!«, rief Leif und warf einen Stock für Penny.
Die Hündin schoss sofort los und rannte hinter dem Stock her. Sie packte ihn, duckte sich in geringer Entfernung, wedelte dabei wie wild mit dem Schwanz und forderte den Jungen auf, sich den Stock zu holen.
»Penny, bring ihn zu Leif!«, rief Justine.
»Sie ist genauso dickköpfig wie alle anderen Frauen in diesem Haus«, ertönte Seths Stimme hinter Justine. »Das heißt, wie die einzige andere Frau in diesem Haus.« Er schlang ihr die Arme um die Taille und küsste sie auf den Hals. Justine lehnte sich gegen ihren Mann, umfasste seine Hände und schloss die Augen, um den schönen Moment zu genießen.
»Ich habe dich gar nicht hereinkommen hören«, sagte sie.
»Daddy, Daddy!«, rief Leif und rannte über den frisch gemähten Rasen.
Seth griff nach seinem Sohn und hob ihn schwungvoll über seinen Kopf. »Wie ich sehe, bringst du Penny bei, wie man Fangen spielt.«
»Sie will mir einfach den Stock nicht wiedergeben.«
»Sie wird es lernen«, sagte Seth. »Komm, wir üben beide mit ihr.«
Während Seth und Leif mit Penny spielten, ging Justine ins Haus zurück, um ihrem Mann ein kaltes Getränk zu holen. Es klingelte an der Tür, und sie ließ das Glas Eistee stehen und beeilte sich, zu öffnen.
Vor der Tür stand ihre Großmutter, ihre große Handtasche an sich gedrückt, die von Leif »Granny-Tasche« genannt wurde. Darin transportierte sie immer ihr aktuelles Strickprojekt, eine Rolle Pfefferminzbonbons, einen Kamm und ein Notizbuch, aber weder Handy noch Kreditkarten. Erfreut, sie zu sehen, umarmte Justine ihre Großmutter fest.
»Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich einfach so hereinschneie«, sagte Charlotte, als Justine sie ins Haus geleitete. »Ich war gerade in der Nachbarschaft – na ja, ungefähr jedenfalls. Olivia sagte, du wolltest mit mir reden.«
»Grandma, du bist jederzeit willkommen. Das weißt du!«
»Schon, normalerweise würde ich dich trotzdem nicht unangemeldet besuchen, aber ich habe heute Nachmittag mit deiner Mutter geplaudert, und sie erwähnte, dass du mich nach Rezepten fragen wolltest.«
»Das stimmt.« Justine nahm Charlottes Hand, und gemeinsam gingen sie in die Küche.
»Ich wollte Seth gerade ein Glas Eistee bringen«, sagte sie. »Darf ich dir auch eins anbieten?«
»Ja, bitte.« Charlotte stellte ihre Handtasche auf einen leeren Stuhl und setzte sich. Heutzutage traf man sie nur selten ohne Ben an, den Mann, mit dem sie seit drei Jahren verheiratet war.
Als hätte sie Justines Gedanken gelesen, lieferte Charlotte eine Erklärung. »Ein alter Freund von Ben ist zu Besuch gekommen. Ich bin lange genug geblieben, um Ralph zu begrüßen, und habe mich dann entschuldigt. Das Gerede über die Zeit in der Marine ist mir einfach zu viel.« Sie holte ihr Strickzeug aus der Handtasche, um weiter an dem Pullover zu stricken, an dem sie gerade arbeitete. Charlotte hielt nicht viel von Untätigkeit.
Justine brachte zwei Gläser Eistee an den Tisch und setzte sich ihr gegenüber.
»Also, was kann ich für dich tun?«, wollte ihre Großmutter wissen. »Brauchst du Rezepte für die Teestube?«
»Ja.« Justine beugte sich vor und stützte beide Ellenbogen auf den Tisch. »Ich habe sehr viel darüber nachgedacht«, sagte sie. Obwohl die Bauarbeiten noch gar nicht begonnen hatten, wusste sie schon ganz genau, welche Art von Restaurant sie haben wollte. Die Speisekarte musste perfekt werden, und Justine konnte sich niemanden vorstellen, der sie besser beraten könnte als ihre Großmutter.
»Es ist eine gute Idee, gründlich vorauszuplanen.« Charlotte hielt beim Stricken inne und schaute sie an. »Olivia hat mir erzählt, dass du Frühstück, Lunch und Nachmittagstee anbieten möchtest und das Restaurant am Abend geschlossen sein wird.«
Justine nickte. »Seth und ich haben entschieden, dass wir unsere Abende lieber für uns haben wollen. Leif ist in den letzten Monaten richtig aufgeblüht, weil wir beide zu Hause sind.« Die Brandstiftung, der das Lighthouse zum Opfer gefallen war, hatte sich letztlich – und unerwartet – als Segen erwiesen, obwohl zunächst alles wie ein reiner Albtraum gewirkt hatte. Justine war dankbar, dass niemand verletzt worden oder gar ums Leben gekommen war. Und sie war dankbar, dass dieses Verbrechen ihr Leben positiv verändert hatte.
»Es ist klug von euch, der Familie oberste Priorität einzuräumen.«
Justine vermutete, ihre Ehe hätte kein Jahr mehr gehalten, so schnell, wie Seth und sie sich entfremdet hatten. Sie warf einen Blick hinaus in den Garten, wo er mit ihrem Sohn und Penny herumtollte.
»Du sagtest, du hättest mit Mom gesprochen. Warst du heute bei Gericht?« Ihre Großmutter sah Justines Mutter gern bei der Arbeit zu. Dann saß sie stolz in Olivias Gerichtssaal und strickte fleißig, obwohl ihre Besuche seit ihrer Heirat mit Ben seltener geworden waren.
»Nein, ich bin ihr heute Morgen in der Stadt begegnet. Sie war auf dem Weg zu einem Arzttermin.«
Justine erschrak. Sie konnte sich nicht entsinnen, dass ihre Mutter davon etwas erwähnt hatte. Dabei redeten sie fast jeden Tag miteinander. »Oh.«
»Es ist nichts Ernstes«, setzte Charlotte rasch hinzu. »Nur eine Routineuntersuchung«, sagte sie. »Eine Mammografie.«
»Oh, gut.« Justine entspannte sich wieder, schlug die Beine übereinander und griff nach ihrem Eistee. »Ich hätte gern ein paar von deinen Rezepten, Grandma«, begann sie.
»Denkst du an ganz bestimmte?« Charlotte strickte längst weiter, und ihre Finger waren sichtlich geübt im Umgang mit Nadeln und Garn.
»Ich hoffe auf dein Scones-Rezept.« Die Scones gehörten seit Langem zu den Lieblingsrezepten der Familie, und Charlotte buk sie zu nahezu jedem Familientreffen.
Charlotte wirkte erfreut. »Die mit Käse und Kräutern mag ich am liebsten.«
»Ich auch.«
Ihre Großmutter hielt nachdenklich inne. »Meine Mutter hat schon diese Scones gebacken. Das Rezept stammt also ursprünglich von ihr. Ich habe noch ein paar weitere Scones-Rezepte auf Lager, die ich dir ebenfalls aufschreiben werde. Clyde mochte ganz besonders die Walnuss-Butter-Scones. Ben bevorzugt die Käse-Kräuter-Variante.«
»Danke«, sagte Justine, »aber es reicht mir schon, sie selbst abzuschreiben, wenn …« Schlagartig kam ihr der Gedanke, dass ihre Großmutter all diese Familienrezepte nur im Kopf gespeichert haben könnte. Womöglich hatte sie sie noch nie aufgeschrieben.
»Ich bringe sie dir morgen früh vorbei«, fuhr Charlotte fort. »Weißt du, du kannst gern alle meine Rezepte haben, Liebes. Sag mir einfach nur, welche du haben möchtest.«
»Grandma«, setzte Justine vorsichtig an. »Du hast die Rezepte doch irgendwo aufgeschrieben, oder?«
Charlotte lachte. »Du lieber Himmel, nein.«
»Nein!«
»Ich koche und backe seit über siebzig Jahren. Die Rezepte hat meine Mutter mir beigebracht, und, nun ja, ich habe es nie für nötig gehalten, sie aufzuschreiben. Die vergesse ich doch nie im Leben.«
»Was ist mit dem Himbeeressig-Dressing für Salat?«
»Ach, das«, meinte Charlotte seufzend. »Das habe ich aus einem Zeitungsartikel von etwa 1959. Ich habe es im Laufe der Jahre verändert.«
»Grandma, würdest du sie für mich aufschreiben? Allesamt?«
»Aber natürlich.« Ihre Stricknadeln klapperten leise, während sie weiterstrickte. »Das ist übrigens ein ausgezeichneter Vorschlag, Justine. Ich bin sicher, dass er Ben auch gefallen wird. Er sagt nämlich immer, ich sollte ein Kochbuch herausbringen, weißt du. Er liebt meine Erdnussbutter-Cookies«, brüstete sie sich.
»Und deine Zimtbrötchen.«
»Ich glaube, der Mann hat mich geheiratet, weil ich für ihn backe.«
Justine musste über diese absurde Bemerkung lachen. Jeder, der auch nur einen Blick auf Ben Rhodes warf, konnte sehen, dass er bis über beide Ohren in ihre Großmutter verliebt war.
»Und jetzt erzähl mir mehr von deiner Teestube«, sagte Charlotte.
Sie lächelte. »Nun, da gibt es eine Planänderung.«
»Oh?« Ihre Großmutter hielt kurz beim Stricken inne.
Justine setzte beide Füße auf den Boden und beugte sich vor. »Seth und ich konnten niemandem davon erzählen, bis alle Einzelheiten geregelt waren. Der Bauunternehmer, Al Finch, hat vor ein paar Wochen Kontakt mit uns aufgenommen und gefragt, ob wir bereit wären, das Grundstück zu verkaufen. Er sagte, er hätte möglicherweise einen Käufer dafür.«
Einen Moment schwieg Charlotte überrascht. »Ich dachte, du und Seth, ihr wolltet nicht verkaufen?«
»Das stimmt, schon gar nicht, wenn das zur Folge hätte, dass am Wasser ein Fastfood-Restaurant gebaut wird. Aber das ist das Beste an der Sache, Grandma. Der Mann, der an dem Grundstück Interesse gezeigt hat, Brian Johnson, ist mit Al befreundet. Er hat im Laufe der Jahre schon mehrere Restaurants geführt. Eigentlich hat er sich zur Ruhe gesetzt, aber ihm ist langweilig. Seth und ich haben uns mit ihm getroffen, und er hat uns beide beeindruckt. Brian sagte, er würde das Lighthouse gern so wieder aufbauen, wie es war. Sogar den Namen möchte er beibehalten.«
»Aber das war euer Restaurant«, protestierte Charlotte.
»Richtig, aber er ist bereit, uns für den Namen und alles andere zu bezahlen.«
Ihre Großmutter schwieg erneut, als müsste sie diese Neuigkeiten erst einmal verdauen. »Werdet ihr das tun? Und was ist mit der Teestube? Wo wollt ihr das bauen?«
Justine erklärte ihr, dass Al Finch ihnen ein Geschäftsgrundstück nahe der Heron Avenue gezeigt hatte, das ihm gehörte und das er verkaufen wollte. Die Lage war perfekt geeignet für die viktorianische Teestube. »Wir haben die Verträge Anfang der Woche unterzeichnet.«
Wieder herrschte einen Moment lang Schweigen.
»Du bist doch hoffentlich nicht von uns enttäuscht, Grandma?«
»Nein«, versicherte Charlotte. »Ich halte das für wunderbare Neuigkeiten.«
Genauso ging es Justine. Die ganze harte Arbeit, die sie ins Lighthouse gesteckt hatten, würde so doch nicht vergebens gewesen sein. Seth hatte dem neuen Eigentümer Vorschläge unterbreitet, wie er das Restaurant wiederaufbauen könnte, und jetzt, da sie selbst nichts mehr damit zu tun hatte, freute sie sich bereits darauf, zu sehen, wie es aus der Asche neu auferstehen würde.
»Das ging alles so schnell.«
»Das stimmt«, sagte Justine und nickte, »aber es fühlt sich richtig an. Das neue Grundstück ist viel besser für eine Teestube geeignet, und es gibt mehr Parkplätze dort. Ich kann immer noch nicht ganz glauben, wie uns all das praktisch in den Schoß gefallen ist.«
»Ich freue mich für euch beide«, sagte ihre Großmutter.
»Ich freue mich auch.« Sehnsüchtig schaute Justine hinaus in den Garten. Der Anblick von Seth und Leif erfüllte sie mit Zufriedenheit und innerer Ruhe. Das hatte sie sich immer gewünscht, genau das hatte sie sich für ihre Ehe erhofft.
»Ich sollte mich auf den Heimweg machen«, meinte Charlotte. »Ben fragt sich bestimmt schon, wo ich bleibe.« Sie trank ihren Eistee aus, verstaute das Strickzeug in ihrer Tasche und stand auf.
»Es war schön, dich zu sehen, Grandma.«
»Das finde ich auch, mein Schatz.« Sie küsste Justine auf die Wange. »Ich fange an, diese Rezepte aufzuschreiben. Und ich werde mein Bestes geben, mich an alle zu erinnern, aber wenn ich eines vergessen sollte, sag’s mir bitte.« Sie runzelte die Stirn. »Am besten schaue ich auch die durch, die ich aus Zeitschriften ausgeschnitten habe. Und natürlich die, die ich während der Totenwachen bekommen habe.«
»Stammt dein fantastisches Kokosnuss-Kuchen-Rezept nicht auch von einer Totenwache?«
»Ja – Mabel Austins Totenwache. Das war 1982.«
Justine musste grinsen, aber vermutlich war ein tolles Rezept nicht die schlechteste Erinnerung, die an einen Menschen blieb.
»Ich geh nur noch mal kurz in den Garten und sage Seth und Leif Hallo«, murmelte Charlotte, als sie ihr leeres Glas zur Spüle brachte. »Meine Güte, der junge Mann wächst vielleicht. Ich habe ihn viel kleiner in Erinnerung.«
»Seth oder Leif?«, fragte Justine lachend. Es stimmte, Leif war groß für sein Alter, aber sein Vater war ja auch ein großer Mann.
»Leif natürlich«, erwiderte ihre Großmutter, die den Witz offenbar nicht verstanden hatte.
»Ach, übrigens …« Justine öffnete die Verandatür. »Wir grillen heute Abend Hähnchen, und zwar nach einem Rezept, das ich von dir habe.«
»Das mit der Marinade aus Sojasauce und Honig? Das habe ich auch einer Totenwache zu verdanken.«
Justine musste lächeln. »Wessen Totenwache? Weißt du das noch?«
»Selbstverständlich«, gab Charlotte würdevoll zurück. »Norman Schultz. 1992. Oder war es 1993?« Damit trat sie in den Garten hinaus.
Penny und Leif rannten sofort auf sie zu. Leif, der genau wusste, dass er seine Großmutter nicht zu stürmisch begrüßen durfte, hielt rechtzeitig an und blieb stehen, um Charlotte die Gelegenheit zu geben, ihn zu umarmen. Penny dagegen kannte keine Zurückhaltung. Mit einem scharfen Kommando brachte Seth die Hündin dazu, sich zu setzen, bevor sie Charlotte anspringen konnte. Charlotte plauderte ein wenig mit Leif und beugte sich dann vor, um Penny zu streicheln. Schließlich winkte sie Justine ein letztes Mal zu, und Seth begleitete sie zu ihrem Auto.
»Ist der für mich?«, fragte er, als er in die Küche zurückkam, und deutete auf das Glas Eistee auf dem Küchentresen.
»Oh, tut mir leid«, erwiderte Justine. »Ich wollte ihn dir gerade nach draußen bringen, als meine Großmutter geklingelt hat.« Sie holte einen Eiswürfelbehälter aus dem Gefrierschrank. »Hier, ich gebe noch etwas Eis dazu.«
»Danke«, sagte Seth und trank durstig von dem Tee. »Hast du ihr erzählt, dass wir das Grundstück verkauft haben?«
»Habe ich.«
»Was hält sie davon?«
Justine grinste. »Sie findet es zu schön, um es in Worte zu fassen.«
Seth nahm noch einen Schluck Tee. Die Eiswürfel in dem Glas klimperten leicht, als er es absetzte. »Deine Mutter und Jack wissen Bescheid, nicht wahr?«
»Ich habe es ihr heute Morgen gesagt. Apropos …« Justine wurde nachdenklich.
»Ja?«, hakte Seth nach.
»Sie hat mir nicht gesagt, dass sie einen Termin beim Arzt hatte.«
»Ach? Hätte sie das tun sollen?«
»Nein, vermutlich nicht, aber ich frage mich …« Sie vermutete, dass es einen Grund gab, warum ihre Mutter nicht wollte, dass sie von dem Termin erfuhr, und das beunruhigte sie. Charlotte hatte zwar von einem Routinetermin gesprochen, aber rechnete Olivia womöglich mit schlechten Nachrichten?
Als hätte er ihr Unbehagen gespürt, legte Seth ihr den Arm um die Taille. Sie war so froh und dankbar, ihren Mann wiederzuhaben. Die Brandstiftung hatte ihn für kurze Zeit in einen zornigen, rachsüchtigen Menschen verwandelt, aber nachdem Warren Saget – ein ortsansässiger Bauunternehmer und früherer Freund von Justine – verhaftet worden war, war ihm eine große Last von den Schultern gefallen, und Seth war wieder zu dem Mann geworden, den sie kannte und liebte.
Er hielt sie einen langen Moment im Arm, als ginge auch ihm gerade durch den Kopf, dass sie beinahe alles zerstört hätten, was ihnen wichtig war.
»Soll ich den Grill anheizen?«, fragte er, als er sie losließ.
»Ja, bitte.«
»Kann ich auch helfen, Mommy?« Leif betrat die Küche, Penny folgte ihm auf den Fersen.
»Natürlich kannst du.« Lächelnd sah Justine ihren Sohn an. »Du kannst mir helfen, den Tisch zu decken – sowie du dir die Hände gewaschen hast.«
»Okay.«
Sie gingen gemeinsam nach draußen, und während Seth sich um den Grill kümmerte, wischten Justine und Leif die Glasplatte des Tisches sauber und richteten den Sonnenschirm aus. Leif machte es sichtlich Spaß, die hellgrünen Tischsets, für die er sich entschieden hatte, und die Servietten mit den bunten Schmetterlingen sorgfältig auf dem Tisch auszulegen.
Nach dem Essen räumten Seth und Leif den Tisch ab. Justine kümmerte sich um die Essensreste und räumte die Küche auf. Bis vor Kurzem war ihr gar nicht klar gewesen, wie sehr es ihr gefehlt hatte, selbst zu kochen. Sie war immer davon ausgegangen, dass Kochen nicht unbedingt ihre Stärke war, anders als bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter, die gern in der Küche standen. Dann hatte sie Seth geheiratet, und in den ersten Monaten, während sie das alte Captain’s Galley renovierten und Pläne für ihr neues Lighthouse Restaurant schmiedeten, hatte sie es sich nicht nehmen lassen, die Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Rezepte und Ideen holte sie sich von Olivia und Charlotte, und zum ersten Mal seit sie eine erwachsene Frau war, hatte sich ein so enges Verhältnis zu ihrer Mutter entwickelt, wie sie es vorher nie für möglich gehalten hätte. Ihre Beziehung zu ihrer Großmutter war schon immer gut gewesen, aber auch sie waren noch enger zusammengewachsen.
»Ich habe mit Großmutter über einige ihrer Rezepte gesprochen«, sagte sie.
»Rezepte?«, fragte Seth zurück, während er sich die Hände wusch. »Für die Teestube?«
Sie nickte. »Weißt du, ich habe wiederentdeckt, wie gern ich koche.«
Seth blinzelte überrascht. »Moment mal. Sagtest du gerade, dass du gern kochst?«
»Ja.« Sie verdrehte die Augen, weil er so schockiert tat.
»Dann verrate mir doch mal, wer eigentlich heute Abend die ganze Zeit am heißen Grill stand?«
»Seth Gunderson, ein paar Hähnchenbrustfilets auf dem Grill zu wenden, ist kein Kochen.«
»Das sehe ich aber anders.«
»Du verhältst dich lächerlich.«
»Tue ich nicht.« Er lachte, umfasste ihre Taille und zog sie an sich.
Justine lachte ebenfalls. Jetzt würde alles besser werden, ach was, das war es schon.
4. Kapitel
Im Kosmetiksalon Get Nailed stopfte Rachel Pendergast eine Ladung Handtücher in die Waschmaschine, gab Waschmittel dazu, schloss die Tür der Maschine und schaltete sie ein. Einen Moment wartete sie, bis sie sicher sein konnte, dass Wasser einlief. Sie nutzte die Gelegenheit, die ihr eine kurze Verschnaufpause zwischen zwei Kundinnen bot, um sich um die Schmutzwäsche zu kümmern, eine Arbeit, die täglich erledigt werden musste. Als sie den kleinen Pausenraum verließ, entdeckte sie ihre beste Freundin Teri, die auf dem Stuhl an ihrem Arbeitsplatz auf sie wartete.
»Teri!« Rachel freute sich ungemein, ihre Freundin zu sehen. Ihre letzte Begegnung lag noch keinen ganzen Monat zurück, aber die Zeit fühlte sich für sie länger an. Ihr fehlte nicht nur Teri, sondern auch ihr Freund. Nate war Marineoffizier und kürzlich nach San Diego versetzt worden.
Teri stand auf und breitete die Arme aus. Die beiden Freundinnen drückten einander und kicherten dabei wie Teenager. Ohne Teris freche Sprüche und ihren beißenden Humor war der Salon einfach nicht mehr derselbe wie früher. Rachel vermisste es, mit ihr über Nate zu reden. Und über Bruce.
»Gott sei Dank kommst du wieder zur Arbeit!«, rief Rachel und schaute sie prüfend an. »Du kommst doch wieder, richtig?«
»Wir werden sehen. Erst einmal muss ich mit Jane reden.«
Rachel war sicher, dass Teri problemlos wieder eingestellt werden würde. »Jane ist zur Bank gegangen. Sie müsste gleich wieder hier sein.«
Rachel verstand nicht wirklich, warum Bobby darauf bestanden hatte, dass Teri ihren Job aufgab. Sie wusste zwar, dass Teri irgendwie bedroht worden war, vermutete aber, dass es dabei in Wirklichkeit mehr um Bobby ging.
Zwei Männer hatten sich Teri auf dem Parkplatz in den Weg gestellt, und kurz darauf hatte Bobby sie gebeten, nicht mehr im Get Nailed zu arbeiten, bis er die Angelegenheit geregelt hatte. Jane hatte zwar einen perfekt geeigneten Ersatz für sie gefunden, aber die neue Angestellte war einfach nicht Teri.
»Es ist mir endlich gelungen, Bobby davon zu überzeugen, dass ich verrückt werde, wenn ich nicht wieder arbeiten gehe«, erklärte Teri und lächelte dabei Jeannie an, die neben ihnen einer jungen Frau die Haare schnitt.
»Wo ist Bobby?«
»Zu Hause. Ich liebe diesen Mann über alles, aber seinen übertriebenen Beschützerinstinkt ertrage ich einfach nicht mehr.« Sie hielt inne und warf einen Blick über die Schulter. »Ich konnte ihn nur unter einer Bedingung dazu bringen, kein Drama daraus zu machen: Ich musste ihm versprechen, mich von James zur Arbeit und wieder nach Hause fahren zu lassen. James soll meinen Bodyguard spielen.«
»James?« Ungläubig schaute Rachel sie an. Bobbys Chauffeur war kein Bodyguard – vor allem, weil er dünn wie eine Bohnenstange war und kein bisschen muskulös. Wenn Teri tatsächlich in Gefahr geraten sollte, würde sie wahrscheinlich eher James retten.
»Kannst du also heute Nachmittag bleiben?«
»Kann ich – bis ich mit Jane gesprochen habe. Danach muss ich wieder nach Hause. Sonst schickt Bobby womöglich ein Suchkommando los.« Sie lachte über ihren eigenen Witz. »Er ist nicht besonders angetan davon, dass ich wieder arbeite, aber er versteht, dass ich meinen Job mag und hier sein will.«
»Ich bin froh, dass er sich entschieden hat, vernünftig zu sein.«
»Ich auch, das kannst du mir glauben«, seufzte Teri erleichtert.
Rachel musterte ihre Freundin genauer, verblüfft, wie liebenswert sie war. Sie war immer impulsiv, gesellig und unverschämt gewesen, außerdem auch ein wenig zynisch, insbesondere, was Männer und Beziehungen anging. Und dann war sie Bobby Polgar begegnet. Im Grunde war sie noch dieselbe, die eigentlich immer im Mittelpunkt stand, und doch hatte sie sich in den letzten Monaten verändert. Sie ist … weicher geworden, dachte Rachel. Hoffnungsvoller, weniger zynisch, und all das ist Bobbys Verdienst.
Nur Liebe konnte erklären, dass zwei so völlig verschiedene Menschen zueinandergefunden hatten. Eine tiefe, echte Liebe, eine Liebe, die Menschen zum Guten wandelte, eine Liebe, die auf Akzeptanz und Vertrauen beruhte. Wenn Bobby mit Teri zusammen war, erwachte er zum Leben. Jeder, der ihm jemals begegnet war oder ihn über ein Schachbrett gebeugt gesehen hatte, würde sofort zugeben, dass er ein Genie war. Darüber hinaus ist er aber auch ein bisschen …, sie suchte nach einem passenden Wort, … exzentrisch. Mit Teri wurde er menschlich, liebenswert und gelegentlich sogar witzig. Obwohl er das meistens nicht einmal beabsichtigte – er war einfach auf eine sympathische Weise naiv.
Ob Nate und sie eine solche Liebe wie Teri und Bobby füreinander empfanden, wusste sie nicht. Vermutlich brauchten sie mehr Zeit, und die erzwungene Trennung erleichterte ihre Situation nicht gerade.
»Also«, begann Teri, setzte sich wieder auf den Frisierstuhl und schlug die Beine übereinander. »Schieß los, was gibt es Neues? Fehlt dir Nate?«
Rachel nickte. »Sehr«, sagte sie. Ohne ihn fühlte sie sich leer. Es half, dass sie miteinander telefonieren konnten, aber es reichte nicht. »Er ruft mich fast jeden Tag an.«
»So wie Bobby mich früher?«, wollte Teri wissen.
Rachel lachte. »Nicht ganz. Nate ruft an, wenn er kann, und das heißt normalerweise abends.« Als Bobby und Teri einander gerade kennengelernt hatten, hatte der Schachprofi absolut zuverlässig immer zur selben Uhrzeit angerufen, nach Pazifischer Zeit wohlgemerkt, ganz gleich, wo er sich gerade aufhielt.
»Was ist mit Bruce?«
»Was soll mit ihm sein?«, fragte Rachel schärfer als beabsichtigt zurück.
»Triffst du dich mit ihm?«