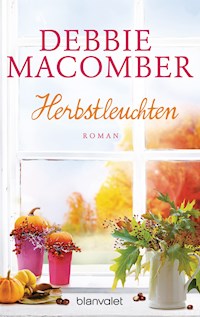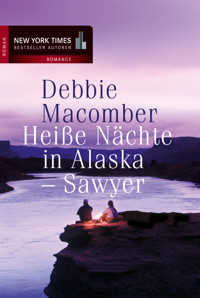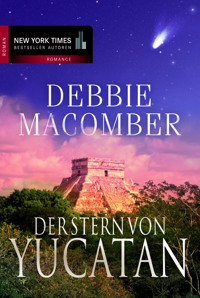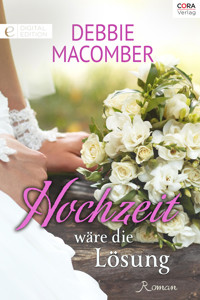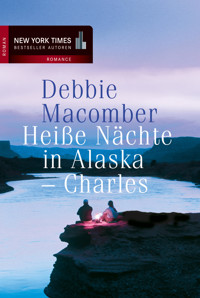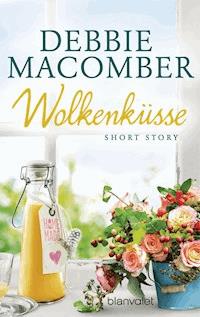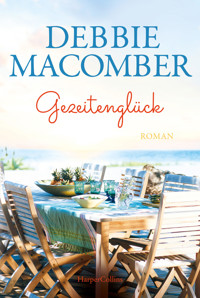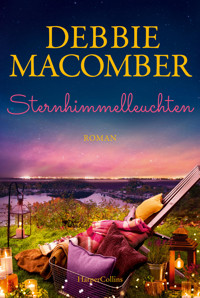8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ROSE HARBOR-REIHE
- Sprache: Deutsch
Wer Nora Roberts mag, wird Debbie Macomber lieben!
Nach einem schweren Schicksalsschlag beschließt Jo Marie Rose, noch einmal neu zu beginnen um endlich ihren Frieden zu finden. Sie zieht in das beschauliche Küstenörtchen Cedar Cove und eröffnet ein gemütliches kleines Bed and Breakfast – das Rose Harbor Inn. Bald schon kann sie ihre ersten Gäste begrüßen, die beide aus Cedar Cove stammen – Abby Kincaid und Joshua Weaver. Dass beide nicht ganz freiwillig in ihre Heimatstadt zurückkehrten, merkt Jo Marie sehr schnell. Ein turbulentes Wochenende steht ihnen bevor, doch am Ende schöpfen alle drei neue Hoffnung für die Zukunft …
Die Rose-Harbor-Reihe:
Band 1: Winterglück
Band 2: Frühlingsnächte
Band 3: Sommersterne
Band 4: Wolkenküsse (Short Story)
Band 5: Herbstleuchten
Band 6: Rosenstunden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
DEBBIEMACOMBER
Winterglück
Roman
Aus dem Amerikanischen von Nina Bader
Die Originalausgabe erschien 2012
unter dem Titel »The Inn at Rose Harbor« bei Ballantine Books,
an imprint of The Random House Publishing Group,
a division or Random House, Inc., New York
Dieser Roman ist unter dem Titel »Rose Harbor und der Traum vom
Glück« bereits bei Blanvalet erschienen.
1. Auflage
Neuveröffentlichung Dezember 2015 bei Blanvalet Verlag,
einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2012 by Debbie Macomber
Copyright © 2014 für die deutsche Ausgabe
by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House, München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Flora Press
Redaktion: Ulrike Nikel
LH ∙ Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-17108-7
www.blanvalet.de
Für meine besonderen Freunde vom Knitter’s Magazine
und von der Stitches Conferences,
Benjamin Levisay und Rick Mondragon
1
Letzte Nacht träumte ich von Paul.
Meine Gedanken kreisen zwar fast ständig um ihn, und kein Tag vergeht, an dem er nicht bei mir ist, aber bis jetzt ist er mir noch nie im Traum erschienen. Vermutlich liegt eine gewisse Ironie darin, dass er mir nachts fernbleibt, denn sobald ich die Augen schließe, male ich mir aus, wie es sich anfühlen würde, von seinen Armen gehalten zu werden. Und bevor ich in den Schlaf hinübergleite, stelle ich mir vor, dass mein Kopf an seiner Schulter ruht. Doch ich werde nie wieder die Gelegenheit bekommen, mit meinem Mann zusammen zu sein.
In diesem Leben nicht mehr.
Falls ich vorher schon einmal von Paul geträumt haben sollte, waren diese Träume beim Erwachen bereits vergessen. Diesmal jedoch blieb jede Einzelheit in meinem Gedächtnis haften und erfüllte mich gleichermaßen mit Trauer und Freude.
Als ich erfuhr, dass Paul ums Leben gekommen war, überwältigte mich der Schmerz so vollkommen, dass ich daran zu zerbrechen glaubte. Aber das Leben ging weiter, und so schleppte ich mich von einem Tag zum nächsten, bis ich irgendwann feststellte, dass ich wieder normal atmen konnte.
Jetzt bin ich in meinem neuen Zuhause, einem hübschen Bed & Breakfast in einer malerischen Küstenstadt namens Cedar Cove, die auf der Kitsap-Halbinsel liegt. Nicht weit entfernt von Seattle im Bundesstaat Washington. Vor weniger als einem Monat habe ich die Pension gekauft und sie Rose Harbor Inn genannt.
»Rose« nach Paul Rose, mit dem ich nur ein paar Monate verheiratet war – jenem Mann, den ich immer lieben und um den ich für den Rest meines Lebens trauern werde. Und »Harbor«, weil das Haus für mich ein Hafen ist, in dem ich vor Anker gegangen bin. Ich erhoffe mir von diesem Ort Linderung meines Kummers über den erlittenen Verlust und Frieden, nachdem die Stürme des Lebens mich unbarmherzig gebeutelt haben.
Wie melodramatisch das klingt, und dennoch scheint es mir angemessen. Obwohl ich am Leben bin und normal funktioniere, fühle ich mich manchmal, als wäre ich halb tot. Paul würde es hassen, mich so reden zu hören, und doch entspricht es der Wahrheit. Ich bin im letzten April mit ihm an irgendeinem Berghang in einem Land am anderen Ende der Welt gestorben, wo er für die Sicherheit unserer Nation kämpfte.
Das Leben, wie ich es bis dahin kannte, war von einer Minute auf die nächste vorüber, und die Zukunft, die ich mir erträumt hatte, wurde mir gestohlen.
Ich erhielt jede Menge gut gemeinte Ratschläge, wie man sie Trauernden zu geben pflegt. Ich solle ein Jahr warten, bevor ich folgenschwere Entscheidungen treffe, rieten meine Freunde. Sie warnten, ich würde es bereuen, wenn ich meinen Job kündigte und meine Heimatstadt Seattle verließ, um woanders Vergessen zu suchen.
Sie verstanden nicht, dass ich keinen Trost im Vertrauten und in der Alltagsroutine fand. Trotzdem verschob ich ihnen zuliebe meine Pläne und harrte sechs Monate aus. Während dieser Zeit besserte sich meine seelische Verfassung nicht, und der Wunsch, fortzugehen und noch einmal von vorn anzufangen, wurde immer mächtiger. Meine Überzeugung, nur so Frieden finden und den furchtbaren Schmerz in meinem Innern betäuben zu können, verfestigte sich zur Gewissheit.
Entschlossen startete ich meine Suche nach einem neuen Leben, informierte mich im Internet über eine Reihe von Orten in allen möglichen Gegenden der Vereinigten Staaten. Um zu meiner Überraschung das, was ich mir vorgestellt hatte, sozusagen direkt vor der Haustür zu finden.
Cedar Cove liegt gegenüber von Seattle auf der anderen Seite des Pudget Sound und in der Nähe von Bremerton, wo sich ein Marinestützpunkt und eine Marinewerft befinden. Die kleine Stadt selbst hat eine Marina für Segel- und Motorboote und einen Jachtclub. Als ich das Inserat entdeckte, mit dem eine bezaubernde kleine Pension zum Verkauf angeboten wurde, begann mein Herz zu rasen. Ich und ein Bed & Breakfast?
Nie wäre mir je zuvor der Gedanke gekommen, ein wie auch immer geartetes Geschäft zu übernehmen, aber ich erkannte instinktiv, dass es genau das war, was ich brauchte und mir Ablenkung verschaffte. Hinzu kam als zusätzlicher Anreiz, dass ich schon immer gern Gäste bewirtet hatte.
Das Haus mit der rundherum verlaufenden Veranda war bezaubernd und der Blick über die ganze Bucht einfach atemberaubend. In einem anderen Leben hätte ich mir vorgestellt, wie Paul und ich nach dem Abendessen auf der Veranda säßen, Kaffee trinken und über unseren Tag und unsere Träume sprechen würden. Das ins Internet gestellte Foto musste von einem Profi aufgenommen worden sein, dachte ich, denn kein einziger Mangel ließ sich erkennen.
Konnte etwas überhaupt dermaßen vollkommen sein?
Ja, es war möglich.
Als ich nämlich wenige Tage später mit Jody McNeal, der Maklerin, in die Auffahrt einbog, schlug mich der Charme des Hauses sofort in den Bann. Mit dem Licht, das durch die großen, auf die Bucht hinausgehenden Fenstern eindrang, war dieses B & B der perfekte Ort, um ein neues Leben zu beginnen. Ich fühlte mich hier auf Anhieb wie zu Hause.
Auch bei meinem Rundgang, den ich mit Jody absolvierte, blieben keine Fragen offen. Ich war dazu bestimmt, diese Pension zu besitzen – es war, als hätte sie die ganze Zeit nur auf mich gewartet. Acht Gästezimmer verteilten sich über den ersten und zweiten Stock, und im Erdgeschoss befanden sich eine große, modern ausgestattete Küche und daneben ein geräumiger Speise- und Aufenthaltsraum. Unterhalb des Hauses verlief die Harbor Street, die sich, zu beiden Seiten von Geschäften gesäumt, durch den Ort wand. Ich spürte den Reiz dieses Städtchens schon, bevor ich Gelegenheit bekam, die Umgebung zu erkunden.
Was mich indes am meisten anzog, das war die Aura von Frieden, die diesen Ort einhüllte. Der nagende Kummer, der mich ständig begleitete, schien nachzulassen, der Schmerz, der mich all diese Monate gepeinigt hatte, erträglich zu werden. Unvermittelt empfand ich eine heitere Ruhe, einen stillen Seelenfrieden, der sich schwer beschreiben lässt.
Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass die Erinnerungen mich erneut überwältigten und meine Augen sich mit Tränen füllten, als wir den Rundgang beendeten. Zum Glück ignorierte die Maklerin den Gefühlsaufruhr, mit dem ich zu kämpfen hatte.
»Was halten Sie davon?«, fragte Jody stattdessen erwartungsvoll.
Ich hatte während der gesamten Besichtigung weder ein Wort gesagt noch eine Frage gestellt.
»Ich nehme das Haus.«
Jody beugte sich vor, als hätte sie mich nicht richtig verstanden. »Wie bitte?«
»Nun, ich werde Ihnen ein Angebot machen«, sagte ich entschlossen und mit fester Stimme, denn zu diesem Zeitpunkt gab es für mich keine Zweifel mehr.
Der geforderte Preis war zudem fair – ich war bereit, den Schritt zu wagen.
Die Maklerin ließ fast den Schnellhefter mit den detaillierten Informationen fallen.
»Möchten Sie nicht erst darüber nachdenken?«, schlug sie vor. »Das ist immerhin eine bedeutende Entscheidung, Jo Marie. Verstehen Sie mich nicht falsch: Natürlich bin ich sehr an einem Abschluss interessiert – nur hatte ich noch nie einen Kunden, der eine so wichtige Entscheidung dermaßen … schnell getroffen hat.«
»Ich schlafe darüber, wenn es Sie beruhigt, aber eigentlich bin ich mir meiner Sache ganz sicher. Diese Pension ist genau das, wonach ich suche.«
Sobald meine Familie erfuhr, dass ich meinen Job bei der Columbia-Bank kündigen und ein B & B kaufen wollte, versuchten alle, mir diesen Plan auszureden. Vor allem mein Bruder Todd, ein Ingenieur. Ich hätte mich immerhin bis zur stellvertretenden Filialleiterin hochgearbeitet, argumentierte er, und würde eine vielversprechende Karriere wegwerfen. Er spielte darauf an, dass irgendwann meine Beförderung zur Geschäftsführerin anstand. Schließlich war ich seit fast fünfzehn Jahren bei der Bank, hatte mich als gute, zuverlässige Angestellte bewährt, und dementsprechend rosig sahen meine Aufstiegschancen aus.
Wie auch die anderen in meiner Umgebung begriff mein Bruder nicht, dass mein altes Leben ebenso endgültig vorbei war wie die Zukunft, die ich mir gewünscht und ausgemalt hatte. Nichts würde mehr so sein wie früher. Ich konnte damit nur abschließen, indem ich ganz neu anfing.
Am nächsten Tag gab ich ein Gebot ab, ohne auch nur einen Moment lang an der Richtigkeit meiner Entscheidung zu zweifeln. Die Frelingers, so der Name der bisherigen Eigentümer, akzeptierten umstandslos, und wenige Wochen später, kurz vor den Ferien, trafen wir uns, um den ganzen lästigen Papierkram zu erledigen. Ich überreichte ihnen einen Bankscheck und erhielt im Gegenzug die Schlüssel. Gäste wurden keine mehr erwartet, da die Vorbesitzer die letzten Dezemberwochen bei ihren Kindern verbringen wollten und keine Reservierungen mehr entgegengenommen hatten.
Nachdem alles geregelt und umgeschrieben war, machte ich noch einen Abstecher zum Gericht und beantragte eine Änderung des Namens in Rose Harbor Inn. Dann kehrte ich nach Seattle zurück und reichte am nächsten Tag bei der Bank meine Kündigung ein.
Die Weihnachtsferien verbrachte ich damit, mein Apartment auszuräumen und den Umzug auf die andere Seite des Sunds vorzubereiten. Obwohl ich nur ein paar Meilen wegzog, hätte es das andere Ende des Landes sein können. Cedar Cove war in der Tat eine andere Welt – ein idyllischer, entlegener Ort fernab der Großstadthektik.
Erwartungsgemäß reagierten meine Eltern enttäuscht, weil ich sie dieses Jahr nicht nach Hawaii begleiten würde, eine alte Familientradition für die Weihnachtsferien. Aber ich hatte mit dem Umzug viel zu tun, musste meine und Pauls Sachen durchsehen und die Möbel verkaufen. Mir war es nur recht, dass ich nicht wusste, wo mir der Kopf stand, denn die Arbeit lenkte mich von der bedrückenden Aussicht auf ein Weihnachtsfest ohne Paul ab.
Am Montag nach Neujahr zog ich offiziell in das Haus ein. Da die Pension mit der kompletten Einrichtung verkauft worden war, nahm ich nur ein paar Erbstücke, die meiner Großmutter gehört hatten, und meine persönliche Habe mit. Somit dauerte das Auspacken nur ein paar Stunden. Ich richtete mich in dem großen Raum ein, den schon die Frelingers als kombiniertes Wohn-/Schlafzimmer bewohnt hatten. Er verfügte über einen Kamin mit einem Sofa davor und einer kleinen Fensternische mit Sitzbank, von der aus man die Bucht überblicken konnte. Besonders gut gefiel mir die Tapete, auf der weiße und lavendelfarbene Hortensien prangten.
Als sich die Nacht herabsenkte, war ich erschöpft. Und als um acht der Regen gegen die Fenster trommelte und der Wind durch die hohen immergrünen Sträucher pfiff, die eine Seite des Grundstücks begrenzten, zog ich mich in mein neues Reich im ersten Stock zurück, das mir jetzt angesichts des unwirtlichen Wetters mit dem prasselnden Feuer im Kamin noch gemütlicher vorkam. Ich empfand überhaupt kein Gefühl der Fremdheit, wie es sich in einer neuen Umgebung sonst oft einstellt – es war, als sei ich dort immer schon zu Hause gewesen.
Die frisch gestärkte Wäsche knisterte, als ich ins Bett kroch. Vermutlich bin ich rasch eingeschlafen, ich weiß es nicht. Erinnern kann ich mich nur klar und deutlich an diesen allzu real anmutenden Traum von Paul.
In der Therapie zur Bewältigung meiner Trauer hatte ich gelernt, dass Träume wichtig für den Heilungsprozess sind, wobei es zwei verschiedene Arten gibt. In erster Linie und wahrscheinlich am häufigsten handelt es sich um Träume, in denen der verstorbene Mensch wieder zum Leben erwacht.
Daneben gibt es die sogenannten Besuchsträume, in denen der oder die Verstorbene die Kluft zwischen Leben und Tod überwindet, um denjenigen zu besuchen, der trauernd zurückgeblieben ist. Im Traum kommt er, um die Lebenden zu trösten. Und um ihnen zu versichern, dass er oder sie glücklich ist und Frieden gefunden hat.
Vor acht Monaten bekam ich die Nachricht, dass Paul bei einem Hubschrauberabsturz umgekommen war. Am Hindukusch, jener Bergkette, die sich durch Afghanistan bis nach Nordpakistan erstreckt. Die Militärmaschine war von Al-Kaida oder den mit ihnen verbündeten Taliban abgeschossen worden; Paul und fünf andere Airborne-Ranger waren vermutlich sofort tot. Allerdings machte es die unwegsame Gegend unmöglich, die Leichen zu bergen. Dass er tot sein sollte, war schon unfassbar genug, aber ihn nicht einmal beerdigen zu können – das ging beinahe über meine Kräfte.
Noch tagelang nach der offiziellen Mitteilung der Army redete ich mir ein, dass Paul vielleicht überlebt hatte, dass er sich irgendwie durchschlagen und einen Weg zurück zu mir finden würde. Luftaufnahmen von der Absturzstelle nahmen mir bald das letzte Fünkchen Hoffnung, denn sie belegten eindeutig, dass niemand diesen Anschlag lebend überstanden haben konnte.
Es wurde zur unausweichlichen Gewissheit: Der Mann, den ich geliebt und geheiratet hatte, kam nie mehr zu mir zurück. Als die Wochen und Monate verstrichen, fand ich mich allmählich damit ab – es jedoch innerlich zu akzeptieren, das vermochte ich nie.
Ich hatte so lange auf die große Liebe warten müssen. Die meisten meiner Freundinnen heirateten mit Mitte zwanzig und hatten mit Mitte dreißig ihre Familie komplett. So war ich zwar sechsfache Patin, blieb aber selbst Single. Ich führte ein abwechslungsreiches Leben und war erfolgreich im Beruf. Irgendwie verspürte ich gar nicht den Wunsch, unbedingt zu heiraten. Deshalb ignorierte ich auch die Mahnungen meiner Mutter, mir endlich einen netten, seriösen Mann zu suchen und aufzuhören, an allen herumzumäkeln. Obwohl ich viele Dates hatte, war nie einer darunter, den ich ein Leben lang lieben zu können glaubte.
Bis ich Paul Rose traf.
Da ich siebenunddreißig Jahre gebraucht hatte, um meinen Traumpartner zu finden, rechnete ich nach seinem Tod nicht damit, ein zweites Mal ein solches Glück zu haben. Und eigentlich wollte ich das auch nicht. Paul war alles gewesen, was ich mir von einem Mann erhoffen konnte, und so viel mehr.
Wir hatten uns bei einem Spiel der Seahawks kennengelernt. Ich hatte von der Bank Karten bekommen und einen wichtigen Kunden und seine Frau mitgenommen. Als wir unsere Plätze einnahmen, bemerkte ich zwei Männer mit militärisch kurz geschorenen Haaren, die neben uns saßen. Im Verlauf des Spiels stellte Paul sich und seinen Kameraden vor und begann ein Gespräch. Er erzählte mir, dass er in Fort Lewis stationiert und ein absoluter Footballfan sei. Genau wie ich und meine Eltern, die glühende Anhänger der Seahawks waren. Während meiner Jugend in Spokane saß ich jeden Sonntag nach der Kirche mit ihnen und meinem Bruder Todd vor dem Fernseher, um mir die Auswärtsspiele meiner Lieblingsmannschaft anzusehen.
Nach dem Match lud Paul mich zu einem Bier ein, und danach sahen wir uns fast jeden Tag. Schnell fanden wir heraus, dass uns nicht nur die Liebe zum Football verband: Wir vertraten dieselben politischen Ansichten, lasen dieselben Autoren, liebten italienisches Essen und waren süchtig nach Sudokus. Wir konnten stundenlang reden und taten es auch. Zwei Monate nachdem wir uns das erste Mal begegnet waren, musste er nach Deutschland, aber die Trennung trug nicht dazu bei, dass unsere Beziehung sich abkühlte. Im Gegenteil: Es verging kein Tag, an dem wir nicht auf irgendeine Weise in Kontakt standen – wir schickten uns E-Mails und SMS, kommunizierten via Skype oder twitterten und nutzten jedes andere Mittel, um in Verbindung zu bleiben. Ja, wir schrieben uns sogar richtige Briefe, die wir per Luftpost schickten.
Wenn früher Leute behauptet hatten, sie seien von der Liebe wie vom Blitz getroffen worden, dann pflegte ich spöttisch und überheblich zu lachen. Albern. Gut, ich will nicht sagen, dass es bei Paul und mir diese berühmte Liebe auf den ersten Blick war, doch es kam dem verdammt nah. Bereits eine Woche nach unserem Kennenlernen wusste ich, dass er der Mann war, den ich heiraten würde. Und ihm ging es ähnlich, bloß dass er angeblich nur ein einziges Date brauchte, um das zu merken.
Ich gebe es zu, die Liebe veränderte mich. Nie hätte ich mir träumen lassen, jemals so glücklich zu sein, und jedem in meiner Umgebung fiel diese Veränderung auf.
Letztes Jahr in der Weihnachtszeit kehrte Paul auf Urlaub nach Seattle zurück und bat mich, seine Frau zu werden, sprach sogar zuerst ganz altmodisch mit meinen Eltern. Wir waren bis über beide Ohren verliebt. Ich hatte lange darauf gewartet, diesen einen Mann zu finden, und als ich ihm mein Herz schenkte, war es für immer.
Direkt nach unserer Hochzeit im Januar wurde Paul nach Afghanistan abkommandiert, und als sein Hubschrauber am siebenundzwanzigsten April abstürzte, fiel meine Welt in Scherben. Ich war nicht vorbereitet auf diese Art von Schmerz und konnte zunächst gar nicht damit umgehen. Meine Mutter riet mir deshalb zu einer Therapie. Verzweifelt und hoffnungslos willigte ich ein, an den Gruppensitzungen teilzunehmen. Am Ende war ich froh darüber, denn ein wenig halfen sie mir, wieder Boden unter die Füße zu kriegen.
Und ich lernte dort meine Träume zu verstehen.
In jener ersten Nacht in Cedar Cove, als mir Paul erschien, sah ich ihn in voller Militärausrüstung vor mir stehen. Im Gegensatz zu dem, was der Therapeut über Besuchsträume erläutert hatte, versicherte Paul mir nicht, dass er seinen Frieden gefunden habe. Er war bloß von einem so hellen Licht umgeben, dass es fast unmöglich war hinzuschauen. Trotzdem vermochte ich den Blick nicht von ihm abzuwenden.
Am liebsten wäre ich auf ihn zugestürzt, unterließ es aber aus Angst, er könnte verschwinden, sobald ich mich bewegte. Der Gedanke, ihn erneut zu verlieren, war zu schrecklich – selbst wenn er nur eine Erscheinung war.
Lange Zeit schwieg er. Ich auch, denn ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Doch meine Augen füllten sich mit Tränen, und ich schlug eine Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken.
Dann kam er zu mir, nahm mich in die Arme, drückte mich an sich und strich mit der Hand über meinen Kopf, um mich zu trösten. Ich klammerte mich an ihn; wollte ihn nicht gehen lassen. Wieder und wieder flüsterte er leise, zärtliche Worte.
Als sich der Kloß in meiner Kehle löste, sah ich zu ihm auf, und unsere Blicke trafen sich. Er kam mir so wirklich vor, als sei er noch am Leben und gerade nach einer langen Trennung zurückgekommen. Es gab so vieles, was ich ihm sagen, so viele Erklärungen, die ich von ihm hören wollte.
Warum er etwa eine so hohe Lebensversicherung zu meinen Gunsten abgeschlossen hatte. Anfangs war ich schockiert gewesen, als ich davon erfuhr, und zögerte, eine derart große Summe anzunehmen. Stand das Geld nicht eher seiner Familie zu? Aber seine Mutter war tot, und der Vater lebte mit seiner zweiten Frau in Australien. Sie hatten sich nie besonders nahegestanden. Der Anwalt erklärte überdies, Paul habe ihm bezüglich der Versicherung unmissverständliche Anweisungen erteilt.
In meinem Traum wollte ich Paul erzählen, dass ich mit dem Geld diese Pension gekauft und nach ihm benannt hatte. Und dass ich einen Rosengarten mit einer Bank und einem Laubengang anlegen wollte. Eigenartigerweise musste ich gar nichts sagen, denn er schien es bereits zu wissen.
Er strich mir das Haar aus der Stirn und küsste mich sanft.
»Du hast eine gute Wahl getroffen«, flüsterte er. Seine Augen leuchteten vor Liebe. »Mit der Zeit wirst du wieder Freude empfinden.«
Freude?
Ich wollte mich empört dagegen verwehren. Es erschien mir weder wahrscheinlich noch überhaupt möglich, ohne ihn an irgendetwas Freude zu haben. Der Schmerz, der mich fest im Griff hielt, mochte mit der Zeit gelindert werden – heilen würde er nicht. Genauso wenig gab es Worte des Trostes, wie meine Familie und meine Freunde hatten einsehen müssen. Außerdem wollte ich nicht getröstet werden.
Dennoch ließ ich mich auf keine Diskussion mit Paul ein. Ich fürchtete, der Traum könnte enden und Paul verschwinden. Mit jeder Faser meines Herzens wünschte ich mir, ihn festzuhalten, denn ein seltsamer Friede war über mich gekommen, und die Bürde, die schwer auf meiner Seele lastete, fühlte sich plötzlich ein wenig leichter an.
»Ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann«, sagte ich zu ihm.
»Du kannst, und du wirst«, antwortete er. »Dir steht sogar ein langes und erfülltes Leben bevor.«
Paul klang wie der Offizier, der er gewesen war, und erteilte Befehle, die keinen Widerspruch duldeten.
»Du wirst wieder Freude empfinden«, wiederholte er. »Und das wird zu einem großen Teil mit dem Rose Harbor Inn zusammenhängen.«
Ich runzelte die Stirn. Mir war bewusst, dass ich träumte, und doch wirkte das Ganze so lebensecht, dass es mir beinahe real zu sein schien.
»Wieso weißt du das?«
Zahllose Fragen gingen mir im Kopf herum.
»Dieses Haus ist mein Geschenk für dich«, fuhr Paul fort. »Zweifle nicht, Liebling. Gott wird es dir zeigen.«
Und dann war er fort.
Ich schrie auf; flehte ihn an zurückzukommen und erwachte durch mein eigenes Schreien. Tränen liefen mir in Strömen die Wangen herunter und hatten bereits mein Kopfkissen nass gemacht. Ich richtete mich auf und saß noch lange im Dunkeln, versuchte das Gefühl seiner Gegenwart festzuhalten. Erst als es verblasste, schlief ich fast gegen meinen Willen wieder ein.
Am nächsten Morgen stieg ich aus dem Bett und tappte barfuß über den polierten Hartholzfußboden des Flurs zu dem kleinen Büro neben der Küche. Ich knipste die Schreibtischlampe an, blätterte in dem Reservierungsbuch, das mir die Frelingers gegeben hatten, und schlug die Namen der beiden Gäste nach, die diese Woche eintreffen sollten.
Joshua Weaver hatte in der Woche gebucht, bevor ich die Pension gekauft hatte. Der zweite Name auf der Liste lautete Abby Kincaid.
Zwei Gäste.
Ich erinnerte mich an Pauls Worte, dass diese Pension sein Geschenk für mich sei, und beschloss, mein Bestes zu tun, damit meine Gäste sich bei mir wohlfühlten. Vielleicht würde ich ja dadurch, dass ich anderen etwas gab, jene Freude empfinden können, die Paul mir versprochen hatte. Und vielleicht gelang es mir im Laufe der Zeit sogar, einen Weg zurück ins Leben zu finden.
2
Josh Weaver hätte nie gedacht, dass er noch einmal nach Cedar Cove zurückkehren würde. In den zwölf Jahren seit seinem Highschoolabschluss war er nur dort gewesen, um an der Beerdigung seines Stiefbruders Dylan teilzunehmen.
Selbst da übernachtete er nicht in dem Städtchen, sondern flog mit der ersten Maschine nach Seattle, mietete ein Auto und fuhr nach der Beerdigung direkt zum Flughafen, um noch am selben Tag zurück in Kalifornien zu sein.
Mit seinem Stiefvater hatte er kaum gesprochen.
Allerdings war Richard daran ebenfalls nicht interessiert gewesen. Alles verlief genauso wie von Josh erwartet. Obwohl das Verhältnis zwischen ihm und Dylan sehr eng gewesen war, schien sein Stiefvater es nicht für nötig zu finden, dass Josh zu den Sargträgern gehörte. Eine Kränkung, die ihn zutiefst verletzte. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, Dylan die letzte Ehre zu erweisen.
Nun war er wieder hier, obwohl er eigentlich so gar keine Lust verspürte, Zeit in Cedar Cove zu verbringen. Abgesehen davon, dass seine Mutter und Dylan hier begraben lagen, bedeutete die Stadt ihm nichts.
Der Altersunterschied zwischen Josh und Dylan hatte nur ein Jahr betragen, und sie standen sich so nah wie leibliche Brüder. Der Ältere hatte den draufgängerischen Jüngeren von Anfang an wegen seiner absoluten Furchtlosigkeit bewundert. Und es war ein schrecklicher Schock für ihn gewesen, als Dylan bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Fünf Jahre lag das jetzt zurück. Und sieben Jahre früher hatte Richard Lambert seinen Stiefsohn Josh aus dem Haus geworfen und sich einen Dreck darum geschert, was aus dem Jungen wurde.
Jetzt sah es so aus, als sei der alte Mann an der Reihe, sehr bald vor seinen Schöpfer zu treten. Richards Nachbarn hatten sich mit ihm in Verbindung gesetzt. Michelle, die Tochter der Nelsons, war auf der Highschool ebenso heftig wie hoffnungslos in Dylan verliebt gewesen, und vielleicht rührte daher ihre Fürsorge für den einsamen Alten: Außerdem war die warmherzige, übergewichtige Michelle Sozialarbeiterin geworden und engagierte sich schon von Berufs wegen für Mitbürger, die Hilfe brauchten.
»Richard geht es sehr schlecht«, hatte sie ihm am Telefon mitgeteilt. »Wenn du ihn noch lebend antreffen willst, solltest du herkommen, und zwar so schnell wie möglich.«
Michelle hatte es sehr dringlich gemacht und noch hinzugefügt: »Er braucht dich.«
Eigentlich verspürte Josh kein Verlangen, den Stiefvater zu sehen. Nicht das geringste. Das Einzige, was sie verband, war eine auf Gegenseitigkeit beruhende Abneigung. Trotzdem war er Michelles Aufforderung gefolgt. Zum einen weil er gerade Zeit hatte – er arbeitete als Bauleiter, ein Projekt war gerade abgeschlossen, und er wartete auf Instruktionen für das nächste – und zum anderen weil es ihm irgendwie angebracht schien, mit seinem alten Widersacher Frieden zu schließen. Außerdem hoffte er, ein paar Sachen aus dem Haus mitnehmen zu können, die ursprünglich seiner Mutter gehört hatten. Das stand ihm zu, fand er.
Was hatte Michelle damit gemeint, dass Richard ihn brauchte?
Josh würde im Grunde jede Wette abschließen, dass sein Stiefvater lieber auf der Stelle tot umfallen würde, als zuzugeben, dass er jemanden brauchte – und schon gar nicht ihn.
Offenbar hatten die Nelsons vergessen, welches Vergnügen es Richard seinerzeit bereitete, ihn nur ein paar Monate nach dem Tod seiner Mutter aus dem Haus zu jagen. Josh war nicht einmal ganz mit der Highschool fertig gewesen, ein paar Wochen fehlten noch bis zum Abschluss. Dennoch musste er gehen und durfte nichts mitnehmen außer seiner Kleidung und seinen Schulsachen.
Richard beschuldigte ihn, ein Dieb zu sein. In seiner Brieftasche fehlten zweihundert Dollar, und er war überzeugt, dass nur Josh sie gestohlen haben konnte. Obwohl der nichts von dem verschwundenen Geld wusste und vermutete, dass Dylan es genommen hatte, schwieg er und wehrte sich nicht. Richard hätte sowieso nicht an die Schuld seines eigenen Sohnes geglaubt. Der Rausschmiss allerdings traf ihn völlig unvorbereitet.
Rückblickend erst wurde ihm klar, dass die fehlenden zweihundert Dollar bloß ein Vorwand gewesen waren. Sein Stiefvater wollte ihn nicht nur aus dem Haus haben, sondern ihn komplett aus seinem Leben streichen. Bis jetzt hatte Josh nicht das Geringste dagegen einzuwenden gehabt.
Und nun war er wieder in Cedar Cove, wenngleich es alles andere als eine Heimkehr war. Die Adresse des B & B hatte er auf die Schnelle im Internet herausgesucht und ein Zimmer reserviert, weil es von dort nicht weit zu Richards Haus war. Wenn nichts Besonderes dazwischenkam, würde er in ein oder zwei Tagen wieder abreisen, nachdem er nach dem Rechten geschaut hatte. Unter keinen Umständen plante er länger zu bleiben als unbedingt nötig. Und wenn er Cedar Cove diesmal verließ, würde es für immer sein, beschloss er.
Nachdem er den Wagen auf dem kleinen Parkplatz des Rose Harbor Inn abgestellt hatte, stieg er aus und griff nach seiner Reisetasche und seinem Laptop. Der Himmel war wolkenverhangen und verhieß Regen, ganz typisch für den Januar im pazifischen Nordwesten, und seine schiefergraue Farbe spiegelte Joshs Stimmung wider. Er hätte alles dafür gegeben, irgendwo anders als ausgerechnet in Cedar Cove zu sein. Vor allem an einem Ort, wo er nicht gezwungen war, sich mit seinem Stiefvater auseinandersetzen zu müssen.
Aber es ließ sich nicht ändern. Seufzend stieg er die Verandatreppe hoch und drückte den Klingelknopf, und nach kaum einer Minute öffnete eine Frau ihm die Tür.
»Mrs. Frelinger?«, fragte er ein wenig verwundert.
Am Telefon hatte die Wirtin nämlich deutlich älter geklungen. Diese Frau hier war jedenfalls viel jünger als erwartet. Von mittelgroßer, schlanker Figur, trug sie ihr dichtes braunes Haar schulterlang, und ihre Augen leuchteten strahlend blau wie ein Sommerhimmel. Er schätzte sie auf etwa Mitte dreißig, was vielleicht auch an der Kleidung lag, legeren Hosen und einem weiten Pullover, darüber eine leuchtend rote Latzschürze.
»Nein, mein Name ist Jo Marie Rose – ich habe die Pension vor Kurzem von den Frelingers übernommen. Kommen Sie bitte herein.«
Sie trat zur Seite, um ihn vorbeizulassen.
Josh betrat die Halle, in der ihn wohltuende Wärme empfing. Im Kamin prasselte ein kleines Feuer, und der Duft frisch gebackenen Brotes ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt diesen Geruch wahrgenommen hatte – von Brot, das direkt aus dem Ofen kam. Seine Mutter hatte manchmal welches gebacken, aber das war endlos lange her.
»Hier riecht es ganz köstlich.«
»Ich backe sehr gern, schon immer«, erwiderte Jo Marie, als fühle sie sich zu einer Erklärung verpflichtet. »Hoffentlich bringen Sie Appetit mit.«
»Allerdings, das tue ich«, bestätigte Josh.
»Sie sind mein erster Gast«, fuhr Jo Marie mit einem freundlichen Lächeln fort. »Herzlich willkommen.«
Sie rieb die Handflächen gegeneinander, als wüsste sie nicht genau, was sie als Nächstes tun sollte.
»Brauchen Sie meine Kreditkartendaten?«, fragte Josh und zog sein Portemonnaie aus der Hosentasche.
»Ja, ich denke schon.«
Sie führte ihn durch die Küche in ein kleines Büro, das vermutlich früher einmal als Speisekammer gedient hatte. Er reichte ihr eine Kreditkarte, die sie zögernd entgegennahm.
»Ich werde Ihre Nummer zunächst einmal notieren – ich habe später einen Termin bei der Bank. Das Gerät ist noch nicht freigeschaltet.« Verunsichert sah sie ihn an. »Wenn das in Ordnung ist?«
»Kein Problem«, entgegnete er und beobachtete sie, wie sie sich die Kreditkartendaten notierte.
»Könnte ich den Schlüssel für mein Zimmer sofort bekommen oder ist es noch nicht fertig?«, erkundigte er sich.
»Ja, natürlich … Entschuldigung. Wie ich schon sagte, Sie sind mein erster Gast: Ich habe den Kaufvertrag erst kurz vor Weihnachten unterzeichnet.«
»Was machen denn die Frelingers jetzt?«
Josh kannte sie zwar nicht persönlich, aber es interessierte ihn, warum sie die Pension verkauft hatten.
Jo Marie ging in die Küche hinüber, griff nach der Kaffeekanne und fragte ihn mit einem stummen Blick, ob er eine Tasse wollte.
Josh nickte.
»Wie es aussieht, haben sie vor, mit ihrem Wohnmobil kreuz und quer durchs Land zu fahren«, erklärte Jo Marie. »Am Tag der Übergabe stand es fertig beladen und startbereit da. Sie haben mir die Schlüssel ausgehändigt und sind direkt danach Richtung Kalifornien aufgebrochen, um über Weihnachten bei ihren beiden Töchtern den ersten Stopp einzulegen.«
»Anscheinend haben sie so einiges vor«, stellte Josh fest, als sie ihm einen dampfenden Becher mit Kaffee reichte.
»Nehmen Sie Zucker oder Milch?«, fragte sie.
»Nein, schwarz ist in Ordnung.«
»Sie haben die freie Zimmerauswahl«, sagte Jo Marie anschließend.
Josh zuckte die Achseln. »Mir ist jedes Zimmer recht. Ich befinde mich nicht gerade auf einer Vergnügungsreise.«
»Oh«, sagte sie bloß und schaute ihn mit unverhohlener Neugier an.
»Nein, ich bin hier, um meinen Stiefvater in einem Hospiz unterzubringen.«
»Das tut mir leid.«
Josh hob eine Hand, um sie von weiteren Mitleidsbekundungen abzuhalten.
»Wir standen uns nicht sehr nah, und unsere Beziehung war offen gestanden nie die beste. Ich tue das mehr aus Pflichtbewusstsein als aus Nächstenliebe.«
»Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«
Josh schüttelte den Kopf. Schließlich wusste er selbst nicht so genau, was konkret zu tun war, und am liebsten hätte er sich vor alldem gedrückt. Nur dass es leider niemanden gab, auf den er die Verantwortung für Richard abwälzen konnte.
Jo Marie zeigte ihm ein Zimmer im zweiten Stock mit einem großen Panoramafenster, das auf die Bucht hinausging. Direkt gegenüber lag die Pudget-Sound-Marinewerft, und er konnte einige Schiffe sowie einen eingemotteten Flugzeugträger sehen, dessen Grau die Farbe des Himmels widerspiegelte.
Richard hatte den größten Teil seines Berufslebens auf dieser Werft verbracht, erinnerte sich Josh. Während des Vietnamkriegs hatte er bei der Marine gedient und anschließend in Bremerton Arbeit als Schweißer gefunden. Auch Dylan war dort bis zu seinem Tod beschäftigt gewesen.
Josh wandte sich vom Fenster ab, sobald er allein war, und griff nach seinem Handy, um seine E-Mails abzurufen. Vielleicht kamen ja Informationen wegen des neuen Auftrags. Er hatte Richard noch nicht einmal gesehen und war in Gedanken schon wieder weg. Seine Sachen packte er erst gar nicht aus.
Er fand eine Nachricht von Michelle vor, die erst wenige Stunden alt war.
Betreff: Willkommen zu Hause
Lieber Josh,
ich rechne jetzt jeden Moment damit, dass du in Cedar Cove eintriffst, und wollte nur sicherstellen, dass wir Verbindung aufnehmen können. Meine Eltern besuchen meinen Bruder in Arizona – er ist gerade Vater geworden –, und ich wohne so lange in ihrem Haus, um den Hund zu füttern und mich um Richard zu kümmern. Ich habe mir die nächsten Tage freigenommen, also ruf mich an, sobald du in deiner Pension untergekommen bist, und ich begleite dich dann zu Richard, wenn du möchtest.
Michelle
360-555-8756
Josh setzte sich auf einen Stuhl und lehnte sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust. Ihm fiel wieder Michelles peinliche Schwärmerei für Dylan ein, und doch hatte sein Stiefbruder sie im Gegensatz zu anderen Jungs nie wegen ihres Aussehens gehänselt oder gar verspottet. Solche Grausamkeiten waren ihm fremd gewesen.
Er war ihr für das Angebot dankbar, ihn zu Richard zu begleiten. Im Notfall konnte sie als Puffer zwischen ihnen dienen. Josh wählte die angegebene Nummer, und sie meldete sich fast augenblicklich.
»Michelle, ich bin’s, Josh.«
»Josh! Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Wie geht es dir?«
»Gut.«
Michelles ehrliche Freude war Balsam für seine Seele – er hatte nicht erwartet, dass jemand überhaupt seine Anwesenheit zur Kenntnis nehmen würde. Die Kontakte zu den Freunden aus Highschoolzeiten waren abgebrochen, nachdem er sich seinerzeit erst mal zur Army gemeldet hatte, weil er nicht wusste, wohin sonst. Später fing er in der Baubranche an und arbeitete sich zum Projektleiter hoch. Inzwischen jettete er von Stadt zu Stadt und Job zu Job, blieb nie länger als ein paar Monate an ein und demselben Ort. Er hatte schon viel gesehen, aber nirgendwo Wurzeln geschlagen. Zu gegebener Zeit würde auch er sicher sesshaft werden, vermutete er, doch wenn es nach ihm ging, musste das nicht so bald sein.
»Du klingst genau wie früher«, sagte Michelle.
Vertraute, nie in Vergessenheit geratene Zuneigung schwang in ihrer weichen Stimme mit.
»Du auch«, murmelte Josh. Er hatte Michelle immer gemocht und sie zutiefst wegen ihres gewaltigen Übergewichts bedauert.
»Ich nehme an, du bist inzwischen verheiratet und hast einen Stall voller Kinder«, fragte er und meinte es nicht als Witz.
Vielmehr war er fest überzeugt, dass sie jemanden gefunden hatte, der ihre Vorzüge zu schätzen wusste. Kaum jemand war so großherzig und mitfühlend wie Michelle. Dass sie den Beruf einer Sozialarbeiterin ergriffen hatte, entsprach nur ihrem Naturell.
»Nein, leider nicht.«
In ihrer Stimme schwangen Bedauern und ein Anflug von Traurigkeit mit, und er verfluchte sich dafür, so etwas angesprochen zu haben.
»Was ist mit dir? Hast du Frau und Kinder mitgebracht, um ihnen dein altes Jagdrevier zu zeigen?«
»Nein, ich bin ebenfalls nicht verheiratet.«
»Oh.« Sie klang überrascht. »Ich habe Richard irgendwann gefragt, doch er hatte keine Ahnung.«
Was nicht weiter verwundern konnte, denn sie hatten seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.
»Wie geht es dem alten Herrn denn so?«, fragte er, um das Thema zu wechseln.
»Nicht besonders gut. Er ist halsstarrig und töricht zugleich. Besteht darauf, nichts und niemanden zu brauchen. Er lässt es so gerade zu, dass ich ihm Essen bringe und ab und an nach ihm sehe. Mehr nicht.«
Demnach schien er trotz seiner Krankheit noch ganz der Alte zu sein: uneinsichtig, zänkisch und permanent schlecht gelaunt.
»Weiß er, dass ich komme?«, erkundigte sich Josh.
»Ich zumindest habe es ihm nicht gesagt«, erwiderte Michelle.
»Könnten deine Eltern es erwähnt haben, bevor sie zu deinem Bruder gefahren sind?«
»Das bezweifle ich. Keiner von uns war sich sicher, ob du wirklich auftauchen würdest.«
Anscheinend kannten die Nelsons ihn besser, als er gedacht hatte.
»Ich war mir selbst nicht sicher«, bekannte er.
»Komm zuerst zum Haus meiner Eltern«, schlug Michelle vor. »Wir treffen uns dort und gehen zusammen zu Richard hinüber.«
»Gute Idee«, stimmte er zu.
Michelle zögerte, und als sie weitersprach, klang ihre Stimme weich, fast wehmütig. »Ich habe im Laufe der Jahre oft an dich gedacht, Josh. Ich wünschte, dass wir … Nun, dass wir bei Dylans Beerdigung mehr Gelegenheit gehabt hätten, miteinander zu reden.«
Josh konnte sich absolut nicht daran erinnern, Michelle überhaupt gesehen zu haben. Vermutlich lag es einfach daran, dass er nur kurz bei der Trauerfeier auf dem Friedhof vorbeigeschaut und sich anschließend gleich wieder verdrückt hatte. Da war kaum Zeit geblieben, ein paar Worte mit jemandem zu wechseln. Außerdem war er zu sehr mit seinem Groll gegen Richard und mit der Kränkung, weil dieser die enge Bindung zwischen ihm und Dylan komplett zu negieren schien, beschäftigt gewesen. Und doch sah es jetzt so aus, als sei er der Einzige, den Richard noch hatte.
»Wann willst du vorbeikommen?«, fragte Michelle.
»Ich mache mich schnell ein wenig frisch und bin in ungefähr einer Stunde da. Passt dir das?«
Je eher er dem alten Mann gegenübertrat, desto besser. Es hinauszuzögern würde das Wiedersehen nicht einfacher machen.
»Perfekt. Wir sehen uns dann bei meinen Eltern.«
»Bis dann«, entgegnete Josh und legte auf.
Es tat gut, einen Verbündeten hinter sich zu wissen – jemanden, mit dem man offen reden konnte, dachte er.
Wenig später griff er nach seinen Autoschlüsseln und stieg die Stufen hinunter. Jo Marie erwartete ihn am Fuß der Treppe.
»Ich muss heute Nachmittag zur Bank, werde also nicht immer da sein. Aber Ihr Zimmerschlüssel passt auch für die Vordertür, und Sie können nach Belieben kommen und gehen. Fühlen Sie sich bitte ganz wie zu Hause.«
»Danke, das werde ich tun. Ich muss jetzt los«, sagte er. »Wann ich zurückkomme, weiß ich noch nicht.«
Er hatte beschlossen, sich ein wenig in der Stadt umzusehen, bevor er zu den Nelsons hinüberfuhr, denn trotz allem interessierte ihn, ob sich Cedar Cove im Laufe der Jahre verändert hatte. Auf der Hinfahrt war ihm nicht viel aufgefallen, und von seinem Zimmerfenster aus wirkte die Hafengegend nicht anders als in seiner Erinnerung, weshalb er eher damit rechnete, dass alles Übrige ebenfalls noch so sein würde wie früher.
»Dann bis später.«
»Bis später«, nickte er, verließ das Haus und blieb einen Moment stehen, um den Reißverschluss seiner Jacke hochzuziehen.
Ein leichter Regen hatte eingesetzt, ein stetiges Nieseln, das typisch war für die Wintermonate in der Gegend rund um den Pudget Sound. Er fuhr zur Highschool und stellte fest, dass von ein paar zusätzlichen mobilen Klassenzimmern abgesehen alles so aussah wie zu seiner Zeit.
Er parkte den Wagen und schlenderte um die Schule herum zur Leichtathletikanlage und zum Fußballfeld. Die Laufbahn schien vor Kurzem einen neuen Belag erhalten zu haben. Josh, früher ein guter Läufer, hatte für seine Schule einige Rennen gewonnen, doch der Vorzeigesportler der Familie war Dylan gewesen und deshalb bei seiner Abschlussfeier besonders geehrt worden. Josh freute sich sehr für ihn, als der Jüngere es ihm in einem Brief mitteilte.
Er selbst hatte nicht an seinem Abschlussball teilgenommen, weil er es sich nicht leisten konnte. Damals hatte Richard ihn bereits aus dem Haus geworfen, aber auch früher konnte er nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen, weil sein Stiefvater ihn erheblich kürzer hielt als den eigenen Sohn.
Er stieg wieder in sein Auto und fuhr die Harbor Street hinunter. Donnerwetter, dachte er, hier hatte sich einiges verändert. Alte Geschäfte waren verschwunden, neue entstanden. Bloß das chinesische Restaurant existierte immer noch.
Josh gab sich einen Ruck.
Es war lächerlich, die Begegnung mit Richard noch länger vor sich herzuschieben, und so lenkte er den Wagen entschlossen in Richtung seines alten Viertels. Zugleich nahm er sich vor, sich nicht noch einmal von seinem Stiefvater einschüchtern zu lassen.
Josh parkte vor dem Haus der Nelsons, griff nach Kugelschreiber und Papier und stellte rasch eine Liste der Dinge zusammen, die er für sich beanspruchte. Die Bibel seiner Mutter stand ganz obenan zusammen mit ihrer Kamee – die würde er an seine Tochter weitergeben, falls er je eine haben sollte. Auch seine Letterman-Jacke mit den Highschoolinitialen würde er mitnehmen und das einzige Jahrbuch, das er besaß. Richard hatte für so etwas nie Geld ausgeben wollen. Als er rausgeworfen wurde, hatte er nur schnell die notwendigsten Sachen gepackt.
Eine Stunde nach dem Telefongespräch mit Michelle klingelte er an der Tür der Nelsons.
»Josh?«, fragte sie lächelnd.
Das konnte nur ein Irrtum sein, schoss es ihm durch den Kopf. Denn die Frau, die ihm die Tür öffnete, war groß und schlank und faszinierend attraktiv.
»Michelle?«, fragte er ungläubig und außerstande, seine Überraschung zu verbergen.
»Ja.« Sie lachte leise. »Ich bin es wirklich. Seit ich abgenommen habe, hast du mich nicht mehr gesehen, oder?«
Josh musste an sich halten, damit er sie nicht mit offenem Mund anstarrte.
3
Während Josh Michelle ins Haus folgte, versuchte er immer noch, den Umstand zu verarbeiten, dass die hübsche Frau vor ihm tatsächlich Michelle Nelson war. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass es sich bei dem übergewichtigen Teenager von einst und dieser gertenschlanken Schönheit um ein und dieselbe Person handelte.