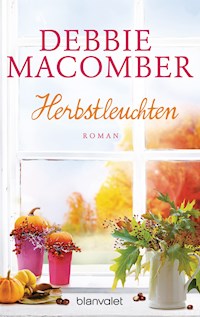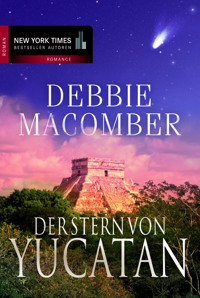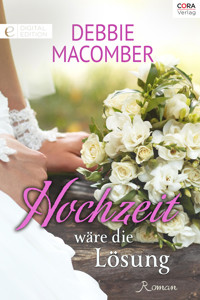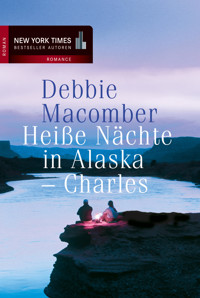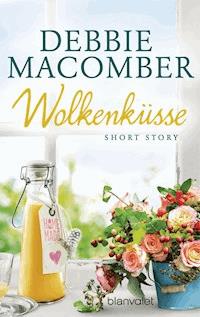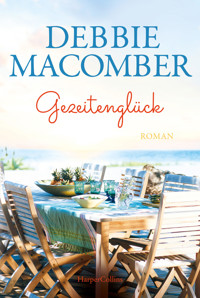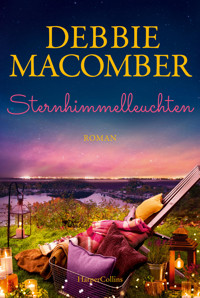4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn du der Liebe die Tür öffnest, macht sie aus einem Haus ein Zuhause ...
Ein Neuanfang im charmanten Oceanside ist genau das, was Hope Godwin nach dem tragischen Tod ihres Zwillingsbruders braucht. Er war Hopes letzter lebender Verwandter, und nun ist sie völlig allein. Um ihrer Trauer zu entfliehen, beginnt Hope im örtlichen Tierheim auszuhelfen. Dort trifft sie auf Cade Lincoln. Auch der Ex-Marinesoldat hat einen großen Verlust erlitten und dieses Erlebnis nie verwunden. Hope und Cade verstehen einander wie es sonst niemand vermag, und all der Schmerz weicht langsam einer neuen Hoffnung. Vielleicht ist es für die Liebe doch noch nicht zu spät?
Lesen Sie weitere gefühlvolle Sommerromane von Debbie Macomber:
Das kleine Cottage am Meer
Liebe mit Meerblick
Die Bucht der Wünsche
Liebe mit Aussicht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Ein Neuanfang im charmanten Oceanside ist genau das, was Hope Goodwin nach dem tragischen Tod ihres Zwillingsbruders braucht. Er war Hopes letzter lebender Verwandter, und nun ist sie völlig allein. Um ihrer Trauer zu entfliehen, beginnt Hope im örtlichen Tierheim auszuhelfen. Dort trifft sie auf Cade Lincoln. Auch der Ex-Marinesoldat hat einen großen Verlust erlitten und dieses Erlebnis nie verwunden. Hope und Cade verstehen einander, wie es sonst niemand vermag, und all der Schmerz weicht langsam einer neuen Hoffnung. Vielleicht ist es für die Liebe doch noch nicht zu spät?
Autorin
Debbie Macomber begeistert mit ihren Romanen Millionen Leserinnen weltweit und gehört zu den erfolgreichsten Autorinnen überhaupt. Wenn sie nicht gerade schreibt, strickt sie oder verbringt mit Vorliebe viel Zeit mit ihren Enkelkindern. Sie lebt mit ihrem Mann in Port Orchard, Washington, und im Winter in Florida.
Lesen Sie weitere gefühlvolle Sommerromane von Debbie Macomber:
Das kleine Cottage am Meer
Liebe mit Meerblick
Die Bucht der Wünsche
Liebe mit Aussicht
Weitere Informationen unter: www.debbiemacomber.com
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
DEBBIE
MACOMBER
Roman
Deutsch von Nina Bader
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Best is Yet to Come« bei Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Debbie Macomber
This translation is published by arrangement with Ballantine Books,
an imprint of Random House,
a division of Penguin Random House LLC
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe by Blanvalet Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © living4media / Sheltered Images; www.buerosued.de
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
LH ∙ Herstellung: sam
ISBN: 978-3-641-30590-1V001
www.blanvalet.de
Im Sommer 2022
Liebe Freunde,
ich habe eine überraschende Neuigkeit für alle: Kein Autor ist eine Insel. Wir veröffentlichen unsere Bücher nicht alleine. Ja, die Worte in diesem Buch stammen von mir, und ich habe es selbst geschrieben, aber ich hatte mehrere Teams äußerst talentierter Experten zur Seite, die sich alle Mühe geben, das Beste aus mir als Autorin herauszuholen. Zuallererst sei mein persönliches Team genannt, das mich zusammen mit meiner wundervollen Agentin hier im Büro unterstützt. Dann natürlich mein Verlegerteam. Sie alle führten mich durch die verschiedenen Stadien dieses Buches. Ich schulde ihnen große Dankbarkeit. Meine Anwaltfreundin Lillian Schauer hat die Gerichtssaalszene gründlich gelesen, damit alle Details der Realität entsprechen. Danke, Lillian! Und meine Assistentin Shawna hat die vielen Versionen dieser Geschichte gelesen.
Ich dachte wirklich, »Unser Sommer am Meer« würde mein letztes Buch sein, und ich würde danach in den Ruhestand gehen. Aber dann hatte ich eine richtig gute Idee für eine andere Story. Das Schreiben macht einen so großen Teil von dem aus, wer und was ich bin, dass ich Zweifel habe, ob ich es jemals aufgeben werde. Das Beste aber kommt auch noch für mich, wie es aussieht, denn Wayne und ich gehen auf Reisen. Wir haben uns diesen Sommer ein Wohnmobil gekauft, und das Abenteuer wartet auf uns.
Debbie Macomber
Für
Jennifer Hershey
und
Shauna Summers
Danke, dass ihr an mich geglaubt habt.
Prolog
Erheben Sie sich bitte«, verkündete der Gerichtsdiener, als die Richterin den Gerichtssaal betrat. »Richterin Walters führt den Vorsitz.«
John Cade Lincoln junior kam neben seiner vom Gericht bestellten Anwältin auf die Füße. Er hatte die Frau erst einmal getroffen und sich einverstanden erklärt, sich schuldig zu bekennen. Er schwankte, als er aufstand. Es fiel ihm schwer, das Gleichgewicht zu wahren, da die Schrapnellwunde an seinem Bein, die er bei seinem Einsatz in Afghanistan davongetragen hatte, nie richtig verheilt war. Er hielt sich an der Kante des Tisches für den Angeklagten fest.
Seine Anwältin, Miss Newman, eine junge Frau, die aussah, als käme sie frisch von der Uni, beugte sich zu ihm, um ihm zuzuflüstern: »Die Richterin hat die Termine aus dem Büro geändert, damit Sie der letzte Fall dieses Nachmittags sind.«
»Was bedeutet das?«
»Ich … weiß es nicht.«
Es klang nicht danach, als wären es gute Nachrichten. Da in seinem Leben sowieso alles bergab ging, hatte er nichts anderes erwartet.
Die silberhaarige Richterin mit den durchdringenden blauen Augen nahm ihren Platz ein, und alle anderen im Saal taten es ihr nach. Cade beobachtete sie, als sie nach seiner Akte griff, und verfolgte stumm, wie der Staatsanwalt die Anklagepunkte gegen ihn verlas. Richterin Walters hob langsam den Kopf und sah ihn direkt an. Ihre Augen verengten sich angesichts der langen Liste, während sie ihn eingehend betrachtete. Cade hielt ihrem Blick stand und straffte die Schultern, als stünde er vor seinem befehlshabenden Offizier.
Ordnungswidriges Verhalten.
Körperverletzung.
Sachbeschädigung.
Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Was seine Aufmerksamkeit erregte, war das Keuchen vom hinteren Teil des Gerichtssaals her. Er kannte diese Stimme. Kannte die Frau, die den Laut von sich gegeben hatte. Sara Lincoln, seine Mutter. Er stöhnte innerlich und senkte den Kopf, gedemütigt und erniedrigt, dass sie am zweitschlimmsten Tag seines Lebens hier aufgetaucht war. Dankbar, sein Bein entlasten zu können, sank er auf seinen Stuhl zurück, während Schockwellen über ihn hinwegrollten.
Seine Mutter war der letzte Mensch, den er erwartet hatte oder sehen wollte. Die letzte Kommunikation, wenn man es denn so bezeichnen konnte, hatte vor fast sechs Jahren stattgefunden. Das Gespräch hatte daraus bestanden, dass sein vor Wut schäumender Vater ihn mit zornesrotem Gesicht angebrüllt und heruntergeputzt hatte. Nachdem er ihn auch noch verwöhnt und undankbar genannt hatte, war Cade klar geworden, dass er eine bittere Enttäuschung für seine Eltern und eine Schande für den guten Namen der Familie war. Und das war nur das, was Cade gehört hatte, bevor er das Haus verlassen und die Tür hinter sich zugeschlagen hatte. Er war nie zurückgekehrt.
Vielleicht war es ein Fehler gewesen, in die Armee einzutreten, aber es war seine Angelegenheit. Was ihn betraf, war die Wahl, entweder seinem Land zu dienen oder nach seinem Schulabschluss Jura zu studieren, eine einfache Entscheidung gewesen. So lange er denken konnte, hatte sein Vater, John senior, von seinem Sohn erwartet, in seine Fußstapfen zu treten und in der Familienkanzlei zu arbeiten.
Vom Moment seiner Geburt an hatte festgestanden, dass Cade Anwalt werden würde. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn zu fragen, was er denn wollte. Er hatte klaglos die Erwartungen der Familie zu erfüllen, ihm wurde in der Angelegenheit keine Wahl gelassen. Alles war arrangiert, in die Wege geleitet, seit er seinen ersten Atemzug getan hatte.
Da er einfach nicht widerstehen konnte, spähte er über die Schulter. Es war tatsächlich seine Mutter, und sie war alleine, was Erleichterung in ihm auslöste und ihn zugleich schmerzte. Er wusste es besser, als zu hoffen, seinem Vater läge genug an ihm, um ihn zu unterstützen, wenn er ganz unten angekommen war. Was ihm auffiel, war die Liebe, die der Blick seiner Mutter ausstrahlte. Rasch richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den vorderen Teil des Gerichtssaals. Falls ihr diese letzte Szene in seinem Elternhaus leidtat, dann war es jetzt zu spät, um Wiedergutmachung zu leisten. Hätte sie ein Wort, nur ein einziges Wort zu seiner Verteidigung vorgebracht, könnte er ihr vergeben. Stattdessen hatte sie geschwiegen, und ihr Schweigen hatte alles gesagt.
Er konnte nur vermuten, wie seine Mutter von der Verhaftung erfahren hatte. Seit dem Tag, an dem er zu seiner Grundausbildung in Kalifornien aufgebrochen war, hatte er mit niemandem aus seiner Familie gesprochen. Er hatte ihre Namen noch nicht einmal als nächste Angehörige auf seinen Rekrutierungspapieren angegeben und nie zurückgeblickt.
Sechs lange Jahre.
Es verstand sich von selbst: Seine Eltern würden nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen – bis er bereit wäre zuzugeben, wie sehr er sich geirrt hatte. Sowie er seinen Fehler einsah, würden seine Eltern ihn wieder in den Schoß der Familie aufnehmen.
Richterin Walters blickte von den Papieren auf, begegnete erneut seinem Blick und hielt ihm lange stand, als wollte sie seinen Charakter einschätzen.
»Mr. Lincoln, sind Sie über Ihre Rechte aufgeklärt worden?«, fragte sie.
Cade erhob sich ebenso unbeholfen wie zuvor und hielt sich am Tisch fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Ja, Euer Ehren«, erwiderte er mit bewusst tonloser Stimme.
Seine Anwältin hatte ihn darüber informiert, was er zu erwarten hatte. Es gab nichts, was zu seinen Gunsten sprach. Er war betrunken und dumm gewesen. Er verdiente die Strafe, die auf ihn zukam, egal wie sie ausfiel. Er würde sie wie ein Mann auf sich nehmen, ohne Entschuldigungen und Rechtfertigungen vorzubringen.
»Das Gericht akzeptiert hiermit Ihr Schuldeingeständnis.«
Cade nahm an, dass das alles war, was von ihm erwartet wurde. Seine Anwältin hatte gemeint, die Richterin würde sein Plädoyer akzeptieren und dann das Urteil verkünden. Als Schweigen folgte, wanderte sein Blick wieder zu Richterin Walters, unsicher, was als Nächstes passieren würde.
Die Richterin sah von ihrer Akte auf. »Hier steht, Sie haben beim Militär gedient.«
»Ja, Euer Ehren.«
»Und Ihnen wurde ein Verwundetenabzeichen verliehen.«
Er nickte und wandte den Blick ab. Als ob ihn das interessieren würde. Er hatte überlebt, während Jeremy und Luke gefallen waren. Es wäre einfacher gewesen, wenn er in dieser Nacht ebenfalls gestorben wäre. Mit jeder Faser seines Seins wünschte er, es wäre so gekommen.
»Wie war das Ausmaß Ihrer Verletzungen?«
Das Letzte, was er wollte, war, ihr eine detaillierte Liste der körperlichen und emotionalen Narben zu liefern, die er davongetragen hatte. »Ich lebe noch.«
»Sind Sie da ganz sicher?«, fragte die Richterin mit hochgezogenen Brauen.
Die Frage erschütterte ihn, und er hob den Kopf, um sie anzusehen. Was sie andeutete, kränkte ihn.
»Setzen Sie Ihre Physiotherapie auch weiterhin fort, Soldat?«
Wenn sie so fragte, wusste sie eindeutig, dass er das nicht tat.
»Nein, Euer Ehren.«
»Können Sie mir sagen, warum nicht?«, wollte sie wissen.
»Nein, Euer Ehren.« Was hatte es für einen Sinn? Sein Bein würde nie wieder so funktionieren wie früher. Er würde für den Rest seines Lebens hinken. Ein Hinken als ständige Mahnung daran, dass er überlebt hatte, während die zwei besten Freunde, die ein Mann sich nur wünschen konnte, in ihren Gräbern auf dem Arlington Cemetery verrotteten.
»Ich verstehe«, erwiderte Richterin Walters langsam. »Dasselbe gilt anscheinend auch für Ihre Psychotherapie.«
»Ich habe keine Posttraumatische Belastungsstörung«, beharrte Cade. Was würde es nützen, herumzusitzen und sich wegen dem, was passiert war, die Augen auszuweinen? Tiefer Kummer war tiefer Kummer. Man lernte, damit zu leben und nach vorne zu schauen. Für ihn kam es gar nicht infrage, sein Innerstes vor einem Therapeuten bloßzulegen, der mit ziemlicher Sicherheit keine Ahnung hatte, wie es war, den Feind in ein Feuergefecht zu verwickeln und mit anzusehen, wie seine Freunde in Fetzen gerissen wurden. Es war kein Nein, es war ein »Zum Teufel, nein«.
»Aufgrund der Liste der Anklagepunkte scheint es mir, dass Sie einen Berg von Wutproblemen mit sich herumschleppen.«
Cade war bereit, das zuzugeben. Die Wahrheit lautete, dass er wütend auf die ganze Welt war. Die Erinnerungen an diesen letzten Kampf gruben sich wie Adlerklauen in seinen Körper, im Schlaf wurde er von Albträumen heimgesucht, die wie ein Baseball mit hundert Meilen pro Stunde auf ihn zuschossen. Er trank, um zu vergessen. Um schlafen zu können. Als Fluchtmöglichkeit.
Der Alkohol war zu seinem einzigen Freund geworden.
»Ich verurteile Sie hiermit zu dreihundertfünfundsechzig Tagen Gefängnis, wobei dreihundertsechzig Tage zur Bewährung ausgesetzt werden und die fünf Tage, die Sie bereits abgesessen haben, angerechnet werden.«
Cade hörte das leise Weinen seiner Mutter im Hintergrund. Er weigerte sich, sich umzudrehen und sie anzusehen. Es war schlimm genug, dass sie hier war und Zeugin wurde, wie tief er gesunken war. Er bezweifelte, dass sein Vater wusste, dass sie gekommen war. Er hätte ihr verboten, jemals wieder mit ihm zu sprechen.
Seine Anwältin packte ihn am Arm. »Verstehen Sie, was das heißt?«, flüsterte sie.
Kein Gefängnis. Das war nicht das, was er verdient oder mit einem Gefühl von Furcht und Unausweichlichkeit erwartet hatte.
»Angesichts Ihres Dienstes für unser Land ordne ich zwei Jahre Bewährung sowie eine verpflichtende Teilnahme an Physio- und Psychotherapie an. Sie werden für den angerichteten Schaden in vollem Maße aufkommen und fünfhundert Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.«
Das milde Urteil bewirkte, dass sich Schweigen über den Gerichtssaal legte. Der Staatsanwalt stand auf, als ob er Einspruch erheben wollte, doch auf einen Blick der Richterin hin nahm er seinen Platz wieder ein.
»Sind Sie mit diesen Bedingungen einverstanden, Soldat?«, fragte die Richterin.
»Das ist er, Euer Ehren«, sagte die neben ihm stehende junge Frau rasch.
»Sie habe ich nicht gefragt, Miss Newman. Mr. Lincoln?«
Miss Newman beugte sich zu ihm und flüsterte eindringlich: »Das ist besser, als wir hoffen konnten. Stimmen Sie ihr zu, ehe sie es sich anders überlegt.«
»Soldat?« Die Richterin durchbohrte ihn mit Blicken.
»Ja, Euer Ehren.«
Sie ließ den Hammer niedersausen, und alle standen auf, als sie den Saal verließ.
»Was ist, wenn ich die Auflagen nicht erfülle?«, fragte Cade seine Anwältin in der Hoffnung, es gäbe einen Weg, der Psycho- und Physiotherapie zu entkommen.
»Dann sitzen Sie die dreihundertsechzig Tage im Gefängnis ab. Sie haben die Wahl. Mir scheint, Richterin Walters hat ein persönliches Interesse an Ihrem Fall. Mein Rat lautet, sie nicht zu enttäuschen.«
Cade stöhnte innerlich. Er sollte dankbar sein. Ginge es nach dem Staatsanwalt, würde er einen orangefarbenen Overall tragen und in Handschellen abgeführt werden.
»Sie müssen noch die Urteils- und Strafmaßpapiere abholen«, sagte seine Anwältin.
Der Gerichtssaal hatte sich geleert. Bevor er antworten konnte, hörte er eine Bewegung hinter sich.
»Cade.« Seine Mutter streckte die Hand aus und berührte ihn am Arm.
Er tat so, als hätte er ihre sanfte Stimme nicht gehört, und folgte seiner Anwältin ohne ein weiteres Wort zu dem Sekretär, der die Papiere vorbereitete.
Als er sich umblickte, sah er, dass seine Mutter gegangen war. Es tat ihm leid, dass sie gekommen war, und noch mehr leid, dass sie sich nichts zu sagen hatten.
1
Eine Lehrerin sollte eigentlich keinen Lieblingsschüler haben.
Aber genau den hatte Hope Goodwin. Sie war einfach hingerissen von Spencer Brown, dem linkischen jungen Mann in ihrem Kurs zur Einführung in die Computerwissenschaft. Er war den anderen meilenweit voraus. Hope fürchtete, dass seine Fähigkeiten bald alles übersteigen würden, was sie ihm beibringen konnte. Als er das erste Mal in ihrem Kurs aufgetaucht war, war sie überrascht gewesen. Er war der bei Weitem intelligenteste Junge an der Schule und sollte die Abschlussrede halten. Er brauchte die zusätzlichen Punkte nicht. Jeder andere Kurs auf seinem Stundenplan war auf AP-Level. Der Klatsch, den sie im Lehrerzimmer gehört hatte, besagte, dass sowohl Stanford als auch Yale Interesse an ihm bekundeten. Der Junge würde es weit bringen. Es war so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Spencer keinen Computergrundkurs brauchte.
Es dauerte nicht lange, bis Hope herausfand, warum Spencer in ihrem Klassenzimmer saß.
Callie Rhodes, eine weitere Oberstufenschülerin, Mitglied des Tanzteams und Königin der Oberstufe. Sie spielte weit außerhalb von Spencers Liga.
Hope hasste es, dass Spencer eine schwere Enttäuschung bevorstand. In jeder Stunde verriet der Junge sich. Hope war überzeugt, nicht die Einzige zu sein, der das aufgefallen war. Spencer schien den Blick nicht von Callie losreißen zu können.
Hope fragte sich, ob er auch nur ein einziges Wort von dem mitbekommen hatte, was sie im Unterricht gesagt hatte. Seine ganze Konzentration galt Callie, die ihn überhaupt nicht zu bemerken schien.
Callie war beliebt, hübsch und intelligent. Demnach zu urteilen, was Hope sich zusammenreimen konnte, datete sie Scott Pender, den Starathleten und Quarterback der Schule. Sie hatte gehört, dass Scott auch auf Schlüsselpositionen bei den Basketball- und Baseballteams spielte. Im Vergleich zu ihm hatte Spencer keine Chance.
Hopes letzter Kurs des Tages war Geschichte, und sowohl Spencer als auch Callie waren anwesend. Die Oceanside High war eine kleine Schule mit weniger als dreihundert Schülern. Die geringe Größe kam Hope durchaus gelegen. Sie hatte eine bedeutsame Veränderung in ihrem Leben vornehmen wollen: ganz allein in Kalifornien zu leben. Sie hatte unbedingt weggemusst, um zu vergessen und nach vorne zu schauen.
Keine Einkommensteuer zahlen zu müssen war nur einer der Gründe gewesen, weshalb der Staat Washington sie gereizt hatte. Es war schön hier, und sie war sicher gewesen, in einer idyllischen und freundlichen Gemeinde einen guten Job finden zu können. Also hatte sie sich in verschiedenen Kleinstädten, von denen es in der Westhälfte des Staates nur so wimmelte, für das Lehramt beworben. Angesichts ihrer beiden Diplome – einem Master in Erziehungswissenschaften und einem weiteren in schulischer Beratung – war es nicht überraschend gewesen, dass sie von der Oceanside Highschool eingestellt worden war. Ihr war klar gewesen, dass sie eine gute Kandidatin war. Zusätzlich zu ihren Computer- und Geschichtskursen arbeitete sie an zwei Nachmittagen als Beraterin, eine Möglichkeit, die ihr von anderen Schulen nicht angeboten worden war. Das machte Oceanside zu einer sogar noch besseren Wahl. Die Schüler kamen mit den verschiedensten Problemen zu ihr. Meistens brauchten sie nur jemanden, der bereit war, ihnen zuzuhören.
Nach Oceanside zu ziehen war die richtige Entscheidung gewesen. In der Nähe des Meeres zu wohnen war ihr immer wichtig gewesen. In Kalifornien sprengten jedes Haus und jede Mietwohnung innerhalb von zehn Meilen des Pazifiks ihr beschränktes Budget. Es erstaunte sie, dass das kleine Mietcottage, das sie in Oceanside gefunden hatte, so nah am Meer lag, dass sie es zu Fuß erreichen konnte, und, das Beste von allem, auch noch erschwinglich war.
Ihre Vermieter Preston und Mellie Young waren großartig. Preston leitete das örtliche Tierheim, und Mellie war Vollzeitmutter zweier Kleinkinder. Die meiste Zeit über blieben sie für sich. Hope tauschte freundliche Floskeln mit ihnen aus, wenn sie sich begegneten. Mellie blieb viel im Haus, sodass Hope sie nicht oft sah, aber das war in Ordnung.
Das Cottage war schon älter, wahrscheinlich in den Sechzigern oder Siebzigern erbaut. Mellie hatte erwähnt, dass es früher ein Ferienhaus gewesen war. Erst seit einigen Jahren wurde es ganzjährig vermietet. Angesichts des Alters des Hauses war es natürlich, dass ein paar kleinere Reparaturen anfielen. Die Küche konnte einen neuen Anstrich vertragen. Einer der Wasserhähne im Bad war locker, das Geländer der Stufen wurde von einem einzigen Nagel zusammengehalten. Alles Kleinigkeiten, die sich leicht beheben lassen würden. Hope beschwerte sich aufgrund der günstigen Miete auch nicht.
Entschlossen, sich als gute Mieterin zu erweisen, war Hope gerne bereit, alles, was anstand, selbst zu erledigen. Sie musste ihren Vermietern ja keinen Anlass geben, die Miete zu erhöhen.
Oceanside war tatsächlich der perfekte Ort für sie, allem zu entkommen, Wurzeln zu schlagen und einen Neuanfang im Leben zu wagen. Ihr Ziel war es, den Schmerz und den Kummer der Vergangenheit hinter sich zu lassen, ihren Weg weiterzugehen, das Neue ein- und das Vergangene auszuatmen.
Nach dem letzten Kurs des Tages verließ Hope den Klassenraum und ging zum Büro, wo man ihr einen kleinen Arbeitsplatz zugewiesen hatte. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie das Footballteam auf dem Trainingsfeld. Sie bemerkte Callie und ein paar ihrer Freundinnen aus dem Tanzteam auf der Seitenlinie, von wo aus sie den Jungs beim Training auf dem grasbewachsenen Feld zuschauten.
Spencer saß mit einem aufgeschlagenen Buch auf dem Schoß auf der Tribüne und beobachtete Callie verstohlen. Den armen Jungen erwartete nichts außer Herzschmerz. Hope hasste es, mit ansehen zu müssen, was mit Sicherheit folgen würde. Aber ihr war klar, dass sie nichts tun konnte, solange Spencer nicht ihren Rat suchte.
Nachdem sie eine Stunde lang Schüler getroffen und mit ihnen Beratungsgespräche geführt hatte, machte Hope für heute Schluss. Das Footballteam war noch immer auf dem Feld. Eines, was Hope früh erkannt hatte, war, wie stolz die gesamte Gemeinde auf die Erfolge des Highschool-Footballteams war.
Ein Vorteil, dass sie das Cottage von Preston und Mellie gemietet hatte, war, dass die Schule von dort aus gut zu Fuß zu erreichen war. Da sie Besorgungen zu machen hatte, war Hope an diesem Morgen mit dem Auto gefahren. Diese Besorgungen waren zugegebenermaßen eine Verzögerungstaktik für das, was sie im Cottage erwartete.
Nachdem sie beim Lebensmittelhändler und der Reinigung angehalten hatte, fuhr sie zurück. Das Haus mit den zwei Schlafzimmern wurde möbliert vermietet, war aber klein. Dennoch bot es entschieden mehr Platz als das Studioapartment, in dem sie in Los Angeles gewohnt hatte. Obwohl die funktionalen Möbel zum größten Teil altmodisch waren, waren sie nicht hässlich. Wer auch immer früher hier gelebt hatte, hatte den Besitz gut in Schuss gehalten. Mittels ein paar Veränderungen konnte sie das Cottage heimelig und gemütlich gestalten. Was jedoch bedeutete, die Kartons auszupacken, die hinter der geschlossenen Tür des kleinen Gästezimmers standen.
Der Raum, von dem sie es seit ihrem Umzug nach Oceanside vermieden hatte, ihn zu öffnen.
Hope brauchte niemanden, der ihr erklärte, warum sie diese Kartons sicher verstaut hatte und außer Sichtweite aufbewahrte. Angesichts dessen, was sie alles verloren hatte, machte es eindeutig Sinn. Diese Umzugskartons enthielten die Erinnerungen an all den Schmerz und das Leid, das sie erfahren hatte.
Entschlossen, nach vorne zu schauen, egal wie schwierig es war, hielt sie sich nur lange genug in der Küche auf, um die Milch und den Käse in den Kühlschrank zu tun und die Tiefkühlkost in den Gefrierschrank zu legen.
Dann ging sie in ihr Schlafzimmer und hängte die Jacke auf, die sie aus der Reinigung geholt hatte. In der Diele betrachtete sie die geschlossene Gästezimmertür, holte tief Luft und drehte den Knauf, bevor sie den Raum betrat.
Die Kartons stapelten sich zu dreien und zu vieren an der Wand, genau da, wo sie sie zurückgelassen hatte. Sie stand auf der anderen Seite des Einzelbetts mit der Tagesdecke mit Rosenmuster, das sie an den kleinen Blumengarten ihrer Großmutter erinnerte.
Einen langen Moment starrte Hope die Wand an und nahm schließlich all ihren Mut zusammen.
»Das ist doch lächerlich«, sagte sie laut, um sich zu überzeugen, dass es an der Zeit war.
Sie griff nach dem obersten Karton, stellte ihn auf den Plüschteppich und klappte ihn in einem Anfall von Energie auf. Dann spähte sie hinein, starrte den Inhalt an und schluckte hart.
Es fühlte sich an, wie ins Feuer zu springen. In dem allerersten Karton befand sich all der Schmerz, den sie zu vergessen gehofft hatte.
Ganz oben, sorgfältig in Luftpolsterfolie verpackt, lag das Foto ihres Zwillingsbruders Hunter in seiner Uniform eines Army Rangers. Noch bevor sie die schützende Folie entfernt hatte, erkannte sie Hunters ernsten Gesichtsausdruck, während seine dunklen, den ihren so ähnlichen Augen vor Stolz funkelten: stolz darauf, bei den Luftlandetruppen zu sein, stolz, seinem Land zu dienen. Hunter war immer furchtlos und willensstark gewesen. Es war ganz natürlich gewesen, dass er es als Nervenkitzel empfunden hatte, Tausende von Fuß über dem Boden aus einem Flugzeug zu springen, während die bloße Vorstellung Hope Entsetzen einflößte. Zwillinge, so verschieden und doch so ähnlich. Sie spürte, dass es sich mit den Zwillingen, die sie in ihrer Klasse hatte, genauso verhielt. Callie und Ben, beide in der Oberstufe.
Tränen sammelten sich in Hopes Augen, als sie das gerahmte Foto an ihr Herz drückte. Hunter, ihr geliebter Bruder, hatte teuer für seine Hingabe dafür bezahlt, seinem Land zu dienen. Weniger als zwei Jahre zuvor war er als Held in irgendeiner unaussprechlichen Stadt in einer Wüste im Irak gefallen.
Zusammen mit der Feuchtigkeit, die ihre Wangen bedeckte, setzte sich der vertraute Zorn in ihrer Brust fest und schnürte sie bis zu dem Punkt zusammen, an dem ihr das Atmen schwerfiel. In jedem Fetzen von Kommunikation zwischen ihnen hatte sie Hunter angefleht, im Einsatz vorsichtig zu sein. Sie hatte ihn gebeten, keine unnötigen Risiken einzugehen.
Sie hatten nur einander auf der Welt gehabt. Hope hatte immer gewusst: Wenn sie Hunter verlor, würde sie mutterseelenallein sein. Er war alles an Familie gewesen, was sie gehabt hatte. Alles an Familie, was sie gebraucht hatte. Als Zwillinge geboren, von der Mutter im Stich gelassen und von den Großeltern großgezogen, hatten sich Hope und Hunter immer besonders nahegestanden.
Mit von Tränen getrübtem Blick ging Hope in ihr Schlafzimmer zurück und stellte das Foto ihres Zwillingsbruders auf die Kommode. Sie schluckte den Kloß in ihrer Kehle hinunter und drehte den Rahmen so, dass sie jeden Morgen als Erstes sein Gesicht sehen würde, als Erinnerung daran, dass er niemals wollen würde, dass sie ihr Leben lang trauerte.
Der Schmerz über ihren Verlust, das Gefühl der Verlassenheit und das Wissen, vollkommen allein zu sein, waren zu viel. Hope brauchte eine Fluchtmöglichkeit. Sie griff nach ihrer Tasche und ging wieder nach draußen, weil sie frische Luft brauchte. Dann fuhr sie eine Weile ziellos umher und parkte schließlich am Strand. Am Meer zu sein hatte sie immer beruhigt, und wenn es je eine Zeit in ihrem Leben gab, in der sie Frieden und Akzeptanz finden musste, dann jetzt.
Die Tränen auf ihren Wangen wurden in dem Wind getrocknet, der an ihr zerrte, als sie Fußstapfen im nassen Sand hinterließ, Abdrücke, die von der einsetzenden Flut fortgespült wurden. Fort: so wie ihr Zwillingsbruder für immer fort war.
In der Hoffnung, ein Kaffee würde ihr gegen die Niedergeschlagenheit helfen, beschloss sie, sich eine von Willas Spezialmischungen zu gönnen. Die eine Freundin, die Hope seit ihrer Ankunft in der Stadt gefunden hatte, war Willa O’Malley, die Inhaberin des Bean There, eines kleinen Coffeeshops in Strandnähe. Sie empfand eine gewisse Seelenverwandtschaft mit Willa. An den meisten Morgen schaute sie auf einen Latte vorbei, da sie ein leichtes Frühstück bevorzugte, bevor sie sich auf den Weg zur Highschool machte.
Sowie Hope den Shop betrat, blickte Willa von der Theke auf und begrüßte sie mit einem einladenden Lächeln. »Normalerweise sehe ich dich nachmittags nicht. Was kann ich für dich tun?«
Hope bestellte einen Latte, setzte sich ans Fenster, schaute eine Weile hinaus; unfähig, die Traurigkeit abzuschütteln, die von ihr Besitz ergriffen hatte, ließ sie den Blick schweifen. Es erschien ihr unmöglich, ohne Hunter in ihrem Leben nach vorne zu schauen. Selbst jetzt noch, fast zwei Jahre nach seinem Tod, dachte sie jeden Tag an ihn. Sie empfand seinen Verlust heute noch als genauso schmerzlich wie damals, als sie die Nachricht erhalten hatte. Gegen ihren Willen füllten sich ihre Augen erneut mit Tränen. Sie griff nach einer Serviette und tat ihr Bestes, die Feuchtigkeit diskret wegzuwischen.
»Hope?« Willa setzte sich zu ihr an den kleinen Tisch. »Ist alles in Ordnung?«
Der Kloß in ihrer Kehle hinderte sie an einer Antwort. Sie nickte, wollte ihrer Freundin versichern, dass alles gut sei, und schüttelte dann genauso schnell den Kopf. »Ich habe jemanden verloren, der mir sehr nahestand«, stieß sie hervor, wobei ihre Worte kaum hörbar waren. »An manchen Tagen frage ich mich, ob ich je über diesen Verlust hinwegkommen werde.«
Willa setzte sich Hope gegenüber, streckte den Arm über den Tisch und griff nach ihrer Hand. »Das wirst du nicht, nicht wirklich. Sie werden immer bei dir sein, aber eines kann ich dir sagen. Der Schmerz lässt mit der Zeit nach.« Willas Stimme zitterte, als hätte sie ebenfalls einen verheerenden Verlust erlitten.
Hope blickte auf. Bislang wusste niemand in Oceanside von Hunter oder dem Grund, weshalb sie von Kalifornien nach Washington gezogen war. »Hunter war mein Bruder, mein Zwilling … der Letzte meiner Familie.«
»Harper war meine Schwester, so voller Freude und Leben und mit so viel Dingen, für die sie leben wollte. Ich vermisse sie furchtbar. Die Welt fühlt sich so leer ohne sie an. Eine Weile war ich am Boden zerstört, aber das Leben geht weiter, das wollte sie für mich, darum hat sie mich gebeten, und daran habe ich mich gehalten.«
Ihre Finger schlossen sich umeinander, als wollten sie die Erinnerungen an die Menschen festhalten, die sie geliebt und verloren hatten.
Ein paar Minuten später kam ein weiterer Gast herein, und Willa ging zur Theke, aber nicht, bevor sie sich zu Hope hinuntergebeugt und sie umarmt hatte.
»Der Schmerz wird immer da sein, aber ich verspreche dir, dass die Liebe, die ihr füreinander empfunden habt, ihn lindern wird und du wieder imstande sein wirst, Glück zu verspüren. In der Zwischenzeit bin ich hier, wenn du mit jemandem reden möchtest.«
Hope schloss die Augen und hielt sich an Willas Worten fest. Kein Wunder, dass sie die Barista als Seelenverwandte betrachtete.
Hope kehrte zum Cottage zurück. Sie fühlte sich weitaus besser als zuvor. Keine zwei Minuten nach ihrer Rückkehr klopfte es an der Tür.
Sie kannte nur wenige Leute in der Stadt und rechnete nicht mit Gesellschaft. Als sie öffnete, sah sie ihren Vermieter Preston Young auf der kleinen Veranda stehen.
»Hope.« Er sagte ihren Namen, als erklärte das seinen Besuch.
Sie wartete; sicher gab es einen Grund dafür, dass er vorbeigekommen war.
»Ich wollte Ihnen sagen, dass ich, sobald ich eine freie Minute habe, das Geländer der Veranda und den Wasserhahn reparieren werde. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange dafür gebraucht habe.«
»Kein Problem, Mr. Young.«
»Preston, bitte.«
»In Ordnung, Preston.«
»Mit den beiden Babys und meiner Arbeit im Tierheim weiß ich nicht, wo die Zeit bleibt. Mellie hat mir zugesetzt, das Leck unter der Küchenspüle zu finden, und der Himmel weiß, dass ich kein Klempner bin.«
Hope empfand Mitleid mit dem Mann, der offensichtlich vor lauter Arbeit nicht wusste, wo ihm der Kopf stand.
»Wir brauchen im Tierheim dringend Freiwillige«, fügte er hinzu, dabei fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht, als wäre dies eine Bürde, die er nicht brauchte.
Sowie die Worte heraus waren, erstarrte er und blickte sie direkt an, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Sie sind neu in der Stadt, richtig?«
»Ja, erst seit ein paar Monaten.« Was er eigentlich wissen sollte, da er derjenige war, der ihr nach ihrer Ankunft das Cottage gezeigt hatte.
»Hatten Sie abgesehen von Ihren Schülern schon Gelegenheit, jemanden kennenzulernen? Außerhalb der Schule, meine ich. In der Gemeinde?«
Hope war nicht sicher, worauf dieses Gespräch hinauslief. »Ein paar.« Sie hatte einige der Kirchen im Ort besucht, sich aber noch für keine entschieden. Der eine Mensch, an den sie sich am engsten gebunden hatte, war Willa, vor allem jetzt, wo sie wusste, welches Schicksal sie teilten.
»Würden Sie in Erwägung ziehen, ehrenamtlich zu arbeiten?«, fragte Preston mit vor Begeisterung funkelnden Augen. »Das Tierheim ist voll, und viele der Hunde bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Wenn Sie mit einigen von ihnen ein paarmal die Woche spazieren gehen könnten, wäre das eine große Hilfe, über die wir uns sehr freuen würden.«
»Ich …« Hope wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Als sie ein Teenager gewesen war, hatte ihre Großmutter einen extrem giftigen Chihuahua namens Peanut gehabt, den sie mit Aufmerksamkeit und Liebe überschüttet hatte. Was Hope und Hunter betraf, so hatte er sie gewissermaßen toleriert.
»Zu Ihrer Verantwortung würde gehören, die Tiere potenziellen Besitzern zu präsentieren.«
»Ich verstehe.« Sie zog den Satz in die Länge. »Und das würde mir helfen, in der Gemeinde Fuß zu fassen?«
»Oh, definitiv.« Preston lächelte, als böte er ihr die Chance ihres Lebens.
»Darf ich darüber nachdenken?«, fragte sie, weil sie den Vorschlag abwägen wollte. Ihre Abende waren damit ausgefüllt, ihren Unterricht vorzubereiten. Hätte Preston Hunter gefragt, hätte dieser sofort Ja gesagt. Er hatte immer gut mit Tieren umgehen können. Sogar Peanut, der jedes Mal geknurrt hatte, wenn einer von ihnen ihrer Großmutter zu nahe gekommen war, hatte Hunter für sich gewinnen können.
»Ich nehme an, es kann bis morgen warten.« Prestons Schultern sackten nach unten, als fände er sich bereits mit einer Niederlage ab.
»Ich gebe Ihnen Bescheid«, sagte sie.
»Alles klar«, erwiderte er und schickte sich an, zu seinem Haus zurückzugehen. »Und ich verspreche, dieses Geländer zu reparieren, sobald es mir möglich ist.«
»Machen Sie sich deswegen keine Gedanken«, versicherte Hope ihm. Sie war durchaus imstande, ein paar Nägel einzuschlagen. Sie hatte das Problem am Tag ihres Einzugs erkannt und wusste es besser, als sich gegen das Holz zu lehnen oder es mit etwas Schwerem zu belasten.
Später an diesem Abend benotete sie nach einem aus einem Eiersalatsandwich und einem Apfel bestehenden Dinner das Popquiz, das sie ihrer Geschichtsklasse gestellt hatte. Es überraschte sie nicht, dass Spencer den Test mit Bravour bestanden hatte. Sowohl Ben als auch Scott hatten jämmerlich versagt, und Callie hatte nur zwei von zehn Fragen nicht beantwortet.
Hope tat ihr Bestes, um die Geschichte zum Leben zu erwecken, sodass ihre Schüler den Eindruck hatten, als würden sie die Männer und Frauen auf den Seiten ihrer Bücher kennen. Geschichte war Hopes erste Liebe. Der Computerkurs hingegen stellte eine Herausforderung dar. Spencer wäre auf diesem Gebiet wahrscheinlich ein besserer Lehrer als sie, obwohl sie ihn das nicht wissen lassen würde.
Als sie sich für den nächsten Schultag vorbereitete, suchte Hope in ihrem Schrank nach etwas, was sie am Morgen anziehen würde. Als sie sich zu ihrer Kommode umdrehte, fiel ihr Blick auf Hunters Foto.
»Was meinst du denn? Sollte ich im Tierheim arbeiten?«, fragte sie ihn, wohl wissend, dass er ihr keine Antwort geben konnte. »Der einzige Hund, mit dem ich je Zeit verbracht habe, war Peanut, und du erinnerst dich ja sicher daran, wie er war.«
Hunter fuhr fort, ihren Blick stoisch zu erwidern.
»Du bist mir eine schöne Hilfe«, sagte sie. Am liebsten hätte sie gestöhnt.
Hunter hatte Tiere geliebt, ständig verletzte Vögel oder verirrte Kätzchen nach Hause gebracht. Ihre Großeltern hatten ihm nie erlaubt, eines seiner Findelkinder als Haustier zu behalten. Erst nach dem Tod ihres Großvaters hatte Grandma sich Peanut, ihren Trosthund, angeschafft. Sie hatte diesen Hund geliebt und wochenlang um ihn getrauert, als er gestorben war. Zu dieser Zeit hatte Hope den Verlust, den ihre Großmutter erlitten hatte, nicht richtig einschätzen können. Schließlich war Peanut nur ein Hund. Erst später verstand sie das volle Ausmaß der Bedeutung des Haustiers für ihre Großmutter. Peanuts Tod hatte ein riesiges Loch in ihr Leben gerissen. Mit Hunter war der letzte Angehörige von Hopes Familie für immer gegangen. Die Leere und der Verlust dieser Bindung nagten an ihr. Sie war alleine auf der Welt, so furchtbar alleine. Wenn sie nicht mehr da wäre, würde außer ihrer besten Freundin Tonya und ein paar anderen Freunden niemand davon Kenntnis nehmen oder sich groß darum kümmern. Diese Erkenntnis bewirkte, dass sie sich hilflos, verletzlich und verloren fühlte.
Hope hatte mehr als nur ein paar Fragen bezüglich dessen, was ehrenamtliches Arbeiten im Tierheim ihr abverlangen würde. Der einzige Vorteil, den sie sah, war der, den Preston erwähnt hatte: dass sie andere Mitglieder der Gemeinde treffen und kennenlernen würde. Als Bonus könnte es genau das sein, was sie brauchte, um sich von ihrem eigenen Verlust abzulenken. Preston hatte überfordert gewirkt, und es lag in ihrer Macht, ihm zu helfen. Wenn die Arbeit im Tierheim mehr Zeit verschlang, als sie erwartet hatte, würde sie sich höflich verabschieden.
In Gedanken an Peanut und den Trost, den er ihrer Großmutter gespendet hatte, beschloss Hope, dass sie selbst ein bisschen Trost gebrauchen konnte. Und da gab es keinen besseren Weg, als diesen verlassenen und verlorenen Tieren zu helfen, ein neues, endgültiges Zuhause zu finden. Und das half ihr vielleicht, dasselbe zu tun.
2
Hope kauerte sich hin und hielt gebührenden Abstand zu dem Deutschen Schäferhund im Zwinger. Preston hatte sie gewarnt, dass Shadow, wie er im Tierheim genannt wurde, sich aggressiv und feindselig allen gegenüber verhielt, die versuchten, sich ihm zu nähern. Shadow war ausgehungert und halb tot von Keaton, einem Freund von Preston, hergebracht worden. Keaton hatte Shadow am Straßenrand liegend gefunden, zu schwach zum Laufen, mit einer gerissenen Kette um den Hals und offenen, nässenden Wunden auf dem Fell, besonders um den Hals herum. Trotz seines jämmerlichen, erschöpften Zustands hatte es einige Mühe gekostet, Shadow in den Truck zu verfrachten. Die traurige Geschichte dieses armen, vernachlässigten Hundes griff Hope ans Herz. Irgendwie war dem Kettenhund die Flucht gelungen.
»Hallo, mein Junge.« Hope sprach bewusst sanft und leise. Der auf seiner Matte ausgestreckte Shadow sah sie mit dunklen, bekümmerten Augen an. »Du bist jetzt in Sicherheit, und hier gibt es Leute, die sich gut um dich kümmern und dich lieb haben werden.«
Preston näherte sich ihnen, und trotz seiner Schwäche hob Shadow den Kopf, knurrte und fletschte die Zähne. Sein gesamtes Verhalten änderte sich; er versuchte, auf die Beine zu gelangen, und kippte zur Seite, bevor er sich an der Seite des Zwingers abfing.
»Alles gut, Junge«, sagte Preston in demselben beruhigenden Tonfall, den Hope vorher angeschlagen hatte. »Niemand wird dir je wieder etwas zuleide tun.« Shadow schien ihm weder zu glauben noch ihm zu trauen, denn er fuhr fort zu knurren.
»Ich weiß nichts über ihn«, sagte Preston, die Brauen besorgt zusammengezogen.
»Wie meinst du das?«
»Wenn sich ihm jemand nähert, wird er aggressiv.«
»Wirklich? Bei mir nicht.« Hope erhob sich von den Knien, und Shadows Blick folgte ihr, bevor er schwankend zu seinem Schlafplatz zurückkehrte.
»Nicht?« Prestons Stirnrunzeln wich Überraschung. »Niemand hat es geschafft, in seine Nähe zu kommen. Der einzige Grund, warum es Keaton überhaupt gelungen ist, ihn zu retten, war, weil Shadow zu schwach zum Kämpfen war.«
»Der arme Kerl. Wie lange ist er schon hier?«
»Seit Mittwoch.«
»Weniger als vier Tage.« Sie zählte im Kopf nach. Es war erst Hopes zweite Woche als Freiwillige. Letzte Woche hatte sie geplant, nur ein paar Stunden zu bleiben, und dann waren es sechs geworden. Sie hatte den Hunden Wasser gegeben und sie gefüttert, ein paar spazieren geführt und zwei Hunde ihren neuen Familien vorgestellt. Mit anzusehen, wie diese verlorenen, im Stich gelassenen Tiere ein liebevolles Zuhause fanden, hatte sie tief berührt. Beide Male hatte sie gegen die aufsteigenden Tränen ankämpfen müssen.
»Da ist jemand, von dem ich möchte, dass du ihn kennenlernst«, sagte Preston, dabei blickte er zum anderen Ende des Tierheims.
»Okay.« Hopes Blick folgte seinem und fiel auf einen anderen der ehrenamtlichen Helfer. Er war ihr schon vorher aufgefallen, man konnte ihn schwerlich übersehen. Er hatte kurz in ihre Richtung geschaut, und dabei hatte sie seine gequälten Augen bemerkt. Er war wahrscheinlich Ende zwanzig oder Anfang dreißig, also ungefähr in ihrem Alter. Beim Laufen hinkte er leicht, was ihr nicht entgangen war. Er hatte nichts gesagt, als er gekommen war, und sie auch nicht. Er wirkte ganz in seine Gedanken versunken, und sie mochte sich nicht aufdrängen.
Preston ging zu dem Mann hinüber, der einen Hund an der Leine hielt. »Das ist Cade«, sagte er. »Ein weiterer Freiwilliger. Cade, das ist Hope.«
Cade trug eine Camouflagejacke und abgewetzte Jeans. Er war gut fünfzehn Zentimeter größer als sie, musste also etwas über eins achtzig sein, war kräftig und muskulös. Sein dunkler Blick kreuzte flüchtig den ihren, bevor er ihn senkte.
»Freut mich, dich kennenzulernen, Cade«, sagte sie fröhlich.
Cade erwiderte den Gruß mit einem Nicken.
»Das ist erst meine zweite Woche hier. Bislang macht mir die Arbeit wirklich Spaß«, fuhr sie in dem Versuch fort, freundlich zu sein.
»Ich muss Joker ausführen.«
»Klar«, erwiderte sie. Sein Mangel an Entgegenkommen brachte sie aus der Fassung. Cade ging davon, und Hope wandte sich an Preston, weil sie wissen wollte, ob sie etwas Falsches gesagt hatte.
Noch bevor sie fragen konnte, meinte Preston: »Nimm es ihm nicht übel. Cade macht eine schwere Zeit durch. Er arbeitet jetzt seit einem Monat ein paar Tage in der Woche hier. Sich um die Tiere zu kümmern scheint ihm zu helfen. Gib ihm Zeit, so wie du es mit Shadow machen würdest.«
»Natürlich.« Cade schien für sich bleiben zu wollen, was ihr recht war. Vielleicht würde er sich irgendwann in ihrer Gegenwart wohler fühlen und sie sich in seiner. Es störte sie nicht, wenn er sich lieber nicht mit ihr anfreunden wollte. Die Entscheidung lag bei ihm. Vielleicht würden sich ihre Wege sowieso nie wieder kreuzen.
Für den Rest des Nachmittags arbeitete Hope eine Liste von Aufgaben ab, die Preston ihr gegeben hatte, als sie das erste Mal gekommen war. Jellybean, ein großer weißer Pyrenäenhund von der Größe eines kleinen Ponys, wurde von Mary Lou Chesterton, einer Lehrerin im Ruhestand, aufgenommen. Hope hatte das Privileg, Jellybean zu ihr hinauszubringen.
Miss Chesterton ließ sich auf ein Knie sinken, sodass sie sich auf Augenhöhe mit dem Hund befand. »Wir werden die besten Freunde werden«, teilte sie ihm mit. Sie schien Hope, die Jellybeans Leine hielt, kaum zur Kenntnis zu nehmen.
»Das glaube ich auch«, meinte Hope.
Die Frau blickte auf und lächelte, als sie Hope sah. »Mein Mann und ich hatten im Lauf der Jahre drei Pyrenäenhunde. Wir lieben diese Rasse. Nicht jeder ist dafür geeignet, so große Hunde zu halten. Zu uns passen sie perfekt.«
»Ich bin sicher, Jellybean wird Sie nicht enttäuschen.«
»Ich werde seinen Namen ändern.« Sie schüttelte den Kopf, als fände sie Jellybean unmöglich.
»Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Wenn die Tiere nicht identifiziert werden können oder nicht gechipt sind, gibt das Tierheim ihnen vorläufige Namen. Jellybeans Name hat überhaupt nichts zu bedeuten.« Den Hunden Namen zu geben verlieh ihnen eine Identität und half dem Tierheim zu wissen, welcher Hund einen potenziellen Besitzer interessierte.
Miss Chesterton fuhr mit der Hand über das dichte weiße Fell und nahm Hope die Leine ab. »Bist du bereit, nach Hause zu gehen, Jasper?«
»Jasper?«, wiederholte Hope und ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen.
»Ja, ich habe mich für den Namen entschieden, nachdem ich sein Foto gesehen habe. Ich habe einen Blick auf ihn geworfen und gleich gewusst, dass er ein Jasper ist.«
»Das gefällt mir.«
Als Hope den Papierkram erledigt hatte und die Gebühren bezahlt waren, konnte Jasper in sein neues ständiges Zuhause entlassen werden. Trotz der kurzen Bekanntschaft war Hope zuversichtlich, dass Miss Chesterton eine gute Hundehalterin sein würde.
Als wüsste er genau, was er als Nächstes zu tun hatte, sprang Jasper auf die Rückbank des roten SUV und legte sich hin, wobei er einen ordentlichen Teil des Sitzes einnahm.
Hope beobachtete, wie das glückliche Paar davonfuhr. Zu sehen, wie die geretteten Tiere ein neues Zuhause fanden, war in der Tat befriedigend. Als sie zum Tierheim zurückkehrte, kam sie an dem Zwinger vorbei, wo Shadow immer noch schwach und traurig lag. Der arme Junge tat ihr entsetzlich leid.
Einmal mehr kauerte sie sich hin und legte die Handflächen gegen den Zwinger. Shadows dunkle Augen trafen ihre. »Ich sehe, du hast deinen ganzen Napf leer gefressen. Guter Junge.« Mit weicher Stimme fuhr sie fort zu reden, ließ Shadow wissen, dass er nicht allein sei und dass er, wenn es ihm besser ginge und er wieder bei Kräften wäre, zu einer Familie kommen würde, die gut für ihn sorgen würde. Er müsste nie wieder Angst haben, dass jemand ihn misshandelte.