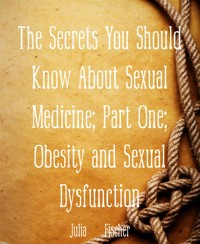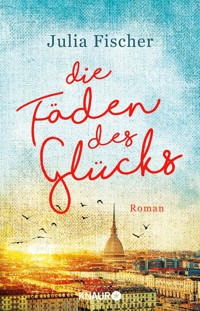Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein wunderbar poetisch erzählter, dabei tragische Themen nicht scheuender Roman über eine ungewöhnliche Frau. Seit 20 Jahren ist die Heilpraktikerin Milli Gruber heimlich in den Arzt Paul verliebt, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verbindet. Als Pauls Frau stirbt, weiß Milli mit ihrem besonderen Gespür für Menschen, dass er selbst sie nun nicht um sich haben will. Aus der Ferne sucht sie nach einem Weg, ihn aufzufangen, seine Trauer, seine Verzweiflung zu lindern. Ein Jahr lang schreibt Milli Paul täglich einen Brief und schenkt ihm Trost. Wenn Worte heilen können, dann ihre. Am Ende besitzen Milli und Paul etwas unglaublich Kostbares: eine Liebe ohne Begehren, eine Sehnsucht ohne Anhaften, ein Tasten, das unter die Haut geht, ohne sie zu berühren.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Fischer
Sehnsucht auf blauem Papier
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Die Geschichte der Millicent Gruber, ihrer besonderen Gabe als Heilerin, ihrer »Patienten« – und ihrer heimlichen Liebe zum Arzt Paul.
Inhaltsübersicht
Für Emma, die Schöne, den Vokal unter den Konsonanten, und
Coony, die Sanfte, die wir beide so sehr vermissen.
»Der Rest ist Schweigen, Treue, Seelenerschütterung, azurner Schatten auf blauem Papier, das alles aufnimmt, was ich schreibe, lautloses Vorbeihuschen silberbenetzter Pfoten.«
Colette
8. September 2012
Lieber Paul,
das Schweigen füllt alles aus. Es gießt Blei in die Worte, lässt sie auf den Grund der Ohnmacht sinken und raubt allen Trost. Doch Dir waren die Dinge unbenannt schon immer lieber. Unausgesprochenes kann der Realität so gut widerstehen, es muss sich nicht am Machbaren messen, nicht in eine Form zwängen lassen, die es nicht ausfüllen kann oder beengt …
Milli blickte auf den untätigen Füllhalter in ihrer Hand. Sie war seit einer Stunde nicht vorangekommen, nur ein paar Worte standen auf dem blassblauen Papier. Das war doch kein Tag zum Briefeschreiben, dachte sie erschöpft, während sie ihn Revue passieren ließ. Das war der Tag zum Einmachen – milchsaures Gemüse, Marmeladen und Pflaumensaft. An so einem Tag ging doch keiner für immer fort, da stürzte nicht einfach eine Welt ein. Die Äpfel und Kartoffeln mussten schließlich eingelagert werden, die Roten Rüben, Möhren und der Sellerie aus ihrem unüberschaubaren Garten hinter ihrem alten Haus. Milli wollte heute die Schätze aus ihrem Gemüsebeet, das im Osten des verwilderten Grundstücks lag, in ihrem Keller in kleine Holzsteigen stapeln, deren Böden sie zuvor mit frischem Stroh ausgelegt hatte. So wie sie das jedes Jahr am ersten Septemberwochenende tat. Zum Abschluss drapierte sie noch eine Schicht Moos darüber und steckte kleine Schilder dazu, damit sie nicht im Halbdunkel wie ein Trüffelschwein zu wühlen brauchte, wenn es zur Winterzeit ans Kochen ging. Ja, heute war der Tag der Vorratshaltung, denn der Sommer hatte sich bereits verausgabt. Er rastete vor Millis Tür, dort, wo das Laub schon leicht verfärbt war und Birken und Buchen erste mattgelbe Blätter im Wind schaukeln ließen. Nur einer der Apfelbäume trotzte noch, grün und ungeerntet stand er da.
In altgedienten Kisten und Schüsseln aus verblichenem Porzellan hatte sich in der Küche, im Flur und sogar in der alten Schubkarre vor der Haustür den ganzen heutigen Samstag über die letzte Ernte gestapelt. Zum Teil stand sie immer noch dort. Damit war das Wochenende fest verplant gewesen, doch dann hätte Milli ihr Gemüse beinahe mit dem Salz der fassungslosen Tränen konserviert, fünfzehn Gramm auf einen Liter Quellwasser, unter sterilen Bedingungen in Gartöpfe und Einweckgläser abgefüllt.
Wie konnte das sein?
Milli hatte schon am frühen Morgen begonnen und den Holzherd mit dem klapprigen blechernen Saftkocher darauf in der Küche angeheizt, dass es ihr die Hitze nur so ins Gesicht trieb. Ihre hellblonden, langen Haare klebten auf der schweißnassen Haut, was ihr einen kleinen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Wechsel in ein paar Jahren gab. Auf dem Elektroherd neben dem knisternden Feuer köchelten derweil die ersten Pickles und Chutneys, und gerade war Milli dabei gewesen, die dritte Ladung Pflaumen in den Entsafter zu füllen, da hatte es lange und durchdringend geklingelt, und jemand klopfte an der Haustür. An ihrem angestammten Einmachwochenende! War den Leuten denn nichts heilig? Die wenigen Bekannten wussten doch um diese Prozedur. Marie, Millis »Pflege-Zieh-Tochter«, eine Dauerleihgabe ihrer überarbeiteten Mutter, hatte sich mit der schwachen Ausrede entschuldigt, sie müsse den Stoff vom letzten Schuljahr noch einmal durchgehen, die Ferien seien schließlich bald um. Und sogar Momo und Kassiopeia, Millis Katzen, hatten sich aus dem Staub gemacht, da sie lieber verhungerten, als das routinierte Scheppern und emsige Hantieren zu erdulden. Diese Geschäftigkeit raubte ihnen den Frieden im Haus. Aber bitte, der Unvorsichtige, der da gerade Einlass begehrte, würde gleich eingespannt werden, es gab schließlich genug Arbeit. Nun klopfte es auch noch am Fenster, und jemand rief: »Frau Gruber, bitte, ich weiß, ich störe, aber es ist ein Notfall. Frau Gruber!« Das war Sophie! Sophie Sager, Pauls Sprechstundenhilfe. Sie war in den letzten zwanzig Jahren immer wieder mal Millis Patientin gewesen und empfahl sie als Heilpraktikerin weiter, sooft sie nur konnte. Außerdem legte Milli ihr ab und an die Karten und beriet sie in privaten Angelegenheiten.
Über die vollgestellte Arbeitsplatte gebeugt, riss Milli jetzt das mittlere der drei Fenster auf, und sofort zog der Duft von Äpfeln, Ingwer und Rosinen in den mittäglichen Garten hinaus. Wie ein Schwall aus einem herbstlichen Füllhorn ergossen sich Aromen von Chili, Zimt, Nelken und Kardamom nach draußen. Sophie konnte das Konglomerat an britisch-kolonialer Geschmacksexplosion gar nicht zuordnen. Küchendämpfe wallten, und eine geschäftige Millicent Gruber in praktischer Schürze erschien dahinter. Sie ließ bei Sophies Anblick prompt den Kochlöffel fallen, so ehrlich verzweifelt sah diese aus. »Ich mache auf«, sagte Milli nur und lief zur Tür.
Dann, Milli saß mit Sophie am Küchentisch, denn sie durfte ihre Töpfe nicht aus den Augen lassen, weinte ihr Gegenüber und erzählte über das leise Köcheln der Herde hinweg stockend: »Sie ist tot. Emma Ebner ist tot. Es war ein Unfall auf der Straße nach Martinsried, gestern Nachmittag.«
»Haben Sie mit Dr. Ebner gesprochen?«, fragte Milli erschüttert.
»Nein, seine Schwägerin hat mich angerufen, vor einer halben Stunde erst. Dass die Praxis bis auf weiteres geschlossen bleibt und ich versuchen soll, eine Vertretung für ihn zu finden.« Sophie starrte mit stumpfem Blick in Millis Küchenchaos. »Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier bin«, murmelte sie dabei geistesabwesend.
Der Tee war fertig, und Milli schenkte ein. Sie trank immer Tee, wenn das Leben keine Antworten mehr bereithielt und die Ratlosigkeit sich breitmachte. Wenn Verzweiflung, Angst oder Traurigkeit überhandnahmen, dann immer und zu jeder anderen Gelegenheit auch. Aber heute half er nicht, die Konfusion aufzulösen. Emma Ebner. Pauls Frau. Dreißig glückliche Ehejahre. Emma. Pauls Frau.
Die Gedanken wiederholten sich. »Ist er zu Hause?«, fragte Milli verzagt.
»Ich weiß es nicht.«
Sophie weinte immer noch, als Milli plötzlich aufsprang. »Sophie, Sie halten hier die Stellung. Das kleingeschnittene Gemüse da drüben muss in die Einweckgläser geschichtet werden. Eine Lage Gemüse, dann etwas von der Sole dort angießen. Gemüse, Sole und am Schluss die Steine obendrauf. Das Salzwasser muss abschließen. Sie sehen es bei den fertigen Gläsern hier.«
»Aber so was hab ich noch nie gemacht«, entgegnete die unfreiwillige Küchenhilfe entgeistert.
»Umso besser, das lenkt ab. Eine Anleitung gibt’s im Kochbuch.« Milli deutete auf ein Regal über dem Tisch. The complete Vegetarian stand auf einem abgegriffenen Buchrücken, und Sophie überprüfte im Stillen ihre Englischkenntnisse. So ein Unsinn! »Wenn das Kleingemachte austrocknet, gärt es nicht mehr im Glas. Das ist mein B12-Vorrat für den Winter, verstehen Sie?«
Tat sie das? Sophie griff nach dem Buch und einer Schüssel und gab ihr Bestes, während Milli überstürzt das Haus verließ und in Ermangelung eines Autos nebst Führerschein wie immer mit dem Fahrrad losfuhr. Am Café in der Bahnhofstraße hielt sie an und kaufte zwei Stücke Sachertorte. Erst als sie die draußen in ihrem Fahrradkorb verstauen wollte, sah sie auf ihre Hände – orange, möhrengelb. Vom Rote-Bete-Saft hatte sie sogar dunkle Ränder unter den kurzen Nägeln. Und wie roch sie denn eigentlich? Puh, das war der Essig, der hing ihr in den Kleidern. Ach herrje, von wegen Kleider, sie trug ja noch die dunkelgrüne Küchenschürze! Und wie sie überhaupt aussah – sie entdeckte gerade ihr derangiertes Spiegelbild in der Auslage der Konditorei –, völlig aufgelöst und verschwitzt. Nein, so konnte sie doch nicht bei ihm in der Tür stehen. Und was sollte sie auch sagen? »Mein Beileid, Paul?« Nein, sicher nicht! Der Schürze entledigt, war Milli schon weitergefahren, da brannte ihr diese essenzielle Frage noch immer auf der Seele. »Paul, es tut mir so leid, ich kann nachfühlen, wie …« Guter Gott, nein! Ja, sie konnte nachfühlen, wie es war, und doch konnte sie nicht mit dieser dummen Floskel bei ihm in der Tür stehen mit Sachertorte in der Hand. Was sollte das denn eigentlich mit dem Kuchen?
Da vorne musste sie links abbiegen, und dann stand am Ende der Straße sein Haus. Milli war in über zwanzig Jahren noch nie da gewesen. Wahrscheinlich war er auch gar nicht allein. Anna, seine Schwägerin, würde da sein. Sie würde sich vorstellen müssen: »Millicent Gruber, eine Kollegin. Also nicht direkt … Ich bin Heilpraktikerin. Nein, eine Freundin …« Ja, was war sie denn überhaupt? Verzweifelt, das war sie. Verzweifelt und ratlos und bereits wieder auf dem Rückweg, weil dieser Besuch eine Schnapsidee gewesen war.
Und so landete Milli, kaum eine halbe Stunde nachdem sie losgefahren war, unverrichteter Dinge wieder bei sich zu Hause und stellte ihr Rad in die Auffahrt. Die Nachmittagssonne wärmte noch kräftig. Was für ein wunderschöner Tag, dachte sie kurz. Was für ein Alptraum. Milli blickte ins Dickicht ihres Gartens, während sie den Kuchen und ihre Schürze an sich nahm. Die ungezählten alten und jungen Bäume dort, die Sträucher und vergessenen Rosenstöcke verschlangen jeden Blick. Der ehemals so respektable Garten ihrer Vorfahren war ein Wald geworden. Ein Dschungel von ungeheurer Größe, den Milli nur deshalb sich selbst überließ, weil sie um seine besonderen Kräfte wusste, die zunahmen, je ungezähmter die Natur hier Raum griff. Zwischen ihr und den Pflanzen hatte sich eine Symbiose gebildet, aus der sie ihre Heilkräfte zog. Genau wie aus dem Haus, das für sie keinesfalls nur ein Werk aus Stein und anderem Baumaterial war, sondern ein lebendiger Organismus. Es war ein Ort der Transzendenz, an dem Energie, die erstarrt war, in ihren anfänglichen Zustand des ungeordneten Chaos zurückfand. Millis aktueller Seelenlage entsprechend.
Sophie hatte während Millis kurzer Abwesenheit sechs Einmachgläser und einige Flaschen Saft befüllt. Allerdings hatte sie die Deckel für Letztere nicht gefunden, weshalb Milli sie später verschloss, als der Pflaumensaft schon fast wieder abgekühlt war. Dabei blieb der Unterdruck auf der Strecke, der für die Haltbarkeit unerlässlich war. Egal, an so einem Tag mussten eben Abstriche gemacht werden. Neben der Küchenarbeit, die die zwei sich jetzt teilten – Sophie, nur weil sie nicht nach Hause wollte, und Milli, um sich an etwas festzuhalten, das wenigstens einen Anflug von Normalität verbreitete –, aßen sie freudlos den Kuchen. Und dann, die Küche war noch immer ein Schlachtfeld, aber es war schon spät, verabschiedete Sophie sich doch und versprach, anzurufen und Milli auf dem Laufenden zu halten. Diese verstaute daraufhin die letzten Einmachgläser im Keller, anstatt sie wie sonst erst einmal in der Speisekammer bei wärmeren Temperaturen zwischenzulagern, damit der Gärprozess in Gang kommen konnte, und räumte in Gedanken an Paul sinnlos ihr Küchengerät hin und her. Den Pflaumentrester hatte Milli in die blaue Papiertonne gekippt, was ihr wohl erst in ein paar Tagen auffallen würde, und den Saftkocher spülte sie nun schon zum zweiten Mal ab, ohne es überhaupt zu bemerken. Sie musste doch etwas unternehmen, dachte sie unentwegt über ihrem konfusen Tun. Irgendetwas. Was fühlte sich denn nicht albern an?
Als Milli die Schüssel mit dem Birnenschnaps, in dem sie immer die Flaschendeckel sterilisierte, in die Spüle leerte, dachte sie an ihre Mutter und die Granny, bei denen die zeitaufwendige Einmachorgie auch schon Tradition gehabt hatte. Das bedurfte eines herzhaften Schlucks direkt aus der Flasche, obwohl Milli so gut wie nie Alkohol trank.
Die kleine Explosion führte sie in die Vergangenheit. Sie war einundzwanzig gewesen, als sie ihre Eltern verlor. Da war ihre Welt eingestürzt. Und Fanny war da gewesen, ihre engste und älteste Freundin. Wie Balsam hatte sie sich damals über alles ausgebreitet, über Millis Haus, in das sie faktisch eingezogen war, über ihre wunde Seele und sogar über die langen, wachen Nächte. Der Fanny-Balsam hatte irgendwann auch die letzte wunde Stelle ausgekleidet. Der und ihr zärtliches Schweigen, mit dem sie Millis begleitet hatte. Fanny war in dieser Zeit überall gewesen und doch nicht da. Genau das musste Milli jetzt auch schaffen, sie musste bei ihm sein und dabei unsichtbar bleiben. Sie musste Worte finden und trotzdem schweigen.
Seit sie diese Eingebung gehabt hatte, saß Milli in ihrem winzigen Büro, ihrem »Kontor der Worte«, wie sie es nannte, und versuchte diesen Brief zu schreiben. Der alte Stuhl ihres Vaters, der selbst ihr angemessenes Gewicht kaum mehr trug, knarrte mittlerweile sogar beim Luftholen, doch Milli liebte das Angeschlagene. Alles, was sich dem Leben und der Zeit mit sanftem Widerstand entgegenstemmte und doch langsam seine vertraute Form und Funktion verlor. Das Nutzlose, Sinnbefreite und Erlöste war für sie immer ein Bild der absoluten Freiheit. Natürlich brauchten solche Dinge besonderen Schutz. Die alte Pendeluhr ihres verstorbenen Großvaters etwa, die ganz aus Holz gemacht war. Nur ein Zeiger wanderte gemächlich zwischen den Stunden, die mit dunkler Farbe in lateinischen Zahlen aufs verblichene Ziffernblatt gemalt waren. Er wurde durch ein kleines Werk hölzerner Zahnräder angetrieben und mit einem waagerechten Pendel über dem Zahlenrund in seiner Geschwindigkeit bestimmt. Wieder und wieder musste man ihn neu justieren, denn die Zeit war hier von allerlei Faktoren abhängig. Der Luftfeuchtigkeit zum Beispiel, die es erlaubte, dass sich das Holz der Uhr im trockenen Sommer zusammenzog und so den Stunden einen kräftigen Schub gab. Bei Regen dagegen sperrten sich die Rädchen, und das alte Ding verfiel in Trägheit. Milli vergaß auch oft, das große gusseiserne Gewicht nach oben zu ziehen, was das Ticktack des verschrobenen Zeitmessers regelmäßig verstummen ließ. Im Gruberhaus gab es Lampen, die nicht mehr leuchteten, weil die Elektrik versagte, fadenscheinige Teppiche, deren zartes Verblassen Millis mütterliche Instinkte ansprach, und munter durcheinandergewürfeltes Porzellan. Jedes einzelne Service hatte, noch in potenter Stückzahl, erlesene Gesellschaften im Haus erlebt. Ja, Milli hatte viele solcher Sinnlosigkeiten in ihrem Haus bewahrt. Sie genossen Asyl, da sie, von anderen als ihr geborgen, mit einem Bein auf der Müllhalde gestanden hätten. Ach was, mit einem Bein, mit beiden!
Über eine Stunde quälte Milli sich nun schon, doch sie war noch immer nicht über die ersten vier Sätze hinausgekommen: »Das Schweigen füllt alles aus …« Die schmalen, hohen Regale, die sie umgaben, schienen immer näher zu rücken. Nun verstand sie die Feigen, die verstummten und sich davonmachten, wenn das Schicksal an die Tür ihrer Freunde klopfte. Das Leid musste einen nur heftig genug mitreißen, dann erschienen einem selbst die aufrichtigsten Worte banal. So banal wie milchsauer eingelegtes Gemüse neben der Nachricht vom Sterben und Verlassenwerden. Doch Milli hatte über dem letzten Raspeln und Stampfen der Vegetabilien und dem sinnlosen Räumen ihrer chaotischen Küche einen Plan gefasst. Sie würde Paul von heute an jeden Tag einen Brief schreiben, das ganze Jahr über, bis wieder geerntet wurde. Er konnte sie lesen, wenn er einsam war, oder auch weglegen. Er konnte sie sammeln, beantworten oder einfach ignorieren, aber sie würde damit stellvertretend in seiner Tür stehen, präsentabel, ohne Ränder unter den Nägeln. Milli wollte einfach in Pauls Briefkasten schlüpfen und mit der Zeit … Wie viel Zeit? Egal. Mit der Zeit würde er ihre Hilfe annehmen. Die Aufmerksamkeit. Die Sorge. Ihre Liebe.
8. September 2012
Lieber Paul,
das Schweigen füllt alles aus. Es gießt Blei in die Worte, lässt sie auf den Grund der Ohnmacht sinken und raubt allen Trost. Doch Dir waren die Dinge unbenannt schon immer lieber. Unausgesprochenes kann der Realität so gut widerstehen, es muss sich nicht am Machbaren messen, nicht in eine Form zwängen lassen, die es nicht ausfüllen kann oder beengt. Für das, was geschehen ist, gibt es ohnehin kein Wort. Keines, das Dich hält oder trägt, so wie sie.
Eine glückliche Ehe lässt Raum zum Atmen, sie ist wie ein Quadrat, das an einer Ecke offen bleibt, hast Du einmal gesagt. Eines, in dem die Liebe schwebt und eine zarte Schicht aus Vertrauen und gemeinsamen Träumen dafür sorgt, dass sie nicht hinausfällt aus dem Konstrukt aus Versprechen und Zeit. Doch Deine Träume sind gestern verschwunden. Deine Liebe ist auf dem Boden aufgeschlagen, mit Säcken gegürtet voll vom Tausendfragensand, wie Luftschiffballast. Sie wird nie wieder aufsteigen.
Wenn es doch nur eine Hoffnung gäbe, die ich Dir auf die leeren Augen legen könnte, in Dein leeres Herz.
Paul, schläfst Du überhaupt? Isst Du etwas? Ich strecke meine Hand aus, um Dich inmitten der Hölle, in der Du vergehst, zu berühren, aber Du kannst mich dort nicht spüren. Und gewiss erträgst Du jetzt auch keinen Zuspruch. Aber ich werde trotzdem hier sein, mit meinen Zeilen bei Dir sein, an jedem Tag.
Millicent
Irene Mayer ging nun schon eine ganze Weile die idyllische Straße entlang und genoss die frühherbstliche Kühle. Die Adresse, nach der sie gesucht hatte, entpuppte sich als Grundstück mit Jugendstilvilla. Sie wirkte nicht mehr ganz taufrisch, aber immer noch herrschaftlich und beeindruckend. Der Besucher fühlte sich durch ihren Anblick in die Vergangenheit versetzt. Der umgebende Garten war völlig verwildert, ein Wald, wie ihn Irene nie zuvor auf einem Privatgrundstück in München und Umgebung gesehen hatte. Eine Schubkarre stand in der Einfahrt, alte Obstkisten stapelten sich darin.
Sie war mit ihrem Wagen auf dem Weg hierher über die Gräfelfinger Bahnhofstraße gefahren, vorbei an hübschen Geschäften, für Bekleidung, Blumen und Lebensmittel, die sie aber nicht abschreckten wie die Billigketten an den zentralen Punkten der übrigen Stadt. Oder wie die riesigen Supermärkte mit mannigfachen Produkten aller bekannten Hersteller und jeden Veredelungsgrades. In diesen Tempeln des dekadenten Überflusses schämte sich Irene. Musste man die vielen, die Tag um Tag ängstlich ihren Kontostand im Auge behielten, wirklich derart verhöhnen? Mit vierzehn verschiedenen Wassern im Angebot, während ein ganzer Kontinent verhungerte, weil kein Regen mehr fiel? Wie weit konnte man es treiben?
Sie hatte einen Optiker gesehen, vielleicht schaute sie auf dem Rückweg mal rein. An ihrer Lesebrille löste sich eine dieser winzigen Schrauben. Wahrscheinlich brauchte sie sowieso eine neue, die Buchstaben waren nicht mehr so bestechend klar wie noch vor drei Jahren. Aber man log sich ja gerne eine Weile lang in die Tasche.
Irene blickte auf die Uhr, neun Uhr fünfzig. Sie war immer noch zu früh dran.
Für eine neue Brille würde sie erst zum Augenarzt gehen müssen. Mein Gott! In diesem Jahr hatte sie das Screening beim Hautarzt ausgelassen und war noch nicht beim Zahnarzt gewesen. Den Gynäkologen hatte sie erst vorgestern aufgesucht, da war alles in Ordnung. Dass sie seit Mai nicht mehr atmen konnte, war auch erst einmal genug. Es hatte mit einer Frühlingsgrippe begonnen, doch die Enge in ihrer Brust verschwand nicht mehr. Also musste sie zum Lungenfacharzt, einem HNO und zuletzt zum Allergologen, der dann das allergische Asthma diagnostiziert hatte. Eine Tierhaarallergie, die wie aus dem Nichts gekommen war. Sie war keine Allergikerin! Sie hatte die laufenden Nasen und rot verquollenen Augen der Freunde oder Kollegen immer mit Mitleid betrachtet und dachte, dass ihr so etwas nie passieren würde. Die Gesundheit ging eben gerne mit der Überheblichkeit der Unverwundbarkeit einher. Doch dieses Asthma betrachtete Irene nur als beunruhigendes Intermezzo, als Warnschuss eines verrückten Immunsystems. Wenn sie jetzt allerdings bloß die Auslöser eliminierte und zum Kortison griff, würde sie vielleicht größere Probleme bekommen. War Krebs nicht auch eine Immunschwäche im weitesten Sinn? Nicht jede Art vielleicht, aber manche?
Letzten Winter war ihr alter Kater schwer krank geworden, und sie mussten ihn einschläfern lassen. Ihr neunjähriger Sohn hatte in der Tierarztpraxis neben seinem großen Bruder gestanden und war starr gewesen vor Angst, als die Arzthelferin dem schwindenden Körper die Spritze gab und die Augen des Katers daraufhin erloschen. Sah man das Leben gehen? Irene bemerkte tatsächlich, wie etwas aus dem Blick ihres Katers verschwand. Es waren nur Sekunden, doch sie verteilten sich, zerstreuten, der Moment verlor seine vertraute Form. Vergangenheit, Zukunft, aber nichts dazwischen. Die Gegenwart wurde zum Vakuum. War das das richtige Wort, Vakuum? Darin dürfte der Schmerz eigentlich nichts wiegen. Er dürfte nicht schneller auf den Grund der Seele sinken als die geliebte Erinnerung.
In dieser Nacht war ihr Kleiner aufgewacht.
»Boomer hat Angst, Mama«, hatte er gesagt. »Er ist da ganz allein.«
»Glaub mir, er fürchtet sich bestimmt nicht. Es geht ihm gut. Und er hat endlich keine Schmerzen mehr.«
»Aber er ist doch nachts immer hier bei mir. Ich will, dass er hier ist. Wir müssen ihn heimholen, Mama.«
So war sie tags darauf ins Tierkrematorium gefahren und hatte eine leere Urne mit nach Hause gebracht. Der Kater war schon eingeäschert worden, namenlos und unter den vielen Tieren nicht mehr auszumachen gewesen, doch das konnte sie den Kindern nicht sagen. Also hatten sie das kleine Gefäß, das freilich nicht mehr geöffnet worden war, im Garten begraben, das Grab geschmückt und ein Licht angezündet. Es war eine Lüge aus Liebe.
Und dann schenkte Irene ihren Buben im Mai ein neues Kätzchen. Die Kleine war seitdem das Leuchten in den Augen ihres Jüngsten am Ende jedes Schultages, sein Hausaufgabenbegleiter und Nachtgefährte. Und der Grund für ihren Termin bei Millicent Gruber, die ihre Praxis offensichtlich mitten in der alten Villenkolonie Gräfelfings hatte. Die Hausnummer 12 war gar nicht ausgewiesen, man musste sie sich zwischen der 10 und der 14 denken.
Hier war Paul Ebner am liebsten. Hier konnte er atmen und aufrecht gehen. Zu Hause saß er gekrümmt Stunde um Stunde in seinem Sessel im Lesezimmer unterm Dach und blickte ins Nichts. Davon gab es jetzt reichlich. Die übrigen Räume ertrug er nicht. Ins Schlafzimmer ging er nur, um die alten Sachen zu wechseln, und würde er Emma jetzt nicht jeden Morgen hier besuchen, hätte er keinen Grund gewusst, wenigstens ein frisches Hemd anzuziehen. Nur unrasiert war er, das musste sie ihm nachsehen, denn er ertrug sein Spiegelbild nicht. Er sah allein hinein, und nichts als sein graues, eingefallenes Gesicht blickte zurück. Die hohe Stirn mit dem dünn gewordenen, längst nicht mehr dunklen Haar, die stumpfen braunen Augen, seine zu klein geratene Gestalt. Ihr Lachen war aus dem Spiegel verschwunden, aus dem Haus, aus seinem Leben, und er blieb übrig. Ein maroder alter Mann, dem die Eingeweide zusammenschrumpften, der immer tiefer in sich zusammensank, ausgezehrt und verkümmert. Der ganze Mensch eine fortschreitende Atrophie.
Aus diesem schlimmen Traum wollte Paul aufwachen. Er wollte mit Emma am Frühstückstisch sitzen wie jeden Morgen und ihn ihr vorenthalten. Sie würden den Tag planen, ihre Termine, ein gemeinsames Mittagessen, falls nicht zu viele Patienten kämen. Er würde ihr wunderschönes Gesicht betrachten, die kleinen Fältchen um die blaugrauen Augen, die ihn immer berührten, ihre feinen Lippen, die so voller Zärtlichkeit waren, und ihre schmalen Hände, die munter durch die Luft fuhren, wenn sie erzählte. Nichts in seinem Leben war je so schön gewesen wie Emma. Er verstand bis heute nicht, warum sie ihn gewollt hatte, warum sie all die Jahre über Tag um Tag an seiner Seite war, aber sie trug seinen Ring.
Es musste ein furchtbarer Unfall gewesen sein, bei dem der Fahrer eines Lkw ein Rotlicht übersehen hatte. Die Polizisten in seinem Wohnzimmer hatten versucht es Paul an jenem unseligen Freitagabend zu erklären, bevor sie ihn zu ihr ins Krankenhaus brachten. Und dort hielt er dann auf der Intensivstation ihren zerschmetterten Körper vorsichtig im Arm.
»Hab keine Angst, Emmi, ich bin bei dir. Ich bin hier«, sagte er wieder und wieder.
Und er verfluchte es, nichts für sie tun zu können, schließlich war er doch selbst Arzt. Ein nutzloser praktischer Arzt, der Erkältungskrankheiten und Nierenbeckenentzündungen kurierte.
»Kannst du mich hören, Emmi? Hast du Schmerzen?«
Sie war noch einmal aufgewacht und hatte ihn angesehen, so voller Angst und Liebe, beinahe schuldbewusst, aber es war doch nicht ihr Fehler. Er strich ihr übers Haar, küsste sie vorsichtig und betrachtete ihre Hände, die schmalen Finger, die völlig unversehrt waren. Und er hatte schon eine Ewigkeit bei ihr gesessen und sich elend einsam gefühlt, als man ihn aufforderte zu gehen. Da war seine Seele bereits mit ihrer an einem anderen Ort. Es war gut, dass sie ihn mitgenommen hatte, er brauchte diese Seele nicht, um weiterzuvegetieren. Der müde, lahme Körper schmerzte so viel weniger.
Doch hier an ihrem Grab auf dem alten Waldfriedhof war Paul nun endlich wieder bei ihr. Er hatte diese weißen Blumen dabei, die sie so mochte und deren Namen er sich nicht merken konnte, und stellte sie neben den Strauß kleiner Rosen. Die waren gestern noch nicht hier gewesen, gelb, mit einem rosafarbenen Samtband gebunden. Anna musste sie gebracht haben.
Der ehemals sandfarbene Grabstein verwitterte immer mehr wie die meisten im alten Teil des Friedhofs, die Zeit nagte mäßig daran.
Prof. Dr. August Ebner 16. März 1859–27. Juli 1923 war darauf zu lesen.
Und Luise Ebner, geborene Fichte 5. Juni 1866–31. Januar 1937, Pauls Urgroßeltern.
Dr. med. Hugo Ebner 14. September 1889–3. April 1962
Luise-Marie Ebner, geborene Fischer 23. November 1902–1943, die Großeltern.
Margarete Ebner, geborene Hauswald 12. Mai 1934 bis 20. März 2009, Pauls Mutter.
Er dachte an ihr Begräbnis. Daran, wie sein Vater schweigend am offenen Grab gestanden und die Beileidsbekundungen über sich hatte ergehen lassen, genau wie er letzte Woche. Nur dass er keinen Sohn bei sich gehabt hatte, der durch sein bloßes Dasein wenigstens ein bisschen Zukunft versprach. Konnte er an diesem Tag im März überhaupt begreifen, wie sein Vater sich fühlte? War ihm die Unermesslichkeit bewusst? Emma hielt damals die ganze Zeit über seine Hand, genau hier. Sie war seine Stärke und seine Gewissheit, dass es auch in Zukunft glückliche Momente geben würde und die Traurigkeit über den Tod seiner Mutter, die er so viel mehr geliebt hatte als den strengen Vater, ein Verfallsdatum kannte. Ja, genau daran erinnerte Paul sich, dass er das dachte. Nein, er wusste es sogar. Mit ihr an seiner Seite wusste Paul es.
Aber das gilt jetzt nicht mehr, Emmi.
Heinrich Ebner war bald nach dem Tod seiner Frau krank geworden. Erst schien er einfach nur seinen Sohn mit dessen ureigener Vergesslichkeit und Unkoordiniertheit überbieten zu wollen. Paul hielt es für eine Bitte um Aufmerksamkeit. Aber dann ließ sich die fortschreitende Demenz nicht mehr verbergen, und Pauls Vater musste in ein Altenheim umziehen. Emma kümmerte sich in dieser Zeit um alles. Sie wollte Heinrich zu ihnen nach Hause holen, doch sein Neurologe konnte sie davon überzeugen, dass sie diese Aufgabe nicht bewältigen könnte. Allein die Treppen im Haus! Vielleicht wäre es im ersten Jahr noch gegangen, doch dann baute Pauls Vater auch körperlich so weit ab, dass er immer öfter im Rollstuhl saß und Hilfe beim Waschen und Anziehen brauchte. Emma hätte ihn nicht einmal alleine heben können.
Heute war Paul klar, warum sein Vater so offensichtlich nicht dagegengehalten hatte, warum er dem Verschwinden seiner Persönlichkeit nicht entgegengetreten war. Er war bereit gewesen zu gehen. Schon seit dem Tag der Beerdigung seiner Frau war er bereit. Und wenn es ihm schon nicht gelang zu sterben, so entzog er sich doch dem Alltag und der Zeit und verweilte mehr und mehr in den Jahren, als Paul noch klein war und Heinrich am Anfang seiner beachtlichen Karriere stand. Manchmal jedoch flammte ein Erinnern an jüngere Ereignisse auf, wenn sie beide ihn besucht und Emma für ihn gebacken hatte oder seine Lieblingsstrickjacke gewaschen und ausgebessert zurückbrachte. Dann nahm er ihre Hände in seine und nannte sie »mein Mädchen«. Selten einmal fragte er auch nach seiner Praxis, die Paul heute führte, und erinnerte sich an alte Patienten. Doch rasch verließ ihn wieder jeder Zeitbegriff, und er ärgerte sich, weil Paul ihn »seit Wochen nicht besucht hatte«.
Emmas Daten standen auf einem kleinen Holzkreuz, das zwischen den Kränzen in der Erde steckte.
Emma Ebner, geborene Walther 4. Mai 1957–7. September 2012
Paul hatte den Steinmetz noch nicht beauftragt, und seit dem Tod seiner Frau auch noch nicht mit seinem Vater gesprochen. Das Altenheim war verständigt worden, das musste eine Weile genügen, denn er ertrug nicht noch mehr Absenz. Wie hätte er auch erklären können, dass er bis auf den Gang zum Friedhof an den meisten Tagen nicht einmal die Kraft aufbrachte, sein Haus zu verlassen, den Briefkasten zu leeren, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, zu essen oder zu schlafen? Ja, selbst zum Schlafen fehlte ihm die Kraft. Und er hatte auch keine Tränen mehr, die waren aufgebraucht, denn es gab nicht genug. Wenn sie versiegten, starrten rote, trockene Augen in die Vergangenheit.
Die Blumen auf die frisch aufgehäufte Erde gelegt, ließ Paul nun seinen Blick lange über die Gräber der Umgebung wandern. Ein Mann stand beleibt und schwer atmend drei Reihen vor ihm an einem schmucklosen Grab, unverkennbar hypertonisch. Ein Witwer vielleicht wie er. Was für ein hässliches Wort – Witwer, welk. Welk wie die Kränze und Sträuße, die seit dem Tag der Beerdigung hier in der Herbstsonne dörrten. Gab es jemanden, der sie fortnahm? Er musste einen Friedhofsgärtner beauftragen, er würde das nicht selbst machen können. Sicher, Zeit hatte er jetzt genug, denn seine Praxis wurde bis auf weiteres von einem Kollegen geführt, der gerade erst in den Ruhestand gegangen war, sich aber sofort anbot. Sophie hatte ihn gestern wissen lassen, dass alles reibungslos lief. Ohne ihr Organisationstalent als Arzthelferin hätte Paul keinen einzigen Arbeitstag überstanden, nichts wiedergefunden und keinen Namen behalten. Sie war gewissermaßen Emmas Verbündete in der Praxis gewesen. Gemeinsam war es ihnen immer gelungen, ihm vorzugaukeln, dass er sein Leben im Griff hatte. Und was seine Arbeit anbelangte, so stimmte das auch, er war ein guter Arzt. Er nahm sich Zeit für seine Diagnosen und suchte stets die Geschichte hinter der Krankheit. Seine Patienten schätzten seine ruhige, bescheidene Art, das Gefühl des Angenommenseins, seine ehrliche Neugier, seine Offenheit und Kompetenz auch auf dem Gebiet der alternativen Medizin. Im Privaten aber war Paul unbestritten unkonzentriert und vergesslich. Anderen war das bewusster als ihm, obwohl er regelmäßig Ruhepausen brauchte, um sich zu sammeln, Stunden, in denen er sich gern unters Dach in sein Lesezimmer zurückzog, ein Glas Rotwein dabei und ab und an einen guten Pfeifentabak. Paul liebte das Alleinsein, weil sie da war. Weil Emma irgendwo im Haus herumhantierte und er geborgen war. Einmal in den letzten Tagen hatte er dieses Gefühl wieder gehabt, in einem Moment, der ganz gegenwärtig schien. Für einen Augenblick war er wieder glücklich gewesen, und hätte er nur seinen Verstand ausschalten können, wäre er es geblieben. Hätte er nur sein Zimmer unterm Dach nicht mehr verlassen, dann wäre sie immer noch da. Irgendwo unten im Haus.
»Frau Gruber? Millicent Gruber?«, fragte Irene Mayer die Dame in der Tür.
Sie war etwas größer als Irene und schlank. Ihr blondes Haar trug sie hochgesteckt, was ihr Strenge verliehen hätte, hätten sich da nicht ein paar Strähnen selbständig gemacht. Und sie schien jünger als gedacht, Ende vierzig vielleicht, wobei sich das schwer einschätzen ließ, denn sie war irgendwie aus der Zeit gehoben. Im schlechten Licht des Hausflurs konnte Millicent Gruber also genauso gut siebzig und ihr Haar schlohweiß sein, was schon eher zu Irenes Vorstellung von ihr passte. »Sie ist eine Hexe«, hatte ihr Frau Sager, die Sprechstundenhilfe ihres praktischen Arztes, ehrfurchtsvoll gesagt. »Sie kann wirklich heilen.«
Das war gleich nachdem Dr. Ebner sie Ende Mai zum Lungenfacharzt überwiesen hatte.
Millicent Gruber trug ein auffälliges Tuch in allerlei Grüntönen um die Schultern geschlungen, das ihre Augen strahlen ließ. Grüne Augen, wie die von Irenes neuem Kätzchen. »Kommen Sie ruhig rein«, sagte sie. »Sie können Ihre Jacke hier rechts in der Garderobe ablegen. Und dann gehen Sie einfach durch.« Die Dame mit dem wachen Blick deutete durch eine Flügeltür mit Glaseinsatz in feinstem Jugendstil, hinter der sie auch gleich wieder verschwand. Sie trennte den Eingang der Villa mit dem kurzen Flur und dem davon abgehenden kleinen Raum mit der Garderobe vom übrigen Haus ab. Irene stülpte ihre Jacke über einen Haken und sah sich um. Der Flur war etwa mannshoch gefliest. Ein Keramikrelief mit grünen Fröschen bildete die ungewöhnliche Abschlussbordüre. Irene war zwar kein Fachmann, aber als sie die breite Tür passiert hatte und in einer zwei Stockwerke hohen Halle mit wuchtigem Treppenaufgang im hinteren Bereich stand, erkannte sie doch, dass an dem Haus seit etwa hundert Jahren alle Modernisierungen vorbeigegangen waren. Rund um das Foyer zogen sich Einbauschränke und Regale aus dem gleichen Holz, aus dem auch die Treppe gefertigt worden war. Sie umschlossen die Türen, liefen über sie hinweg und waren in ein Ensemble schlichter Vertäfelung eingebunden. Um die Jahrhundertwende, als viele Villen in diesem alten Stadtteil gebaut worden waren, beschränkte sich der Entwurf eines Hauses eben noch nicht aufs nackte Mauerwerk. Architekten wie Gabriel von Seidel oder Theodor Fischer konzipierten Gesamtkunstwerke, bei denen alle Einbauten, Türen, Möbel und sogar die Armaturen aus einer Feder stammten. Und manche Baumeister schrieben darüber hinaus verbindlich vor, wie die künftigen Nachbarhäuser auszusehen hatten. Das dunkle Holz wirkte etwas düster, doch durch das breite, hohe Fenster zur Westseite, der Straßenseite, flutete die Septembersonne kräftig herein.
Irene drehte sich hilflos im Kreis und sah zwei Türen zu ihrer Linken und eine vor sich. Rechter Hand dominierte die breite Treppe, die wohl nach oben in den privaten Bereich führte. Sie hörte das Klappern von Geschirr und Millicent Gruber, die offensichtlich hinter einer dieser Türen hantierte. Sollte sie rufen? Das schien ihr irgendwie unangemessen. Nein, lieber warten. Oder klopfen? Ja, klopfen war gut. Aber da tat sich schon eine der Türen auf.
»Kommen Sie rein, meine Liebe, ich habe uns Tee gemacht. Trinken Sie eine Tasse?«, fragte Milli und schenkte, ohne Irenes Antwort abzuwarten, eine duftende Teemischung in zartes Porzellan, das auf dem Tisch vor den Erkerfenstern des Behandlungsraums stand. Einen Moment lang herrschte Schweigen, dann nahmen sie auf äußerst fragilen Stühlen Platz. Irene roch das feine Aroma des Tees und fühlte sich plötzlich ganz leicht und gelassen. Erst jetzt bemerkte sie die Behandlungsliege mit dem weißen Tuch und die Vitrinen mit den unterschiedlichen Fläschchen. Homöopathie und Bachblüten, die kannte sie. Und natürlich hingen ringsum Bilder an den Wänden, Schautafeln, auf denen Meridiane, Reflexzonen und Akupunkturpunkte dargestellt waren. Bekanntes und Unverständliches. Sophie Sager hatte Irene erklärt, dass Millicent Gruber auf Reiki spezialisiert war. Sie ließ Lebensenergie durch ihre Hände zum Patienten fließen, wodurch angeblich blockierte Energiebahnen wieder in Fluss gebracht wurden. Irene, die noch immer nicht wusste, was sie davon halten sollte, glaubte sie auf einem der Bilder hinter der Liege zu erkennen. Wie ein Plan der Zugnetze im Nahverkehrsbereich sah das aus.
»Ich war bei sämtlichen Fachärzten«, begann sie nun zu erzählen, »und drei Monate lang bei einer anderen Heilpraktikerin, die … nun ja … etwas praktischer arbeitet, Entgiftung, Darmsanierung und hochdosierte Vitamine. Dadurch hat sich aber leider gar nichts bewegt.«
Milli nickte in ihre angeschlagene Teetasse, eine von drei Überlebenden eines Wedgwood-Services, cremefarbenes Porzellan mit schwindendem Rosenmuster. Ihre Mutter hatte es aus der englischen Heimat mitgebracht, als sie 1960 den Vater geheiratet hatte. Ihre Familie väterlicherseits war schon immer sehr anglophil gewesen, seit ihr Urgroßvater Eugen Gruber über seine Privatbank Beziehungen in das Königreich unterhielt. So war er auch zum Sammler britischer Kunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts und neuerer Werke der London Group geworden. In ihrem Wohnzimmer hing ein echter Roger Fry, eine blaue Winterlandschaft. Und im Foyer stand eine Büste des Urgroßvaters, angefertigt von Jacob Epstein. Eugen Grubers Steckenpferd waren die Kubisten gewesen, Braque hatte er besonders geliebt. Doch dass er ein Stillleben mit Violine von ihm besessen haben soll, hielt Milli für ein Gerücht. Im Spätherbst 1918 starb Eugen in London an der Spanischen Grippe. Die Stadt war damals ins Chaos gefallen. Zeitweise konnten nicht einmal genug Särge für die Opfer der Pandemie herbeigeschafft werden, es gab weltweit über fünfzig Millionen Tote. Ämter und Botschaften, die gesamte Infrastruktur brach zusammen, weshalb an eine Überführung des Urgroßvaters nach Deutschland gar nicht zu denken war. Die Leichen der Grippetoten wurden, so schnell es ging, verbrannt und beerdigt. Freunde und Geschäftspartner sorgten für eine Beisetzung auf dem Abney Park Cemetery, einem der schönsten, heute untergegangenen Friedhöfe, den Milli je gesehen hatte. Auf dem weiten, verwilderten Grund gab es zwischen exotischen Pflanzen unzählige verfallene Grabmäler der verschiedensten Stile, sogar mit ägyptischen Einflüssen. In seiner Mitte verfiel seit Jahrzehnten die Abney Park Chapel, was die düstere Stimmung in der Dämmerung noch verstärkte. Milli war mit ihren Eltern oft dort gewesen, wenn sie die Familie ihrer Mutter in der Stadt besucht hatten. Daher kam wohl auch ihre etwas skurrile Liebe zu alten Friedhöfen mit prominenten Verstorbenen.
Der Großvater führte die Geschäfte seines Vaters nach dessen Tod weiter und pflegte die alten Verbindungen. Schon 1909 hatte er, noch gemeinsam mit den Eltern, den ansehnlichen Grundbesitz erworben und die Gruber-Villa bauen lassen, die, genau wie er selbst, ohne Substanzverlust zwei Weltkriege überstand. Vincent Gruber jedoch, Millis Vater, brach mit der Tradition der Hochfinanz. Er studierte Literaturwissenschaft und schloss sein Studium am London King’s College ab, wo er auch Alice kennenlernte, seine spätere Frau.
»Wissen Sie, Frau Gruber, meinen Buben würde es das Herz brechen, wenn wir unsere Sookie wieder hergeben müssten. Ich habe gelesen, dass es möglich ist, solche Allergien zu heilen, aber die Schulmediziner belächeln das natürlich nur.«
Milli war dem Porzellan in ihrer Hand in die Vergangenheit gefolgt. Irene Mayer holte sie gerade von einem Spaziergang mit ihrer Mutter nahe der U-Bahn-Station Manor House zurück. Sie musste sich wirklich etwas konzentrieren.
Das schien eine patente Frau zu sein, diese Frau Mayer, nicht eben zimperlich, dachte Milli. Sie ertrug schon seit Monaten diese Atemnot, um ihre Kinder vor einem weiteren Verlust zu schützen. Und auch, weil sie sich für das neue Wesen im Haus verantwortlich fühlte, wie sie sagte. Milli erwähnte ihre zwei Maine-Coon-Katzen an dieser Stelle lieber nicht, ihre »sanften Riesen«, die einzigen Kinder, die sie hatte, abgesehen von Marie. Heute blieben die beiden vorsichtshalber oben im Wohnzimmer eingeschlossen, denn Milli wusste ja nicht, wie heftig ihre neue Patientin reagieren würde. Wobei die Allergene sicher im ganzen Haus waren, selbst in den Praxisräumen, in die die Katzen nie kamen.
»Ja, die Schulmedizin zieht so manches nicht in Betracht«, nahm Milli jetzt den Gesprächsfaden auf und zupfte unauffällig ein verräterisches feines Haar von ihrem Ärmel. »Wenngleich man nicht ungerecht sein darf. Heilprozesse dieser Art verlangen auch einen mündigen, disziplinierten Patienten. Sie sollten zum Beispiel bereit sein, Ihre Ernährung umzustellen. Tiereiweißfreie Kost wirkt bei der Heilung von Allergien sehr unterstützend.«
Milli war selbst, abgesehen von einem Kuchenstück am Mittwochnachmittag, Veganerin.
»Ja, warum nicht«, meinte Irene. »Ich experimentiere ohnehin gern in der Küche.«
Über der ersten Kanne Tee führte Milli dann ein ausführliches Vorgespräch mit Irene Mayer. Sie studierte ihre Blutwerte, den Lungenfunktionstest, informierte sich über die Antihistaminika, die sie nahm, las den Facharztbericht und hörte sich den Verlauf der Krankheit in Irenes eigenen Worten an. Milli war wie immer sehr gründlich. Zwar waren all diese Befunde für sie nicht wirklich relevant, doch das sorgfältige Abklären sämtlicher Aspekte beruhigte ihre Patienten immer kolossal. Das allein versetzte sie schon in einen ausgeglichenen Gemütszustand.
Milli beobachtete nun einen grünlich grauen Lichtschein um Irene Mayers Brustkorb, sowie ein rotes Leuchten in den beiden unteren Chakren, den Energieknotenpunkten. Das war eine gute Basis für ihre Arbeit. Sie bat ihre Patientin, sich auf die Liege zu legen, und sah bereits, wie sich Irenes Konturen vor ihrem inneren Auge auflösten.
Dieses Phänomen war jedoch keine Nebenwirkung des klassischen Reiki, vielmehr nahm Milli Menschen schon immer anders wahr als jeder andere. Sie nahm die gesamte Welt um sich anders wahr. Während ihrer Energiearbeit verloren die physischen Körper für sie jede bekannte Struktur, sie bestanden dann nur noch aus Licht, Schwingung und Klang. So entdeckte Milli auch ungelebte Lebensentwürfe, die, Schichten gleich, übereinanderlagen und eine Matrix des Lebens bildeten, ein Informationsgitter, das ihr heute Irene Mayers Kreativität zeigte. Sie sah sie als Goldschmiedin und hörte das leise Klingen eines feinen Hammers auf dünnem Edelmetall. Und sie sah sie in einer Hutwerkstatt und fühlte den rauhen Filz unter ihren Fingerspitzen.
Millis spezielle Wahrnehmung durchlief auf diese Weise bei jeder Behandlung verschiedene Körperebenen, die weder Röntgenstrahlen noch ein Computertomograph je abbilden könnten. In Irenes Energiekörper las sie intuitiv deren Zellprogramm wie andere die Morgenzeitung, um dann in ihrem Mentalkörper ihre Lebensenergie, das Reiki, fließen zu lassen. Denn hier nahmen die Gedanken und Gefühle der Menschen Gestalt an, und manche verdichteten sich als Webfehler des Lebens zur Krankheit. Doch Milli übersah keinen, schließlich befand sie sich die ganze Zeit über in vollkommener Resonanz mit ihrer Patientin, einem Gleichschwingen, das sie bis zum Ende der Anwendung aufrechterhielt. Bis Irene Mayer sich aufsetzte und lächelte. Selbst Tage später hätte sie nicht sagen können, was mit ihr auf dieser Liege geschehen war. Sie hätte nur Millis warme Hände beschreiben können, die auf ihrem Körper gelegen hatten, und ein Glücksgefühl, das wie ein Wasserfall in sie gestürzt war. Wie der Moment, als sie ihre Söhne zum ersten Mal im Arm gehalten hatte.
Milli stattete ihre Patientin zum Abschluss noch mit einer Bachblütenmischung aus, die sie selbst hergestellt hatte. Aus verschiedenen Blütenblättern, die, in Glasschälchen mit reinem Quellwasser gelegt, einige Stunden süd- oder ostseitig am Haus auf einem der Fensterbretter in der Sonne stehen mussten. So übertrug sich die Schwingung der Pflanzen auf das Wasser, vorausgesetzt, es zogen keine Wolken auf. Anschließend wurde die Essenz gefiltert und mit Alkohol konserviert. Edward Bach, der Erfinder der Methode, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Heilwirkung der insgesamt achtunddreißig nach ihm benannten Bachblüten erforscht hatte, empfahl Brandy. Milli, den britischen Vorfahren trotzend, wählte den universalen Birnenschnaps für die heikle Prozedur.
»Mehrmals täglich fünf Tropfen auf die Zunge. Der Alkoholgehalt ist verschwindend gering«, erklärte Milli wie immer bei der Verordnung ihrer Stockbottles. »Wenn Sie davon gute Laune bekommen sollten, liegt es an den Blüten.«
Irene Mayer ließ das Fläschchen daraufhin verschwörerisch in ihrer Handtasche verschwinden und grinste. »Na, dann ist’s ja gut, dann kann ich sie auch getrost bei der Arbeit einnehmen.«
»Was machen Sie denn beruflich, Frau Mayer?«, hakte Milli gleich ein. Die Lebensentwürfe waren ihr wieder eingefallen.
»Ich arbeite halbtags als Anwaltsgehilfin. So bleibt noch Zeit für die Kinder.«
»Und könnten Sie sich auch mal einen Wechsel vorstellen?«
»Sie meinen, in eine andere Kanzlei? Nun, eigentlich geht’s mir dort ganz gut.«
»Nein, meine Liebe«, entgegnete Milli mit arglosem Blick, »ich meine zum Beispiel eine Selbständigkeit. Tragen Sie gern Hüte?«
3. Oktober 2012
Lieber Paul,
die Sachertorte in unserem Café hat nachhaltig gelitten. Sie schmeckt nicht mehr nach Wiedersehen, hat keine Neuigkeiten, keinen Klatsch zwischen den Schichten, kein bisschen Vertrautheit um die Glasur. Selbst der Tee duftet nicht nach Mittwochnachmittag. Glaube mir, ich habe mich durch traute Wiederholung darum bemüht, genau diesen Geschmack zurückzuholen, aber ganz ohne Gabelkampf und Gegenüber, dem ich geschätzte Cholesterinwerte in den Mund legen kann, mag es nicht gelingen. Da sitze ich also wieder einmal hier in der Bahnhofstraße, und es ist Mittwoch, wie früher, wenn Du die Praxis geschlossen hattest und wir uns austauschten. Deine schulmedizinische Skepsis, Deine unverhohlene Verwunderung über meine Heilungen waren das Sahnehäubchen auf dem gemeinsamen Kuchenstück. Das »Ganz unmöglich, Millicent, das kannst du doch nicht mit ein paar Globuli geschafft haben« beginnt mir zu fehlen. Und wie Du immer die Stimme gesenkt hast, wenn Du sagtest: »Millicent, es gibt Leute im Ort, die halten dich für eine Hexe. Sie nennen dich sogar so.« Na und? In unseren Tagen brennen die Scheiterhaufen Gott sei Dank nicht mehr ganz so heiß. Und Du musst zugeben, der Unwissenheit steht mein Gelingen gegenüber, wenngleich das manche sicher noch mehr verwirrt. Noch mehr als Dich!
Paul, wenn ich wüsste, dass ich auch Dich heilen könnte, ich stünde in Deiner Tür. Aber die Traurigkeit darf man nicht überspringen. Dieser Weg kennt keine Abkürzung. Ich könnte eine Brücke für Dich schlagen, aber es wäre doch nur ein Morphiat für die Seele und ließe sie gleich wund zurück. So sitze ich hier neben dem leeren Stuhl und lausche seiner Geschichte von einem, der sein Leben aufgegeben hat. Sophie erzählt, Du hältst Dich gut. Aber was mag das heißen? Dass Du morgens aufstehst, etwas isst am Tag und abends zu Bett gehst? Dass Du bereit bist zu akzeptieren, dass Du übrig geblieben bist und weitermachen wirst?
Der Tee ist schal, Du hast übersehen, mir nachzuschenken, und die Sonne geht schon bald unter. Ich sitze schon viel zu lange hier. Wir werden einen anderen Ort auswählen, wenn Du zurück bist. Und einen anderen Tag. Nichts wird wie vorher sein, aber es gibt ein Danach.
Millicent
Das Grab war wieder bepflanzt worden, mit einem kleinblättrigen grünen Rand mit winzigen roten Beeren. Diese Einfassungen hatte Paul auch schon auf anderen Gräbern gesehen. Es gab Heidekraut in verschiedenen Rosétönen, und sein Strauß vom letzten Besuch stand in einer der üblichen Plastikvasen, die in die dunkle, schwere Erde gedrückt worden war. Die alten Baumriesen hatten ihre Blätter darübergestreut. Die lagen jetzt überall wie ein herbstlicher Teppich, denn dieser Friedhof war vor über hundert Jahren in einem bestehenden Wald angelegt worden. Zwischen seinen mächtigen Laubbäumen und den vereinzelten Tannen ruhten die alten Grabstätten mit ihren schweren säulenverzierten Steintafeln. Das Schmiedeeisen der Kreuze war vom Grünspan befallen und efeuumflossen, und manche Familien hatten sogar Grüfte, gemauerte Häuschen mit Urnennischen, die die Ewigkeit bargen. Es gab Flächen mit Wiesen und im neueren Teil, neben der Aussegnungshalle, sogar einen kleinen See. Emma und er waren hier oft spazieren gegangen. Sie meinte, es sei ein verzauberter Ort, an dem die Zeit stillstehe.
Du weißt gar nicht, wie sehr, Emmi.