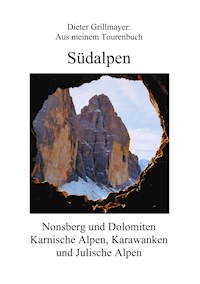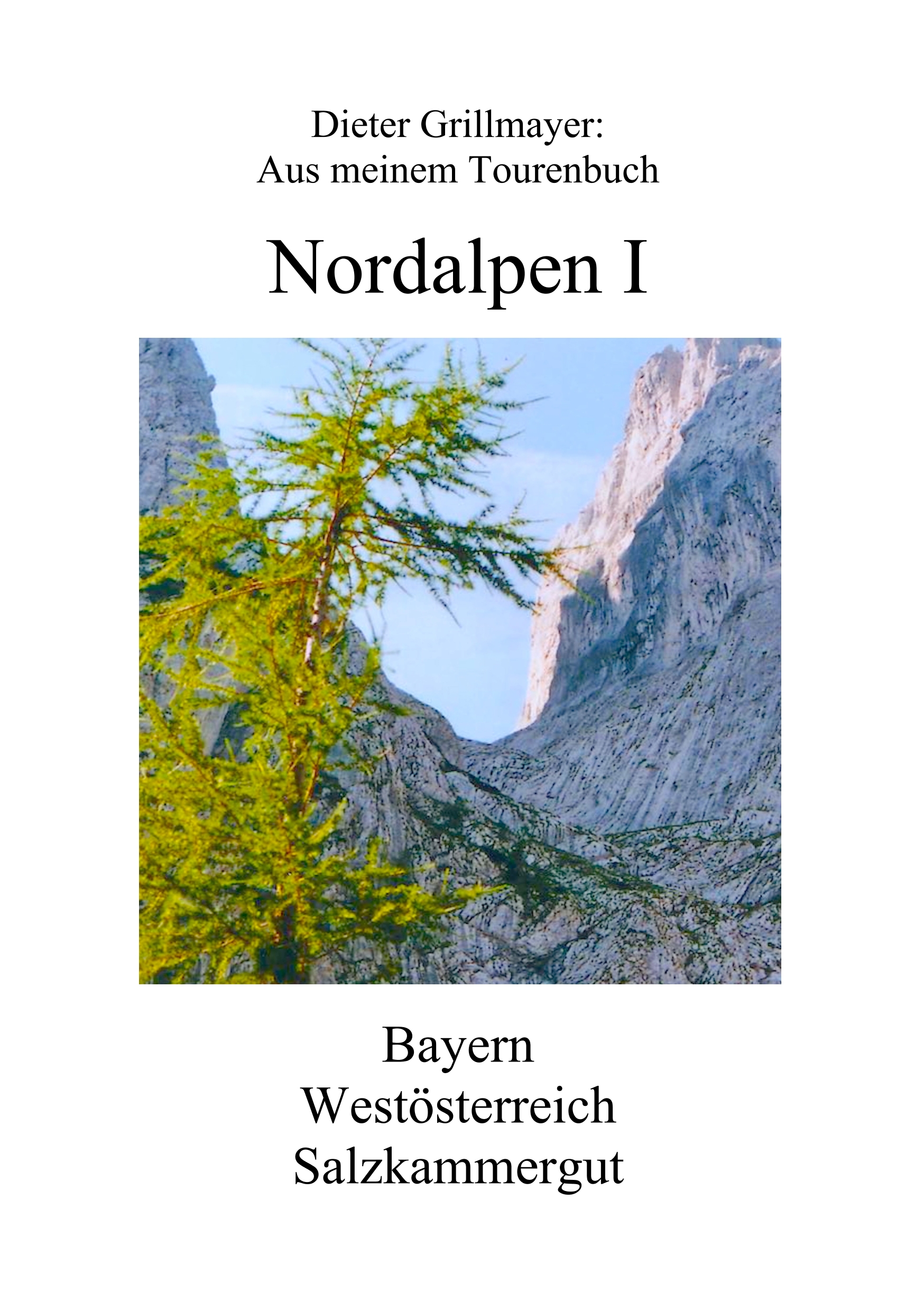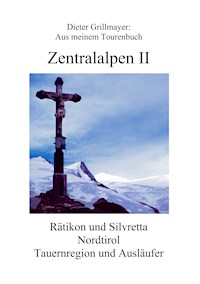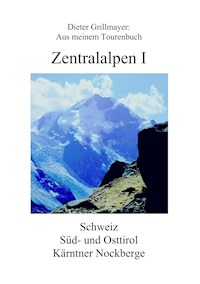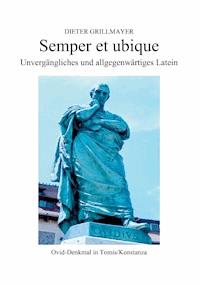
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
In einer Bildungsgesellschaft sollte unbestritten sein, dass Latein ein abendländisches Kulturgut ersten Ranges ist, dem im Schulunterricht die Funktion eines europäischen Integrationsfaches zukommt. Der (leider oft bestrittene) Praxisbezug ist dadurch gegeben, dass das Lateinische eine gute Grundlage für das Erlernen lebender Sprachen darstellt, dass es für das Fremdwörter-Verständnis einen wichtigen Beitrag leistet und dass Latein vermöge seiner strengen Grammatik schließlich auch das Verständnis für die Struktur der Muttersprache – oder besser noch von „Sprache an sich“ – fördert. „Semper et ubi-que“ möchte dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu festigen. Neben einem grundlegenden Grammatikwissen vermittelt das Büchlein den Zugang zu Hunderten von lateinischen Spruchweisheiten, Floskeln und Fremdwörtern, ihrer Herkunft und Übersetzung, eingebettet in das historisch-kulturell-politische Umfeld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quídquid agís, prudénter agás et réspice fínem!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Wortarten und Satzbau; Hauptwörter
11
Nomen est omen
12
Repetitio est mater studiorum
13
Iustitia regnorum fundamentum
14
Homo homini lupus
und
In vino veritas
15
O tempora, o mores!
16
Vox populi, vox Dei
17
Lupus in fabula
und
Advocatus diaboli
18
Casus belli
und
Genius loci
19
Summa summarum
und
Curriculum vitae
2. Eigenschaftswörter
21
Perpetuum mobile, Misera plebs
und
Tabula rasa
22
Expressis verbis
und
Viribus unitis
23
Fortuna est caeca
24
Mors certa, hora incerta
25
Carum est, quod rarum est
26
Fundamentum totius Reipublicae est recta Iuventutis educatio
27
Usus est magister optimus
28
Salus publica suprema lex
29
Non plus ultra
,
Ultima ratio
und
Vis maior
3. Zeitwörter
31
Fui quod es. Eris quod sum.
32
Audi, Fiat und Volvo
33
Veni, vidi, vici und Quod scripsi, scripsi
34
Variatio delectat
und
Pecunia non olet
35
Manus manum lavat
und
Similis simili gaudet
36
Verba docent, exempla trahunt
37
Carpe diem! Cave canem! Sapere aude!
38
Errare humanum est
und
Alea iacta est
39
Pacta sunt servanda
4. Fürwörter und Zahlwörter
41
Alter ego
und
Suum cuique
42
Cuius regio, eius religio
und
Cui bono?
43
Eadem mutata resurgo
44
Qualis dominus, talis servus
45
Quod licet Iovi non licet bovi
46
Quod erat demonstrandum
47
Tres faciunt collegium
48
Germania est divisa in partes tres
49
Ovum, ovum, quid lacus ego
5. Vorwörter und Vorsilben
51
Ad Kalendas Graecas
und
Ad multos annos!
52
Summa cum laude
und
Cum grano salis
53
De gustibus non est disputandum
54 Der
Deus ex machina
55
Medias in res
und
Requiescat in pace
56
Austria Erit In Orbe Ultima
57
Per aspera ad astra
und
Sanitas per aquam
58
In dubio pro reo
und
Pars pro toto
59 Die
Conditio sine qua non
und
Sine ira et studio
6. Umstandswörter
61
Hic et nunc
62
Hic Rhodos, hic salta!
63
Semper et ubique
64
Sic transit gloria mundi
65
Ubi bene, ibi patria
66
Bis dat, qui cito dat
67
Plenus venter non studet libenter
68
Fortiter in re, suaviter in modo
7. Satzgefüge; Bindewörter und Verneinungen
71
Audiatur et altera pars
und
Cogito, ergo sum
72
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
73
Si vis pacem, para bellum!
74
Si tacuisses, philosophus mansisses
75
Difficile est saturam non scribere
76
Non scholae, sed vitae discimus
77
Nulla poena sine lege
und
Nolens, volens
78
Noli me tangere! Noli turbare circulos meos!
79
De mortuis nihil nisi bene
und
Nil novi sub sole
8. Versmaße; Hexameter und Distichon
81
Bélla geránt alií, tu félix Áustria núbe!
82
Témpora mútantúr et nós mutámur in íllis
83
Quídquid agís, prudénter agás et réspice fínem!
84
Órandúm (e)st, ut sít mens sána in córpore sáno
85
Príncipibús placuísse virís non última láus est
86
Ést modus ín rebús, sunt cérti dénique fínes
87
Quídquid id ést, timeó Danaós et dóna feréntes
88
Áurea príma satá (e)st aetás, quae víndice núllo spónte suá, sine lége fidém rectúmque colébat
89
Dónec erís sospés, multós numerábis amícos: témpora sí fuerínt núbila, sólus erís
9. Das „
Gaudeamus
“ und seine Geschichte
Personenregister
Sachregister
Literaturverzeichnis
*****
Textauszeichnungen und Abkürzungen
Normalschrift (Times New Roman): Deutscher Text. Dabei werden Anführungzeichen dort gesetzt, wo es sich um (wörtliche) Übersetzungen aus dem Lateinischen handelt sowie bei deutschen Aufsatz-, Buch- und Vortragstiteln. Gelegentlich werden auch die deutsche Bedeutung von Fremdwörtern und deutsche Textbeispiele zur Grammatik in Anführungszeichen gesetzt, aber nur dort, wo es geraten erscheint, diese vom Begleittext abzuheben.
Kursivschrift: Alle nicht deutschen, vor allem lat. Wörter und Texte, in Anführungszeichen nur dann, wenn es sich um Buchtitel handelt.
Kursivschrift fett: Alle (auch griechische, englische und französische) Fremdwörter einschließlich aller grammatikalischen Fachausdrücke, aber nur dort, wo sie erklärt werden. Die Fremdwörter werden in der im Deutschen üblichen Schreibweise wiedergegeben. Das trifft etwa auf das Ersetzen der lat. „Ces“ durch „Kas“ oder „Zets“ gemäß der Rechtschreibreform von 1901 zu, aber auch auf das Verwenden von Umlauten, vor allem „ä“ statt „ae“.
Normalschrift fett: Alle aus dem Lateinischen kommenden Lehnwörter, wobei die Abgrenzung zu den Fremdwörtern oft schwer fällt. Als Lehnwort ist in diesem Büchlein ein Wort des deutschen Sprachschatzes ausgezeichnet, das eine (mehr oder weniger starke) Veränderung gegenüber dem lateinischen Wort erfahren hat, von dem es abstammt. (Beispiel: Fenster leitet sich von lat. fenestra ab.) Ist es hingegen – Endungen ausgenommen – zu keiner Veränderung gekommen, so wird das Wort als Fremdwort ausgezeichnet. (Beispiele: Villa, Provinz von lat. provincia.)
Vorwort
Es ist wohl keine ganz sinnlose und unerklärliche Beschäftigung für einen Pensionisten, wenn er die in sechsjährigem Lateinunterricht (von 1953 bis 1959) erworbenen Kenntnisse wieder aufzufrischen versucht. Eher unverständlich ist es dann schon, wenn er, gelernter und wohl auch von seinem Fach geprägter Mathematiker, sein wiedergewonnenes und zum Teil auch neu geschöpftes Wissen zu Papier bringt und einem größeren Publikum zur Verfügung stellen möchte.
Dafür gibt es zwei Gründe: Einmal das Bonmot von Mark Twain, die beste Art, mit einer Sache vertraut zu werden, sei es, ihr ein Buch zu widmen. Dieses Rezept habe ich, weil ohnehin eher der schriftliche Typ, schon mehrmals erfolgreich angewendet. Der zweite Grund ist typisch lehrerhaft: Mit zunehmendem Alter hat sich in mir die Meinung verfestigt, dass Latein ein abendländisches Kulturgut ersten Ranges ist, das es zu bewahren gilt. Dafür möchte ich den Beweis antreten und dazu möchte ich beitragen.
Ein wichtiger Anstoß war mir ein Aufsatz des Schweizer Altphilologen Dr. Klaus Bartels, welchen „Die Presse“ in ihrer Wochenendausgabe vom 27./28. Mai 2000 veröffentlicht hat. Bartels, dessen Name in diesem Büchlein noch mehrmals fallen wird, weist darin u. a. darauf hin, dass Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch Tochtersprachen des Lateinischen sind und fährt fort: „Wer sich mit der Mutter auch nur einigermaßen versteht – und hier genügt bereits ein vergleichsweise kleines Quentchen Basic Latin –, der hat mit den Töchtern leichtes Spiel.“
Seither lässt mich die Idee vom Basic Latin nicht mehr los, das jedem Heranwachsenden, der eine höhere Bildung anstrebt, in jungen Jahren eingepflanzt werden sollte und auch zugemutet werden darf. Die Grammatik der Muttersprache würde dazu einen nahezu fließenden Einstieg liefern. Neben dem Kennenlernen der international üblichen Fachausdrücke könnte bereits ein Basic Latin zu grundlegenden Einsichten führen, wie etwa, dass Prädikatsadjektiva und Adverbia Wortarten mit ganz verschiedenen Funktionen sind, wiewohl z. B. das Deutsche dafür völlig identische Wörter gebraucht. Ebenso zu einer vertieften Allgemeinbildung gehört es nach meinem Verständnis, die Herkunft von Fremdwörtern, Spruchweisheiten und Floskeln einigermaßen nachvollziehen zu können. Was es dabei für Überraschungen geben kann, davon zeugen hier etwa die Texte 76 (Non scholae, sed vitae discimus) und 84 (Mens sana in corpore sano).
Vor einem guten Jahr setzte ich mich dann, zunächst nur mit den geläufigsten Textbeispielen ausgestattet, an mein Notebook, linker Hand den „Stowasser“, das österr. Standard-Lateinwörterbuch, rechter Hand die Latein-Grammatik von Gaar-Schuster, beides noch Bücher aus meiner Schulzeit. Erst später wurde ich gewahr, dass sich sogar an den Latein-Schulbüchern in den letzten 60 Jahren einiges geändert hat und habe auf neuere Ausgaben zugegriffen. Auch meine Texte-Sammlung ist durch Zuruf und Nachschau kontinuierlich angewachsen.
Im Zuge der Erwähnung meines Vorhabens im Bekanntenkreis fehlte es auch nicht an Hinweisen darauf, dass es solche Bücher schon gibt und es wurden mir auch Titel genannt. Glücklicherweise durfte ich nach deren Erwerb feststellen, dass diese Veröffentlichungen anders aufgebaut sind und zum Teil auch andere Schwerpunkte verfolgen als das Büchlein, an dem ich gearbeitet habe und das nun vorliegt.
Weil nicht „vom Fach“ habe ich meinen langjährigen Berufskollegen OStR. Mag. Helfried Raab gebeten, mein Manuskript gründlich zu lektorieren. Für diesen Freundschaftsdienst bin ich ihm zu großem Dank verpflichtet. Helfried Raab war am Bundesrealgymnasium in Steyr/OÖ, dem ich von 1984 bis 2002 als Direktor vorstand, ein äußerst erfolgreicher Lateinlehrer, was ich darauf zurückführe, dass er sich auf das unbedingt Notwendige beschränkt, dieses aber „gnadenlos“ eingefordert hat. Generationen von Schülern haben davon profitiert und sind ihm dankbar dafür. Denn in aller Regel schlugen anfängliche Irritationen schon bald in Verehrung für den Lehrer und Liebe zur Sprache um, so wie es sein soll.
Dieter Grillmayer
Teil 1: Wortarten und Satzbau; Hauptwörter
(1) Die Wortarten des Lateinischen können in drei Gruppen eingeteilt werden: Nomina (Einzahl Nomen), im Deutschen gelegentlich als Nennwörter bezeichnet, Verba (Einzahl Verbum, kurz Verb), im Deutschen Zeit- oder Tätigkeitswörter genannt, und Partikel(n). Das sind unveränderliche Wörter, können also nicht gebeugt werden. Demgegenüber erfolgt bei den Nomina eine als Deklination bezeichnete Beugung nach 1. dem Geschlecht, lat. Genus, 2. dem Fall, lat. Kasus, und 3. der Zahl, lat. Numerus.
(2) Die als Konjugation bezeichnete Beugung der Verba erfolgt nach 1. der Person, 2. der Zahl (Einzahl, lat Singular, oder Mehrzahl, lat. Plural), 3. der Zeit, lat. Tempus (z. B. Gegenwart, lat. Präsens), 4. der Aussageweise, lat. Modus (Wirklichkeitsform, lat. Indikativ, Möglichkeitsform, lat. Konjunktiv, oder Befehlsform, lat. Imperativ) und 5. der Zustandsform (aktiv oder passiv). Es gibt aber auch „unpersönliche“ Verbalformen, lat. Nominalformen, wie z. B. die Grund- oder Nennform, lat. Infinitiv, und das Mittelwort, lat. Partizip, Mehrzahl Partizipia. Letztere haben auch an den in Anm. (1) genannten Eigenschaften der Nomina Anteil, worauf der deutsche Fachausdruck „Mittelwort“ treffend hindeutet. (Eine ausführlichere Behandlung erfolgt in Teil 3.) Vorweggenommen sei wegen des dringenden Bedarfs schon in Teil 1 und Teil 2 die dritte Person S. Präsens Ind. des nur in der Aktivform vorhandenen Hilfszeitworts esse „sein“, nämlich est „(er/sie/es) ist“.
(3) Die Nomina gliedern sich in Hauptwörter, lat. Substantiva, Einzahl Substantiv(um), Eigenschaftswörter, lat. Adjektiva, Einzahl Adjektiv(um), Fürwörter, lat. Pronomina, Einzahl Pronomen, und Zahlwörter, lat. Numeralia, Einzahl (das) Numerale. Obwohl das Lateinische für persönliche Fürwörter, lat. Personalpronomina, wie z. B. ich, du, wir, ihr, Vokabel hat, werden diese gewöhnlich unterdrückt bzw. sind sie in den Verba bereits enthalten. Gleiches gilt für die besitzanzeigenden Fürwörter, lat. Possessivpronomina, wenn sie sich von selbst verstehen. Weil schon in den Texten 25, 31 und 33 gebraucht sei als Beispiel für ein auf etwas Bezug nehmendes („bezügliches“) Fürwort, lat. Relativpronomen, das sächliche quod („welches“ oder „was“) genannt.
(4) Im Unterschied zum Deutschen kennt das Lateinische keine Artikel (wie z. B. der, die, das oder einer, eine, eines) bzw. sind diese im Hauptwort bereits inkludiert. Ob bei der deutschen Übersetzung der bestimmte oder unbestimmte Artikel zu verwenden ist ergibt sich aus dem Zusammenhang.
(5) Partikel (von lat. particula, particulae f. „Teilchen“, „Weniges“) sind die Vorwörter, lat. Präpositionen, gern auch als Vorsilben, lat. Präfixe, verwendet, ferner die Umstandswörter, lat. Adverbia, weiters die Bindewörter, lat. Konjunktionen einschließlich der Verneinungen, lat. Negationen, und schließlich noch die Empfindungswörter, lat. Interjektionen. Wie im Deutschen ist auch im Lateinischen das in „in“ (oder „im“) eine der wichtigsten Präpositionen und kommt schon in den Texten 14 und 17 vor. Die häufigste Konjunktion ist das et „und“, die häufigste Negation das non „nicht“; auch diese zwei Partikel werden laufend in Texten verwendet, die vor der systematischen Behandlung der entsprechenden Wortarten (Teil 7) angesiedelt sind. Zu den Interjektionen gehört z. B. das o, wie im Deutschen ein Ausruf der Überraschung (und auch auf „oho“ oder „oje“ ausgeweitet), siehe Text 15.
(6) So wie ein Adjektiv eine Eigenschaft eines Substantivs ausdrückt, so gibt ein Adverb(ium) i. A. über eine Eigenschaft eines Verbs Auskunft, worauf die Präposition ad „zu“ hinweist. Das erlaubt eine Vielzahl von Möglichkeiten, etwa im Deutschen zum Verb „schreiben“: hier, dort, überall; oft, heute, später; schön, gern, viel. Generell gibt die Wortklasse der Adverbia – Näheres dazu in Teil 6 – die besonderen Umstände an, unter denen ein Geschehen stattfindet, daher die deutsche Bezeichnung „Umstandswort“.
(7) Der einfachste vollständige Satz besteht aus einem Satzgegenstand, lat. Subjekt, und einer Satzaussage, lat. Prädikat, die nach Person und Zahl übereinstimmen müssen. Das Subjekt ist i. A. ein immer im 1. Fall stehendes Substantiv, doch können auch (im Prädikat enthaltene) Personalpronomina, substantivisch gebrauchte Nomina (z. B. der Beste, die Meinen, das Erste), aber auch Nominalformen von Verba (z. B. Irren ist menschlich, das Gesagte war wichtig) diese Funktion übernehmen. (Nach NDR werden auch solche Subjekte grundsätzlich groß geschrieben.) Prädikat ist i. A. ein Vollverb oder in Verbindung mit einer Form des Hilfsverbs esse „sein“ ein ebenfalls im 1. Fall stehendes Nomen, welches dann als Prädikatsnomen, im Falle eines Hauptworts insbesondere als Prädikatssubstantiv bezeichnet wird. Gelegentlich kann ein ganzer Subjektsatz oder Prädikatsatz die Rolle von Satzgegenstand bzw. Satzaussage übernehmen. Zwei Beispiele für Subjektsätze liefern die Texte 25 und 66. Schließlich kann das Subjekt aber auch gänzlich fehlen; ein solcher subjektloser Satz ist z. B. Orandum est „man muss beten“ (Text 84).
(8) Neben Subjekten und Prädikaten können auch Objekte auftreten, das sind (nicht im 1. Fall stehende) Substantiva oder substantivisch gebrauchte Nomina und Nominalformen, welche den Bezugspunkt des konkreten Geschehens angeben. Gegebenenfalls werden diese drei wesentlichen Satzglieder durch Adjektiva, Adverbia, Pronomina und/oder Numeralia ergänzt. Ein Beispiel: Der kleine Michael liebt seine Lehrerin sehr. Subjekt ist „der kleine Michael“, Pädikat „liebt sehr“, Objekt „seine Lehrerin“.