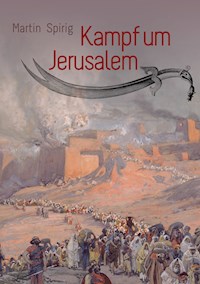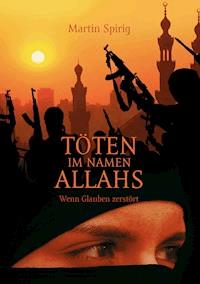Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
10. Jahrhundert: Marozia, Gräfin von Tusculum, ergriff nach dem Tod ihrer Eltern die Macht in Rom, nannte sich "Senatrix et Patricia Romanorum" und übernahm das Amt der "Vestaratrix", des 1. weiblichen Kämmerers und Finanzverwalters im Vatikan. Sie regierte mit harter Hand, war dreimal verheiratet, hatte ungezählte Liebhaber, setzte willkürlich Päpste ein und ab und liess sie im Kerker ermorden, sogar den eigenen Sohn, Papst Johannes X. Das Papsttum befand sich moralisch auf dem Tiefpunkt und in Marozias völliger Abhängigkeit. Die Pornokratie (Hurenherrschaft) begann mit Marozias Mutter Theodora (I.), erreichte mit der Tochter den Höhepunkt und das Ende. Sie waren zwei der berüchtigtsten Frauen der frühmittelalterlichen Geschichte Italiens. Ein schonungsloses Zeitbild, basierend auf historisch-biografischen Begebenheiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle erwähnten Örtlichkeiten, Adelsnamen, Könige, Kaiser, Päpste, Erzbischöfe, Äbte, die beschriebenen sozialen, politischen und religiösen Begebenheiten sind historisch. Die Quellenlage aus jener Zeit ist dürftig; sie wurde jedoch vom Autor bestmöglich ausgewertet.
Amtierende Päpste während Marozias Lebzeit (890–836)
(Jeder zweite der unten erwähnten Päpste starb eines unnatürlichen Todes oder wurde abgesetzt.)
Stephan V. (885–891)
Formosus (891–896)
Bonifaz VI. (896/14 Tage Pontifikat)
Stephan VI. (896–897)
Romanus (897/4 Monate Pontifikat)
Theodor II. (897/3 Wochen Pontifikat)
Johannes IX. (898–900)
Benedikt IV. (900–903)
Leo V. (903/3 Monate Pontifikat)
Christophorus (903–904)
Sergius III. (904–911)
Anastasius (911–913)
Lando (913–914)
Johannes X. (914–928)
Leo VI. (928/8 Monate Pontifikat)
Stephan VII. (928–931)
Johannes XI. (931–935), Sohn Marozias
Leo VII. (936–939)
Stephan VIII. (939–942)
Martin III. (942–946)
Agapet II. (946–955)
Johannes XII. Octavian (955–963), Enkel Marozias
Anno Domini 914.
Europa wird von Hungersnöten, Seuchen, blutigen Kriegen und nie endenden Fehden der Herzöge, Grafen und Barone heimgesucht. Kaiser Karl der Große ist seit hundert Jahren tot, sein fränkisches Reich, das halb Westeuropa umfasste, nach einer kurzen Wiedervereinigung zwischen 885 und 888 in fünf Königreiche geteilt: in das Reich Karls des Kahlen, Westfranken geheißen, in Lotharingen, in Hoch- und Niederburgund, in das Königreich Italien und Ostfranken, das Reich Ludwig des Deutschen. Spanien wird vom aufstrebenden Kalifat von Cordoba beherrscht. In Süditalien, Sizilien und auf Sardinien haben sich die Sarazenen eingerichtet. Das Königreich Italien ist ein bunter Flickenteppich von Herzogtümern, Grafschaften und nach Autonomie strebenden winzigen Städtchen, die eifrig um die Vorherrschaft kämpfen, um im Machtgerangel nicht unterzugehen.
Die karolingischen Neuerungen sind in der düsteren, schweren Romanik aufgegangen. Die Wikingerüberfälle enthüllten die Grenzen von Karls Macht und die Schwächen seines Reiches. Mit der Vernichtung der seefahrenden Friesen gab Kaiser Karl die Nordsee den Wikingern preis. Auf ähnliche Weise trug sein Sieg über die Awaren in Zentraleuropa dazu bei, den Magyaren (Ungarn) den Weg freizumachen, die jetzt brandschatzend durch Österreich, Süddeutschland und Norditalien ziehen. Mit der Aufnahme der Sachsen nach jahrelangen Kriegen ins Reich öffnete er die Nordostgrenze den aufständischen Slawen. Kaiser Karls Reich war ein Riese, das an seiner eigenen Größe starb. Die »Karolingische Renaissance« vereinigte zwar viele Völker unter einer gemeinsamen lateinischen Kultur, aber sie vertiefte auch das Bewusstsein nationaler Interessen und ethnischer Differenzen, die sie voneinander trennte. So musste das fränkische karolingische Kaiserreich zerfallen. Aus der Vielzahl der Fragmente sollte kein geeintes Reich mehr entstehen, sondern eine Ansammlung von Nationalstaaten. Die Idee des Kaisertums blieb als politische Kraft bis 1806 bestehen. Napoleon Bonaparte sollte in diesem Jahr als selbst ernannter Herrscher dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ein Ende setzen.
Und mitten in den Wirren des ausgehenden Frühmittelalters des 10. Jahrhunderts steht das Papsttum in Rom, durch Landschenkungen zu einer beachtlichen weltlichen Regionalmacht in Italien herangewachsen, aber auf einem moralischen Tiefpunkt angelangt und politisch abhängig. Die mächtige Römer Familiendynastie des Theophylakt von Tusculum beherrscht den Vatikan, dessen Politik und die Stadt. Hinter Theophylakt stehen seine Gattin Theodora und ihre älteste Tochter Marozia. Sie weben eifrig Intrigennetze für mehr Macht und Einfluss in Rom und auf das Papsttum. Theodora amtiert als Senatrix und leitet bei Abwesenheit ihres Herrn Gemahls die weltlichen und geistlichen Geschicke der Stadt und der Kirche. Sie erzog ihre Tochter ganz in diesem Sinne und scheut sich nicht, sie als politischen Spielball einzusetzen, um die ehrgeizigen Ziele der Familiendynastie zu erreichen. Marozia entwickelt schon als kleines Mädchen einen beachtlichen Machtinstinkt, den sie haargenau für ihre eigenen Zwecke einzusetzen weiß; er ist heute mit ihren zweiundzwanzig jungen Jahren zu einem Teil des Charakters und zur Besessenheit geworden. Marozias anmutige, strahlende Schönheit betört allein durch ihre Anwesenheit. Sie weiß, die weibliche Schönheit ist die schärfere Waffe als das Schwert; der Verstand des Mannes rutscht sehr schnell unter die Gürtellinie beim Anblick eines schönen Weibes. Marozias Vater hat ihr militärische Kenntnisse über die Truppenführung beigebracht. Sie weiß den Pfeil zielgenau vom Bogen zu lösen und das Schwert zu führen. Hätte Niccolo Machiavelli bereits gelebt, er würde an Marozia und ihrer machtbewussten Mutter seine helle Freude haben.
Papst Lando wurde unlängst vom Kämmerer (Vestararius) tot im Bett aufgefunden. Er sei friedlich eingeschlafen und rechtschaffen vor den Thron Gottes getreten, heißt es, obwohl jeder sein moralisches Lotterleben kennt: Er hatte kleine Mädchen und Jungs zu gern und Dirnenfeste und Fressgelage im Vatikan veranstaltet. Gerüchte kreisen unter vorgehaltener Hand: War es Gift? War es Mord? Hat der Leibhaftige den Papst für die Unmoral seines ausschweifenden Lebens geholt? Die Höllenhunde? Die Teufelsaffen?
Kaum einer glaubt an Landos natürlichen Tod im jungen Alter von neunzehn Jahren und einem Pontifikat von acht Monaten. Er hätte während dieser kurzen Zeit kaum etwas bewegen können, das der Familie Theophylakt unpässlich gewesen wäre.
Der Mordverdacht fällt sofort auf Theodora und deren Tochter Marozia als Komplizin. Es wäre nicht der erste Mord, den das Volk dem römischen Herrschergeschlecht unterschiebt und auch nicht der erste Papstmord in der Kirchengeschichte, wie zum Beispiel Johannes VIII. Anglicus, den der Pöbel steinigte, weil er während einer Prozession ein Kind gebar! Zweifellos handelt es sich um die als Mann amtierende Päpstin Johanna, die von 953–955 ein vorbildliches Pontifikat führte; die katholische Kirche bestreitet bis heute vehement die Existenz dieser Päpstin, obwohl sie in über zweihundert Chroniken erwähnt wird. Aber das ist eine andere Geschichte.
Der Mordverdacht an Lando durch die Senatrix und Marozia ist nicht ganz unbegründet. Seit der Machtergreifung des Theophylakt von Tusculum in Rom und der Vertreibung konkurrierender Familien aus der Stadt sind tatsächlich einige Senatoren plötzlich verschwunden, exiliert worden, wie es heißt, oder ganz unerwartet verstorben. Sie alle wurden durch genehme Senatsmitglieder ersetzt. Wer Senatoren mordet, kann auch einen Papst morden! Jeder weiß das. Keiner spricht es aus. Vorlaute verlieren schnell die Zunge und noch schneller das Leben.
Macht, Einfluss, Landbesitz und Luxus sind im Hochadel und dem Klerus höher bewertet als Menschenleben oder das Seelenheil der der Kirche anvertrauten Schäfchen. Das Volk wird sündig und schuldbewusst im Staub gehalten und mit den fürchterlichsten Höllenqualen bedroht. Der Leibhaftige gehe um und hole sich die Störrischen, Apostaten und Ungläubigen, um sie zu fressen. Der Zorn Gottes schicke die grausigen Seuchen, Hungersnöte, Naturkatastrophen und Kriege wegen der Verderbtheit des Volkes, während im Vatikan und den Palästen die bare Unmoral bis zum Äußersten ausgekostet wird. Weder selbstzerstörerische Flagellanten (Selbstauspeitscher) noch herzzerreißendes Kinderflehen, Bußmessen und Heiligenprozessionen können Gott besänftigen. Korruption, Ämterschacher und das Lotterleben der Mönche, Priester bis zum Papst treiben giftige Blüten. Die apokalyptischen Reiter schwingen ihre tödlichen Sensen über den unwürdigen Häuptern.
Die warnende Stimme Bernhards von Clairvaux, des Abtes des Reformklosters Cluny, zur Umkehr und Besinnung, ist Schall und Rauch. Was können vier Jahre seit seiner Gründung (910) bewirken, um den Klerus von Verderbtheit und Ausschweifung abzuhalten und die marode Kirche zu reformieren? Bernhard setzt die Hoffnung eines Anfangs auf den neuen Papst – und der steht auch schon fest: Johannes X.
Johannes Cenci, geboren 860, stammt aus Tossignano bei Imola. Er war Bischof von Bologna und ab 905 Erzbischof von Ravenna, jetzt ein Mann von beachtlichen vierundfünfzig Jahren.
Bernhard von Clairvaux sagt zu seinen Brüdern, den Clunyensern, den späteren Zisterziensern: »Was kann man erwarten? Ausschlaggebend für seine Amtseinsetzung war wohl die Nähe zum italienischen König Berengar (I.) und zu Senator Theophylaktus von Tusculum. Johannes wurde zum neuen Papst erhoben wegen seiner ,engen Beziehung‘ zu Theodora, dessen Gattin, der Senatrix und Patricia von Rom, wie sie sich stolz zu nennen geruht. Man sagt, der Johannes habe der Marozia sogar ein Kind gezeugt, eine Tochter! – Ich glaube, meine Brüder, wir müssen für unsere verkommene Kirche beten. Gott möge unseren neuen Papst, den ich nicht als Heiligen Vater zu nennen wage, mit Besinnung, Weisheit und Moral erleuchten. Ich fürchte: Wieder hat ein Günstling jener verworfenen Familie von Tusculum den Stuhl Petri bestiegen, der nichts weiter als eine Marionette ist!«
Der ehrwürdige Abt und seine Mönchsschar in den weißen Kutten knien auf den harten Steinboden der Klosterkirche nieder. Bernhard bekreuzigt sich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes … - -
Es ist März, ein düsterer Tag und viel zu kalt für die Jahreszeit. Schneeregen fällt. Auf dem Land und den verwinkelten Dächern Roms liegen ausgedehnte Schneebatzen; die Sonne hat noch nicht die Kraft, sie wegzuschmelzen.
Das Volk versammelt sich trotz schlechten Wetters entlang den Straßen. Johannes Cenci, als Papst Johannes X. bereits inthronisiert, schreitet vom Lateran, dem ursprünglichen Sitz des Bischofs von Rom und seit Papst Gregor I. dem Großen (590–604) auch des Papstes, zur Petersbasilika, um sich krönen zu lassen. Eine bewaffnete Reiterei und Fußsoldaten sorgen für die Sicherheit des Heiligen Vaters. Man weiß nie! Meuchelmörder sind in den Gassen Roms unterwegs. Schnell fliegt ein Stein, surrt ein Pfeil von einem Bogen aus dem Hinterhalt.
Johannes trägt die knöchellange Albe, darüber die »Casula«, ein Übergewand mit bis zu den Knien reichenden weiten Ärmeln, und rote Schuhe. Das »Pallium« ist ein antikes Vermächtnis hoher römischer Würdenträger; es zu tragen steht nur den Päpsten und Erzbischöfen zu. Es ist ein breiter Stoffstreifen aus weißer Wolle. Zwei Bänder hängen vorn herab. Sechs schwarze Kreuze sind in regelmäßigen Abständen eingestickt. Der Fischerring des Simon Petrus prangt am rechten Mittelfinger. Die linke Hand führt im Schritt den pastoralen, oben gebogenen Stab, das Symbol des »Guten Hirten«.
Johannes’ Haupt ist unbedeckt. Ein schmaler, grau melierter Kranz ist von der einstigen üppigen Haarpracht geblieben. Vier Diakone tragen den reich bestickten Baldachin. Zwei weitere flankieren den Papst. Sie schwingen die Weihrauchkessel. Dies aus zwei Gründen: um mit dem erhabenen Duft den lebendigen Stellvertreter Christi auf Erden zu ehren und um die päpstliche Nase vor dem fürchterlichen Gestank der Stadt zu bewahren. Dem Baldachin folgen würdigen Schrittes kaum ein Dutzend in Rot gekleidete Kardinäle und ein paar Bischöfe in purpurnen Amtsgewändern. Hinter den altehrwürdigen Herren haben sich die Priester, Diakone, die Mönche und ganz am Schluss die Äbtissinnen und die Nonnen aus den umliegenden Klöstern Roms streng hierarchisch eingeordnet. (Es gab im 10. Jahrhundert nur den Benediktinerorden und die Klarissen der Schwester des heiligen Benedikt, die Klara hieß. Die Klarissen waren streng genommen gleichfalls Benediktinerinnen.)
Graf Theophylakt von Tusculum führt hoch zu Ross den Prozessionszug an, von seiner Leibwache in Paradeuniformen begleitet. Er ist als Senator und »Dux Romanorum« der Herrscher über die Ewige Stadt und der Herr über das Papsttum. Ihm folgt lediglich eine vorbestimmte Marionette, die in seinem Sinne die Geschicke der Kirche leiten wird. Trompetenstöße und Paukenschläge künden dem Volk sein Kommen an. Johannes, der X. dieses Namens, segnet beim Vorüberschreiten die Gläubigen, die in dicht gedrängten Reihen die Straße säumen, und verteilt großzügig links und rechts ein erhabenes Lächeln.
Viele Leute verachten den Klerus wegen seiner Verderbtheit. Es gibt auch welche, die dem neuen Papst zujubeln in der Hoffnung, es möge jetzt alles besser werden. Gott werde den Menschen gnädig die Sünden vergeben und sein Antlitz zeigen. Der jugendliche Papst Lando hatte den Vatikan mit Sexorgien und Fressgelagen in ein Bordell verwandelt; er schmort jetzt in der Hölle! Der Heilige Vater Johannes vertreibe jetzt die Dirnen, Mätressen, Kurtisanen und Konkubinen, die unbekümmert im Vatikan ein und aus gehen. Seine Heiligkeit höre endlich die Stimme des Bernhard von Clairvaux, die dringlich anstehenden Kirchenreformen durchzuführen und der Moral und der christlichen Bescheidenheit wieder Geltung zu verschaffen. Es ist eine Minderheit der Gläubigen, die an ein solches Wunder glaubt. Die Stimmung der Menschen schwankt zwischen vager Hoffnung und bitterer Enttäuschung, dass alles beim Alten bleibt. Johannes ist bloß wieder ein höriger Günstling der Mächtigen der Stadt, und da stehen Theodora und Marozia an vorderster Stelle. Es besteht kein Zweifel, dass sie Landos plötzlichen Tod zu verantworten haben, auch wenn, wie immer, nie Beweise für befohlene Morde vorliegen.
Die Krönung findet in der Petersbasilika statt, die Kaiser Konstantin über dem Grab des Apostels Petrus errichten ließ (326 durch Papst Sylvester I. feierlich eingeweiht). Sie wurde während des Sarazenensturms im August 846 schwer beschädigt, und der Zahn der Zeit nagt an den baufälligen Mauern. Es fehlten die Mittel (sprich Pilger-, Buß- und Spendengelder; Geldablässe gab es noch nicht), sie in den vergangenen siebzig Jahren vollständig in Stand zu setzen. Die Stadt wurde schwer gebrandschatzt und arg zerstört. Der Wiederaufbau der Wohnhäuser der Bevölkerung war erste Priorität, um keine blutige Revolte zu provozieren. Die »Leontinische Mauer«, die den Vatikan fest und sicher umringt, trotzt bis heute allen Kriegen und Unbilden der Natur. Papst Leo IV. (847–853, der Amtsvorgänger der Päpstin Johanna, die ihm als Kardinalssekretär diente) hatte das backsteinerne Mauerwerk nach dem Schock der schrecklichen Sarazenenplünderung erbauen lassen.
Rom hat im 10. Jahrhundert von einst 1 Million Einwohnern zur Zeit des Kaisers Hadrian (117–138) kaum mehr als 50 000 Seelen. Vom Glanz der antiken Stadt, dominiert von gigantischen Marmorbauten, breiten Paradestraßen, prachtvollen Tempeln, Foren, Zirkussen und öffentlichen Parkanlagen mit Springbrunnen fürs Volk zum Flanieren, ist wenig übrig geblieben. Rom, der »Nabel der Welt« – Caput mundi –, ist zum Rom »Cauda mundi«, zum »Schwanz der Welt«, verkommen. Einst prunkende Paläste liegen weitgehend in Trümmer. Das Kolosseum, die größte Arena der damaligen Welt, wo glanzvolle Gladiatorenspiele und Seeschlachten 320 Jahre lang stattfanden, ist ein Kalksteinbruch für die Gewinnung von Dünger für die Felder und die Herstellung von Mörtel für den Häuserbau geworden. Ratten und Mäuse, wilde Katzen und Hunde hausen in den Gewölben, Kranke, Krüppel, Verbrecher, der letzte Abschaum, den die Stadt ausgespuckt hat.
Tausende wohnen in monotonen, bis zu acht Stockwerke hohen, meist baufälligen Mietskasernen aus Backstein. Vielköpfige Familien drängen sich in engen Wohnungen. Sie sind überteuert, laut, feucht und finster. Viele Leute leben auf der Straße im Schmutz, weil sie sich keine Bleibe leisten können. Die Ärmsten der Armen vegetieren dreckig und krank in den antiken römischen Kloaken. Bettler gibt es wie Sand am Meer. Rom ist ein Misthaufen von Abfall und Exkrementen.
Nachts ist es lebensgefährlich in den Gassen. Diebe, Gauner, Ganoven, Auftragsmörder sind unterwegs. Straßenbanden terrorisieren, rauben, plündern, vergewaltigen. Keine Edeldame – nur die geringe Gassenhure und ihr Zuhälter – darf es wagen, sich ohne Leibgarde im Freien aufzuhalten; sie würde rasch überfallen, ausgeraubt, vergewaltigt und schlimmstenfalls getötet.
Tausende Pilger beten im römischen Sündenpfuhl um Vergebung und erflehen den Segen des Heiligen Vaters. Das kostet die »allerchristlichste Majestät« einmal am Tag einen öffentlichen Kurzauftritt auf dem Balkon, ein weites Schlagen des Kreuzes und an speziellen Feiertagen eine flammende Predigt in der Basilika über Höllenqualen und Fegefeuer. Hunderte würden ohne die allergnädigste, tägliche Ausgabe von Almosen verhungern.
Die Hospitäler sind heillos überfüllt. Ärzte, Mönche und Nonnen arbeiten bis zur Erschöpfung für ein Plätzchen im Himmel unter haarsträubenden Bedingungen. Die arabische Medizin ist noch nicht über Andalusien und Sizilien nach Europa vorgedrungen. Die wenigen sarazenischen Ärzte arbeiten im Verborgenen. Ihre Lehrbücher, sie nur zu lesen, das ist verboten werden verbrannt, ihre Besitzer eingekerkert. Stirbt ein Patient des Adelsstandes, dann wartet der Tod auf den Medikus. Diese »Gebildeten« werden kurzerhand als Spione und Feinde hingerichtet. Der Aberglauben und die Gesundbeterei der mönchischen Doctores grassieren. Offene Wunden werden mit Dungwickeln behandelt, vom Wundbrand befallene Glieder ohne Betäubung mit Sägen amputiert und Salben mit unvorstellbaren Ingredienzen verwendet. Die Überlebenschance im Hospital ist gering. Die Kirche erfüllt hier zweifellos wertvolle Dienste und mitfühlende Nächstenliebe. Die Kräuterfrauen und Apothekerinnen stehen oft im Ruf von »weißen Hexen«; der Schritt zur »schwarzen Hexe« ist klein. Es gibt auch Adlige, die der Kirche Geld spenden zur Linderung der Not und zum Bau von neuen Krankenhäusern. Das geschieht meistens nicht ganz selbstlos; sie erwarten Privilegien, die der Heilige Vater (noch) in eigener Kompetenz erteilen kann und die das Papsttum weiter schwächen.
An jeder Ecke gibt es Weinstuben, Spielhöllen und Bordelle in der Stadt. Armut und Not treiben viele Frauen in die Prostitution, um nicht hungern zu müssen. Chronisten schätzen, dass anfangs des 10. Jahrhunderts jede dritte Frau in Rom ihre Liebesdienste anbieten musste, um überhaupt überleben zu können.
Die Petersbasilika ist für die Papstkrönung bereit. Es existieren keine Gebetsbänke für die Gläubigen. Es gibt nur Stehplätze. Die tragenden Säulen der Kirchenschiffe sind mit duftenden Blumengirlanden umwunden, um den ärgsten Gestank menschlicher Ausdünstung zu überdecken. Man wäscht sich zu kirchlichen Feiertagen, wenn überhaupt, und steigt mitsamt den Kleidern ins Sitzfass mit zumeist gebrauchtem Badewasser. Die Ärmsten, die Mönche und Nonnen tragen oft zeitlebens dasselbe flickenübersäte Gewand.
Das niedrige Volk darf einer Papstkrönung oder einer Hochzeit im Adel ausdrücklich beiwohnen, sonst gäbe es eine Revolte in der Stadt. Ansonsten geht der gemeine Mann und die geringe Frau zur Heiligen Messe, um feurige Predigten zu hören, den Leib Christi beim Abendmahl zu empfangen, zu beichten und endlose Heiligenlitaneien zu sprechen, die das Seelenheil begünstigen.
Zwei Throne flankieren den Altar und das Chorgestühl der Kathedralherren: ein weltlicher und ein geistlicher. Alles, was in Rom Rang und Namen hat, ist gekommen: Adelsherren, ihre Gattinnen mit den Kindern, Stadtherren, Richter, reiche Kaufleute, Geistlichkeiten, edle Hofdamen, Mätressen und Konkubinen und natürlich die hochverehrte Gräfin Theodora von Tusculum, die Senatrix und Patricia von Rom, in vorderster Reihe. Neben ihr stehen Marozia und ein junges Mädchen von 17 Jahren, Theodora (II.), die jüngere Schwester. Die beiden Töchter haben zweifellos die blendende Schönheit ihrer machtbewussten Mutter geerbt. Ihr Anblick betört das männliche Auge.
Ein Raunen geht durch die versammelte Menschenmenge in der Basilika.
»Er kommt! Er kommt! Der Heilige Vater kommt! Der Papst! Endlich!«
Trompetenstöße künden sein Erscheinen an. Die Menschen bilden eine Gasse, damit Johannes vom Eingangsportal zum Altar schreiten kann. Soldaten sorgen, dass keiner ausbricht und den Saum des päpstlichen Gewandes küsst oder ein arglistiger Attentäter zusticht; Johannes hat auch Neider und Feinde. Nonnen und Mönche singen einen feierlichen Choral. Kirchenorgeln sind noch unbekannt. Der Graf, Senator und »Dux Romanorum« Theophylaktus schreitet dem Papst voraus. Das gemeine Volk soll sehen, wer hier das Sagen hat und die Macht ausübt. Er führt den Papst zum Altar zur Krönung, dem finalen Akt seiner Amtseinsetzung durch die herrschende Familie.
Es braucht Zeit, bis jeder Prozessionsteilnehmer seinen Platz eingenommen hat. Der feierliche Choral verhallt in den hohen Kirchenschiffen der Basilika. Der Machthaber Roms sitzt auf dem weltlichen Thron, flankiert von seinen engsten Familienmitgliedern, Johannes X. ihm gegenüber auf einem kleineren, weniger prunkvollen Thronsessel. Der Unterschied macht dem Volk die wahren Machtverhältnisse zwischen Kirche und Staat augenscheinlich: die Abhängigkeit des Papsttums vom weltlichen Herrscher.
Der Zeremonienmeister, der Kardinaldekan, ebenfalls ein Günstling Theophylakts und von Theodora an der Leine gehalten, tritt vor und segnet die versammelte Gemeinde. Ein Mönch betritt die Kanzel. Feurige Worte beschwören die Hölle und das Fegefeuer in einer Predigt, die Angst und Schrecken verbreitet. Die Sünder, Apostaten und Ungläubigen, die nicht endlich Buße tun und in den Schoß der heiligen katholischen Kirche zurückkehren, wissen, was sie erwartet, wenn sie durch ihre schändlichen Taten den Zorn Gottes herausfordern, Dämonen beschwören und dem Leibhaftigen zutrinken. Aber der gnadenvolle, neue Papst Johannes, der X. dieses Namens – der Mönch weist huldvoll auf den Mann auf dem päpstlichen Thron –, werde Jesus, den Herrn, die Heilige Jungfrau Maria als Fürsprecherin und alle Heiligen bitten, uns armen Sündern gnädig das Antlitz wieder zuzuwenden und unsere Not zu mildern. Der Erlöser werde seinem Stellvertreter auf Erden nicht das Ohr verweigern. Alles werde sich zum Besseren wenden.
»… Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes«, schließt der Mönch seine Predigt.
Die Krönungsmesse geht der Papstkrönung nach alter römischer Tradition voraus. Sie wird vom ranghöchsten Kardinalbischof – dem Kardinaldekan – des noch kleinen Kardinalskollegiums vollzogen. Er wird die päpstliche Mitra dem neuen Stellvertreter Christi feierlich aufs Haupt setzen. Der Papst krönt seinerseits die Häupter der Könige und Kaiser, erstmals so geschehen bei Karl dem Großen im Jahr 800 durch Leo III. (795–816). Der Ritus tut seither den göttlichen Willen für die Einsetzung und die Herrschaft eines Königs oder Kaisers kund, was nicht (mehr) hinterfragbar ist. Gleichzeitig symbolisiert die Krönung durch den Papst den Supremat über Kaiser und Könige, die der Heilige Vater fortan beliebig ein- und absetzen kann. Kaiser Karl der Große war über die päpstliche Dreistigkeit Leos III. sehr verärgert. Bislang wurde die weltliche Krone dem Herrscher vom Papst übergeben und nicht aufs Haupt gesetzt. Dies tat der Kronrat in der Petersbasilika mit dem Segen des Heiligen Vaters. Seither flammt der Konflikt zwischen Kaiser und Papst über den Supremat, der im Mittelalter zum Investiturstreit ausartete.
Die Tiara – die dreifache Krone Petri – gibt es im 10. Jahrhundert noch nicht. Ihre Herkunft leitet sich aus dem persischen Reich über die byzantinische Hofhaltung ab. Aus der »phrygischen Mütze« könnten sich sowohl die päpstliche Mitra – ein konisches Barett aus Stoff – als auch das »Camelaucum« der Orthodoxie entwickelt haben. Die Päpste trugen die Mitra vermutlich seit dem 4. Jahrhundert. Unklar ist, wer zuerst einen Kronreifen anbringen ließ. Die Tiara in der heutigen Form ist seit Papst Bonifaz VIII. (1294–1303) historisch verbürgt, dessen Fresko sie bei der Eröffnung des »1. Heiligen Jubeljahres« 1300 zeigt. Bonifaz fügte der Krone einen zweiten Reif hinzu, um den Anspruch auf die geistliche und weltliche Herrschaft kundzutun. In Avignon nimmt die Tiara die Form der dreifachen Krone an, 1315 als »Trignum« erstmals erwähnt. Sie symbolisiert die drei Seinsweisen der Kirche: leidend – streitend – triumphierend –, und die geistliche Oberhoheit, den Supremat des Papstes als Vater der Fürsten und Könige, Lenker der Welt und Stellvertreter Christi auf Erden.
Seit der frühen Neuzeit verwendet das Papsttum das Herrschaftssymbol der beiden gekreuzten Schlüssel Petri als heraldisches Element. Der goldene Schlüssel bedeutet die Bindegewalt der Kirche, der silberne die Lösegewalt (retine et solve): »Was du auf Erden bindest, soll auch im Himmel verbunden sein, und was du auf Erden lösest, das soll auch im Himmel gelöst sein.« Die goldene Lösegewalt beinhaltet die Sündenvergebung, die silberne den Bannstrahl, die Exkommunikation, ein äußerst gefürchtetes Machtinstrument des Papstes, das jedes Seelenheil und die Auferstehung am Jüngsten Tag verwirkt …
Die päpstliche Mitra liegt auf einem purpurnen Kissen für die Krönungszeremonie bereit. Johannes (X.) kniet vor dem Kardinaldekan auf die Altarstufen nieder. Ein Kardinalpriester nimmt das Kissen mit dem konischen päpstlichen Barett auf und schreitet feierlich an die Seite des Dekans, um ihm zu assistieren. Es ist mucksmäuschenstill in der Basilika. Gespannte Stimmung herrscht. Die Gläubigen stehen in dichten Reihen. Man hätte eine Haarnadel fallen hören können.
»Dominus vobiscum.«
»Et cum spiritu tuo«, antwortet die versammelte Volksmenge mit einer Stimme. Der Kardinaldekan schlägt ein weites Kreuz über dem Haupt des Johannes und nimmt die Mitra vom Purpurkissen auf. Dann spricht er feierlich die Worte:
»Nimm hin diese Krone und wisse, Papst Johannes, der X. dieses Namens: Du bist auf Erden der Stellvertreter unseres Erlösers Jesus Christus, welchem die höchste Ehre und der größte Ruhm ist in alle Ewigkeit!« (Der Zusatz »Vater der Fürsten und Könige und des Kaisers, Lenker des Erdkreises« (Urbi et Orbi) wird erst im 12. Jahrhundert den offiziellen Initiationsworten der Krönung hinzugefügt.)
»Amen«, bestätigt Johannes demütig, mit versteckter Freude.
Und jetzt geschieht ein ungeheuerlicher Eklat: Ehe die päpstliche Mitra sich feierlich auf Johannes’ Haupt niedersenkt, tritt Senator Theophylaktus von Tusculum hinzu. Er legt seine Hände über die des Kardinaldekans, die die Mitra festhalten. Dieser ist von der Dreistigkeit so überrumpelt, er kann sich der sanft zwingenden Kraft nicht widersetzen, die Mitra auf das päpstliche Haupt zu setzen. Nicht allein der Kardinaldekan krönt jetzt den Papst, sondern er gemeinsam mit dem weltlichen Herrscher. Es ist nicht auszudenken, welche unabsehbaren Folgen diese unheilige, blasphemische Intervention des Theophylakt für die Krönung späterer Päpste haben kann. Das Papsttum ist augenscheinlich in seiner Abhängigkeit auf dem Tiefpunkt angelangt!
»Bedenke, von wem du die päpstliche Krone erhalten hast, Johannes, und wer dein Herr auf Erden ist«, sagt der Senator mit gedämpfter Stimme. Er drängt den Kardinaldekan sanft zur Seite. Dieser ist so perplex, er ist unfähig, Widerstand zu leisten. Es ist ihm bewusst, dass er gleichfalls ein abhängiger Günstling des Herrschers von Rom ist.
»Jetzt küss meine Hand, Johannes! Dann erhebe dich und gehe auf deinen Platz zurück, damit dir gehuldigt werde«, lautet der sanft zwingende Befehl.
Johannes überwindet seine Überraschung schneller als der Kardinaldekan und zögert.
»Tue es, Johannes!«, befiehlt Theophylakt strenger und fügt hinzu: »Mit deinem Handkuss versicherst du dir und dem Papsttum meine wohlwollende Freundschaft und Unterstützung. Also?«
Eine versteckte Drohung unabsehbarer Folgen liegt in der Einwortfrage, sollte Johannes den Handkuss verweigern. Die Unterwerfung ist noch demütigender, weil Theophylakt einen Handschuh trägt. Die Entwürdigung des Stellvertreters Christi und die Abhängigkeit des Papstes finden wohl keinen stärkeren Ausdruck.
Johannes zögert.
»Tu es! Küss meine Hand! Mach schon!«, zischt der »Dux Romanorum« gleich einer Viper vor dem Biss.
Der Papst fasst langsam die hingestreckte Hand und zögert, den Handkuss der Unterwerfung zu geben. Theophylakt führt sie plötzlich mit einer raschen Bewegung an den päpstlichen Mund.
»Siehst du, mein lieber Johannes, das war doch gar nicht schwer«, munkelt er lächelnd. Nur die umstehenden Personen können es hören, aber Theodora, Marozia, ihre Schwester Theodora (II.) und der versammelte Hochadel der Stadt, alle haben es gesehen.
Graf Theophylakt von Tusculum wendet sich dem Kardinaldekan zu. Mit versteckter Hand schiebt er ihn vor.
»Jetzt segnet den Heiligen Vater, Eminenz«, befiehlt er mit steifen Lippen. »Dann fahret mit der Zeremonie fort.«
Der Dekan tut wie geheißen. Der Graf setzt sich machtbewusst auf seinen Thron. Die Gattin nickt ihm leise zustimmend zu. Hatten sie den Handkuss der Demütigung und der päpstlichen Unterwerfung geplant?
Das versteckt empörte Volksraunen in der Basilika über den blasphemischen Akt eines selbstherrlichen Herrschers ist unüberhörbar. Mönche und Nonnen stimmen einen Choral an. Johannes X. begibt sich feierlichen Schrittes, mit der päpstlichen Mitra gekrönt, auf seinen Platz zum niedrigen Thronsessel, der dem des weltlichen Herrschers gegenübersteht. Die ungeheuerliche Blasphemie wird ein paar Monate später stillschweigend aus den päpstlichen Annalen gelöscht. Der Chronist Liutprand von Cremona wird die unverschämte Dreistigkeit der Nachwelt erhalten.
Diakone prozessieren die »Flabelli« aus der Sakristei. Das sind zwei tragbare große Fächer aus schneeweißen Straußenfedern. Sie fächeln dem Papst kühle Luft zu. Weihrauchkessel vertreiben den grässlichen Gestank menschlicher Ausdünstung von der päpstlichen Nase.
Die Mitglieder des vatikanischen Kardinalskollegiums huldigen jetzt dem Heiligen Vater: Die Eminenzen bestätigen ihren Treueid und den unbedingten Gehorsam mit einem Handkuss, die Exzellenzen (Bischöfe) mit dem Kuss des päpstlichen Pantoffels. Dafür erhält jeder den Segen des Pontifex über dem Haupte und ein wohlwollendes Lächeln.
Der Chorgesang verhallt feierlich in den Gewölben der Kirchenschiffe. Sie sind römisch-byzantinisch gebaut; die düstere, schwere Romanik hat bei Instandstellungsarbeiten der Basilika keinen Einfluss genommen. Die lichte Gotik ist von den Kirchenarchitekten noch nicht erfunden worden. Sie wird Rom erst im 12. Jahrhundert erreichen.
Die päpstliche Auszugsprozession steht einer Königskrönung in ihrem Prunk nicht nach. Das Volk Roms jubelt Johannes hoffnungsvoll zu, der jetzt mit allen erforderlichen Amtsinsignien versehen auf den Platz vor die Petersbasilika tritt. Die Glocken läuten. Trompeten schallen. Fahnen wehen. Der »gute Hirte« begrüßt seine ihm anvertrauten Schäfchen und schlägt unverdrossen links und rechts das Kreuz mit den drei Segnungsfingern der rechten Hand.
Es hat zu regnen aufgehört. Gleißende Sonnenstrahlen brechen durch die dunklen Wolkenbänke und erleuchten das Gesicht des Heiligen Vaters – ein wahrlich gutes Omen – eine Offenbarung? Ist Johannes X. jetzt endlich der moralische Papst, der länger als seine verderbten Vorgänger den Stuhl Petri bekleiden und alles zum Besseren wenden wird?
Theophylakt und seine Gattin Theodora, die wahren Machthaber Roms und über den Vatikan, überlassen jetzt ihren Günstling der Volkshuldigung in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt. Sie verlassen die Basilika durch einen Seitenausgang, gefolgt von Marozia und der jüngeren Schwester Theodora. Sie kehren in die Engelsburg zurück, ihrem befestigten Regierungs- und Wohnsitz, der Hochadel in die Häuser der Familiendynasten innerhalb oder vor den Mauern Roms. Papst Johannes hat seine Schuldigkeit getan, wenn auch widerstrebend. Die weltliche Obrigkeit kann ihn einstweilen gewähren lassen. Marozias Mutter wird ein wachsames Auge auf ihn haben.
Eigentlich wollte der »Dux Romanorum« mit seiner Familie am Festbankett im Lateran teilnehmen, das der Papst nach seinem Triumphzug durch Rom zur Feier der Krönung gibt. Ein Bote König Berengars (I.) von Italien erwartet Theophylakt mit einer gesiegelten Botschaft, die ihn zu den Waffen ruft. Die Sarazenen treiben in Latium wieder vermehrt ihr böses Unwesen: Sie rauben, plündern, brandschatzen, morden, vergewaltigen, streuen Salz auf die Äcker und Felder und schlachten sinnlos das Vieh ab. Das höllische Ungeziefer muss endlich ausgemerzt, die schaurige Pestbeule ein für alle Mal ausgebrannt werden!
Theophylaktus übergibt seiner Gemahlin die Regierungsgeschäfte, schließlich ist sie Senatrix von Rom, und reist noch vor dem Abend mit einem beachtlichen Truppenkontingent ab. Sein lakonischer Rat an Marozia: »Unterstütze deine Mutter!«
Die Tochter verspricht’s. Sie verabschiedet den Herrn Vater und die Soldatenkolonne am Südtor der Stadt an der Seite der beiden Theodoras, der Mutter und der Schwester. Es sind drei Frauen, die in Rom jetzt das Sagen haben: Es herrscht eine Pornokratie – eine Weiber- oder Hurenherrschaft!
Marozia ist eine betörend schöne Frau von vierundzwanzig Jahren und seit 909 mit Alberich I. von Spoleto verheiratet. Der Ehe ist ein Sohn gegönnt, Alberich (II.). Er ist erst dreijährig, aufgeweckt und flink, ein lernbegieriger Bub, der viel Freude bereitet. Marozia weiß, er wird einmal ein mächtiger Mann werden.
Alberich ist nicht ihr erstes Geblüt. Johannes ist ein Jahr älter. Er ist ein unehelicher Bastard. Ihre eigene Mutter hat die schöne Marozia als fünfzehnjähriges Mädchen Papst Sergius III. als Mätresse zugeführt, der jungfräuliches Fleisch begehrte, obwohl Theodora mit ihm seit langem das Bett teilte. Sergius war süchtig nach der Virtuosität von Theodoras Liebeskunst, wie sie keine Kurtisane in Rom beherrscht.
Papst Sergius III. war ein alter kranker Mann, als er Marozia wie ein wilder Stier deflorierte. Marozia ekelte sich vor dem Geruch des Greises, vom Schweiß und dem Alkohol, vor den unsagbar schlechten Zähnen und dem Mundgestank dieses geilen Mannes, der seine belegte Zunge gierig in die Vagina steckte, um ihren Liebessaft zu trinken, und in ihren Mund bohrte, um vom Speichel zu kosten. Das junge Mädchen musste ihm jederzeit zu Willen sein – selbst nach der Heirat mit Graf Alberich von Spoleto – und das schwabbelnde Fressfett und das Gewicht über ihr ertragen, das sie zu erdrücken drohte. Sergius stellte in seiner Geilheit Dinge mit ihr an, die unaussprechlich sind. Irgendeinmal muss er den Johannes gezeugt haben. Böse Gerüchte behaupten, Sergius habe oftmals bei Marozia und ihrer Mutter gelegen; sie hätten lustvoll den lesbischen Inzest getrieben, der schlimmer ist als die sieben Todsünden zusammen. Auch der Leibhaftige wäre anwesend gewesen.
Marozia dankte Gott in der Familienkapelle der Theophylakts, als Sergius endlich das Zeitliche segnete. Das ist jetzt drei Jahre her. Der Ekel, das grausige Würgen im Hals, ist geblieben. Sergius hat ein tiefes Trauma in ihre Seele geschlagen und das Herz verhärtet. Es wird niemals mehr heilen. Trotzdem: Marozia liebt den Johannes wie ihren legitimen jüngeren Sohn Alberich. Johannes kann ja nichts dafür. Seine Existenz ist Gottes Wille. Gott liebt alle Kinder, auch unehelich geborene. Marozia wollte ihn nicht in ein Kloster weggeben. Alberich von Spoleto, ihr Herr Gemahl, hat auf ihr Ansinnen und Drängen den Bastardsohn als nicht erbberechtigtes Mitglied in die Familie aufgenommen. Er ist ja noch so klein: vierjährig und so niedlich; der andere ist drei und genauso aufgeweckt und lebendig.
Die Mutter schließt ihre Geblüte in die Arme, die sie stürmisch nach dem Auszug eines Teils der gräflichen Armee aus der Stadt in den Privatgemächern der Engelsburg begrüßen. Sie küsst die beiden Buben auf die Stirn und die Wangen und streicht liebevoll über ihre Wuschelköpfe. Es hat sich ein langobardisches Element in ihren Habitus eingeschlichen: helle Augen und eine aschblonde Haarfarbe mit einem leichten Rotstich. Sie haben ihn von ihrer Mutter geerbt, der Tochter des Theophylakt von Tusculum. Ihre Familiendynastie wurzelt in der Toskana, die vor wenigen hundert Jahren von eingewanderten langobardischen Volksstämmen besiedelt war, die sich zwischenzeitlich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt haben …
»Der Herr Gemahl verlangt nach dir, edle Herrin«, unterbricht Aglaia den kindlichen Übermut. Sie steht mit demütig vor der Brust verschränkten Händen unter der Kammertür. Aglaia ist Marozias Amme und vertraute Zofe, die in unverbrüchlicher Treue zu ihr steht. Sie gehört zu den wenigen Frauen, die lesen und schreiben können. Aglaia ist die gebildete Tochter aus reichem byzantinischem Haus. Sie wurde auf einer Handelsreise mit ihrem Mann von den Sarazenen auf hoher See überfallen, gefangen genommen und als Edelsklavin verkauft. Sie gelangte auf verschlungenen Leidenspfaden nach Rom an den Hofstaat von Papst Sergius III., der sie missbrauchte, bis er ihrer überdrüssig war. Er reichte sie an Theodora von Tusculum weiter. Marozias Mutter erkannte sogleich Aglaias Fähigkeiten und lernte sie zu schätzen. Sie durfte schließlich in Marozias Familie ihre Stärke und Begabungen entfalten. Die heute vierzigjährige Frau von reifer Schönheit besitzt eine aristokratische Aura und überlebte durch ihren unerschütterlichen Lebensmut und ihre weibliche Seelenstärke. Sogar der Herr Graf Theophylakt lässt sich mit seiner Gattin herab, von Aglaia in der griechischen Sprache unterrichtet zu werden. Die Familie behandelt sie gut. Sie gibt niemals Widerworte und lässt sich von Intriganten in ihrer vorzüglichen Stellung weder als Spionin noch als Geliebte missbrauchen. Aglaia war verheiratet und gebar einen Sohn, Demetrios. Der Gatte war damals im Kampf mit den sarazenischen Piraten gefallen. Die Spur ihres Sohnes verliert sich irgendwo im Stadtmoloch Byzanz. Aglaia weiß nicht, wo er lebt, ob er in diesen kriegerischen Zeiten überhaupt noch lebt. Seit einem Jahr regiert Kaiser Konstantin VII. das Oströmische Reich. Ein reger urbaner Handel blüht, im Gegensatz zum bäuerlichen, ärmlichen Westrom, das nach Karl dem Großen in kriegerische Königreiche, Herzogtümer und Grafschaften zerfallen ist. Aglaia genießt das vollste Vertrauen der Familie Theophylakt. Das beweist ihre Stellung als Kindermädchen, Zofe und Lehrerin. Theodora, die mächtige Senatrix von Rom, hat sie unlängst vom Sklavenstand befreit. Aglaia ist die Einzige, die Marozias große Jugendliebe kennt, die Alexander hieß. Die Liebe durfte nie erblühen. Marozia wurde von der eigenen Mutter Papst Sergius III. als Geliebte zugeführt und musste die politische Heirat mit dem Grafen Alberich I. von Spoleto eingehen …
»Ist mein werter Herr Gemahl noch immer leidend?«, fragt Marozia die Zofe. Sie übergibt die Söhne ihrer Obhut.
»Ich fürchte ja. Der Arzt hat ihn vor einer Stunde zur Ader gelassen.«
»Ich glaube, wir sollten es einmal mit einer Kräuterfrau versuchen, die seine Kriegswunde nicht mit Eseldung behandelt«, erwidert Marozia und betritt die Kammer ihres Gatten.
»Bist du noch immer fiebrig, mein Herr Gemahl?«
Sie kniet an der Bettstattseite nieder. Alberich ist bleich und schwach. Schweiß perlt auf der Stirn; der Mann sieht fürchterlich aus. Der rechte Unterarm ist dick einbandagiert. Es stinkt nach Kot im Raum. Aglaia reicht der Herrin ein Becken mit kaltem Wasser und ein Leinentuch, um den Schweiß von der Stirn abzutupfen.
»Du weißt, ich bin kein Weichei, Marozia, aber mein Arm tut fürchterlich weh«, sagt er mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Ich halte es kaum aus. Dieser verdammte Mönch ist kein Doktor. Der verruchte Scharlatan weiß nichts Besseres, als mich mit Aderlass zu schwächen und Pferdemist auf die Wunde zu schmieren. – Verdammt! Zum Teufel noch mal!«
»Du solltest vielleicht beten und weniger fluchen«, mahnt Marozia den Gatten. Sie nässt das Leinentuch und legt es Alberich auf die Stirn.
»Oh, das tut gut!«, munkelt er und schließt entspannt die Augen. »Du bist mir ein gutes Weib, Marozia.«
»Ich tue, was ich kann, mein werter Herr Gemahl. Ich bin ja dafür da«, sagt sie, wegen des Gesundheitszustands besorgt, der sich seit dem Morgen erheblich verschlechtert hat.
»Sage, Weib, ich hörte unlängst Pferdehufe im Innenhof der Feste«, lenkt Alberich das Gespräch unerwartet in eine andere Richtung. »Ist mein Schwiegervater mit Soldaten ausgerückt? Herrscht Aufruhr in der Stadt wegen der Papstkrönung, die dem Plebs ungenehm ist?«
Marozia verneint. Sie klärt ihn über den Marschbefehl auf, den Theophylakt von König Berengar von Italien erhalten hat.
»Gott verdamme das verfluchte Sarazenenpack in den tiefsten Höllenschlund!«, speit Alberich hasserfüllt heraus. Eine Schmerzwelle fährt vom Arm durch seinen Körper. Die Zähne knirschen. Das Gesicht ist verzerrt.
»Vielleicht nehmen wir diesen schrecklich stinkenden Dungwickel ab«, meint Marozia tröstend. »Er ist nicht gut für dich.«
Ein alter, blutverkrusteter Schwerthieb klafft am Unterarm. Der Mist dampft; er ist noch frisch. Marozia entfernt ihn mit Fingerspitzen. Ekliger Eiter quillt aus der Wunde hervor.
»Wenn ich den Herrschaften einen Vorschlag machen dürfte?«
»Sprich, Aglaia!«, kommt Alberich seiner Frau zuvor, ohne die Augen zu öffnen.
»Eure edle Frau Gemahlin hat vorgeschlagen, eine Kräuterfrau kommen zu lassen, um eure entzündete Kriegsverletzung und das Fieber zu behandeln. Was haltet Ihr davon?«
Graf Alberich horcht auf.
»In Byzanz und im orientalischen Pergamon behandeln die Doctores akutes Fieber einstweilen mit Essig an den Hand- und Fußgelenken, auf der Stirn und im Nacken. Bei sehr hohem Fieber legen sie Essigtücher auf Brust und Rücken, um den Körper zu kühlen, bis die Arzneien wirken«, ergänzt Aglaia wissend. »Sie verwenden eine gemahlene Baumrinde. Die Apotheker nennen sie Chinin. Es senke das Fieber auch bei Malaria.«
Gespannte Stille herrscht im Raum. Ein guter Vorschlag. Eine echte Alternative.
»Gebe Aglaia eine Münze und lass sie tun, was sie gesagt hat«, meint Graf Alberich von Spoleto gequält zu seiner Gattin. »Man mache mir Essigwickel. Ein Kräuterweib mag kommen. Ich lasse den Scharlatan von Mönch hinrichten, wenn er mir einen neuen Dungwickel verpasst!«
Eine Schmerzwelle fährt durch Alberichs Körper, die ihn zittern und die Zähne knirschen lässt. - -
Kaiser Konstantin der Große ließ im 4. Jahrhundert gleichzeitig neben der Lateranbasilika einen Palast für den Bischof von Rom errichten. Dieser war lediglich der »Primus inter Pares« der zahlreichen Bischöfe im Römischen Kaiserreich und noch kein Papst. Der Erste, der sich historisch verbürgt Papst und Bischof von Rom nannte, war Gregor I., der Große (590–604). Der Lateran war fortan der Hauptsitz der Päpste, die Zentrale der katholischen Kirche, bis 1309 Seine Heiligkeit nach Avignon umzog. Nach der Rückkehr 1377 nahm Papst Gregor XI. (1370–1378) Sitz im Vatikan. Der konstantinische Lateranspalast wurde abgerissen und erst 1586, auf Betreiben von Papst Sixtus V. (1585–1590), neu aufgebaut, wie er sich heute als päpstliche Residenz präsentiert.
Kaiser Konstantin ließ neben der Basilika und dem Lateranspalast ebenfalls ein Paptisterium errichten. Es wurde allerdings in runder Form gebaut. Der Römer Bischof Sixtus III. (432–440) baute das christliche Taufgebäude achteckig um. Die Architekten haben diese Grundform für das Paptisterium in Florenz übernommen.
Der Lateran ist im 10. Jahrhundert ein Konglomerat verschiedener Gebäude. Es gibt Wohn- und Repräsentationsbauten für geistliche und weltliche Gäste und päpstliche Empfänge, mehrere Kapellen und Speisesäle, sogenannte Triclinen, sogar ein Kloster mit Skriptorien und ein Kreuzgang. Der heutige Kreuzgang ist einer der schönsten seiner Art. Vassaletto versah ihn 1215 mit den prächtig gedrehten Arkadensäulen.
Der Papst, die Kardinäle, Bischöfe und der niedrige Klerus wohnen streng hierarchisch getrennt in verschiedenen Gebäuden. Ein Heer von Bediensteten hält den kirchlichen Alltagsbetrieb am Laufen. Weit über die Hälfte ist weiblich, zum moralischen Argwohn des Volkes. Die päpstliche Armee sorgt für die Sicherheit des Laterans und seiner geistlichen Bewohner. Sie untersteht dem Kommando eines Generalhauptmanns. Papst Johannes (X.) ersetzte den Günstling seines Vorgängers Lando sofort nach Amtsantritt durch Marozias Bruder, Graf Adalbert von Tusculum, einen kaum zwanzigjährigen Nepoten (die Schweizer Garde wird erst 600 Jahre später (1506) durch Papst Julius II. gegründet). Die Soldaten und Offiziere leben mit ihren Familien in Kasernen etwas außerhalb des Laterans. Dieser bildet einen eigenen Gebäudekomplex, überragt von der Petersbasilika Konstantins des Großen.
Die päpstliche Krönung gibt Johannes X. jeden Grund, am Abend ein rauschendes Bankett für seinen Hofstaat zu geben. Da geht es sehr weltlich zu. Kirchliche Amtsträger jeden Ranges feiern in der Gesellschaft von edlen Damen und zwielichtigen Frauen. Die Römer nennen Letztere verächtlich Huren. Die Geistlichkeiten bezeichnen sie als Mätressen, Konkubinen und Kurtisanen. Der niedrige Klerus darf heiraten (bis zum Konzil von Trient 1545). Der letzte Mönch hat sein Freudenmädchen. Sie dürfen das Kloster verlassen und Weinstuben und Bordelle besuchen, was die Kirche zähneknirschend duldet. Die Nonnen müssen zeitlebens keusch als Bräute Christi in den Klöstern bleiben.
Es wird musiziert, parliert, getanzt, gegessen. Die holden Weiblichkeiten sind leicht bekleidet. Einige tanzen auf den Tischen zwischen brennenden Kandelabern und den reichlich aufgetragenen Speisen. Sie reiben sich im Rhythmus der Musik gegenseitig das Möschen an den Oberschenkeln. Lautes Geschwätz herrscht im Raum. Obszönes Lachen. Man schmust, langt an die Brüste und die Lenden. Becher mit funkelndem Wein prosten lautlos aneinander. Halbnackte Dienerinnen kriechen auf dem Boden herum. Sie sammeln mit dem Mund ausgestreute Kastanien auf. Ein Kardinal reitet auf dem Rücken eines Mädchens und treibt es grölend an, während er die Brüste massiert. Schöne Sklavinnen stülpen die Lippen über die Eichel der Männlichkeit hinter und unter den Bänken oder kopulieren gleich mit den Geistlichkeiten drauflos. Die klerikale Moral ist niedrig, der Geschlechtstrieb groß, die Prostitution grassierend und einträglich. Moralapostel schreien »Skandal!«, was da im Lateranspalast an Fressgelagen und sexueller Ausschweifung passiert. Jeder in der Stadt weiß Bescheid. Es wird unter dem neuen Pontifikat des X. Johannes nicht anders sein als unter seinen Amtsvorgängern Lando, Anastasius III. und Sergius III. Nur Sergius starb eines natürlichen Todes. Die beiden anderen wurden auf Theodoras und Marozias Befehl meuchelgemordet, weil sie politisch untragbar waren.
Johannes, jetzt Papst und Bischof von Rom, klatscht in die Hände. Diener stellen flink die Kandelaber vom Banketttisch auf den Boden. Das Orchester spielt auf päpstlichen Fingerzeig lautstark auf. Köche tragen Sänften herein. Sie stellen sie ins Licht der Kerzenständer. Splitternackte Mädchen liegen mit gespreizten Beinen auf dem Rücken. Die schönen Körper sind dicht bepackt mit Früchten, Melonenschnitten, Beeren, Kuchen und allerlei köstlichen Süßigkeiten, besonders an den erotischen Stellen. Das Dessert wird aufgetragen. Die Festgäste spenden stürmisch Beifall. Um sich zu bedienen, muss man auf den Boden knien und sich über die Mädchen beugen. Die Hände dürfen nicht benutzt werden. Man muss die Häppchen mit dem Mund aufnehmen. Natürlich dürfen sich auch die weiblichen Gäste an den Leckereien der Mädchentafel erfreuen. Danach werden die Mädchen, die zu den schönsten Roms gehören, erotisch tanzen, und der Erste, der mit einem kopuliert, erhält dieses als Preis zur Sklavin geschenkt.
Beifallssturm.
»Kann uns der Heilige Vater denn verraten, wie wir Weiber mit einem Weib kopulieren sollen? Geben uns die Diener einen Doppeldildo?«, ruft eine Frauenstimme provozierend aus der bunten Gästeschar. Kreischendes Lachen. Zahlreiche weltliche Adelsleute sind auf dem Fressbankett anwesend. Die meisten sind betrunken.
»Lasset doch das nächste Mal keusche Jünglinge als Desserttafel auftreten, von denen die edlen Damen naschen und dann mit ihnen kopulieren können«, meint Adalbert von Tusculum zur Güte. Er ist der neu ernannte Generalhauptmann der päpstlichen Armee, Sohn des mächtigen Grafen Theophylakt und Marozias zwei Jahre jüngerer Bruder, der verlängerte Arm der Machthaber in Rom.
Die Frauen, ob adlig oder Dirne, stimmen begeistert zu. Ein perfekter Vorschlag.
»Es ist Sünde, wenn zwei Weiber kopulieren!«, schreit ein besoffener Mönch mit beachtlichem Bauchumfang vornübergebeugt, den leeren Becher schwingend. Ein tiefer Rülpser entfährt der Kehle. Mit der linken Hand hält er die Kutte hinten hoch. Ein Saufkumpan hält eine Fackel an sein nacktes Hinterteil. Ein lauter Furz ertönt. Eine Stichflamme faucht kurz hoch. Der Mönch steht kerzengerade da und reibt die angesengten Backen des Allerwertesten.
Kreischendes Grölen, obszönes Lachen erfüllt das Gewölbe des Bankettsaals. Der Papst schreitet im losen Gewand über den gedeckten Tisch. Der päpstliche Pantoffel räumt ein paar Speiseplatten und Karaffen aus dem Weg, dass es scheppert. Perlender Wein fließt über den Boden.
»Ja hätte die Sünde denn sonst einen Reiz, mein lieber Mönch und Beichtvater? Habt ihr vergessen, meine Freunde, meine lieben Freunde: Gott erschuf die Sünde, damit wir Seine Gnade erfahren können«, verkündet’s Johannes frohgemut der festlichen Runde.
Die Gäste klatschen stürmisch Beifall. Wenn ein Papst das sagt, dann ist das so! Widerworte sind gefährlich, selbst wenn man sie im Weinrausch sagt.
Johannes gibt die Mädchentafel für das Dessert frei. Wüstes Geschmatze und Geschlürfe auf nackter Haut. Der Leibdiener tritt auf Johannes zu und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der Papst verzieht das Gesicht.
»Was wollen sie denn von mir?!«, munkelt er gestört. »Ich habe jetzt keine Zeit.«
»Bitte untertänigst um Vergebung, Heiliger Vater«, erwidert der Diener demütig. »Vielleicht habt Ihr’s vergessen? Ihr habt die Obrigkeiten zum Krönungsbankett eingeladen. Jetzt sind sie da und erwarten Eure Heiligkeit.«
»Beim Dyonisos! Das ist wahr«, erinnert sich Johannes gestresst.
»Zuerst auf ein Wort mit den Herrschaften, Heiliger Vater.«
Johannes verdreht die Augen. Gerade jetzt, da die schönen Mädchen mit leckeren Süßigkeiten auf nackter Haut aufwarten!
»Mein Cape!«, ertönt der Befehl. Der Leibdiener hat dieses bereits mitgebracht. Er legt es dem Papst über die Schultern und schließt die goldene Schnalle vor der Brust. Johannes drückt ihm den Becher in die Hand, dass der Wein über den Rand schwappt. Zügigen Schrittes verlässt er den Bankettsaal. Der Mann kann trotz Alkoholeinfluss aufrecht und gerade gehen.
Zwei Gardisten begleiten den Pontifex. Sie betreten den Empfangsraum. Johannes breitet die Arme aus und geht entschlossenen Schrittes auf die Neuankömmlinge zu.
»Willkommen, meine Damen! Willkommen! Ich habe Euch erwartet! Ihr hattet gewiss wichtige Geschäfte zu erledigen, dass Ihr nicht früher kommen konntet. Das Bankett ist bereits im vollen Gange«, sagt er heiter mit überschwänglicher Höflichkeit, gespielter Freude und Herzlichkeit.