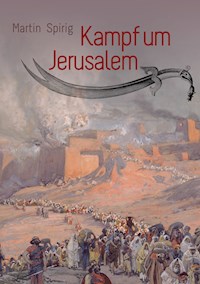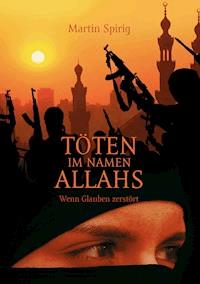Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Frankreich 1656 auf historischen Hintergrund: Eine harmlose Wette um die Jungfräulichkeit eines jungen Mädchens bis zum Vollzug der Hochzeitsnacht läuft aus dem Ruder. Auf der einen Seite Täuschung, Arglist, Betrug, Intrige und Gewalt, auf der anderen Seite Leidenschaft, Erotik, Koketterie und Sex. Bei weiblichen Reizen rutscht der männliche Verstand oft rasch unter die Gürtellinie, und die Frau weiss, ihre naturgegebene Waffe für ihre Zwecke wirksam einzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Koketterie: Eine Kunst? – Vergnügliches Spiel mit weiblichen Reizen? – Verführung? – Eiskalte Berechnung?
Im späteren Barock entwickelte sich sogar eine Fächersprache. Eine Dame signalisierte beim Flirten dem Gegenüber ihren Gemütszustand und ihre Absicht.
Inhaltsverzeichnis
Das Hugenottenkreuz
Der historische Hintergrund
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Anhang
Das Hugenottenkreuz
Das weltweit verbreitete Hugenottenkreuz ist besonders in Frankreich zu einem Erkennungszeichen der reformierten Christen geworden. Das Kreuz geht zurück auf den Orden St. Esprit – den Orden vom Heiligen Geist. Es gründet auf dem mittelalterlichen Malteserkreuz. König Heinrich III. von Frankreich stiftete den Orden 1578. Im Unterschied zu diesem Orden, der die Taube im Zentrum des Kreuzes zeigt, hat das Hugenottenkreuz eine herabhängende Taube als Sinnbild für den Heiligen Geist. An der Stelle der Taube kann ein Tropfen hängen, Sinnbild einer Träne, als Zeichen der Leiden der verfolgten Kirche oder eine kleine Keule, die für den Glaubenskampf steht. Zwischen den Kreuzesarmen prangt die königliche Lilie, das Wappen der Bourbonen. Sie ist Ausdruck der Königstreue der Hugenotten. Die acht kleinen Kugeln oder Kreise an den Enden der Kreuzesarme symbolisieren die Seligpreisung der Bergpredigt.
Seit 1560 ist Hugenotte die gebräuchliche Bezeichnung für die französischen Protestanten. Der Name wird in der Regel vom deutschen Wort `Eidgenosse` (eiguenot) abgeleitet. Die 1520 im französischen Genf entstandene Bezeichnung gilt den Bundesgenossen der dortigen Calvinisten. Die Eidgenossen in Bern und Zürich unterstützen die Reformation in der Stadt am Genfer See im Kampf um die Freiheit von Savoyen.
In Frankreich werden die Anhänger von Jean Calvin als Hugenotten verunglimpft, erstmals 1551 als Schimpfwort in Schriften nachgewiesen. Der Begriff Hugenotten setzt sich in Frankreich nach 1560 als Bezeichnung für die Protestanten durch. In der Zeit der Hugenottenkriege verliert das Schmähwort seine negative Bedeutung und wird zu einer ehrenvollen Bezeichnung.
Der historische Hintergrund
Es ist das Jahr 1656. Das Dörfchen Montmédy liegt im Grenzgebiet der spanisch-habsburgischen Niederlande, dem Herzogtum Luxemburg und dem Königreich Frankreich. Lehnsherr der Grafen von Chiny de Montmédy ist der Herzog von Luxemburg, der seinerseits dem römisch-deutschen Kaiser Ferdinand III. lehnsrechtlich verpflichtet ist, aber unter starker Abhängigkeit der holländischen Habsburger steht. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. führt gegen die spanischen Habsburger einen heftigen Krieg. Seine Majestät fühlt sich wegen der habsburgischen Einkreisung seines Reiches höchst bedroht: das Königreich Spanien südlich des Pyrenäen-Gebirges und die spanischen Niederlande, die ihm wie ein Krebsgeschwür in der Nordostflanke sitzen.
Im Innern Frankreichs tobt seit 1648 ein erbitterter Kampf gegen die `Fronde`, die sich mit Waffengewalt gegen die Entmachtung des Adels und des Parlaments wehrt: Louis XIV. strebt die absolute Alleinherrschaft an! Der erste Minister, Kardinal Mazarin, ebnet seinem König mit einer schonungslosen Politik den Weg dorthin.
Dann sind da die lästigen Hugenotten – die calvinistischen Protestanten – im Königreich und unter ihnen eine Minderheit, die der lutherischen Lehre anhängen. Acht blutige Hugenottenkriege stürzen Frankreich zwischen 1562-1598 ins Elend. Der französische König Heinrich IV. (Navarra) kann 1598 durch das Edikt von Nantes den blutigen Konflikt der unversöhnlichen Parteien beilegen. Den Hugenotten werden mit wenigen Ausnahmen die gleichen Rechte wie den Katholiken zugesichert. Heinrich vollzieht seinen demonstrativen Übertritt zum Katholizismus bereits 1593; Zitat: `Paris ist eine Messe wert`, Zitat Ende.
Der vom Sonnenkönig angestrebte Absolutismus weicht diese Zugeständnisse im Edikt von Nantes an die Hugenotten seit seiner Thronbesteigung 1643 zunehmend auf, die bereits unter seinem Vater Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu de Plessis eingeleitet wurden: Religionsfreiheit und königlicher Absolutismus sind unvereinbar! Der im Westfälischen Frieden von 1648 (nach Beendigung des grausigen 30jährigen Krieges, der acht Millionen Tote kostet und weite Teile Deutschlands verwüstet) formulierte Beschluss, wonach der Fürst die Konfession seines Landes bestimmen kann, nimmt Louis XIV. auch für sein Reich in Anspruch. Die sich stetig ausweitenden Einschränkungen der religiösen Freiheiten der Hugenotten sind schmerzlich spürbar: die Zahl der Verbote für Berufe, die Gottesdienste, das öffentliche Wirken (Ämterzugang) und im Familienrecht. Dann sind die zunehmenden Dragonaden, die Einquartierung von katholischen Dragonern als gestiefelte königliche Missionare in den Häusern von bekehrungsunwilligen Protestanten unerträglich geworden. Ziel von Kardinal Mazarin und des Sonnenkönigs ist die Abschaffung sämtlicher Rechte der hugenottischen Minderheiten im Land und ihre Rekatholisierung. Die Devise lautet: `une foi – une loi – un roi (ein Glauben – ein Gesetz – ein König). Diese Politik wird im Edikt von Fontainbleau am 18. Oktober 1685 den Höhepunkt erreichen. – –
Das Dorf Montmédy-Médybas besitzt im Jahr 1656 kaum vierhundert Steuer zahlende Einwohner. Es sind vorzüglich in Familienbetrieben arbeitende Handwerker. Der ländliche Flecken teilt sich in die Unterstadt (Médybas) im Tal unten und in eine Oberstadt (Montmédy), die von einer Bergfestung umringt ist. Hier befinden sich fünf Kasernen für insgesamt acht Hundert Mann, zwei Pulvermagazine und das Arsenal. Es gibt eine Kirche und ein paar Gebäude für den gräflichen Hofstaat und die Bediensteten, standesgemäss voneinander getrennt. Der Palast ist der Regierungssitz des Grafen von Chiny-Montmédy. Er besitzt ein eigenes Verteidigungswerk für den Fall einer feindlichen Eroberung der Oberstadt. Die Burganlage ist von der Unterstadt autark und kann eine mehrwöchige Belagerung unbeschadet überstehen. Es gibt Vorratshäuser und zwei Zisternen, die den Wasserbedarf der Garnison und der Burgsassen sicherstellen. Die vorhandene Festungsmauer weist zahlreiche Vorsprünge auf, die jeden toten Winkel abdecken. An heiklen Stellen sitzen Maschikulis, das sind erkerartig vorspringende Schüttlöcher, durch die kochendes Öl und Pech auf einen allfälligen Angreifer gegossen werden. Der Bergkegel fällt auf drei Seiten hin steil ab. Er steht mit einem strategisch wichtigen Hügelrücken in Verbindung, der beim Dorfweiler Thonelle die grösste Breite und Erhebung über der Talsohle des Flüsschens Chiers erreicht, das hier mehrere Gebirgsbäche aufnimmt. Die Festung ist von dicht bewaldeten Hügelzügen umgeben. Sie sind für schweres Kriegsgerät nahezu unzugänglich, um der Burganlage gefährlich zu werden. Die landschaftlichen Profilverhältnisse und die Lage der Feste auf dem 80 Meter hohen felsigen Berg machen ihre Stärke aus; sie schützen sie vor jeder gewaltsamen Unternehmung.
Ganz anders ist es bei der Unterstadt: Médybas ist von einer Mauer umgeben. Sie ist aber bis auf einen kleinen Teil freistehend und kann leicht in Bresche gelegt werden. Das Lazarett und eine Kavallerie-Kaserne mit Stallungen für 100 Mann und Pferde sind nur wenig stark befestigt. Der Stadtwall bietet einem entschlossenen Feind kaum grossen Widerstand. Er kann höchstens Pferdediebe und Banditen aufhalten.
Graf Arnauld III. von Chiny errichtet 1221 die erste Burg in Montmédy. Kaiser Karl V. baut die ursprüngliche Anlage 1545 zur Festung aus. Montmédy ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier kreuzen sich die Handelswege von Paris in das von den spanischen Niederlanden dominierte Herzogtum Luxemburg und von Sedan nach Metz. Graf Arnauld V. von Chiny-Montmédy ist befugt, auf die Handelswaren einen Wegzoll zu erheben, den er allerdings zu 85% an seinen Lehnsherrn, den Herzog von Luxemburg, abführen muss. Trotzdem, der landesherrliche Graf hat aus den restlichen 15% und von den Steuereinnahmen seiner Untertanen einen beachtlichen Reichtum erwirtschaftet. Das erlaubt ihm, im nahen Fresnois seinem Lehnsgut einen kleinen Barockpalast hinzu zu fügen. Es ist ein Lustschlösschen ganz zum Vergnügen der gräflichen Familie. Es gibt keine Befestigungen, dafür einen gepflegten Garten zum Lustwandeln. In der Mitte, wo sich die gekiesten Wege zwischen geschnittenen Platanen, Sträuchern und geschwungenen Hecken kreuzen, sprudelt der imposante Apollo-Brunnen. Ein der Venus geweihtes Marmortempelchen gilt der Verehrung der weiblichen Schönheit, Eleganz und Grazie, ein geeigneter Ort für Kaffeekränzchen.
Da hat sich Graf Arnauld, der V. dieses Namens, vielleicht ein wenig bei den Kosten übernommen. Ein tiefes Loch klafft in der gräflichen Schatulle. Zudem werden einige Rechnungen der Bauleute, Landschaftsgärtner und Bildhauer zur Begleichung fällig, wie es der Gutsverwalter Auguste Cattin der durchlauchten Gräfin Marie-Louise Chiny de Montmédy (geborene Guébriant) untertänigst eröffnet. Marie-Louise ist eine hoch elegante Dame Mitte vierzig, die viel auf die höfische Etikette gibt und sehr stolz auf ihren Vater ist, der im Dreissigjährigen Krieg als Feldherr beachtliche militärische Erfolge unter der französischen Kriegsstandarte verzeichnete.
„Dann erhöhen wir halt die Steuern!“, sagt die Gräfin spontan.
Auguste Cattin räuspert sich verlegen, denn direkter Widerspruch wird nicht geduldet.
„Verzeiht, Durchlauchte“, erwidert er. „Glaubt Ihr, es wäre im Sinne Eures Gatten, der die Untertanen nie übermässig mit Steuern belegt hat? – Eine Steuererhöhung könnte grosse Unzufriedenheit auslösen – gar eine Revolte! Vor allem bei den Bauern!“
Die Gräfin überlegt.
„Dann erhöhen wir die Steuern für die Hugenotten“, meint sie im Tonfall sanfter. Die Feststellung tönt eher als wäre sie eine Frage.
„Die Hugenotten, die unter uns leben, zahlen ohne zu murren ihre Steuern vollständig und zeitgerecht ganz im Gegensatz zu einigen Handwerkern, Durchlauchteste. Graf Arnauld sagt, dass die Hugenotten als gleichwertige Bürger behandelt werden sollen. Es ist eine gute Politik, die Frieden schafft und das Volk ruhig hält.“
„Dann schickt einen Gesandten zum Herzog nach Luxemburg, Cattin!“, empfiehlt die Gräfin etwas ungehalten. „Unser Begehr sei, den Wegzoll um ein paar Prozent zu senken, bis wir unsere Bauschuld beglichen haben – oder er soll uns ein Darlehen gewähren…“
„Bei allem untertänigen Respekt, wenn ich Euch unterbreche, hochehrwürdige Gräfin“, sagt Auguste und neigt kurz das Haupt. „Das wird der Herzog kaum tun! Kaum tun können! Weil er seinerseits bei den spanischen Habsburgern in der Pflicht steht, die seine Ländereien besetzt halten – und ausserdem sitzt ihm der römisch-deutsche Kaiser mit Forderungen im Nacken…“
Jetzt ist Marie-Louise verärgert. Sie stösst den Stuhl brüsk zurück und steht auf.
„Dann besprecht die Angelegenheit mit meinem Herrn Gemahl, wenn er vom Kriegsdienst heimkehrt – nicht mit mir, Monsieur Cattin! Ich habe jetzt keine Zeit!“, sagt sie unwirsch. „Und glaubt ja nicht, ich sage die heutigen Festlichkeiten meiner Konzertgäste aus Kostengründen ab! Das ist unmöglich. Ich würde das Gesicht verlieren!“
Frau Gräfin rafft die Röcke und geht. Die Absätze klappern auf dem Parkett. Zwei Domestiken ziehen die Türflügel hinter ihr zu.
Die Frage über eine Kürzung der Apanagen – die Jahresbezüge des Adels – erübrigt sich; es wäre sinnlos gewesen. Der Adel schaut in erster Linie auf seine Privilegien. Er arbeitet nicht wie das gemeine Volk. Er verwaltet. Er befiehlt und zahlt keine Steuern. Er entscheidet in allen politischen, wirtschaftlichen und schweren strafrechtlichen Angelegenheiten auf seinem Hoheitsgebiet nach den geltenden Gesetzen, manchmal launisch, selbstherrlich, tyrannisch und setzt willkürlich untergebene Amtsträger ein und ab. Er widmet sich vorzüglich dem Vergnügen, den Festlichkeiten und der Jagd. Die Männer üben das Waffenhandwerk für die Selbstverteidigung und den Kriegsdienst; sie müssen jederzeit bereit sein, wenn der Herr sie einberuft.
Die Edeldamen beschäftigen sich ausschliesslich mit den neusten Modetrends, den Kakao- und Kaffeekränzchen und legen ihre Intrigennetzchen aus. Sie spielen Karten, Schach, vergnügt Verstecken, Blinde Kuh, Tennis oder mit einem Ball und halten Picknicke ab, lachen herzlich und vertrauensvoll, tun aber alles, eine lästige Konkurrentin aus irgendwelchen Gründen zu desavouieren und loszuwerden. Heuchelei, Neid, Eifersucht und das Streben nach Beachtung sind unheilvolle Charakterzüge. Der weibliche Reiz ist die schärfste Waffe. Spielerisches Flirten und berechnendes Kokettieren irritiert das Mannsvolk mächtig. Es lässt das Blut in den Adern kräuseln und geheime Absichten realisieren. –
Graf Arnauld behandelt seine Untertanen streng und anständig. Er vermeidet das tyrannische Joch, beutet nicht aus und macht zwischen Katholiken und Hugenotten keinen Unterschied. Er hält sich an die altbewährte römische Maxime: Behandle deine Untertanen gut, dann arbeiten sie besser. Er gewährt den Protestanten uneingeschränkt die Freiheiten, die im `Edikt von Nantes` zugestanden werden.
Graf Arnauld V. geniesst im Volk den Ruf eines gerechten Landesherrn. Jeder Untertan – und sei es die geringste Magd oder ein Bauernknecht – darf sein Anliegen in einer einmal im Monat stattfindenden Volksaudienz vortragen und sogar Ideen einbringen. Der Graf hat ein offenes Ohr. Er tut das nicht ganz uneigennützig. Er erspürt so den Puls der Menschen und erfährt von deren Sorgen, Ängsten, Nöten und den Ungerechtigkeiten des Alltags, bevor eine gefährliche Unzufriedenheit in eine Revolte ausartet, die seine Soldaten blutig niederschlagen müssten. Diese erfahren schwere Strafen, wenn sie sich besaufen, den Leuten unanständig begegnen oder weit schlimmer, ein Weib vergewaltigen, und sei es die niedrigste Maid! Die Schwänze müssen in den Hosen bleiben! Deshalb duldet der Landesherr Wanderhuren in seiner Grafschaft. Diese dürfen die Verrichtungszelte allerdings nie innerhalb eines Stadtwalls errichten; die `Hübschnerinnen` bieten ihre Liebesdienste vor den Toren eines Städtchens an, um Konflikte mit der weiblichen Bevölkerung und den Moralisten zu vermeiden und sehr zum Argwohn der beiden Kirchen, die die Hurengesellschaft zähneknirschend dulden. Insgeheim nehmen nämlich die, die am lautesten schreien und die Nutten verfluchen, ihre Liebesdienste in Anspruch, ebenso Mönche, Priester, Inquisitoren, nicht zuletzt streng moralische Familienväter – und natürlich die Soldaten.
So wird der männliche Geschlechtstrieb in kontrollierte Bahnen gelenkt. Anderseits riskiert jede Frau, vergewaltigt zu werden, wenn sie sich ohne Begleitung vor allem nachts auf der Gasse zeigt. Der Bürgermeister darf die Wanderhuren jederzeit per Dekret und soldatischer Gewalt wegweisen, wenn sie zum Ärgernis werden oder sich weigern. Das kommt jedoch recht selten vor. Die verachteten Wanderhuren müssen nämlich für ihren Standplatz eine Gebühr entrichten, die dem Stadtsäckel zugutekommt. So macht man mit der Moral hinten rum Geschäfte. Bischöfe und Adlige halten sich Mätressen, Kurtisanen und Konkubinen zum erotischen Vergnügen auf ungleich höherem Niveau.
Der Graf ernennt den Bürgermeister, den die Dorfbewohner vorschlagen dürfen. Dieser schlichtet Streitigkeiten. Der Stadtrat hält die Gemeinde am Laufen. Ein ebenfalls vom Grafen (ohne Vorschlagsrecht) ins Amt bestalltes Richterkollegium – zumeist eines, das dem Landesherrn anhängt – spricht bei Verfehlungen, Vergehen und kleineren Verbrechen im Namen des Grafen und der geltenden Gesetze Strafen aus. Der Graf behält sich Landstreitigkeiten, politische Entscheide und die Bestrafung von schweren Verbrechen vor; er spricht das letzte Wort, das auch ein Todesurteil sein kann und nicht anfechtbar ist, es sei denn, der Beklagte besitzt den Mut (und das Geld), seinen Fall vor das herzogliche Gericht in Luxemburg zu ziehen.
Bei Abwesenheit des Grafen Chiny de Montmédy ist seine Gattin für die Angelegenheiten der Grafschaft zuständig, assistiert vom gräflichen Gutsverwalter-Gouverneur Auguste Cattin. Er besitzt keinen Adelstitel und ist ein Mann des Volkes, der jedoch das vollste Vertrauen des Landesherrn geniesst. Ohne das Einverständnis der Gräfin kann und darf er keine Entscheidungen treffen, die ausserhalb seinen Kompetenzen liegen. Die angesagten Festivitäten geniessen bei der hohen Dame im Augenblick die höhere Priorität als dumpfe Amtsgeschäfte und lästige Schuldentilgungsfragen.
Marie-Louise gibt viel auf die höfische Etikette, Kleidung und das Benehmen. Die Hierarchien sind klar strukturiert und gottgegeben. Sie ist zweifellos die Herrin des Hauses. Sie agiert bei Abwesenheit des Herrn Gemahls als gestrenge Landesmutter, die nicht gibt, sondern gewährt. Die Untertanen respektieren sie, weil sie sie fürchten. Den Graf Arnauld verehren sie, weil sie ihn mögen. –
„Jetzt hör` endlich mit dem Gezappel auf!“, befiehlt die Gräfin unwirsch ihrer Tochter und zieht die Miederbänder straff an. „Du brauchst nicht nervös zu sein!“
„Ich bin nicht nervös, Mama. Ich kriege nur fast keine Luft, Mama“, erwidert die 15jährige. „Ihr schnürt mich ein, als möchtet Ihr mir die Rippen brechen! Wie kann ich spielen, wenn ich bewusstlos vom Hocker falle, weil ich nicht richtig atmen kann?“
„Schönheit muss leiden, Mädchen!“, lautet die Antwort lakonisch. „Alle Weiber müssen leiden, wenn sie den Mannsbildern gefallen wollen! Und heute, mein liebes, musst du bei deinem Auftritt ganz besonders schön sein! – Jetzt schweig und halt still!“
Es ist in der Barockzeit üblich, dass die Kinder zeitlebens ihre Eltern siezen, aus Respekt und um sie zu ehren. Es war eine Gepflogenheit, die in Frankreich bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts in oberen Gesellschaftskreisen üblich war (Maman, vous – nicht Maman, tu).
Henriette Adéline Chiny de Montmédy ist ein strahlend schöner Familienspross, ein begehrenswertes, junges Mädchen, das gerade zur Frau geworden ist. Sie steht auf einem Schemel vor einem ovalen hohen Spiegel, damit Mama auf Augenhöhe das Mieder verbandeln kann und die beiden Zofen den Saum des Kleides auf die richtige Länge nähen können. Der gräfliche Hofschneider ist hoch entzückt über seine neuste Kreation. Er steht da, als müsste er für ein Gemälde posieren, denn das verlangt die Etikette in Anwesenheit der durchlauchten Gräfin. Der aufgeputzte Mann mit Schminke und Perücke streicht immer wieder durch die Röcke Henriettes, damit sie richtig fallen und aus Bewunderung, nicht nur für das Mädchen, sondern für das perfekt sitzende Kleid aus seiner Schneiderei.
„Wahrlich: Ihr seht wie eine richtige Prinzessin aus, Mademoiselle Henriette! – Wenn Ihr mir ehrwürdiger Weise gestattet, das feststellen zu dürfen“, schnurrt er wie ein geiler Kater.
„Nanana, nur nicht übertreiben, mein lieber Carouche!“, dämpft Gräfin Marie-Louise die Begeisterung. „Mein Geblüt glaubt sonst, sie wäre eine! Und das wollen wir doch nicht!“
Henriette Adéline verdankt das Kompliment mit einem flüchtigen Lächeln. Mama kann es nicht sehen, weil sie gerade die Rocksäume kontrolliert. Schneidermeister Blaise Carouche hat verstanden: Das Kleid gefällt, und Mama ist manchmal unausstehlich! Ein Lächeln der Tochter des Hauses tut seiner Seele gut.
„Diesen Faden da: abschneiden! Macht schon!“
Die Zofe – sie heisst Sophie – tut hurtig, wie geheissen.
Ein Domestike betritt den Ankleideraum. Er verneigt sich nach höfischer Sitte.
„Durchlauchteste! Ein Vorauskurier meldet, die hohe Herrschaft trifft in wenigen Minuten ein, die Ihr zu melden wünschtet.“
Marie-Louise würdigt den Diener keines Blickes.
„Werdet nun endlich mit dem Kleid fertig! Achtet auf die Accessoires! Dass sie richtig platziert sind! Schuhe, Schmuck und Perücke, wie besprochen! Pudert das Gesicht ab, schminkt die Lippen und vergesst den Schönheitsfleck auf der linken Wange nicht! Dann tut, wie geheissen!“, lautet der Befehl an die beiden Dienerinnen.
Sie machen den ergebenen Zofenknicks. Die Gräfin rafft den Rock und schreitet auf klappernden Absätzen in den Korridor hinaus. Schneidermeister Carouche verharrt in verneigter Pose, bis der Lakaie die Türflügel hinter der Gräfin schliesst und Ihrer Durchlaucht folgt. –
Das barocke Lustschlösschen in Fresnois des Grafen Chiny de Montmédy besitzt einen kleinen, repräsentativen Vorplatz. Er ist gerade weit genug, dass Sechsspänner mühelos wenden können. Der Palast verfügt über keine eigenen Stallungen. Die Pferde, Kutscher und mitgereiste Dienerschaft werden im benachbarten Bauerngehöft versorgt, die Gefährte vor den Stallungen fein säuberlich aufgereiht, bis die Obrigkeiten geruhen, sie abzurufen.
Die Kutschen der Adelsgäste fahren in unterschiedlichen Zeitabständen vor. Nicht alle Geladenen sind bis jetzt eingetroffen. Domestiken öffnen die Türen und sind den Edeldamen behilflich, über das ausgeklappte, schmale Treppchen zu balancieren. Das ist auf hohen Absätzen und in rauschenden Kleidern nicht ganz einfach. Leicht stolpert sich`s. Dann wehe dem Lakaien!
Die sechsspännige Kutsche ist ein besonders Gefährt. Es ist verziert. Truhen sind auf dem Dach festgezurrt. Zwei Domestiken stehen am Heck auf einer Schwelle, und eine berittene Begleiteskorte reitet vor. Eine hochgestellte Persönlichkeit kommt an.
Ein Arm erscheint graziös in der Türöffnung. Der seidene Handschuh reicht über den Ellenbogen. Der Lakaie fasst nach höfischem Etikett die elegant entgegen gestreckte Hand und neigt ergeben das Haupt. Eine strahlende Edeldame von Rang und Stand entsteigt leichtfüssig dem Kutschenkasten, der unter dem verlagerten Gewicht leicht auswippt. Der Diener wird keines Blickes gewürdigt. Er schaut ganz verdutzt. Keine männliche Begleitung? Keine Amüsierdame? Kein Dienstmädchen? Madame reist allein?
Gräfin Marie-Louise empfängt den hohen Gast als Hausherrin, weil der Gatte zurzeit abwesend ist.
„Mireille de Montmirail, liebste Kusine! – Wie freue ich mich, dass du gekommen bist!“, ruft die Gräfin in fast überschwänglicher Höflichkeit. Madame faltet elegant den Fächer in der rechten Hand mit einem Klack. Die Damen herzen. Küsschen links. Küsschen rechts. Fröhliche Begrüssung.
„Lang ist`s her, meine Liebe! Fünf, sechs Jahre? Vielleicht acht? – Es ist schön, dich wieder zu sehen! Komm, lass dich nochmals umarmen. Ich freue mich sehr. Ich konnte deine Einladung unmöglich ausschlagen!“
„Es ist ja auch ein ganz besonderer Anlass, liebe Kusine“, erwidert die Gräfin schmunzelnd.
„Und weiss sie es?“
„Du meinst? …“
„Pssst! Sie ahnt nichts! Es soll ja eine Überraschung werden!“, munkelt Marie-Louise Madame ins Ohr. Mireille macht eine unscheinbare Fingerbewegung über ihren geschwungenen, rot leuchtenden Mund, der zum Küssen gemacht ist.
„Von mir erfährt niemand was! Ich bin schweigsam wie ein Grab.“
Die Edeldamen schlendern freundschaftlich eingehängt zum Eingangsportal des barocken Landsitzes.
„Eine Ehrengarde? Für mich?“
„Wenn du schon mal kommst?“, versichert die Gräfin verschmitzt. Eine kleine heuchlerische Höflichkeit? Die stramme Ehrengarde in tadelloser Paradeuniform steht natürlich für alle geladenen Gäste da.
„Komm, erzähl: Wie war die Reise? Wie geht`s in Paris?“
Die Gefragte atmet kurz aus.
„Ach, lang und beschwerlich! – Paris stinkt, ist schmutzig und überbevölkert. Aber König Ludwig (XIV.) ist es egal. Seit ich verwitwet bin, residiere ich jetzt standesgemäss als Marquise de Montmirail im Louvre.“
Dass Mireille zwischenzeitlich eine begehrte und vermögende Kurtisane ist, verrät sie der lieben Kusine freilich nicht.
„Du warst verheiratet? Das wusste ich nicht!“, stellt Marie-Louise überrascht fest.
„Drei Jahre! Wie die Zeit vergeht? Ein Marquis, der zum königlichen Gardeoberst der Kavallerie abkommandiert wurde! Er ist im Kriegsdienst gegen die Hugenotten gefallen!“
„Tut mir aufrichtig leid.“
„Es braucht dir nicht leid zu tun, meine Gute“, stellt Mireille korrigierend fest. „Mathieu war ein Schlappschwanz. Es war eine Ehe ohne Liebe. Ein goldener Käfig für mich!“
„Und? Hast du Kinder?“
„Er kriegte ihn ja kaum hoch, obwohl ich mir die grösste Mühe gab!“, lächelt Madame säuerlich. „Wie konnte er mir da ein Kind zeugen?“
Madame Marquise atmet befreit ein und aus.
„Ich bestimme als angesehene Kriegswitwe mein Leben selbst! Ich hüte mich, erneut unter die Fuchtel eines Ehegatten zu geraten und mit einem Liebhaber ertappt zu werden – mit allen Konsequenzen!“, fügt sie schelmisch hinzu.
„Und du wohnst jetzt im Palast des Louvre, der Regierungsresidenz des Königs von Frankreich?“, ergänzt die Gräfin entzückt und fast ein bisschen neidisch.
„Och, die Majestät ist oft unterwegs!“, dämpft Madame Marquise die Begeisterung der Kusine. Der versteckte, neidische Unterton ist ihr nicht entgangen. „Der König hat bloss den Krieg im Kopf, die Kunst, Musik, ein paar Weiber und das Jagdschloss in Versailles, das er glanzvoll zum neuen Regierungssitz ausbaut. – Ha, du glaubst nicht, wie anstrengend es ist,“, setzt Mireille de Montmirail nahtlos hinzu, „sich Tag täglich mit speichelleckenden Hofschranzen und gelangweilten, hirnlosen Hofdämchen abzugeben, denen jedes Mittel recht ist, die Gunst des Königs zu ergattern und aufzufallen! Sei froh wohnst du auf dem Land fernab vom heuchlerischen Geschwätz arglistiger Intrigantinnen und eigennützigen Karrierejägern! – Aber lass uns jetzt über Erfreulicheres parlieren, liebe Kusine. Du hast es wirklich schön hier draussen…“
„Unser Anwesen ist zwar klein aber fein“, meint Frau Gräfin stolz. „Wir residieren normalerweise im Burgpalas von Montmédy auf dem Hügel oben“, weist Marie-Louise kurz auf die Bergfestung hin. „Dort sind wir von Verteidigungsanlagen geschützt in diesen unsicheren Zeiten. – Aber komm jetzt, ich zeig dir unser barockes Schmuckstück und stelle dich meiner Tochter vor, bevor es losgeht! Sie wartet im Ankleidezimmer bestimmt ganz ungeduldig.“
Die Marquise rafft das sündhaft teure Kleid und schreitet elegant die drei Stufen zum Palastportal hoch. Mireille ist eine betörend schöne Frau, die die dreissig um vier Jährchen überschritten hat. Ihre graziöse Erscheinung zieht jedes Mannsbild in Bann. Gerade ist sie unverhofft in den Fokus des Sonnenkönigs getreten; Seine Majestät war von ihrer erotischen Ausstrahlung, Eleganz und Grazie höchst angetan. Die Marquise weiss: Wer dem hellen Glanz der Sonne zu nahe kommt, kann leicht verbrennen, sprich – einem schnellen Aufstieg zu Hofe folgt oft rasch der tiefe Fall in die Bedeutungslosigkeit! Solange König Ludwig ihr nichts befiehlt, ist er auch bloss ein Mann, der keinem weiblichen Reiz abgeneigt ist. Mireille beherrscht meisterhaft das Spiel des Kokettierens, der Raffinesse und der Intrige. Bis ins letzte Detail ausgefeilte Manieren und höfisches Benehmen gepaart mit Bildung, Humor und Schlagfertigkeit machen ihr charmantes Frausein unwiderstehlich, was sie trefflich mit der Schönheit ihres Körpers zu kombinieren weiss. In der höfischen Gesellschaft ist das überlebenswichtig, sonst geht man unter. Schnell wird man zum verlachten Mauerblümchen ohne Privilegien.
In der gepflegten Gartenanlage prominieren zahlreiche Adelsgäste in festlichen Gewändern zwischen geschnittenen Bäumchen, Zierbüschen und um den rauschenden Apollo-Brunnen in der Mitte. Zelte wurden aufgestellt, Stühle aufgereiht, im weissen Marmorpavillon ein Orchester eingerichtet. Domestiken versorgen die adligen Herrschaften mit perlendem Wein, Tee, Kakao, Kaffee und köstlichen `Amuses bouches`, das sind mundgerecht zubereitete Süssigkeiten und fruchtige Schnäppchen.
„Da ist ja mein Geblüt!“, ruft die Gräfin überrascht und ein ganz klein wenig verärgert. Henriette Adéline stürmt aufgeputzt und frohgemut gleich einem übermütigen Rehkitz die geschwungene Barocktreppe in den Empfangssaal hinunter.
„Kind, habe ich dir nicht gesagt, du sollst oben bei Monsieur Carouche warten, bis ich dich rufen lasse?“
Das Mädchen ignoriert den verborgenen mütterlichen Tadel und dreht sich tänzerisch im Kreise.
„Ist das Kleid nicht wunderschön, das Monsieur Carouche für mich geschneidert hat, Mama? – Sagt bitteschön, dass es Euch gefällt, Mama, denn mir gefällt es sehr. Ob es den geladenen Herrschaften auch gefallen wird?“
„Das Kleid ist äusserst exquisit, junges Fräulein. Ich bin überzeugt, dass es den geladenen Herrschaften bestimmt gefallen wird“, kommt die Marquise einer weiteren Rüge der Mutter zuvor. „Und wie reizend Ihr aufgeputzt seid? Ihr seid bezaubernd – ach, was sage ich da? Betörend! Ihr könntet im Louvre vor den König von Frankreich treten. Seine Majestät würde Euer Kleid und Eure Eleganz bestimmt mögen!“
Henriette hält in ihrem überschwänglichen Vorführtanz inne und ist ganz perplex.
„Wirklich?“
„Wirklich!“, bestätigt die hohe unbekannte Edeldame und lächelt sympathisch. Sie neigt anerkennend das schöne Haupt, als wäre Henriette eine Prinzessin. Das Kompliment hat das ungestüme Mädchenherz im Sturm erobert.
„Möchtest du mich der charmanten Demoiselle nicht vorstellen, liebe Kusine?“
Gräfin Marie-Louise schluckt den Ärger über den Ungehorsam ihres Geblüts hinunter.
„Kind, nimm Haltung an!“, sagt sie gestreng. „Diese Edeldame, die dich netterweise komplimentiert, ist unsere Kusine, die hoheitliche Marquise de Montmirail! …“
„… und Ihr müsst Henriette Adéline Chiny de Montmédy sein, die Tochter des Hauses, nicht wahr?“, übernimmt Mireille das Wort.
„Ihr ward so gross wie ein Schwan, als ich Euch das letzte Mal sah. Ihr seid ja eine richtige Damselle geworden! Und eine hübsche, ach, was sage ich da wieder? – eine überaus reizend schöne dazu! – Ich bin Mireille!“, überrascht die Marquise das junge Mädchen. „Und ich sage dir Henriette! Einverstanden?“
Das Gesicht des Mädchens leuchtet unter der weissen Schminke vor Verlegenheit rot wie eine Orange. Henriette macht sprachlos überwältigt den demonstrativen Hofknicks, den die Marquise elegant erwidert. Mama funkelt überfahren mit den Augen. Sekunden angespannte Stimmung, man könnte sie in Stücke schneiden.
„Und wer ist der fesche, junge Kavalier auf der Galerie oben, der, wie es scheint, ganz neugierig, ich möchte sagen: interessiert, auf uns blickt?“
Die Frage ist an Henriette gerichtet. Das Mädchen richtet sich auf und schaut hoch.
„Das ist – das ist – mein Musiklehrer, Madame…“
Die Marquise öffnet den Fächer behänd mit einem Klack.
„… Mireille!“, korrigiert sich Henriette verlegen.
„Und? – Dein Musiklehrer hat gewiss einen Namen, nicht wahr, Henriette?“
„Philippe Montafone!“, erwidert Marie-Louise, um auch mal was zu sagen. „Er ist Italiener.“
„Oh!“, entfährt es Mireilles` wohl geformten Mund. „Ich mag die italienische Oper! Claudio Monteverdi! Kastraten singen in seinen Opern, aber auch in Jean-Baptiste Lullys französischen Opern, Sing- und Ballettspielen treten Kastraten auf…!“
„Was sind Kastraten?“, wagt das junge Mädchen zu fragen.
„Ein Kastrat ist ein Mann, der singt wie eine Frau“, lautet die Antwort der Marquise umgehend.
Der Mund der 15jährigen öffnet sich mit einem stummen Aha. Sie fragt sich, wie das wohl geht? Selbstverständlich hat Henriette keine Ahnung, was ein Kastrat ist.
„Ich glaube, wir begeben uns jetzt in den Garten, wo uns die Gäste erwarten!“, lenkt die Mutter ab, bevor Peinlichkeiten ausgesprochen werden. „Und das Fräulein bereitet sich jetzt vor! Der Signore Philippe wird dich anweisen. Geh! Los, geh schon!“
„Danke Mama! Ich bin auch gar nicht aufgeregt! Vielleicht ein bisschen. Ein ganz klein bisschen!“
Henriette lacht aufgeweckt und kichert. Weg ist sie auf flinken Beinen!
Signore Philippe Montafone wirkt für sein junges Alter von 19 Jahren sehr abgeklärt, ein gut aussehender Jüngling mit schwarzem Haar. Er wirkt auf die Marquise sehr sympathisch und angenehm anregend. Ein schwarz umrandetes, weisses Malteserkreuz prangt gut sichtbar auf der linken Seite seines Umhangmantels. Er wäre im Louvre eine schnelle Beute von abenteuerlustigen Dämchen. Das fröhliche Mädchen zieht den Lehrer ungestüm nach draussen, ehe er die Edeldame aus Paris standesgemäss begrüssen kann.
„Dein Töchterchen ist wahrlich ein kleiner Wildfang, liebe Kusine“, gibt sich Mireille amüsiert. Dann flüstert sie Marie-Louise diskret hinter dem Fächer zu: „Bist du sicher? Ist sie noch Jungfrau? – Der Musiklehrer scheint mir ein fescher Jüngling zu sein!“
„Oh, keine Sorge, meine Liebe!“, verwirft die Gräfin den ungeheuren Verdacht umgehend. „Sie sind nie allein! Es befinden sich mindestens eine Anstandsdame und ein Kammerherr im Raum, wenn ich bei den musikalischen Lektionen nicht dabei sein kann! Es kann nichts passieren! Henriette ist nur an der Musik interessiert, nicht an dem jungen Schnösel. Es würde mir auffallen oder mir sofort gemeldet, wenn da etwas wäre! Meine Tochter ist zu naiv, geheime Blicke und Gesten vor unseren Augen zu verbergen! Signore Philippe logiert übrigens im Hôtel de Ville in Médybas. Montmédys Burgtor ist nachts geschlossen, und die Wachen sind streng instruiert!“
Madame Marquise hebt von der mütterlichen Überzeugung erstaunt die Augenbrauen. Ein wissendes Lächeln umspielt die geschwungenen Lippen; Liebende finden stets einen Weg zueinander und sind schlau! Kein Hindernis kann sie für längere Zeit trennen! Wenn sich die verehrte Kusine da nicht irrt?
„Dann ist`s ja gut, nicht wahr?“, bestätigt Mireille geheimnisvoll lächelnd. Ihr weiblicher Instinkt sagt etwas anderes. Sie wedelt plötzlich erwartungsvoll mit dem Fächer. „Und wer ist jetzt der Glückliche? Ist er hier? Im Garten?“
Frau Gräfin möchte es lieber nicht verraten.
„Aber mir kannst du es doch sagen! Vertraust du mir nicht mehr? In zwei Stunden wissen es ohnehin alle.“
Marie-Louise bleibt standhaft und schüttelt das Haupt, dass die Perückenlocken den Hals umtanzen.
„Och, sei keine Memme! – Kusine! – Spielverderberin! – Was verlierst du schon?“, schmeichelt die Marquise gespielt enttäuscht. „Dann zeige ihn mir wenigstens.“
Madame zögert. Bon!
„Du hast Recht! In zwei Stunden wissen es ohnehin alle!“, stellt Frau Gräfin fest. „Komm, ich stelle ihn dir vor!“
Die Edeldamen verlassen den Palast und treten in den Garten hinaus. Es herrscht ein reger Betrieb. Das Orchester spielt sanfte Klänge zum Gesang der Vögel. Die adligen Herrschaften flanieren, parlieren und unterhalten sich diskret in Grüppchen.
„Er steht beim Brunnen drüben. Es ist der Grosse, Stattliche, der mit dem Rücken zu uns steht. Kein Wort, dass du`s weisst! Ich müsste dir sonst böse sein, liebe Kusine.“
Mireille mustert neugierig den gut gekleideten Mann auf dem Weg zum sprudelnden Wasserspiel. Er ist in der Tat selbst von hinten eine imponierende Erscheinung.
„Sei nicht irritiert. Er tut manchmal etwas geheimnisvoll“, warnt Marie Louise. „Ich glaube, er hat eine Mätresse und wohl Schwierigkeiten, sich ihrer zu entledigen! Sie ist ein wenig…“
Die Handbewegung an die Schläfe und zu den Augen deutet `schwachsinnig` an.
Mireille lacht und meint, sie hätte auch schon von Liaisons dieser Art gehört.
Das Parliergrüppchen, drei Chevaliers und zwei aufgeputzte Edeldamen, amüsieren sich köstlich. Gewitzter Small Talk lässt die Fächer in der Wärme des sommerlichen Nachmittags heftig vor den Gesichtern der Schönen wedeln.
„Monsieur Comte De Sovigni“, unterbricht Marie-Louise die Unterhaltung höflich. Das darf sie tun, denn sie ist die Gastgeberin der geladenen Obrigkeiten. „Gestatten Sie, dass ich Ihnen meine Kusine vorstelle? Sie ist gerade aus Paris eingetroffen.“
Der Angesprochene dreht sich um.
„Das ist die Marquise Mireille de Montmirail – und das ist Graf…“ Marie-Louise unterbricht sich erstaunt.
„Oh! – Kennen Sie – bereits einander?“
Sprachlosigkeit. Sekunden lang. Mireille fasst sich und lächelt kokett. „Tun wir`s?“
Der gross gewachsene Schönling von Welt hat seine Überraschung gleichfalls im Griff und spielt den Ball der Marquise zurück.
„Falls Sie meinen, dass wir uns kennen, Madame, ist Ihr Erinnerungsvermögen wesentlich besser als meines.“
Das kokette Lächeln verwandelt sich eine Sekunde lang in ein verlegenes.
Monsieur Comte schweigt und grüsst die Marquise höfisch galant. Er wendet sich ab und lässt Madame stehen ohne sie zu kompromittieren. Ein Missverständnis?
„Du hättest nur schwerlich eine bessere Wahl treffen können“, säuselt Mireille der Kusine besänftigend hinter dem Fächer ins Ohr. „Ich bin überzeugt, Henriette wird sehr glücklich werden. Der Graf De Sovigni macht den besten Eindruck eines Ehrenmannes. Ich frage mich: Ist er für die kleine Henriette Adéline nicht ein wenig zu fortgeschrittenen Alters?“
Sekunden schnell läuft die letzte Begegnung mit Maurice de Sovigni vor dem inneren Auge ab. Es ist kaum vier Wochen her, da besuchte er sie in ihrer Pariser Stadtwohnung:
Er steht nach einem erschöpfenden Liebesakt auf und pisst gehörig in den dafür vorgesehen Kessel hinter dem Damast Vorhang. Dann wäscht er sich das Gesicht am Boudoir und kleidet sich an. Sexuelle Befriedigung bedarf keiner Worte.
„Mehr“, gurrt Mireille de Montmirail. Sie liegt verzaubert im Himmelsbett auf weichen Kissen, splitternackt wie Gott sie machte.
„Was murmelst du? Ich verstehe nicht?“
„Mehr!“, schnurrt sie geil wie eine läufige Katze. „Ich will mehr! Viel mehr! Ich bin unersättlich, mein lieber Maurice! – Nochmal!“
Mireille öffnet langsam die wohlgeformten Beine, berechnend, fordernd, zeigt ihr Weiblichstes – ein unbefriedigter Mann könnte der einladenden Geste niemals widerstehen.
Der Graf gibt sich unbeeindruckt. Er hat ja gehabt, was er wollte. Und ein drittes Mal? Er ahnt, er wäre bei aller Schönheit und Raffinesse seiner Mätresse ein ganz klein wenig überfordert.
„Ich weiss nicht“, meint Maurice de Sovigni schliesslich. „Vielleicht siehst du dich doch lieber nach einem anderen Liebhaber um?“
Madame Marquise streichelt ihr Intimstes, funkelt verführerisch mit den Augen und feuchtet mit der Zunge die Lippen an, Venus könnte es kaum erotischer tun.
Maurice bleibt unbeeindruckt und zieht sich weiterhin an. Mireille dreht sich auf den Bauch und räkelt sich zwischen den Kissen.
„Oh – nein!“, haucht sie zwischen Stöhnen und lustvollem Atmen.
„Hmhm!“
„Ich bin überaus glücklich mit dem, den ich habe!“
Die Luft knistert vor Erotik und Begierde. Maurice bindet gefasst das Leinentüchlein mit den Spitzen um den Kragen – es ist eine Art Vorgänger der heutigen Krawatte.
„Ist es dir noch nicht langweilig?“
„Unaussprechbar langweilig!“
„Aha!“, erwidert er trocken. Eine kokette Provokation, die das Gegenteil ausdrückt.
„Wann sehe ich dich wieder?“
Schweigen.
„Am Montag?“
Der Graf überlegt.
„Montag? – Da kann ich nicht!“
„Am Dienstag?“
„Dienstag?“, echot er. „Ich fürchte nein!“
Maurice prüft den Sitz der Perücke im Spiegel.
„Am Mittwoch?“
Schweigen. Spannung. Sekunden lang. Maurice de Sovigni atmet kurz ein.
„Ich werde es Sie wissen lassen, meine Liebe.“
Der Graf gürtet den Degen. Er legt ein ledernes Beutelchen aufs Boudoir: der Mätresse Liebeslohn.
„Sind Sie denn – bei einer anderen?“
De Sovigni lächelt geheimnisvoll.
„Natürlich nicht, Madame! Aber ich trage mich mit Heiratsgedanken!“
Er drückt die Geliebte sanft aufs Bett und küsst sie, wohl eher um die Frage nach der Glücklichen zu verhindern. Der romantische Gitarrenklang verklingt hinter der geschlossenen Tür. Der Musikus ist blind und kann nur schlecht hören. Aber so leicht lässt sich Madame Marquise nicht abschütteln, von einem, der bei Hofe Macht und Einfluss hat! Ja, Mireille de Montmirail ist die Mätresse, die die Gräfin Marie-Louise Chiny de Montmédy erwähnte, die loszuwerden Henriettes zukünftigem Gatten Schwierigkeiten bereitet – aber plemplem ist Mireille wahrlich nicht, die jene mit eindeutiger Geste als nichtsnutziges Dummchen abgetan hatte…
„Was sind schon 25 Jahre Altersunterschied?“, holt Marie-Louise die Marquise aus dem Tagtraum zurück. „Er ist gleich dem zwischen meinem Mann und mir. Ein junges Mädchen ist für die Ehe besser geeignet und dienlicher, als eine reife Dame.“
Die Gräfin wendet sich einem ansehnlichen Mann zu, der ihnen entgegenkommt, ohne Mireilles Antwort abzuwarten.
„Mein Gutsverwalter-Gouverneur, Chevalier Auguste Cattin – meine Kusine, die Marquise de Monmirail aus dem Louvre in Paris.“
Wer im Louvre residiert besitzt königliches Ansehen und hat stets den Vortritt. Der Adelsrang spielt keine Rolle. Eine Gräfin muss der niedriger gestellten Marquise die Louvre-Ehre erweisen, Platz machen, ihre Wünsche erfüllen, sogar Befehle befolgen und das Logierrecht gewähren. Das gilt für jedes Adelshaus in Frankreich.
„Oh! Ich bin entzückt, Madame“, säuselt Auguste ergeben. Er weiss genau, wie er sich gegenüber einer königlichen Edeldame zu benehmen hat. Er macht die höfische Verbeugung und deutet einen Handkuss an. Es wäre ein unverzeihlicher Fauxpas, die Hand mit dem Mund zu berühren. Mireille erwidert die Begrüssung damenhaft. Ihr Mund umspielt ein leises, freundliches, unverbindliches Lächeln.
„Stets zu Euren Diensten, Madame…“
„Monsieur Cattin hat deine Dienerschaft und berittene Begleiteskorte einquartiert und dir standesgemässe Gemächer im Palast herrichten lassen“, unterbricht Marie-Louise den Untergebenen schroff. Sie hat ihre Beamten fest im Griff und führt wohl ein strenges Regiment am gräflichen Hof von Montmédy.
„Ich danke Monsieur Cattin für die Aufmerksamkeit und Mühe“, erwidert die Marquise. Auguste ist hingerissen vom Charme und der Galanterie der Edeldame aus dem königlichen Louvre.
„Lass es mich bitte wissen, liebe Kusine, wenn es dir an etwas mangelt oder du etwas wünschst. Ich werde mich persönlich um dein Anliegen kümmern.“
Der Hinweis ist klar: die Hausherrin wünscht keinen direkten Kontakt von den Gästen mit ihren beamteten Bediensteten. Würde sich eine Hofdame mit Louvre-Ehren dazu herablassen?
Der Gutsverwalter-Gouverneur beugt das Haupt und weist ergeben die Richtung.
„Darf ich die durchlauchte Madame Comtesse und die überaus galante Madame Marquise bitten, sich zu den Sitzen zu begeben und Platz zu nehmen? Das Konzert beginnt in Kürze. Unsere Gäste warten schon recht ungeduldig.“
„Die fangen doch nicht an, bevor ich die Herrschaften offiziell begrüsst habe?“
„Wir halten uns streng ans Protoll, durchlauchte Gräfin“, versichert Auguste Cattin ergeben.
„Wo ist meine Tochter?“
„Sie erhält von Signore Montafone für den Auftritt die letzten Instruktionen, Madame. Mademoiselle Henriette Adéline wird gleich erscheinen.“
Das Mädchen springt wie ein übermütiges Rehkitz herbei, den jungen Musiklehrer im Schlepptau.
„Du sollst nicht rennen, sondern schreiten, wie es sich für eine Damselle gebührt!“, nimmt Marie-Louise ihr Geblüt in Empfang. „Zeig dich!“
Die 15jährige dreht sich im Kreise. Dem prüfenden Auge der Mutter entgeht rein gar nichts.
„Wo ist das Mieder?! – Du trägst keine Strümpfe?!“
„Bitte – bitte, seid nicht böse, Mama! – Das Korsett engt beim Spielen zu sehr ein – und es ist doch viel zu warm, um Strümpfe zu tragen! …“
Dem Mädchen steigt das Tränenwasser in die Augen.
„Hör gefälligst zu flennen auf! Du verschmierst das Make-up! – Das wird noch ein Nachspiel haben, Kind!“
Mireille de Montmirail schaltet sich ein.
„Ich finde, du siehst bezaubernd – was sage ich da? – betörend aus, Henriette! Du bist eine richtige Dame geworden! Ist`s nicht wahr, liebe Kusine: Lässt`s sich nicht leichter ohne Mieder musizieren? – Ohne schweisstreibende Strümpfe zu tragen?“
Es gibt einen Teich, in der Mitte ein Inselchen, auf dem der verträumte, weisse Marmorpavillon steht; er ist der Marquise bis anhin gar nicht aufgefallen. Ein Steg führt zum Ufer. Das Orchester hat Platz genommen. Ein Cembalo und eine Harfe erwarten die Solisten. Eine hölzerne Plattform wurde errichtet, eine Tanzfläche für die edlen Herrschaften nach dem Konzert. Stühle sind fein säuberlich darauf aufgereiht. Die vordersten Plätze sind selbstverständlich für die Gastgeberin und die Ehrengäste reserviert.
Der oberste Kammerherr ruft auf ein Zeichen der Gräfin die Herrschaften auf, sich jetzt zu den Plätzen zu begeben. Die Marquise de Montmirail nimmt auf dem zugewiesenen Gobelinstuhl neben ihrer Kusine Platz. Mireille grüsst links und rechts die unbekannten Gäste mit damenhafter Eleganz nach der Sitte des königlichen Louvre. Graf De Sovigni tut`s ihr gleich nach höfischer Gepflogenheit, die für hohe Adelsherren dort gilt. Maurice gehört ganz offensichtlich zu den Ehrengästen, wie Mireille jetzt weiss. Beide ignorieren meisterhaft die Anwesenheit des anderen. Maurice nimmt auf der anderen Seite der Gastgeberin Platz. Insgeheim beobachten sich Freier und Mätresse mit Argusaugen. Alle Gäste ahnen, nach dem Konzert gibt es im Hause Montmédy eine Ankündigung. Ob sie die höchst vornehme Dame aus Paris und den Mann von Welt betrifft? Die Obrigkeiten wären jedenfalls bestens für einen Auftritt gekleidet.
Madame Marquise ordnet das Kostüm. Sie achtet auf die Schuhe; nur die Spitzen dürfen unter dem Rocksaum sichtbar sein. Es wäre ein arger Fauxpas, den ganzen Schuh oder gar den Knöchel beim Sitzen zu zeigen. Kurtisanen und leichte Hofdämchen locken nämlich liebeshungrige Mannsbilder an, wenn sie den Knöchel zeigen. Madame Marquise übt jetzt den Smalltalk mit den Sitznachbarn und lacht hin und wieder frohgemut auf. Sie wedelt unverfänglich mit dem Fächer vor dem tiefen Ausschnitt, der den Blick auf sanfte Brustrundungen und den kleinen Schönheitsfleck erlaubt.
Die Hausherrin begrüsst die Adelsgäste in höfischer Manier und eröffnet offiziell den Konzertauftritt ihres Töchterleins. Der Musiklehrer, der hochverehrte Signore Philippe Montafone aus Italien, wird Henriette beim Harfenspiel am Cembalo begleiten und dem Orchester die Einsätze geben. Die seidenen und samtenen Handschuhe der holden Edeldamen dämpfen den vornehm verhaltenen Applaus. Die Solisten nehmen an den Instrumenten Platz. Philippe gibt das Zeichen, aber schon beim zehnten Takt zupft das Mädchen die falschen Saiten. Der Misston löst ein befremdliches Murmeln aus, und die Fächer wedeln zweimal schneller vor den Gesichtern. Montafone unterbricht das Spiel des Orchesters.
„A nicht C“, korrigiert er Henriettes Fehlgriff freundlich und gar nicht tadelnd. Er schlägt den richtigen Ton auf dem Cembalo an. „A – A – A! – Gnädiges Fräulein?“
Die Tochter des Hauses übernimmt den Ton auf der Harfe. Mama funkelt blamiert mit den Augen. Henriette kann den brennenden Blick spüren. Sie möchte vor Scham im Boden versinken.
„Keine Bange, meine edlen Herrschaften: Mademoiselle Henriette Adéline wärmt lediglich die Finger ein wenig auf!“, entwaffnet der Musikus die Zuhörer. Die Bemerkung erntet spontan Beifall. Die Marquise de Montmirail lächelt dem Mädchen aufmunternd zu. Fehler passieren den grössten und erfahrensten Musikern.
„Wir beginnen das Spiel von vorn. – Also? – Seid Ihr bereit, gnädiges Fräulein? – Zwei – Drei…“
Es klappt. Henriettes Finger fliegen flink und fehlerfrei über die Saiten. Ihr Gesang ist hell und klar. Mama mag ihrem 15jährigen Spross den Fehlstart verzeihen. Henriette ist noch viel mehr Mädchen als Frau. Niemand bemerkt bis anhin, dass sie weder Mieder noch Strümpfe trägt, denn dann würde darüber getuschelt.
Der letzte Klang des Orchesters verliert sich im Rauschen des Apollo-Brunnens und dem Spatzenschilpen in den Bäumen und Büschen. Henriette verneigt sich unsicher und mädchenhaft im Beifall der Zuhörer. Ihr Gesichtsausdruck wechselt zwischen Erleichterung, Lächeln, Weinen und Verlegenheit. Es ist die Marquise de Montmirail, die als Erste aufsteht, klatscht, Bravo ruft und das Publikum zu einer Standing Ovation ermuntert.
Henriette möchte sich zurückziehen, aber Philippe Montafone weist sie nach vorne. Sie soll den Beifall der Obrigkeiten entgegennehmen. Sie habe es verdient. Das Mädchen empfindet es wegen ihres dummen Fehlers peinlich, von den Gästen beklatscht zu werden.
Der Musiklehrer fordert die Herrschaften höflich auf, die Plätze wieder einzunehmen. Das Konzert habe gerade erst angefangen.
„Ich finde, Henriette hat ganz gut gespielt“, stellt Frau Gräfin etwas entspannter fest. „Was meint Ihr, Graf De Sovigni?“
„Ich sage: Ihr wertes Fräulein Tochter ist talentiert – sehr talentiert – äusserst talentiert! – Sie hat exzellent gespielt! Ich wusste gar nicht, dass sie so hervorragend singen kann? – Sie nimmt Platz am Cembalo? – Sagen Sie bloss, Madame, Henriette kann auch auf dem Cembalo spielen?“
„Warten Sie`s ab, mein lieber Graf.“
Mireille versteckt ein verhaltenes Lächeln hinter dem Fächer, während sie sich setzt. Maurice war immer ein Säusler und Schleimbeutel gewesen!
Tatsächlich: Henriette Adéline spielt das Cembalo genauso vortrefflich wie die Harfe ohne einen einzigen Missgriff in die Tasten.
Rauschender Applaus.
„Vorzüglich! Einfach vorzüglich! Exzellent!“, sagt Sovigni ergriffen zur Mutter hingewendet, ohne den Blick von seiner Zukünftigen abzuwenden und klatscht am lautesten.
Was ist das? Henriette nimmt eine Oboe zur Hand? Der Musikus setzt sich wieder ans Cembalo und gibt die Tonlage an.
„Wie viele Instrumente spielt denn das Fräulein Tochter, Verehrteste?“, erkundigt sich der Graf verblüfft.
„Warten Sie`s ab, Mon Seigneur!“, wiederholt Marie-Louise schmunzelnd. Sie legt die gepflegte Hand kurz auf seinen Unterarm. Eigentlich ist es in Adelskreisen unschicklich, dass eine Frau ein Blasinstrument spielt, schon gar nicht ein jungfräuliches Mädchen! Die männliche Fantasie könnte angeregt werden!
Stürmischer Applaus. Beifallsrufe.
„Vorzüglich! Einfach vorzüglich! Einmalig! Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll, verehrte Frau Gräfin!“, schwärmt Maurice de Sovigni überwältigt.
„Genial! Virtuos!“, schiebt Mireille ein. „Sagen Sie einfach genial, virtuos, verehrtester Herr Graf. Das trifft doch zu, nicht wahr?“
Ein zwiespältiger Blick trifft die Mätresse. Er ist überrascht, von seiner Geliebten angesprochen zu werden.
„Ja, genial, virtuos sind gewiss die trefflichsten Worte, Madame!“ …
Der Musiklehrer tritt vor. Er bittet das hochverehrte Publikum um Aufmerksamkeit. Der Beifall verebbt. Das Konzert sei noch nicht beendet, lässt Philippe Montafone verlauten. Es erreiche gerade den Höhepunkt.
„Mademoiselle Henriette Adéline spielt, wie wir gerade gehört haben, die Harfe, das Cembalo und die Oboe vortrefflich und hat eine wunderschöne Singstimme…“
Das Publikum bejaht es begeistert.
„Meine hochverehrten Herrschaften! Jetzt darf ich Euch verraten: Mademoiselle Henriette Adéline erlernt ein weiteres Instrument: das Spiel der Violine, das ich die Ehre habe, sie zu unterrichten…“ Der Musikus macht es spannend. „Und… und… noch etwas! – Ja, das gnädige Fräulein komponiert auch! – Sie hat ihr erstes Werk, eine Suite für Cembalo und Orchester, fertiggestellt. Mademoiselle Henriette Adéline Chiny de Montmédy möchte Ihnen jetzt das Musikstück gerne präsentieren. Ich bitte um Aufmerksamkeit.“
Das Publikum verharrt überrascht, erstaunt, wortlos. Das ist ja unglaublich! Was für ein musikalisches Mädchen! Ein höchst talentiertes, musikalisches Mädchen!
„Hast du das gewusst, liebe Kusine?“, munkelt Mireille Marie-Louise zu.
„Ich frage mich, wann sie Violine spielte! Wer ihr das Komponieren beibrachte! Wann sie komponierte!“
Die Marquise lehnt sich zurück.
„Du hast es nicht gewusst!“, stellt sie fest und lächelt schelmisch. Sie lehnt sich wieder vor und wedelt gemächlich mit dem Fächer vor dem Antlitz.
„Ist es nicht offensichtlich, wer Henriette das Komponieren beibrachte? Wie wir jetzt wissen, im Geigenspiel unterrichtet? Vielleicht komponieren sie auch zusammen! Wär` doch möglich? Oder nicht? – Holla, was da passieren kann!“
Die Gräfin unterdrückt ihr Ungemach im Bauch und macht gute Miene zum Spiel der Tochter. Es ist ungeheuerlich, was da hinter ihrem Rücken läuft, wie sie jetzt erfahren muss. Das geht keineswegs ungestraft durch.
Henriettes Komposition zieht die Zuhörer in den Bann. Welch` wunderschöne Melodie! Welch` überraschende Harmonie! Niemand hätte es dem jungen Mädchen zugetraut. Die `Kleine Suite für Cembalo und Orchester` dauert gerade zehn Minuten. Der Beifallssturm ist überwältigend. Das romantische Musikstück muss wiederholt werden. Standing Ovation! Lautes Klatschen! Beifallsrufe! Das Gesinde auf dem nahen Bauernhof horcht auf und hält bei der Arbeit inne. Ist bei der adligen Obrigkeit die Glückseligkeit im Garten drüben ausgebrochen?
Das Töchterlein des Hauses stürmt auf flinken Füssen und gerafften Röcken auf die Tribüne.
„Hat Euch meine Musik gefallen, Mama? – Bitte sagt, dass Euch meine Musik gefallen hat, Mama!“
Der Mutter fehlen die Worte. Die Gefühle schwanken zwischen Freude, Ärgernis und Überraschung.
„Superbe! Einfach superbe!“, komplimentiert Maurice de Sovigni das ungestüme Mädchen. Er ist gerührt und hat das Tränenwasser in den Augen. „Ich finde, dein Musiktalent muss in professionelle Hände gelegt und gefördert werden, liebe Henriette!“
„Aber das ist es ja, durchlauchter Graf De Sovigni!“, erwidert sie überschwänglich. „Es ist der Chevalier Philippe, der mir alles beibringt und mich fördert! Ich bin ja bloss eine Schülerin!“
„Der durchlauchte Graf De Sovigni deutet gewiss an, dass du im Louvre vor dem König spielen und von Jean-Baptiste Lully unterrichtet werden solltest, nicht wahr, durchlauchter Graf?“, schaltet sich die Marquise schelmisch ein. Der Gefragte stimmt den in den Mund gelegten Worten höfisch höflich zu, obwohl er nie im Traum daran dachte.
„Wer ist denn dieser Monsieur Jean-Baptiste Lully?“, erkundigt sich Henriette enttäuscht. Sie möchte lieber von Signore Philippe Montafone in den Musiklektionen angeleitet werden, wagt es aber nicht zu sagen.
„Der Monsieur Kompositeur Jean-Baptiste-Lully ist der bekannteste Kompositeur Frankreichs“, beantwortet Mireille die Frage. „Er ist der Beste!“, fügt sie hinzu. „Es gebührt einem Schüler oder einer Schülerin die höchste Ehre, von Signore Lully in der Musikkomposition unterwiesen zu werden!“
Der weibliche Instinkt sagt der Marquise: Da ist etwas zwischen Lehrer und Schülerin! Da muss etwas sein!
„Hat Ihnen meine Musik gefallen? – Ach, sagen Sie doch bitte ja, Madame Mireille!“, lenkt das Mädchen vom Thema ab.
„Ich schliesse mich den Worten des erlauchten Grafen De Sovigni an: Superbe! Deine Musik ist einfach superbe, liebe Henriette Adéline. Du hast wunderschön gespielt! Du verdienst unsere allergrösste Bewunderung!“
Das mädchenhafte Antlitz Henriettes leuchtet wie die Sonne. Jetzt geschieht in den Augen der Mutter ein Eklat: Die 15jährige umarmt Madame Marquise spontan, eine Fremde, die sie seit kaum zwei Stunden kennt und bedankt sich unter Freudentränen.
„Henriette! Was fällt dir ein! Ungezogenes Mädchen! Ich muss mich entschuldigen…“
„Ach, lass sie doch, liebe Kusine! – Sie freut sich doch nur!“, entwaffnet Mireille lächelnd Mutters Rüge über den herben Verstoss der höfischen Etikette.
Die Gräfin von Montmédy wendet sich unwirsch den Gästen zu.
„Meine verehrten Herrschaften! Darf ich um Eure Aufmerksamkeit bitten? Wenn Ihr etwas näher treten wolltet? Ich habe eine Ankündigung zu machen!“
Der letzte Applaus über Henriettes musikalisches Spiel verebbt. Neugierige Blicke richten sich auf die Herrin des Hauses.
„Ich spreche hier im Namen meines werten Herrn Gemahls, der leider in Kriegsdiensten steht und nicht anwesend sein kann und in meinem eigenen als Mutter unserer Tochter Henriette Adéline. Die Adelshäuser Chiny de Montmédy und des hier anwesenden Graf De Sovigni sind übereingekommen, sich durch eine Vermählung zu verbinden. Darf ich bitten, Mon Seigneur?“
Ein erstauntes Raunen geht durch die Reihen der Gäste. Der Graf tritt vor und kniet vor aller Augen vor Henriette nieder. Das Mädchen muss auf Geheiss der Mutter die Hände in die seinen legen. Er bittet es in aller Form, seine Frau zu werden; es handle sich um eine Verlobung, da Henriette erst in vier Monaten 16 und damit volljährig und heiratsfähig werde.
Das Mädchen ist perplex, überfordert, sprachlos, verlegen, völlig überrumpelt, es möchte im Boden versinken. Gespannte Stille. Sekunden lang. Man könnte in einem Raum eine Haarnadel fallen hören. Spatzen lärmen in den Bäumen und Büschen. Die Wasser des Apollo-Brunnens rauschen gemächlich.
„Ich… ich… ich…“, stottert Henriette mit hochrotem Antlitz. Ein ungewollter, flüchtiger Seitenblick auf den Signore Philippe bestätigt Mireilles instinktive Vermutung: Henriettes Herz gehört dem Musikus!
„Sag schon ja, Mädchen!“, raunt Mama der zögernden Tochter warnend zu. „Sag endlich ja!“
„Ich… ich…“
Henriettes nach Hilfe suchender Blick findet den der Marquise. Sie schaut kurz auf den Chevalier Montafone. Der junge Mann scheint von der Ankündigung der Gräfin ebenso überrumpelt zu sein wie seine Schülerin. Glasklar! Da ist etwas zwischen den Beiden!
„Sei nicht verstockt! Los, sag schon ja, verdammt!“, drängt Mutters Stimme hinter dem Fächer verärgert die störrische Tochter.
„Ich… ich… ich muss es mir überlegen…!“
Panikattacke! Henriette Adéline rafft die Röcke und springt los zum Palast, als wäre der Leibhaftige auf ihren Fersen. Eine perplexe Gästeschar bleibt im Garten zurück und ein noch perplexerer Graf De Sovigni. Mireille de Montmirail atmet fast schadenfroh aus: Das war die beste Antwort, die der Lüstling verdient! – –
Das Heerlager des Königs von Frankreich blockiert den Durchgang zwischen zwei Hügelzügen und sichert eine natürliche Furt. Feindliche Truppen können das brusttiefe Wasser nahezu mühelos überqueren. Die Strömung ist sanft und nur bei Hochwasser gefährlich. Das Feuer einer postierten Kanonenbatterie verhindert den Übergang gegnerischer Kräfte. Es gibt hier weit und breit keinen Bauernhof; das nächste Dorf ist ein paar Wegmeilen entfernt. Der lokale Feudalherr befand es als unnötig, eine Strasse hierher zu bauen, eine Brücke zu errichten und den Wegzoll von einer Garnison weitab von seinem Wohnsitz einzuziehen; es wäre ein Umweg für den Handel und Verkehr gewesen. Schmuggler nützen die Flussfurt und hin und wieder Militäreinheiten, um Truppenkontingente ungesehen überzusetzen und ins Landesinnere zu verschieben. Das Heerlager ist rudimentär mit improvisierten Palisadenzäunen gesichert. König Ludwigs Armeeführung ist auf dem Durchmarsch. Oder in Wartestellung?
Vor dem königlichen Zelt prangt die Flagge der `Fleur-de-lys`, die goldene Lilie auf blauem Grund, und das Wappen des Leitenden Ministers, Kardinal Jules Mazarin. Eine Kompagnie Musketiere bewacht als königliche Leibgarde das Zelt und die Unterkünfte der Adelsführung. Soldaten patrouillieren in den Zeltgassen der Mannschaft und entlang der Palisadenzäune. Die Truppenstärke beläuft sich auf ein reduziertes Regiment von 300 Infanteriesoldaten mit Gewehren, 20 Armbrustschützen, 30 Artilleristen, 150 Mann für den Tross und ebenso viele für die Logistik, Dienerschaft und Köche. Frauen mitzuführen steht unter Strafe. Selbst Dirnen sind untersagt, die normalerweise eine Armeeeinheit begleiten.
Feldmarshall Michel Le Tellier, sein Sohn, der Marquis de Louvois, Staatssekretär für das Kriegswesen und Minister sowie für die Weiterleitung von `Placets` verantwortlich, das sind Bittgesuche aus dem Volk an den König, und drei Generalstabsoffiziere besprechen mit Mazarin und dem König den Einsatzplan und ob die Kanonenbatterie nicht wirkungsvoller von der kleinen Hügelkuppe aus eingesetzt werden könnte. Sie tun das im Flüsterton. Nicht einmal ein Musketier, der das höchste Vertrauen von König und Minister geniesst, soll etwas über die Schlachtordnung erfahren.
Ludwig XIV. ist noch jung, 18jährig. Sein Vater Ludwig XIII. und seine Mutter Anna von Österreich gaben ihrem Spross nach 23 Jahren kinderloser Ehe den Namen `Dieudonné`, der Gottgegebene. Bereits 4½jährig wurde er 1643 als König von Frankreich inthronisiert. Er lebte bis zum 13. Lebensjahr unter der Regentschaft seiner Mutter. Die tatsächliche Macht übt Kardinal Mazarin als Leitender Minister aus. Es ist das höchste Staatsamt gleich nach dem König, das er schon unter Ludwig XIII. in der Nachfolge von Kardinal Richelieu bekleidet. Seine jugendliche Majestät wird im gleichen Jahr (1651) für volljährig erklärt. Damit endet offiziell die Regentschaft seiner Mutter. Sie überträgt erwartungsgemäss die Macht und die Ausbildung ihres Sprosses an Mazarin, der auch Taufpate ist und nicht an einen Prinzen des Königshauses. Kardinal Mazarin bereitet Ludwig, der noch zu jung zum Regieren ist, in persönlicher Obhut zielgerichtet und ganz im Sinne Richelieus auf seine Rolle als absoluter Herrscher vor. Er bildet ihn in der Kunst des Regierens, der Lenkung der Staatsgeschäfte, der Kriegsführung, Strategie und Taktik aus. Seine Mutter impft ihm zeitlebens das Bewusstsein des Gottesgnadentums ein, als von Gott zum absoluten Herrscher Frankreichs auserwählt zu sein. Daraus erklärt sich der unumschränkte Machtanspruch des XIV. Ludwig. Den glänzenden Beinamen `Roi Soleil` (Sonnenkönig) verdankt er seiner Liebe zum Ballett. Er tanzte (1653) als kaum 15 Jähriger im `Ballet Royal de la Nuit` die Rolle der aufsteigenden Sonne in einem diamantbesetzten Kostüm…
Seine Majestät hat das Haupt in die Hände, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt und schaut mit leerem Blick auf die vor ihm liegende Landkarte.
„Ihr scheint etwas abwesend zu sein, Majestät?“, wundert sich Kardinal Mazarin. „Ihr interessiert Euch nicht sonderlich für den Schlachtplan, was Ihr eigentlich tun solltet, nicht wahr? – Worüber denkt Ihr denn nach, Majestät?“
Ludwig erwacht aus dem Tagtraum. Er räuspert sich und richtet sich auf.
„Nichts! Wir dachten an nichts Besonderes.“
Eine Majestät spricht nur in Wir- und niemals in Ich-Form. Domestiken, Lakaien, Bedienstete und Leute vom Dorfe werden vom Adel generell mit `er` oder `sie` (klein geschrieben) angesprochen. Innerhalb des Adelsstandes und des Klerus ist das `Euch` angemessen. Handelt es sich um Familienmitglieder oder Verwandte duzt man sich. Davon ausgenommen sind Kinder, die Ihre Eltern zeitlebens siezen.
„Wenn Ihr einen Vorschlag machen möchtet, Majestät?“
Jetzt ist Ludwig ungehalten.
„Ach, weshalb kann Eure Nichte nicht hier sein! Ihr wisst, dass Wir Maria Manzini lieben und zu heiraten gedenken! Wir verlangen eine stichhaltige Begründung, Eminenz!“
Der Kardinal lässt sich niemals aus der Fassung bringen. Es wäre seines Amtes unwürdig. Unmut trübt zudem den Geist und lähmt den Verstand.
„Weil Ihr der König seid!“, erwidert Jules Mazarin streng. „Weil Ihr Frankreich seid! Weil Ihr der Staat seid, Majestät! – Heiratet Ihr meine Nichte, würde sie zwar die Königin von Frankreich und könnte Euch legitime Erben schenken! Maria Manzini schmälert Euren majestätischen Glanz. Sie bringt kein Erbe in die Ehe ein! Was aber eine kluge Vermählungspolitik mit einer Prinzessin tut…“
„Nun, hört auf, Eminenz!“, unterbricht Ludwig unwirsch den Kardinal. „Wir wissen, von wem Ihr sprecht: Maria Teresa von Spanien. Wir hörten, dass sie kleinwüchsig, pausbäckig, ziemlich ungebildet und kaum als schön zu bezeichnen ist. Man sagt, sie habe vom Kakao- und Kaffeetrinken und von den vielen Süssigkeiten schlechte Zähne! Zudem wies König Philipp (IV.) von Spanien die Ehe der Infantin mit Unserer Majestät vehement zurück!“
„Philipp lehnt die Friedensverhandlungen ab, weil er keinen männlichen Thronerben hat und Maria Teresa die Infantin ist. Sie ist zudem Kronprinzessin von Österreich und führt `Erzherzogin von Österreich` im Titel“, bestätigt Mazarin die Feststellung seines königlichen Schützlings. „Frankreich befindet sich seit zwanzig Jahren (1635) in einem erschöpfenden Krieg mit Spanien, Majestät. Unsere Staatskassen leeren sich. Wir sollten uns um Friedensgespräche mit dem spanischen König bemühen – insgeheim, ohne es zuzugeben und Philipp keine Wahl lassen. Durch die Vermählung der Tochter König Philipps und Isabellas von Frankreich aus erster Ehe, die wiederum die Tochter des französischen Königs Heinrichs IV. ist, fällt das Reich der spanischen Habsburger Linie nach dem Tode Philipps an Euch, Majestät!“, begründet der Kardinal die Heiratspolitik mit der spanischen Infantin. „Philipp will unter allen Umständen verhindern, dass Frankreich sich aus der habsburgischen Umklammerung befreit und Ihr, Majestät, König von Spanien werdet! Er sagt: Lieber Krieg mit Frankreich, als einen schlechten Frieden und den Verlust seines Königreichs durch die Ehe seiner Tochter mit dem ärgsten Feind, dem König von Frankreich!“
Gespannte Stimmung herrscht im Kommandozelt. Sekunden lang.
„Das ist Uns bekannt!“, stellt Ludwig plötzlich fest. „Und trotzdem lieben Wir Maria Manzini!“, fügt er hinzu.
„Liebe hat mit einer Heirat nichts zu tun, Majestät“, stellt Jules Mazarin fest. „Das war so, ist so und wird immer so sein. Es sollte ausserdem sorgfältig bedacht werden, dass innenpolitische Angelegenheiten gleichfalls die Staatskasse belasten. Der Sieg über die `Frondes` ist recht wackelig. Der Schwertadel bangt um seine Privilegien und verteidigt sie mit Waffengewalt. Die Hugenotten bedeuten trotz Treuebeteuerungen gegenüber der französischen Krone eine latente Gefahr; sie könnten sich mit dem rebellischen Hochadel verbünden“, doppelt Jules Mazarin nach. Er will den jungen König von der Notwendigkeit einer Vermählung mit der spanischen Infantin überzeugen, was einen kostspieligen Abnutzungskrieg mit Spanien beendet, der französischen Krone mehr Macht und Einfluss bringt und Finanzresourcen für innenpolitische Belange freisetzt.
Ludwig schweigt. Er geht unruhig ein paar Schritte auf und ab und hin und her. Was kann er dazu sagen?
„Ihr seid der König von Frankreich und durch das Erbe Heinrichs IV. auch von Navarra und Kofürst von Andorra!“, beteuert der Kardinal. „Ihr seid die Majestät! Vergesst meine Nichte! Nehmt Euch Mätressen, wenn Ihr mit Maria Teresa verheiratet seid und werdet König von Spanien, wenn Philipp das Zeitliche segnet. Erhebt Anspruch auf die österreichische Krone durch Eure Gattin, die Erzherzogin-Infantin und Eure königliche Mutter, Anne d`Autriche!“
Ludwig wendet sich dem Staatsminister zu.
„Das meint Ihr ernsthaft, Eminenz? – Wirklich?“
Mazarin erweist dem königlichen Jüngling die Referenz.
„Ich spreche nicht über meine Meinung, Majestät, wenn Ihr erlaubt dies anzumerken? Ich spreche über Tatsachen und zukünftige Entwicklungen. Ihr werdet König von Frankreich, Navarra, Spanien und vielleicht auch von Österreich sein! Gott hat Euch für das Ganzgrosse ausersehen, Majestät: Ein gottgegebenes, absolutes Königtum! Ihr werdet der mächtigste und strahlendste Herrscher aller Könige in Europa sein!“
Roi Soleil findet keine Worte. Eine Prophezeiung aus dem Munde eines Kardinals? Eines frommen Kirchenmannes? Hat die königliche Mutter Anne d`Autriche Ludwig im gleichen Sinn erzogen?
„Wir sollten uns ein klein wenig gedulden, Majestät“, spinnt Mazarin den Faden weiter. „Was im Moment als Patt-Situation mit Spanien erscheint, wird bald keine Patt-Situation mehr sein. Die Heirat wird sie zu unseren Gunsten wenden!“
„Was heisst das? Wie?“, will Louis XIV. wissen.
„Ich darf Euch sagen, Majestät: Königin Maria Anna, die zweite Gattin Philipps von Spanien, ist schwanger! Sie wird im nächsten Jahr einen Thronerben gebären.“
Ludwig wendet sich unwirsch ab. „Ha, dann bleibt alles beim Alten! Philipp wird die Infantin bei einem Eheschluss bestimmt enterben.“
„Zum Ersten: Es wird für diesen Fall eine Klausel im Ehevertrag geben, die eine Mitgift von 500`000 Gold-Écus erfordert“, fährt der Leitende Minister fort. „Philipp kann diese Summe niemals aufbringen, weil seine Staatskasse leer ist. Zum Zweiten: Durch eine kontrollierte Kriegsverlängerung wird König Philipp gezwungen sein, in Friedensverhandlungen mit Frankreich einzutreten. Und drittens, das Wichtigste: Maria Teresa besitzt als Kind aus erster Ehe das Erbrecht der spanischen Krone vor den Kindern der zweiten Gemahlin. Königin Maria Anna kann so viele Kinder gebären, wie sie will: Die Sprösslinge werden zeitlebens bloss königliche Prinzen und Prinzessinnen bleiben. König Philipp hat die Wahl, Maria Teresa als erbberechtigte Kronprinzessin mit Euch zu vermählen gegen einen guten Friedensschluss mit Frankreich oder die Mitgift zu entrichten…“
„…oder die 500`000 Gold-Écus einzubehalten und den Krieg gegen Frankreich weiterzuführen…“
„…was er sich aber wegen des leeren Staatssäckels nicht leisten kann! Er muss nachgeben und in die Heirat der Infantin mit Euch einwilligen, Majestät!“, beendet der Kardinal den Satz und schmunzelt. „Ich habe mir als Leitender Minister Frankreichs erlaubt, diesbezüglich Verhandlungen einzuleiten, Majestät!“
Es herrscht eine gespannte Stille im Kommandozelt. König Ludwig scheint die Handlungsweise seines Mentors zu billigen. So wird anscheinend Politik gemacht! Frankreich befindet sich in einer Win-Win-Situation, würde man heute sagen. –
Ein Späher wird gemeldet. Er betritt das königliche Kommandozelt und kniet vor Kardinal Mazarin nieder.
„Er spreche!“