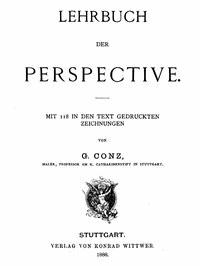0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Der vorliegende Text wurde anhand der 1922 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Zeichensetzung und offensichtliche typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert bzw. ergänzt. Einige altertümliche Wortformen wurden vom Autor offenbar in illustrativer Absicht eingefügt; diese Begriffe wurden nicht verändert. Unterschiedliche Schreibweisen wurden nicht vereinheitlicht.
Im Originaltext beginnen neue Absätze ohne Kennzeichnung durch Einrückungen oder vergrößerte Zeilenabstände. In einzelnen Fällen mussten daher vom Bearbeiter willkürliche, aber möglichst sinngemäße, Entscheidungen bezüglich des Beginns eines neuen Absatzes getroffen werden.
Wie bei den meisten Frakturschriften üblich, kann auch im Original zwischen den Großbuchstaben ‚I‘ und ‚J‘ nicht unterschieden werden. Die Zuordnung erfolgte in einigen Fällen gezwungenermaßen rein willkürlich; obwohl beispielsweise die Schreibweisen ‚Iago‘ und ‚Jago‘, sowie ‚Iachimo‘ und ‚Jachimo‘ gleichermaßen bekannt sind, wurden in diesem Text die Formen ‚Jago‘ bzw. ‚Jachimo‘ verwendet.
Die Originalausgabe enthält am Ende des vorliegenden zweiten Teiles ein Inhaltsverzeichnis für beide Bände, welches in der elektronischen Fassung der Übersichtlichkeit halber vom Bearbeiter an den Beginn des Textes gestellt wurde. Die Links zu den entprechenden Seiten sind nur innerhalb des vorliegenden zweiten Bandes aktiv.
Gesperrt gedruckte Passagen im Original werden hier in Fettdruck hervorgehoben, Antiquaschrift in der Buchausgabe wird kursiv wiedergegeben.
Gustav Landauer
ShakespeareDargestellt in Vorträgen
Zweiter Band
1922
Literarische Anstalt Rütten & Loening
Frankfurt am Main
Alle Rechte, besonders die der Übersetzung, vorbehalten
Copyright 1920 Literarische AnstaltRütten & Loening, Frankfurt a. M.
6. bis 10. Tausend
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Inhaltsverzeichnis
Erster Band
Seite
Vorwort
V
Romeo und Julia
1
Der Kaufmann von Venedig
42
König Johann
91
Julius Cäsar
139
Hamlet
189
Troilus und Cressida
256
Othello
303
Zweiter Band
Maß für Maß
1
Macbeth
48
König Lear
80
Antonius und Cleopatra
130
Timon
160
Coriolan
189
König Zymbelin und Das Wintermärchen
238
Der Sturm
269
Die Sonette
318
Shakespeares Persönlichkeit
371
Maß für Maß
Von dem Augenblick an, wo ein Registrator sich auf den Himmelsthron setzt und mich als gebietender Gott zwingt, Shakespeares Stücke ordentlich auf die gehörigen Rubriken zu verteilen, werde ich Troilus und Cressida zu den ganz großen Tragödien, Maß für Maß aber unbedenklich als größte zu Shakespeares Komödien stellen. Eine Komödie größter Art ist dieses Stück gerade darum, weil es seinem Stoff nach durchaus tragisch ist; die Komik liegt nicht im entferntesten in den Geschehnissen, die zur Höhe der Handlung emporgeführt werden, nicht einmal eigentlich in der Art, wie der Dichter die Welt, in der diese Dinge geschehen, ansieht: die größte Schärfe des Blicks und Bitterkeit der Stimmung ist mit unsäglich liebender Innigkeit und verzeihender Milde verbunden, so daß ein Umfang der Empfindung von einer Weite und Höhe entsteht, die man Heiterkeit oder Humor nur nennen kann, wenn man jeglichen Beigeschmack von Vergnüglichkeit oder idyllisch kauziger Beschränktheit aus diesen Begriffen entfernt; die Komik liegt vor allem in der gleich von Anfang an vorbereiteten Wendung, die die Handlung auf ihrem Höhepunkt nimmt: ein geheimer Lenker, ein deus nicht ex machina, sondern ex anima ist da, der mit einer liebenswürdigen Grazie ohnegleichen wilde Wallungen besänftigt, schroffe Gegensätze ausgleicht und den pochenden Schmerz der Leidenschaften in sinnvollen Scherz und ernstes Spiel verwandelt. Wie wenn ein ironischer Gott die Menschen erschaffen hätte und nun als Zuschauer sie frei gewähren ließe, bis ihre Leidenschaften und Widersprüche zu solchen Verwicklungen und Konflikten geführt hätten, daß sie ohne sein Eingreifen verderben müßten, und dann käme er und lenkte sie mit sanfter Bestimmtheit, wohin er sie haben will, so erschafft der Herzog dieser Komödie einen Fürsten an seiner Statt mit dem Vorbehalt, ihm eine Weile zuzusehen, zur rechten Zeit aber einzuschreiten. Die Ironie weckt die Tragik und gestattet ihr ihre verzerrte Bahn, bis es der Pein und des Frevels genug und schon fast zu viel ist und die Ironie wieder die Herrschaft antritt.
Shakespeares Lustspiele könnte man einteilen in die Spiele, in denen alle Erdenschwere in Ironie, Musik, Traum und Geisteszauber aufgelöst scheint; dahin gehören der Sommernachtstraum und der Sturm; auch der Kaufmann von Venedig, nur daß da das Geisterhafte ganz vom Menschlichen und Natürlichen bestritten wird; und in die Stücke, die zwar oft in dieses Reich hineinragen, deren Leichtigkeit und Spielerei aber zum Teil auch daher kommen, daß der Dichter in ihnen etwas auszuruhen scheint, nicht nur die Probleme, sondern auch die Durchführung leichter nimmt und sich eine Umbiegung der Charaktere je nach dem Erfordernis der Handlung und Bühnenwirkung keineswegs immer verbietet; Was ihr wollt, Wie es euch gefällt, Viel Lärm um nichts sind die vollendetsten Exemplare dieser Gattung. Aus diesem Bezirk ins Reich der großen, bitter ernsten Komödie hebt sich Ende gut, alles gut, ohne die letzte Vollendung zu erreichen. Diesem Schauspiel ist Maß für Maß in mehr als einem Punkte benachbart; hier aber ist die Vollendung erreicht, und die Wendung zum Sinnspiel bringt diese Dichtung wieder in die Nähe der Gattung menschlich-natürlicher Märchen, die Der Kaufmann von Venedig repräsentiert, nur daß im Kaufmann die Tragödie als alles überschattende Episode im Lustspiel steht, während in Maß für Maß die gesamte Handlung, in der alle Hauptpersonen stehn, zu tragischer Höhe ansteigt, bis vom Scheitelpunkt an die Tragik mählich gemildert und in Prüfung verwandelt wird.
Der erste Druck, den wir von dem Stück haben, steht in der Folioausgabe von 1623. Nach einem Dokument, dessen Echtheit nicht völlig feststeht, wäre das Stück 1604 am Hof aufgeführt worden.
Der Stoff findet sich zuerst in derselben Novellensammlung Hecatommithi von Giraldi Cinthio, in der sich auch die Novelle vom Mohren von Venedig findet; Shakespeare stützte sich aber überdies auf zwei Arbeiten von Georg Whetstone, die Komödie Promos und Kassandra (1578 gedruckt), und eine kurze Novelle, die er 1582 in der Sammlung Heptameron of civil discourses herausgab. Die ursprünglichen Namen und Schauplätze Cinthios haben sowohl Whetstone wie dann wieder Shakespeare verändert. Shakespeares Herzog Vincentio von Wien ist bei Cinthio Kaiser Maximilian in Innsbruck, bei Whetstone König Corvinus von Ungarn und Böhmen; der Statthalter heißt erst Juriste und dann Promos; unsre Isabella bei Cinthio Epitia, bei Whetstone Kassandra; in all diesen Fassungen vor Shakespeare muß dies Mädchen um der Rettung ihres Bruders willen sich tatsächlich dem Statthalter hingeben; und aus der Umgestaltung dieses Hauptmotivs, die Shakespeare vornahm, ergibt sich schon, wie er mit dem äußern Stoff und innern Sinn im Kleinen und Großen frei geschaltet hat.
Maß für Maß hat sehr vielen, die über Shakespeare geschrieben haben, aus demselben Grund und im nämlichen Grad unangenehme Gefühle und Verlegenheit erzeugt, wie Troilus und Cressida. Man hat von berühmten, geachteten und anerkannten Männern Urteile gehört, wie: das Stück sei auf unsrer Bühne nicht möglich; für unsern Geschmack dürfe bei einem solchen Motiv von komischer Behandlung und Wirkung keine Rede sein; unser sittliches Gefühl werde in unerträglicher Weise verletzt; und die üblichen Epitheta sind: peinlich, abstoßend, widerlich. Mit alledem zeigen, die so schreiben, nur, daß sie für Shakespeare nicht reif sind; und daß ihresgleichen in Ehren und nicht in verlachtem Schimpf stehen, ist kennzeichnend für unsre öffentlichen wie geheimen Zustände.
Ich sage von vornherein, daß mir Maß für Maß zu Shakespeares vortrefflichst gebauten, schlagkräftigsten, spannendsten, bühnenwirksamsten, innigsten, reinsten und reifsten, freiesten und tiefsten Schöpfungen gehört. Kann es denn für eine Komödie, das heißt für eine solche Darstellung von Gegensätzlichkeiten, über die wir lachen dürfen, weil wir sie in uns und um uns zugleich kennen und nicht kennen, in unsrer erbärmlichen Wirklichkeit kennen, in unserm Glauben, Wünschen und Umschaffen nicht kennen, kann es tauglichere Motive geben, sowie wir die Komik ernst genug nehmen und mit ihr nicht Vergnügliches betrachten, sondern wollend in unsrer eignen Zwiespältigkeit eine Entscheidung treffen? Wer, der in Betracht kommen will, ist denn durch elende Lustigkeit, bei der die Gemeinheit mit der Gemeinheit lacht, oder gar durch Frohsinn, bei dem der Philister mit den Philistern vergnügt ist, so verdorben, daß er nicht weiß, daß das echte Lachen der Komik ebenso gegen die Niedrigkeit Partei ergreift, wie die Ergriffenheit der Tragik für die Hoheit und Innigkeit eintritt? Ich habe das Wort Tränen hier vermeiden müssen, weil die Rührung allermeist erbärmlich geworden ist und weil bei diesen edeln Tropfen nicht mehr die adligen Gefühle der Teilnahme am Großen und Reinen, das beschmutzt und zu Fall gebracht wird, von den Regungen der Tröpfe zu unterscheiden sind; genau so ins Gemenge und in die Menge gekommen ist das Lachen, das eine Steigerung sein sollte und allermeist eine Erniedrigung oder Plattheit geworden ist.
Maß für Maß zeigt uns die Macht und den Mißbrauch der Macht; das Verhältnis des wahren Menschen zu der Rolle, die er im Amt spielt; die hohe richterliche Pose; zeigt uns den Mann, der in einem idealen Wortgebäude wohnt, welches einstürzt, sowie der Sturm der Triebe kommt; den Anspruch des Staates, regulierend und sittlichend ins Geschlechtsleben einzugreifen, wobei sich dann ergibt: was für eine Erfindung, vom Staat zu reden, als ob das ein Gebilde übermenschlicher Art für sich wäre, und ist doch nur ein Name für Menschen und Untermenschen! Einen Fürsten sehen wir, der wie Harun al Raschid im Verborgenen, verkleidet, die Vorgänge in seinem Staat beobachtet, Zeuge wird, die Fäden lenkt, alles zum Guten wendet, der Milde und Nachsicht, vor allem aber Wahrheit an die Stelle der Strenge, der Übergriffe, der Heuchelei setzt; dazu kommen die Probleme des Rechts, vor allem des Strafrechts und geradezu der Strafrechtstheorie; der Moral und Moraltheorie, der Gnade, der himmlischen und irdischen Liebe, des Lebens und des Todes.
Dazu ist die Sprache dieses Dramas nach Form und Gefühls- wie Gedankengehalt rein, reich, voll, kräftig, knapp; sie bringt Bilder von wundervoller Ausdrucksgewalt; die Komposition ist glänzend und sicher; die Abwechslung zwischen Verssprache und Prosa ist besonders weise abgestuft; die Szenen der niederen Komik, diese burlesken Scherzo-Variationen sowohl des erotischen wie des Beamtenthemas, die es mit den entsprechenden in Viel Lärm um Nichts getrost aufnehmen können, sind lustig, reich an Einfällen, famos; und selbst in diesem untern Bezirk ist das höchste tragische Motiv mit Fug in eine keineswegs bloß das Zwerchfell erschütternde, in eine schlechtweg erschütternde Komik gewandt: da haben wir den Mörder und Räuber, der lustig leben und sterben will.
Dies Stück, das, wie jedes von Shakespeares bedeutenden, seinen Sinn nicht irgendwie sentenziös ausspricht, sondern sich deiktisch verhält, ist darum auch nur denen voll zugänglich, die schauend, Gegensätze schauend, empfindend, in der Phantasiesphäre zu denken vermögen, die überdies das, was ihnen plastisch, als bewegtes, dissonierendes Leben, als Gegensätze der Sphären, der Regungen, der Charaktere entgegentritt, aufzulösen und zu vereinigen wissen in der Musik, die durch dieses Stück so waltet wie in Rembrandts Schöpfungen. Das hat sehr schön Hugo von Hofmannsthal gesehen und zum Ausdruck gebracht, und besonders gut weist er auch auf diese gegenseitige Ergänzung des oberen und unteren Bereichs hin: „Welche Lichter auf dem Finsteren, welches Leben des Schattens durch das Licht.“
Das Stück setzt, so wie der König Lear, in der Staatsszene, die den Eingang bildet, sofort mit einem Sprung in die Haupthandlung hinein: der Herzog entfernt sich aus Wien, seiner Hauptstadt, und übergibt aus besonderen Gründen dem jungen Angelo mit voller Statthalterhoheit das Regiment; einen alten, klugerfahrnen Mann, Escalus, der eigentlich das nächste Anrecht auf die Vertretung des Herzogs hätte, gibt er ihm nur als Gehilfen bei. Was sind das für Gründe besondrer Art? Was ist Angelo für ein Mann? Das merken wir, daß die besondern Gründe in ihm, in seiner Natur liegen; ihn selbst aber, wie er ist, zeigt uns der Dichter noch lange nicht; und auch, was der Herzog über ihn zu ihm selbst äußert, ist zwar von entscheidender Wichtigkeit, aber mit Absicht dunkel gehalten; so dunkel, daß die meisten Übersetzer, die ich habe prüfen können, — zumal der neueste und doch wohl allerschlechteste, Hans Olden — den Sinn verfehlt, oft ins Gegenteil verkehrt haben; der Herzog sagt:
Ein paar Szenen weiter, nachdem Angelo dem Rat, dem Gebot prompt gefolgt ist und schon begonnen hat, seine Tugenden in die Welt wirken zu lassen, hören wir vom Herzog in seinem Gespräch mit dem Bruder Thomas schon deutlicher, wie er’s gemeint hat: die scharfen Gesetze, über die das Land verfügt, hat dieser Fürst in den vierzehn Jahren seiner milden Regierung kaum zur Anwendung gebracht; so ist vielerlei Zügellosigkeit eingerissen,
würde er selbst jetzt mit einem Male auf die Gesetze zurückgreifen, die fast vergessen wurden, so wäre das eine Härte, die er geneigt wäre, Tyrannei zu nennen. Denn hatte er nicht selbst all die Schlechtigkeiten geradezu geboten?
Darum also soll Angelo,
wie uns jetzt gesagt wird, den Gesetzen wieder Geltung verschaffen. Und mit den Worten, die wir vorhin hörten und die keineswegs bloß uns, die auch Angelo selbst dunkel bleiben sollen, hat er ihn dazu bringen wollen und dazu sofort dazu gebracht, aus sich herauszugehen und seine Tugenden — im Anschluß an die alten Gesetze — an die Anwendung zu lassen. Der Herzog hat aber, er deutet es Bruder Thomas schon an, noch einen geheimen Hintergedanken: nicht bloß sollen die Gesetze jetzt wieder zu Leben erweckt werden; diesen Statthalter, der nun auf öffentlichem Gebiet seine Tugenden ans Werk lassen soll, will er prüfen.
Nach diesen Worten sehen wir schon viel deutlicher in das Verhältnis des Herzogs zu dem jungen, begabten Mann, den er zu seinem Statthalter gemacht hat: etwas Strenges, Asketisches, Welt- und Wirkungscheues hat Angelo bisher an sich gehabt; drum hat der Herzog ihn ermahnt, er solle sein Licht der Welt leuchten lassen, solle seine Tugend auf die Menschen anwenden; und den weitesten Spielraum hat er ihm gelassen, überdies noch zu dem Versuch, in seinem Staat für Zucht und Ordnung zu sorgen. Bist du so tugendhaft, hier hast du Arbeit! Verschwende nicht deine Tugenden in dir, in sich selbst; gib ihnen entfesselte Freiheit, so wie in meinem Lande die bösen Triebe allzu lange diese Freiheit genossen haben.
Das soll sich also nun zeigen; die Widersprüche der Menschennatur sollen an den Tag kommen; der Gegensatz von Schein und Wesen, vor allem von Reden und Handeln soll heraustreten. Ganze Systeme hat sich das Reden geschaffen: das System der Tugend oder die Moral; das System der Religion; das System des Rechts. Sie alle treten in diesem Stück auf und spielen ihre Rolle; und ihnen allen treten die leibhaften Tatsachen gegenüber und entlarven sie.
Eine kleine Probe solcher Kritik bekommen wir gleich zu Beginn der zweiten Szene in einer kleinen episodischen Einlage. Der Herzog hat absichtlich seine Spuren verwischt; am Hof meint man, er sei in den Krieg gegen Ungarn gezogen; die Berufsoffiziere kennen aber seine milde, vernünftige Natur und fürchten, es könne zu einem Vergleich mit dem Feind kommen. Da seufzt einer den frommen Wunsch:
Der Himmel schenk’ uns Frieden; nur nicht mit dem König von Ungarn!
Und ein andrer ruft Amen dazu. Da spottet der Edelmann Lucio mit seinem bösen Mundwerk:
Du amenst wie der andächtige Seeräuber, der sich mit den zehn Geboten einschiffte, aber eins davon von der Tafel auskratzte.
Da lachen sie und wissen gleich, welches Gebot der Seeräuber nicht mit auf seine Berufsfahrt nahm: Du sollst nicht stehlen.
Und einer der Offiziere macht sofort die aufrichtige Nutzanwendung:
Kein rechter Soldat ist unter uns, der im Tischgebet an der Bitte um Frieden Gefallen fände!
So geht’s, das sehn wir sofort nach der kurzen feierlichen Einleitung der Übergabe des Regiments, in diesem Staat, in dieser Stadt Wien zu: es gibt gewisse allgemeine Normen, gewisse Lehren, die ihre Wortmacht üben, so daß man sie mit den Lippen bekennt; aber im vertrauten Kreis macht man kein Hehl daraus, daß dieses Allgemeine sich auf die besondern Stände und Interessen in Wirklichkeit gar nicht anwenden läßt.
Und nun ist ein junger Mann ans Ruder gekommen, nicht durch Ehrgeiz oder Usurpation; er hatte sich’s, wir haben es wohl zu beachten, nie träumen lassen, so hoch hinauf zu kommen; und er muß ja auch von vornherein annehmen, daß es nur für eine Weile ist und daß er für alles, was er verfügt, Rechenschaft abzulegen haben wird; wir wissen zunächst weiter nichts von diesem Statthalter, als daß er ein strenger Idealist oder Ideologe sein soll. Wo wird er zunächst angreifen? Welches Gebiet liegt seinem Reform- und Reinigungseifer am nächsten?
Noch ehe wir so weit sind, über Angelos Wesen, seine Sittenstrenge und Selbstbeherrschung aus dem Mund des Herzogs etwas zu erfahren, sehen wir, daß dies das Gebiet ist, auf dem der Rigorist vor allem eingreift: die Gesetze zur Aufrechterhaltung und Hebung der Sittlichkeit sind da — nicht von diesem Herzog, der sie kaum angewandt hat, gegeben, sondern von seinem Vorgänger — nun soll Ernst gemacht werden. Die Freudenhäuser in den Vorstädten sollen niedergelegt werden; den Kupplern und Kupplerinnen will Herr Angelo das Handwerk legen; ein junger Edelmann, Herr Claudio, der einem Mädchen — das er sogar zu heiraten gedenkt, nur aus Gründen der Mitgift ist der Akt verschoben worden — ein Kind gemacht hat, ist verhaftet worden; auf diesem Verbrechen steht nach dem Gesetz der Tod.
An dem nämlichen Tag, an dem Claudio ins Gefängnis abgeführt wird, tritt seine Schwester Isabella ins Kloster ein, um da als Novizin ihre Probezeit durchzumachen. Aber sie wird ganz anders, als sie sich’s dachte, wird mitten in der Welt geprüft, wird in die Prüfung Herrn Angelos verwickelt. An sie wendet sich der Bruder durch Vermittlung eines Freundes: sie soll durch Freunde und vor allem persönlich beim Statthalter tun, was sie irgend kann, um ihren Bruder zu befreien. So widerwärtig dem reinen Mädchen, das in einem Zusammenhang, von dem wir nichts Äußeres wissen, im Begriffe steht, der Welt Valet zu sagen, ehe es sie aus Erfahrung kennt, diese Männergeschichten sind, so weiß sie doch, daß der Fall hier anders liegt, als der Anschein sagt: das Mädchen, das Mutter werden soll, ist ihre Freundin, sie hat schon immer gewünscht, daß ihr Bruder sich mit ihr vermähle. Und dann: der Tod! Tod, weil gegen die Ordnung des Staats, aber nach der Ordnung der Natur ein neuer Mensch geboren werden soll! Sie ist bereit, zur Rettung alles zu tun, was sie kann.
Wie allmählich, wie zurückhaltend Shakespeare diesmal seine Motive bringt! Da haben wir, jetzt ganz im Hintergrund, den Herzog, den die Leute seiner Regierung und das Volk im fernen Polen glauben, der sich aber in einem Kloster verbirgt, um bald als Mönch zum Volk und zum Statthalter zu gehn, und zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Da ist der junge Mann im Gefängnis, vom Tode bedroht, und seine fromme Schwester soll helfen. Und da ist der Herr über Leben und Tod, der stellvertretende Fürst, Herr Angelo, und noch wissen wir nichts von seinem innern Wesen, noch kennen wir ihn nur aus Amtshandlungen und Kennzeichnungen aus dem Munde andrer; von seinem privaten Leben sehen wir gar nichts. Können wir uns auf das verlassen, was die Leute so über ihn sagen, jetzt zum Beispiel Claudios mit dem Mundwerk so leichtfertiger Freund Lucio, der Herrn Angelo also schildert:
Ist er so? Ist damit alles über ihn gesagt? Nicht sehr wahrscheinlich; Lucios Psychologie steht auf schwachen Beinen: die Heiligen und Anwärter zur Heiligkeit, die durch Fasten und Kasteien ihre Triebe im Zaum halten, spüren die Regungen und den Aufruhr der Sinnlichkeit nur allzu stark. Sollte das vielleicht der Fall des jungen, strengen Mannes sein, den der Herzog jetzt aus seiner Abgeschiedenheit holte und in die freie Welt, in die Welt des Befehls und der Verantwortung stellte?
Mit solchen Fragen und auf wahre Innerlichkeit gespannten Erwartungen treten wir in den zweiten Akt ein, in dem nun sofort Angelo als Hauptperson dasteht.
Bei einem Aufbau, wie ihn Shakespeare hier gewählt hat, daß eine Person inmitten des Dramas agiert, deren letztes Wesen und Geheimnis noch unbekannt bleibt und erst später enthüllt wird, könnte es eine Schwierigkeit für den darstellenden Künstler sein, daß er von allem Anfang an einen ganzen Menschen hinstellen muß, während wir nach der Absicht des Dichters noch im Unbestimmten bleiben, das Ganze noch gar nicht durchschauen sollen. Hier ist das keine ernste Schwierigkeit, weil Angelo, das sehen wir jetzt sofort und er sagt es überdies selbst, solange er’s irgend vermag, nicht in seiner privaten Menschlichkeit unter die Leute geht, sondern in der Rolle seines Amtes. Wie es mit ihm bestellt war, als er noch in seinem Wiener Palast sein strenges, privates Leben führte, ob auch da die Sittenstrenge ein Gewand war, das er aus Pflicht oder sonst einem Grund über seinen Menschen streifte und nicht auszog, das wissen wir nicht. Jetzt aber ist er vom Herzog mit dem Amtscharakter bekleidet worden; den trägt er, den hat er darzustellen, das ist seine Aufgabe im Staat, dagegen darf nichts aufkommen. Und das eben wird in dem Drama vorgeführt, wie der zurückgedrängte Mensch Sieger über die Rolle wird. Selbst wenn das nicht ein so wundervolles Motiv wäre, das unser aller Leben, das im Haus und das auf dem Markt, aufs nächste angeht, so wäre es immerhin erstaunlich, daß das Theater sich diesem Stück trotz manchen Versuchen in Wahrheit noch heute verschließt, einem Stück, in dessen Mitte das Problem steht, das den Schauspieler in seiner innersten Menschheit angeht: der Konflikt zwischen der Rolle, die ein Mensch annimmt, und dem von dieser Rolle unterdrückten Triebleben, das, während die Amtsperson ihre Rolle agiert, eben in der Betätigung des Amtes herausgekitzelt wird.
Escalus, der alte weise Mann, den der Herzog Herrn Angelo als nächsten Berater unterstellt hat, bittet für den mit dem Tod bedrohten Claudio. Da der Fall ihm arg ans Herz greift — er hat Claudios und Isabellas Vater gekannt und verehrt —, wird er sehr warm, und es fügt sich natürlich, daß er Herrn Angelo sagt: Kein Zweifel gegen Eure strenge Tugend; aber bedenkt doch nur, um welches Vergehen es sich handelt, besinnt Euch auf Euch selbst; hätte sich die Gelegenheit günstig und verführerisch erwiesen, hättet Ihr nicht denselben Fehler begehn können? Das ist menschlich gefragt; was Herr Angelo zur Antwort gibt, ist in großer Art unmenschlich und heißt nichts anderes als: Richtet euch nach meinen Worten und nicht nach meinen Taten, und noch viel weniger nach Trieben, Gelüsten und Regungen meiner Natur.
Was Angelo hier, in Vornehmheit und Amtswürde eingehüllt, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne über seine Natur das geringste zu verraten, verkündet, ist weder Tartüfferie noch Heuchelei zu nennen. So viel ist jetzt schon sicher, wo wir den Mann immer noch von außen abtasten: eine solche vereinfachende Karikatur wie den Tartuffe hat Shakespeare mit diesem Herrn Angelo nicht dargestellt; eher könnten wir darauf gefaßt sein, daß das, was Molières elende Psychologie als Heuchelei des isolierten Individuums gegeben hat, von Shakespeare in seinen gesellschaftlichen Zusammenhang eingefügt wird. Angelos Erklärung, Recht müsse Recht bleiben, auch wenn unter den zwölf Geschworenen, die einen Dieb verurteilen, einer oder zwei sitzen, die ärgere Diebe seien als der Beschuldigte, seine Erklärung, der Richter habe das Gesetz anzuwenden, ohne an seine eigene Natur, an seine eigenen verbrecherischen Triebe auch nur zu denken, diese Losung, die wir nannten: Richtet euch nach meinen Worten und nicht nach meinen Taten, — das ist in Wirklichkeit die Losung jeglicher Kirche, worunter hier jede Organisation zu verstehen ist, in der fehlbare Menschen die Hüter und Rächer eines Idealismus sind. Es geht in dieser gewaltigen Komödie nicht um so eine vom primitiven, abkürzenden, verleumderischen Denken erfundene Figur wie den Tartuffe, mit der man die Lacher aller Stände mit Ausnahme des jeweils betroffenen immer auf seiner Seite hat, sondern es geht um dieses Grundproblem der Kirche, der Schule, des Staats und seiner Rechtsordnung, um ein Problem von unendlicher Erhabenheit und unendlicher Komik, um ein Problem, das immer wieder neu ersteht, solange der Pfarrer in der Sakristei den Talar über den bürgerlichen Anzug streift, unter dem sein nackter Leib sitzt, solange der Richter in der Robe sich zur Frühstückspause zurückzieht, solange es in unsern Menschengesellschaften Bacons Idole gibt, an welche man hier, ohne vor den törichten Schlußfolgerungen der Baconianer Angst zu haben, sachlich zu erinnern hat[1]. Ehe wir Herrn Angelo wegen der These, die er hier verficht, einen Heuchler nennen, wollen wir uns besinnen, ob wir nicht wie er in unsrer Maske stehn, wenn wir als Vater oder Mutter mit unsern Kindern, als Kaufmann mit unsern Kunden, als Offizier mit unsern Soldaten, als Arzt mit unsern Patienten, als Mann mit der Frau, als Mensch mit Menschen, ja sogar als einzelner mit uns selbst und unsern Bedürfnissen zu tun haben.
Vielleicht verstehen wir jetzt besser, was es mit dem Problem auf sich hat, das Shakespeare hier behandelt, und mit der Behauptung der Prüderie, dieses Problem könne und dürfe bei uns nicht komisch behandelt werden, das Problem nämlich des Zusammenstoßes zwischen Geschlechtsleben und Rechtsordnung. Vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum es grade die Grundnatur des Tiermenschen, das Geschlecht ist, mit dessen Regulierung sich hier der Fürst und oberste Richter zu beschäftigen hat. Vielleicht verstehen wir jetzt auch schon, warum in diesem Stück die niedrige Sphäre der Hurenwirte und Kuppelknechte einen so breiten Raum einnimmt, verstehen, warum hier auch der niedrigste Standpunkt der Kritik an diesen Regulierungen des Staates zu Wort kommt, so, wenn zum Beispiel der Kuppelknecht, der den pompösen Namen Pompejus führt, bei den neuen Maßnahmen und Verfolgungen erstaunt fragt:
Soll die ganze Jugend in der Stadt kapaunt und wallacht werden?
Und wie das verneint wird, begreift er gar nichts mehr; braucht man denn nicht Freudenhäuser oder so ähnliche Anstalten, solange es lockere Buben und liederliche Dirnen gibt?
In der Tat ist das Geschlechtsleben von allen Grundtrieben des Menschen bei weitem der geeignetste, um auf der Bühne mit der Maske der Gerechtigkeit und Hoheit konfrontiert zu werden. Ein Zeichner kann eine komische Wirkung schon erzielen, wenn er einen Priester den Talar hochheben läßt, um, sagen wir, einen Floh zu fangen; oder wenn er einen Monarchen in seinem Ankleidezimmer im Hemd zwischen den Uniformen seiner verschiedenen Regimenter und Feldherrnstellen im In- und Ausland zeichnet; eminent komisch wirkt es, wenn wir etwa in einem Briefe Mirabeaus lesen, die Abgeordneten der Nationalversammlung hätten eine Sitzung in einem entscheidenden und kritischen Moment unterbrochen, weil sie das Bedürfnis verspürten, zu pissen; aber alle solche natürlichen Bedürfnisse und Verrichtungen, auch das Essen und Trinken, haben nicht annähernd eine so seelische Weite wie das Geschlecht, das in seiner Verbindung mit Wildheit, unbezwingbar Leiblichem und erschütterter Innigkeit das Tierische in uns mit der Phantasie und dem Geiste in nächste Beziehung bringt, das vor allen Dingen durch seine Polarität das Element des Dramatischen schon in sich trägt. So daß mich dünkt, Shakespeare hätte sich auf das, was aus dramatischen und eminent wichtigen ethischen und sozialen Gründen auf unsre Bühne gehört und in höchst bedeutendem Sinne komisch zu behandeln ist, besser verstanden als seine Kritiker.
Irgend etwas muß in Angelo leben, was ihn zu der unnahbaren Pose des Monarchen, der die staatliche, schon fast die göttliche Gerechtigkeit zu repräsentieren hat, besonders geeignet macht; und der Herzog muß es bemerkt haben. Aber ein andres — oder ist es das selbe? — lebt noch dazu in ihm, was die Grenze der Strenge bis zur Härte, bis zu einer fast wilden Grausamkeit hin überschreitet. Von dem Verhör der armseligen Kupplergesellschaft wendet er sich schließlich wie ein Gelangweilter ab und kann den Wunsch nicht unterdrücken, es möchte sich Grund finden, alle miteinander auszupeitschen. Mild und klug, als ein Mann, der in seinen hohen Jahren es noch nicht aufgegeben hat, mit Warnungen, Verweisen, bedingter Strafandrohung zu arbeiten, zeigt sich dagegen Escalus. Aber er, so will es für diese Zwischenzeit der Prüfung der Herzog, darf der Gerechtigkeit, sagen wir besser, der Justiz, nur dienen; Angelo ist ihr Herr.
Zu diesem Herrn des Rechts, der schon auf den nächsten Tag die Hinrichtung Claudios verfügt hat, kommt nun, um den Starren zu beugen, die angehende Nonne Isabella, des Verurteilten Schwester. Himmel und Welt treffen da auf einander, Welt in den beiderlei Formen von Staatsregiment und privatem Libertinismus. Furchtbar ist es diesem herben, keuschen Mädchen, daß sie für eine Sünde eintreten muß, die ihr vor allen verhaßt ist; so sind in diesem Zwiegespräch, das nun anhebt, die Rollen verteilt: Isabellas Natur sträubt sich gegen alles, was mit geschlechtlicher Unordentlichkeit im geringsten zu tun hat, sie hat aber, aus Liebe zu ihrem Bruder, das Amt übernommen, ihn zu erretten; Herr Angelo hat das Amt, ihn zum Gericht und zum Tode zu bringen; wie steht es mit seiner Natur? Was sagt die dazu?
Isabella hebt damit an, daß sie bittet, die Schuld und den Schuldigen zu trennen; die Schuld soll verdammt werden, nicht ihr Bruder. Schwächer könnte sie’s nicht beginnen; aber auch nicht gefährlicher für sich selbst; denn was geht es den Hüter des Rechts an, daß der Verurteilte eine Schwester hat? Lenkt sie nicht in ihrer Verlegenheit, in ihrer Scham sofort den Blick auf sich? Und tut sie übrigens damit nicht das, was ihr verzweifelter Bruder und sein leichtfertiger Freund Lucio von ihr erwarteten? Wenn Claudio meinte:
was kann er andres gewollt haben, als daß sie mit ihrem Persönlichen durch die starre, stachlige Hecke des Rechts hindurch auf die Person Herrn Angelos wirken solle? Wie schön wäre das, wenn die reine Menschlichkeit der Jungfrau alle Überzüge, Decken, Masken und Kostüme der Wortsysteme entfernte und zur reinen Menschlichkeit des Fürsten durchdränge? Aber ist das, in dieser Situation, unter Menschen, wo ein Menschliches ganz andrer Art dazwischen steht, zu erwarten? Wird es vielmehr nicht dahin kommen, daß Mensch von Mensch, wie sie jetzt getrennt sind durch das trotz allem ideale Gestrüpp des Rechts, nach dessen Entfernung noch viel tiefer getrennt sind durch das, was sich statt dessen zwischen ihnen erhebt und sie zusammenwerfen will? Das ist die Frage, vor die wir jetzt gestellt sind; und um dieser Frage willen ist das Stück so gebaut, daß wir Herrn Angelo nicht kennen, nichts von seinem Wesen, nichts von seinem Leben.
Auf diese Anforderung Isabellas, die Schuld zu verdammen, aber nicht den Schuldigen, hat der Mann des Strafrechts leicht antworten. Die Schuld zu verdammen, einmal für alle, dazu ist das Gesetz da. Er hat gerade das Amt, das Gesetz anzuwenden, ohne Ansehen der Person, auf die Personen, die es übertreten. Isabella, der ihre Rolle über die Kraft, so ganz gegen die Natur geht, sieht es seufzend ein und will gehen. Lucio hält sie zurück, ermahnt sie, flehentlicher zu sprechen; erinnert sie, daß es ums Leben geht. Das bringt sie zu größerer Klarheit, was hier ihres Amtes ist; sie darf nicht mit dem Wahrer des Rechts rechten, sie hat um Gnade zu bitten. Das aber ist ein Punkt, wo irgend etwas in ihm ganz besonders empfindlich getroffen sein muß; er scheint sich noch fester in den Mantel der Justiz einzuhüllen, ehe er schroff zur Antwort gibt:
Kaum, daß er als Mann, der sich eifrig, eifersüchtig an die Wahrheit hält, anderes sagen kann. Er ist ja nicht bloß der oberste Gerichtsherr; ihm ist in vollem Maße, ohne Einschränkung, auch die Gnade anvertraut worden. Das entnimmt sie, die, wir merken es mehr und mehr, eine der Frauen ist, die den Geist haben, der ihrer schönen Natur gewachsen ist, seiner kurzen Abweisung sofort; sie wird wärmer, weil sie nun am rechten Ort ist, und fragt, stellt fest, er könne also Gnade üben, wenn er nur wolle. Das rührt nun wieder an ein ungeheures Problem, an kein geringeres als das der Willensfreiheit. Herr Angelo hat in seinem Leben offenbar Gründe genug gehabt, sich mit ihm zu beschäftigen; und der Rigorist hat es in seiner Art gelöst:
Was hilft da alles Zureden? heißt diese Antwort, aller Versuch, ihn umzustimmen? Er kann doch den Willen nicht haben, den Schuldigen zu begnadigen. Während wir aber dieser Dialektik zuhören, achten wir noch auf etwas andres, kaum Merkliches. Der Mann, der da cäsarisch als Fürst steht, ist kurz, schneidend, schroff, sachlich in seinen Antworten bei dieser Audienz; er will seine Schuldigkeit tun, die Fürbitte zu hören, nichts weiter. Da fällt es auf, wie er allmählich ein ganz klein wenig weicher, wie auftauend wird; mal fügt er als Anrede das Wort „Mädchen“ in eines seiner knappen Sätzchen ein; mal mildert er eine Schroffheit, indem er „look“, seht her, dazu sagt. Man könnte wohl einwenden, das seien kleine Flickworte des Versdichters; aber da kennte man den Shakespeare dieser Stufe schlecht! Bei einer solchen Szene ist jedes Wort erwogen und steht kein Wort umsonst; und so sind wir an dieser Stelle schon ahnungsvoll gespannt, was sich weiter mit seiner Menschlichkeit begeben wird.
Und siehe da! Gleich bei seiner nächsten Replik ergibt sich zur Evidenz: der Mann ist verwirrt, er ist nicht mehr ganz verwachsen mit seiner Rolle, etwas in ihm fängt an, den Mann von dem Gewandträger loszulösen und einen Spalt zu eröffnen. Denn diese Antwort:
hätte er in normaler Gemütsverfassung nie geben können; so weit kennen wir den gegen sich selbst viel mehr noch als gegen andre harten und gewalttätigen Mann nun schon aus Schilderungen und aus seinem eignen Auftreten. Von der Gnade ist jetzt die Rede; er kann es nicht vergessen haben; und für Gnade ist es niemals zu spät. Isabella merkt auch sofort, daß da so etwas wie eine nachgiebige Stelle ist; jetzt erst läßt sie ihre schöne Menschlichkeit in ihr bitteres Geschäft, sie wird warm, lebhaft beseelt. Sie weiß ja, fühlt ja im Innersten, daß die Gnade, die menschliche Nachsicht mit der wahren Menschheit, wie sie in ihr selber lebt, mehr zu tun hat als das starre Recht. Sie spricht als eine Liebende; Eros redet aus ihr; und sie, die Strenge, Züchtige, Herbe, beinahe schon Nonne, ahnt nicht, wie der Eros und das Geschlecht bei dem einen aufs feinste, bei dem andern aufs gröbste und leidenschaftlichste beieinander wohnen, sie ahnt nicht, was sie in dem Manne erweckt, dem sie mit ihren kühnen, beflügelten, erwärmenden Worten, mit der ganzen Bewegtheit ihrer Seele, die aus Augen und Mienen und Haltung zu ihm hinüberstrahlt, das Amtskleid herunterreißt! Sie will die Liebe, die Gnade darunter zeigen, wenn sie sagt:
Irgendwie wird auch in ihr selbst in dem Grade und in der Art, wie es der keuschen Seele ziemt, damit, daß sie das so sagt, eine Hülle dünner, die das Geschlecht von dem Geiste des Eros in ihr trennt, und sofort findet sie die Brücke von ihrem Appell an die Gnade zu der Betrachtung: Wie bist du Mann denn eigentlich selbst in deinen Regungen?
Das trifft; diese Betrachtungen liegen dem Mann des Determinismus nahe genug; und vielleicht hat er auch sonst in seinem Inwendigen Gründe zu solchen Erwägungen, der Heilige? Aber heute hat er ganz Ähnliches schon einmal gehört, von Escalus, und da hat er scharf und trefflich erwidern können, ganz in der Hoheit des Amtes und der Ideologie:
Was aber weiß er jetzt zu erwidern? Er sagt:
sagt es dumpf, als handle es sich um etwas für ihn Persönliches, was er fast nicht mehr aushalten könne. Sie aber wird davon, von diesem Hauch des Verstehens, der von ihm zu ihr geht, nur kühner, sie ist jetzt mit Feuereifer, mit Hingegebenheit, mit Größe bei ihrer Sache. Erst zeigt sie ihm, was sie für ein ganz andrer Richter an seiner Statt wäre, wenn er als Isabella vor ihr stände; sie kann nicht ahnen, was sie mit dieser Vertauschung in dem wüsten Manne anrichtet, der bei dieser Vorstellung fast zurückweicht; Lucio, der mit dem Kerkermeister dabei steht, merkt es wohl. Sie aber ist eine so reine himmlische Seele und lebt so in den innigsten Vorstellungen ihrer Religion, daß sie von diesem Gedanken, sie wäre Richter, sofort wieder zur Gnade übergeht, die seinen mechanisch stereotypen Einwand, das Gesetz habe gesprochen, fortweist. Und wieder, von noch höher oben, erinnert sie ihn: Bist nicht auch du ein Sünder? Ähnlich ihrer Schwester Porzia, aber christlicher getönt, wie es der Novizin natürlich ist, ruft sie ihm in die Seele hinein:
Während sie so sprach, dadurch, daß sie so sprach, ist viel, ist Großes, ist fast schon Entscheidendes in ihm vorgegangen. Irgend einer in ihm hat einer Stelle in ihm eine Erlaubnis gegeben; etwas ist losgelassen worden. Er wird aufgeräumt, zutraulich, freundlich, und — oh über uns seltsame Menschenkinder! über das absonderliche Verhältnis in uns zwischen Trieb und Geist! — gerade dadurch, daß er da drunten irgendwo den Mann der Erhabenheit, den Mann im Amtskleid verrät und dadurch freier wird, ein Erlöster in ganz anderm Sinn, als die Christin jetzt eben dies Wort an sein Ohr klingen läßt, grade dadurch kann er die Sache seines Amtes jetzt wieder besser, jetzt wieder mit trefflichen Gründen verteidigen. Er ist nicht mehr starr und zugeknöpft; „schönes Kind“ sagt er zu ihr, und wie sie denn wieder, jetzt gar nicht mehr widerstrebend, im Feuereifer ihrer Rolle, der sie so sehnsüchtig Erfolg wünscht, von den „Vielen“ spricht, die dasselbe getan wie ihr Bruder, da doziert er ihr mit offenbarer Freude, wohlgefällig und mit vorzüglicher Beherrschung der Sache seine Theorie des Strafrechts:
Und wie sie ihn von dem starren Recht abbringen will und sein Mitleid anruft, da fährt er gewandt, elegant, beredt und grausam fort, Mitleid erweise er am meisten, wenn er Gerechtigkeit erweise:
Das alles ist für Isabella, an der wir mit immer innigerer Freude die schöne, seelen- und geistvolle Natur entdecken, unbegreiflich unmenschliche Überhebung und Pose; so ein kleiner Mensch will den strafenden Gott spielen, wo Gott selber lieber für unsre Sünden den Martertod erlitt, als daß er strafte!
Sie fühlt sich ihm nun, ohne zu ahnen, wieso der Machthaber einschrumpfte und der Mensch vor ihr wie in Fesseln kam, überlegen; es kommt wie Glück, wie Heiterkeit über sie; und mit der Vorwegnahme des Gefühls, sie könne ihren Bruder retten, fällt von ihr das Christelnde ab; sie wird weltlich, witzig, heidnische Vorstellungen, in denen sie in der gebildeten Sphäre ihres edeln Vaters aufgewachsen ist, werden von Angelos Theorie des gestrengen Rechts, nach dem jeder für seine Taten büßen muß, damit andre sich von ihnen abschrecken lassen, erweckt:
Sie erkennt, sie durchschaut den Mann, der jetzt selbst wie niedergedonnert kläglich vor ihr steht, wäre sie gleich erschrocken, wenn ihr einer von einem Wissen in ihr spräche, von dem sie in der obern, oberflächlichen Region unsres Geistes nichts weiß. Sie redet von dem Hochmut des Menschen; und in dem
klingt noch etwas anderes, klingt das spezifisch Männische in dem herrschenden Menschen an; von der armseligen autoritären Gewalt redet sie, von der gläsernen Gebrechlichkeit dieses Herrschaftsmannes, der sich wie ein wütiger Affe aufspielt, — sie weiß und weiß nicht, was sie dem Manne da vor ihr, da unter ihr sagt. Er wird ganz verwirrt, weiß gar nichts mehr zu sagen, schweigt und stammelt schließlich beinahe die Frage, wozu sie ihn mit all den Worten überhäufe; und sie nimmt herzhaft ihre ganze Kühnheit zusammen und schneidet mit großem Zuruf den Würdenträger vom Menschen ab:
Nönnlein! Nönnlein! Nur allzu gut ist dir geglückt, was du da unternahmst! Isabella hat Herrn Angelo mit diesen Worten, mit all ihrem schönheitsvollen, seelenberauschten Wesen das Amtsgewand heruntergezogen; aber der Arme, der Gepeinigte, der Peiniger seiner selbst! Darunter ist, meint er, nicht die seelenvolle Güte und Gnade, sondern der nackte, pochende, fiebrig gierende Leib. Wir aber, die wir ihn besser kennen, als er sich selbst, dürfen vorwegnehmend sagen: der Mann, der so lange den kalten Juristen sich und der Welt vorgespielt hat, der strenge Mann, der sich selbst vergewaltigt, der seine Triebe unterdrückt hat, der vielleicht von einer Gewissensschuld erdrückt wird, die er weit aus dem Gedächtnis verbannt, der nimmt da etwas für Brunst, für wütende, unwiderstehliche Geilheit, was seelische Innigkeit, was Mitfreude wäre, wenn er seine gute Natur nicht verfälscht und verwandelt hätte. Kaum ist sie weg — denn sowie er die Sinnlichkeit deutlich in sich hochsteigen fühlt, schickt er sie eilends fort, morgen soll sie wiederkommen, er flieht vor ihr und vor sich selbst, indem er sie für heute entläßt, aber — wie vielfältig ist der Mensch! — heute sind auch Zeugen bei der Unterredung, morgen werden sie wohl allein sein — da bekennt er sich, da fragt er sich staunend:
Es ist nur möglich bei Gewaltsmännern gleich ihm, die so anfällig sind, daß sich in ihnen die wunderzarte Erotik, die bei jeder Seelenfreude, Seelenbewegtheit auch das Geschlecht leise rege macht, in tobende Sucht verwandelt. Er wehrt sich, wehrt sich mit gewaltiger Anstrengung, hält sich ihre Reinheit, ihre Tugend, ihre Himmelsart vor, aber gerade damit, daß er ihre Seelenschönheit und den Ausdruck, den sie im bewegten Leibe findet, vor seine verwahrloste und verderbte Phantasie stellt, wird sein schmerzlich-begehrender Überwältigungstrieb zu diesem Weibe hin immer ärger.
Dieses Gespräch zwischen Angelo und Isabella ist von dem zweiten, das, wir fühlen es voraus, entscheidend sein wird, nur durch eine kurze Szene getrennt, die uns in unsrer erwartungsvollen Erregung eine Trosteshoffnung bringt: der hinter alledem steht, der diese Zwischenzeit der Prüfung gewollt und so ähnliche Ereignisse vielleicht gar vorhergesehen hat, der Herzog ist als Mönch in dem Gefängnis eingetroffen, in dem der junge Claudio auf seinen Tod wartet, und versteht sich gut mit dem braven, menschenfreundlichen Kerkermeister. Und dann sind wir wieder bei Herrn Angelo. Er erwartet Isabella; er möchte beten, aber Isabellas Gestalt tritt zwischen ihn und Gott; er will sich an den Staat, dem sonst all seine Gedanken gelten, anklammern, aber mit einem Mal, zum ersten Mal, findet er diese Beschäftigung langweilig und abgedroschen. Sonst streckte er sich stolz in Amt und Würde hinein und stand aufrecht und — er bekennt es sich — eitel in dieser Figurine da; jetzt sieht er ein: Rang und Form sind äußre Schale und Gewand, doch
Isabella, die nun bei dem Gepeinigten eintritt und gleich wieder als „schönes Mädchen“ begrüßt wird, hat am Tag zuvor alles gesagt, was sie irgend weiß; sie ist wieder herb und spröde geworden; und wie sie aus Angelos ersten, gepreßten Reden entnimmt, es müsse beim Todesurteil bleiben, wendet sie sich zum Gehen. Er hält sie aber auf, zunächst mit einem furchtbar heftigen Ausbruch, äußerlich gegen das Laster, das ihren Bruder zur Verdammung gebracht hat; er braucht aber diese leidenschaftlich aufwallende Rede, einmal, um seine eigne Glut irgendwie herauszulassen, dann, um mit dem Inhalt dessen, was er sagt, eben diese seine Wildheit in gewalttätiger Unterdrückung zu zähmen. So schäumt er gegen die unsaubere Lust, die das Standesamtsregister des Staates bastardiert, die Akten fälscht, das Leben der Neugebornen fälscht und in unheilvolle Bahnen lenkt; solche Zeugung ist nichts Bessres als Mord! Für staatsrechtliche und gesellschaftliche Argumente der Art, wie sie sein verzweifelter Kampf gegen sich selbst ihm aus dem bereiten Vorrat seiner Studien und Gesinnungen jetzt über die Lippen bringt, hat sie wenig Sinn; was ihr Bruder getan, ist ihr eine schwere Sünde vor Gott und eine Unordentlichkeit, die ihr widerwärtig ist; kein Verbrechen, das auf Erden, dem Staat gegenüber, mit dem Tode gesühnt werden müßte. Bei diesen ihren Worten jubelt es in ihm; sie wird also zu gewinnen sein, sagt er sich; er gibt den Kampf gegen sich auf und geht zum Kampf gegen sie, zu seiner Art der Werbung über. Ganz erbarmenswürdig, ganz erbärmlich geht er da vor; er denkt nicht daran, sein Begehren nach ihr nun vor allen Dingen loszulösen von dem Fall ihres Bruders; er denkt nicht daran und versteht es nicht, sich bei dieser Frau liebenswert zu machen; seine Gier kann er nicht trennen von der Situation, durch die sie ihm, wähnt er, verfallen ist. Haben, erobern, besitzen will er sie, da in ihm Gewalt des Triebs hämmert, mit Gewalt; die Gewalt des Triebs setzt sich bei diesem Mann, der darin geübt ist, den Trieb durch den Geist zu unterdrücken, jetzt, wo er ihn loslassen will, zur Vermittlung in Logik um. Das ist sein Instrument; raffinierte Manneslogik soll ihm zur Vergewaltigung, zu nicht viel Besserem als zur Notzucht dienen; in ein Dilemma, in diese gespreizte Gabel der Logik will er sie hineintreiben.
So legt er ihr zunächst die Frage vor, was ihr lieber wäre: daß ihr Bruder stürbe oder daß sie ihren Leib derselben lustvollen Unsauberkeit hingäbe, wie jenes Weib, das ihr Bruder befleckte? Sie ahnt nicht im entferntesten, was der Mann, den sie nun als starren Theoretiker schon kennen gelernt hat, mit der Abschweifung will, und erwidert zerstreut, aus frommer Gewöhnung heraus, den Leib würde sie gewiß eher geben als die Seele. Er antwortet ungeduldig; mit greulich dummer Brutalität versteht er so, als meine sie, eine beseelte Liebe, die zu solcher Sünde führe, wäre ihr ärger als die Preisgabe des Leibes selbst; und zu ihrer Beruhigung sagt er, die Seele könne ganz aus dem Spiele bleiben; es handle sich um eine pure Zwangslage. Sie versteht nicht, und er will jetzt ganz deutlich werden:
Entzückend, wie sie nicht im entferntesten versteht, was er meint, ganz sicher aber ist, recht zu verstehen; ja, er will barmherzig sein! Und eifrig, beglückt versichert sie ihm, das wäre keine Sünde, solche Gnade sei nur Barmherzigkeit. So geht es nun noch eine Weile mit dem Mißverstehen hin und her; der elende Tropf wird ärgerlich und redet grob, wie er wohl in schlechter Laune als Untersuchungsrichter mit einer unlogischen oder schlauen Angeklagten umgegangen wäre; und so legt er ihr denn knappe, ganz klare Fragen vor, um ihr jeden Ausweg zu verrammeln. Der Bruder muß sterben; das Gesetz spricht klar dieses Urteil. Das muß sie zugeben. Nun aber, wo er ihr bedeuten will, wie der Bruder noch zu retten sei, hindert ihn doch die Scham, direkt herauszureden; er setzt einen Fall, wie aus der Moralkasuistik. Gesetzt den Fall, der Bruder wäre vom Tod nur zu retten durch einen Mächtigen oder Einflußreichen; und „dieser Supponierte“ stellte zur Bedingung, daß sie, die Schwester, ihm ihren Leib preisgäbe; was würde sie tun?
Die Frage ist nun klar; nur daß sie noch immer keine Ahnung hat, warum er so fragt. Sie zögert keinen Augenblick mit ihrer entschiedenen Antwort. Wo’s um die Tugend geht, die von Seele und Züchtigkeit geboten wird, ist sie so fest bis zur Härte, wie er’s bis vor kurzem war, wenn sich’s um die Tugend handelte, wie sie Staat und Gesetz vorschreiben. Nur daß in der edeln Frau die Tugend keine Idee, sondern zur Natur gewordene seelische Notwendigkeit ist, während im Mann — selbst wenn ihm, wie Herrn Angelo, Adel nicht fehlt — die Staatsidee immer eine kahle Sache der Überlegung und des Verstandes bleibt, die sich gegen ursprünglichen Naturtrieb niemals behaupten kann. Was sie tun würde? Qualvoll sterben würde sie lieber — für ihren Bruder wie um ihrer selbst willen —, ehe sie den Leib der Schmach gäbe.
Er gibt es noch nicht auf, sie mit Theoretisieren zu fangen. Aber sie ist jetzt, in der Wallung des Zorns bei der bloßen Vorstellung solchen Schimpfs, wieder glühend geworden und repliziert schlagkräftig. Er möchte ihre Härte erweichen und meint grob aufmunternd:
sagt es aber nicht entschuldigend für Claudio, nicht einmal so recht für sich selber, sondern für die Weiber. Da gibt sie, und wundervoll wirkt in dieser Situation die unschuldige Lebhaftigkeit ihres Geistes, auf dieses sein Wort: Nein, auch die Weiber sind gebrechlich! zur Antwort:
Jetzt glaubt der Mann, den die Vermengung des Triebs mit entartetem, willfährigem Verstand zum bösen, verrannten Narren gemacht hat und den dazu noch gerade bei diesem Bilde des schwachen, leicht verführten Weibes eine persönliche Erinnerung ermuntern mag, sie zu haben. Sie redet der Schwäche der Frauen das Wort; nun — er faßt sich einen gewaltigen Mut — wir Männer sind auch nicht stärker. Sie soll nur ein Weib sein; mehr tut gar nicht not. Und er wird deutlich genug, daß sie endlich verstehen muß, was er ihr anträgt. Erst will sie immer noch annehmen, er wolle sie prüfen; wie er dann aber „auf Ehre“ erwidert, es sei ihm Ernst, muß sie’s glauben. Kaum einen Augenblick verweilt sie, deren Sittsamkeit so rein wie ihr Denken schnell ist, bei der Schmach, die dieser Antrag ihr antut; ihr liegt bei dem ganzen Gespräch nichts im Sinn wie ihr Bruder. Jetzt, glaubt sie, muß er gerettet sein: sie scheut die Erpressung gegen den elenden Machthaber nicht:
Ihm aber, der die Schwelle der Schamlosigkeit überschritten hat, ist nun keine Wahl mehr geblieben. Er kann nicht, er will nicht zurück; seine Gier läßt sich so nicht abweisen. Ihre Drohung schreckt ihn nicht; wer wird ihr denn glauben, wenn er’s abschwört? Solche Anklage gegen ihn, den Vertreter des Fürsten, dessen Ruf fleckenlos ist, dessen strenges Leben die Welt kennt? Einen Tag noch gibt er ihr Frist; bis dahin muß sie nachgeben; sonst stirbt ihr Bruder nicht den einfachen jetzt mehr, den martervollen, schweren, langsamen Foltertod.
Damit verläßt er sie. Und sofort sieht sie ein: ihr letzter Versuch ist gescheitert; sie kann die Gnade nicht erpressen. Ihr Bruder ist zum Tode verurteilt; jetzt auch von ihr; um ihrer Ehre willen muß er sterben. Sie geht zu ihm, um ihm das zu sagen: er stirbt nicht mehr bloß für sein heißes Blut; er stirbt für die Reinheit seiner Schwester.
Wiewohl sich alles um die Rettung dieses Bruders drehte, galt unser Anteil bisher viel mehr Herrn Angelo und Claudios Schwester, die ihn nun beide verurteilt haben. Jetzt, wo Angelo für lange zurücktritt, lernen wir Claudio kennen; durch den Konflikt zwischen Angelo und Isabella, der fürs erste in der Schwebe bleibt, ist, wir sehen es voraus, ein Konflikt zwischen den Geschwistern reif geworden. In dem Moment, wo der dritte Akt beginnt, stehen wir zwischen der physischen Möglichkeit und der psychischen Unmöglichkeit mitten inne: Claudio kann durch Isabella gerettet werden; er kann nicht durch sie gerettet werden. Der Vorhang geht auf; wir sehen den Herzog-Mönch bei dem zum Tod Verurteilten und sagen uns noch stärker als zuvor: Der aber, der wahre Fürst, wird ihn retten! Der Mönch bereitet den Gefangenen indessen zum Tod vor und spendet ihm die Tröstung keineswegs christlicher Verheißung, sondern allerbitterster pessimistischer Philosophie. Der Mann, der sich in den Tod finden soll, erfährt von dem erfahrenen, leidgeprüften Pilger durch sein Reich, was das Leben ist. Claudio, dessen Gemüt rasch bewegt und dem Moment unterworfen ist, ist für den Augenblick ruhig:
Da sagt der Mönch, und diese große Rede, die weniger auf den Tod vorbereiten als den Tod im Leben, die Abgeschiedenheit, lehren will, wollen wir ausführlich vernehmen:
Erst ist Claudio davon wunderbar besänftigt; dann aber, wie zum Mönch der skeptischen Resignation mit frommem Friedensgruß die Nonne in dieses Gefängnis dazukommt, wie die Lichte aber nicht die Erlösung bringt, sondern den Zweifel, da kommt die Todesangst über ihn.
Ihr ist es notwendig, ihm alles zu sagen; keineswegs um ihm die Entscheidung zu überlassen; so lieb sie ihn hat, so sehr wir ihr glauben, daß sie ihr Leben an seine Rettung setzen würde, in dieser Sache gibt es keine Beratung und keine Wahl für sie. Sie will aber, daß er sie stützt, daß er jeden Gedanken an ihr Opfer verwirft; daß sein Tod jetzt einen Sinn bekommt: er soll wissen, daß er für seine Schwester stirbt. Mit dieser Absicht ist sie gekommen; jetzt aber, wo sie seine weichen Züge sieht, bangt sie im voraus vor dem, was nicht ausbleibt. Erst, wie er’s vernimmt, ist er entsetzt, daß sein strenger Richter so dastehn soll; dann sieht er ein, daß sie sich nicht preisgeben darf, und will sich in den Tod, vor dem jetzt keine Rettung mehr ist, finden. Aber es regt sich ein Sinnen in ihm; also dieser erhabene weisheitsvolle Mann ist doch auch dem Trieb unterworfen! Claudio wagt nicht zu sagen, kaum auszudenken, wie ihm von dieser Vorstellung, daß die Lust doch mächtiger sei als alles, die Gedanken von Angelo zur Schwester, von der Schwester, die nun über sein Schicksal verfügt, zu seiner eigenen Lebenslust irren. O Isabella! Mehr vermag er noch nicht als diesen Ausruf; und dann, immer noch wieder gebändigt und bedächtig, sinnt er vor sich hin:
Wie sie aber, schon in streng vestalischer Abwehrstellung, erwidert:
da, wo für ihn auf der einen Seite das Leben, sein Leben, steht, auf der andern — ein Nichts, ein Wort, eine Tugend, von deren Notwendigkeit seine eigne Natur kein Wissen und keine Erfahrung hat, die ihm ein so kaltes Schema ist wie der Staatsgedanke, dem er geopfert werden soll, da wallt die Todesangst zu einem gewaltigen Ausbruch heraus. Vergessen auch alles, was der Mönch — der, ohne daß die beiden es wissen, alles mit anhört — Schlimmes an die Adresse des Lebens gesagt hat; nur leben, leben will Claudio, leben um jeden Preis! Er sieht das Grauen des Grabes vor sich, er ist in der Situation des Prinzen von Homburg, und ich zweifle nicht, daß Kleist, dem dieses Stück ja auch sonst so ganz besonders, so unsäglich nah gehn mußte, aus dieser Szene den Mut zur Fassungslosigkeit seines Prinzen geschöpft hat; geht Kleists Szene darin über Shakespeares hinaus, daß sein romantischer Prinz sonst von Natur und Gewöhnung in der Rolle des Helden steht, so ist wiederum Claudios Ausbruch insofern erschütternder, als dieser weiche Genießer nicht bloß die eigne Würde wegwirft, sondern die Schwester anbettelt, sie solle um seinetwillen sich in Schmach und Ekel stürzen:
Erst war die Schwester bei diesen apokalyptischen Bildern von den unausdenkbaren Schrecknissen, die der Seele im Tode warten, unnennbar erschüttert worden, ins Gewissen hinein; was kann den fühlenden Menschen schwerer treffen, als wenn er aktiv hilflos sein muß: wenn er physisch erretten könnte, aber angesichts bitterster Not in dem moralischen Entschluß steht, stehn muß, nichts zu tun? Wie Claudio dann aber seinen fassungslosen Jammer in diesen Anruf münden läßt, da schlägt all ihre Innigkeit in lodernde Empörung um. Über alle Grenzen setzt ihre Verachtung gegen diesen Wicht vor ihr, der um diesen Preis sein Leben erhandeln möchte. Sie spricht ihm endgültig das Todesurteil; sie kann ihn nicht retten; das wußte sie vorher; er verdient nicht zu leben; das empfindet sie jetzt und sagt es ihm.
Da tritt der Herzog dazu. Was hat er gehört! Von all diesen Zusammenhängen, von seinem Statthalter Angelo!