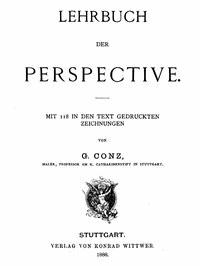Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht feiern ist auch keine Lösung! Geburtstage sind ebenso großartig wie unvermeidbar - und das gilt nicht nur für uns, sondern auch für Tanten und Onkeln, für Eltern und Geliebte, für Omas und Opas, für Freundinnen, die nicht älter, und Kinder, die nicht rasch genug größer werden können. Sogar an jene wird hier gedacht, die vor jeder Feier ans andere Ende der Welt (oder auch nur in die nächste Bar) flüchten, ebenso an die Auserwählten, die am 29. Februar, am 1. Mai oder am letzten Tag des Jahres geboren oder gar bereits wiedergeboren sind: 25 zeitgenössische Autorinnen und Autoren schenken uns ihre schrägsten, herzerwärmendsten und unglaublichsten „Geschichten zum Geburtstag". Dieses Buch selbst ist schon ein Grund zum Feiern. Mit Geschichten von Polly Adler, Ela Angerer, Bettina Baláka, Ruth Cerha, Friedrich Dönhoff, Petra Hartlieb, Monika Held, Peter Henisch, Wolfgang Hermann, Margarita Kinstner, Elisabeth Klar, Edith Kneifl, Konrad Paul Liessmann, Heidi List, Klaus Nüchtern, Klaus Oppitz, Kurt Palm, Verena Petrasch, Eva Rossmann, Tex Rubinowitz, David Schalko, Susanne Scholl, Dirk Stermann, Cornelia Travnicek, Anna Weidenholzer und einem Songtext von Gustav
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TortenschlachtenGeschichten zum Geburtstag
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2015 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucksund das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nanna PrielerTypografische Gestaltung, Satz: BoutiqueBrutal.comSchriften: Mr. Moustache, Nexa, MinionLektorat: Jessica Beer
ISBN 987 3 7017 4518 0
Inhalt
Petra Hartlieb
Vorwort
Gustav
Happy Birthday
Polly Adler
Mon dieu, Dépardieu
Peter Henisch
Geburtstag in Istanbul
Anna Weidenholzer
Disko
David Schalko
Badeschluss
Monika Held
Der Maikäfer gehört auf den Baum – das Maikind auf die Straße oder: Es lebe der 1. Mai! Es lebe die Anarchie!
Klaus Oppitz
Fledermauswiedergeburtstag
Bettina Balàka
Friedhof der Kuscheltiere
Klaus Nüchtern
Fats Navarro in Großraming
Elisabeth Klar
Wolle und Staub
Dirk Stermann
Die Kuhnase
Verena Petrasch
Der Junge, der seinen Geburtstag in einer Kiste verlor und ihn viele Jahre später auf der Straße wiederfand
Friedrich Dönhoff
Rate mal …
Susanne Scholl
Stella – Ein Geburtstagsmärchen
Eva Rossmann
Aufriss
Wolfgang Hermann
Knut
Heidi List
Das Leben mit meinem Geburtstag
Tex Rubinowitz
Der große Schwindel
Cornelia Travnicek
Auf Ex
Margarita Kinstner
Mein Vater, der Clown
Kurt Palm
Wie ich einmal meinen 50. Geburtstag in Lappland nicht gefeiert habe
Ruth Cerha
Zwölf Stunden und dann?
Ela Angerer
Die Essigmutter
Konrad Paul Liessmann
Das Sonntagskind
Edith Kneifl
Schuhe von Ferragamo
Petra Hartlieb
Meine Geburtstage
Biografien
Petra Hartlieb
Vorwort
An meinem Geburtstag bekomme ich keine Geschenke und es wird auch nicht gefeiert. Mein Geburtstag ist der 18. Dezember und der fällt Jahr für Jahr ins Wasser, denn ich verkaufe an diesem Tag unzählige Bücher, die ich natürlich als Geschenke verpacke, damit sie bei anderen Leuten unter dem Christbaum liegen.
Wer also, wenn nicht eine Buchhändlerin, die im Dezember Geburtstag hat, wäre berufen, eine Anthologie zum Thema »Geburtstag« herauszugeben?
Noch dazu, wo das sogenannte Geschenkbuch in den meisten Buchhandlungen nicht gerade zur beliebtesten Warengruppe zählt – die meisten unserer Mitarbeiter/innen haben dringend etwas im Lager zu erledigen, wenn jemand ein »kleines Geschenk für ein Geburtstagskind« sucht. Damit ist nun Schluss, denn von nun an steht dieses Buch in den Geschenkbuchabteilungen der Buchhandlungen, die Autor/ innen sind zwischen 27 und 70, und deswegen ist dieses Buch das perfekte Geschenk für alle zwischen 17 und 99.
Gustav
Happy Birthday
heute also ein jahr älter
lacht nicht ihr alle werdet sterben
im freien fall und ohne netz
tja, das leben ist kein wunschkonzert
nein, das leben ist kein wunschkonzert
alter also fortgeschritten
musst nun ständig neue risse kitten
um nicht einzufallen und abzudrücken
aufzuprallen und einzuknicken
es gilt rauszugehen und aufzublicken
und blumen von den wiesen zwicken
ich will friede und freude
und verdammt noch mal den eierkuchen
und die freunde – die friends
die möcht ich mir gefälligst selbst aussuchen
doch und das sei stets vermerkt
das leben ist kein wunschkonzert
nicht für peter, nicht für boris,
nicht für achmed, nicht für todd
nicht für svensky oder rita
nicht für rosie vormals bob
nicht für martha
nicht für elke
nicht für isa
nicht für fred
nicht für simon oder gitte
nicht für hassan oder sepp
nicht für hamid oder hertha
nicht für geli oder bert
nicht für julia
nicht für jens
den haben sie nämlich eingesperrt
nicht für robert und roberta
nicht für erik
nicht für killy
nicht für oliver und elise
nicht für pierre
nicht für billy
das leben ist kein wunschkonzert
das leben ist kein wunschkonzert
nicht für tonkov, für alexi, nicht für barbara-luise
nicht für reinhard oder agnes
nicht für kiang, nicht für marie
nicht für stefan
nicht für maggie
katharinchen & tahir
nicht für leon ab-al-kadil
nicht für lory und emil
nicht für lars, lini, lilly
nicht für drehli und gabou
nicht für esthers schwester aki
nicht für dorian und flo
nicht für filip oder ona
nicht für hong
nicht für ann
nicht für clara und luzia
nicht für mirko & juan
nicht für imke und hermine
nicht für eva
nicht für björn
nicht für edith
nicht für walter
hab schon lang nichts mehr gehört von ihm
nicht für youssuf oder adi
nicht für lore & andré
nicht für andrew und alisha
nicht für bogdan und noel
nicht für karmil oder karsten
nicht für mutti
nicht für dirk
nicht für francis oder fjodor
nicht für basti
nicht für kurt
nicht für valerie & judith
nicht für søren
nicht für shin
für elfriede oder sara
oder lotte, stan und tim …
… nicht für thelma & luise
nicht für gerhard
nicht für karl
nicht für sigrid und für pearl
für eugena, für luigi
nicht für agnes
nicht für nell
nicht für samuel, für pablo
nicht für jeanne
nicht für claude
nicht für dario und lise
nicht für harold und für maude
nicht für matze
nicht für maki
nicht für bine
nicht für ted
nicht für kathrina oder patrick
nicht für martin, eugen, ed
nicht für katja oder sonja
nicht für jürgen
nicht für paul
nicht für max und nicht für martin
nicht für william
nicht für saul
nicht für charles & camilla
nicht für karo
nicht für wolf
nicht für dimitri und lakis
nicht für siegfried und für rolf
rolf?
nicht für anselm und castillez
nicht für conny für kristin
nicht für wolferl und für schurli
nicht für sergey und tylin
nicht für taylor und für mia
nicht für chloe
nicht für yu
nicht für sandra
nicht für ulrich
nicht für franz und nicht für lou
nicht für gunnar und für eike
nicht für ben und nicht für pet
nicht für hanni und für nanni
für die is es längst zu spät
nicht für fredl und antonio
nicht für giovanna und für keith
nicht für hatari und für bilal
nicht für fuad und auch nicht für steve
nein, das leben ist kein wunschkonzert
das leben ist kein wunschkonzert
nicht für yoko und für seli
nicht für hedi und für h.
nicht für hugo und für viktor
nicht für carla
nicht für mark
nicht für henning oder mona
nicht für hershel oder fritz
nicht für otto oder emil
nicht für woody
nicht für liz
nicht für donald oder ronald
nicht für tina
nicht für mark
nicht für hentat oder una
nicht für betty oder eik
nein, das leben ist kein wunschkonzert
nein, das leben ist kein wunschkonzert
nein, das leben ist kein wunschkonzert
nein, das leben ist kein wunschkonzert
nein, das leben ist kein wunschkonzert
Polly Adler
Mon dieu, Dépardieu
Also dieser Geburtstag. Ein etwas unheimlicher Geburtstag. Auf alle Fälle kein Fest. Denn was gibt es eigentlich genau daran zu feiern, dass man im besten Fall die Hälfte seines Lebens schon hinter sich hat? Im allerbesten Fall. Mit 40 war man noch im letzten Quartal der Jugend angelangt. Und jetzt sitzt man unwiderruflich im ersten Drittel des Alters fest. Man kennt bereits unheimlich viele Menschen, die unheimlich viele gesundheitliche Probleme haben. Und auch gerne darüber erzählen. »Way too much information« als SOSParole gegen den Tsunami an Krankengeschichten nützt nicht immer. In den Parfümerien bekommt man ja schon längere Zeit unaufgefordert Probetuben für die reife Haut.
Was habe ich mir eigentlich gewünscht? Zeit, Zeit, Zeit und noch einmal Zeit. Aber in welchem Ambiente? Und unter welchen Umständen?
Eines Nachts kam mir die Königinnenidee. Ich werde die Stadt verlassen. Einen ganzen Monat. Keine Deadlines, keine Ausredentourneen, warum dieser und jener Text schon wieder einmal so was von verzögert ist. Und nach Paris ziehen. Klischeevertrottelt? Aber ja. Paris war schon in meiner Spätpubertät mein Stadtfetisch. Ich war in einen Franzosen bis zum Anschlag verliebt, der noch dazu Jean-François hieß, bordeauxrote Pullunder trug und von dem ich bis heute einen Stapel lavendelfarbener Liebesbriefe, die noch immer nach seinem Chanel-Rasierwasser riechen, im Archiv des Herzens aufbewahrt habe. Das Leben musste dringend wieder weniger Amstetten und mehr Paris sein. Vor allem vor dieser bedrohlichen Jahreszahl.
Unvernünftig? Hundert Pro! »Sechsspännig ins Armenhaus« war schon immer mein Lebensmotto gewesen. Der Verschwendungsfrohsinn war einfach nicht aus meinem System rauszukriegen.
Ich verhandelte also mit der Bank über einen gesprengten Überziehungsrahmen. Eine handverlesene Schar von Menschen lud ich ein, mich bei diesem Experiment für ein paar Tage zu begleiten. Der Fortpflanz durfte auch mit. Für kurze Zeit. Schließlich war das auch ein Belohnungstrip dafür, dass man das Kind aus dem Gröbsten hochgezogen hat.
Und dann war ja auch noch meine Freundin M immer wieder in Paris. Sollte mir die Einsamkeit in die Knochen kriechen, konnte ich bei ihr Zuflucht finden. Wir hatten viel gemeinsam, aber die Eigenschaft, die uns am meisten verband, war, dass wir nie im Club der Vernünftigen um eine Mitgliedschaft angesucht hatten.
Ich fand eine winzige, drollige Wohnung – wie aus dem Klischeebilderbuch gepurzelt sah die aus – in der Rue Clauzel. Das dazugehörige »Quartier« trägt den fetzigen Kosenamen »Sopi«, so die Abkürzung für »South of Pigalle«, und erstreckt sich rund um seine Lebensader, die Fressstraße »Rue des Martyrs«. Überquert man den Boulevard Clichy, die runtergerockte Sündenmeile, fällt man sofort in das ehemalige Künstlerdorf Montmartre, das noch immer wie eine Mischung aus Disneyland und Mörbischer Operetten-Kulisse wirkt. Dazwischen liegt viel Einzelhandel mit den thematischen Hauptgebieten Lack und Leder; sollte man achtschwänzige Peitschen brauchen, ist man in dieser Gegend goldrichtig.
Der erste Abend. Ich denke an Jean Gabin, der stehend aus seinem Cabrio »Es lebe die Freiheit – besonders meine!« in die Welt gebrüllt hatte.
Gegen acht, halb neun sammeln sich in der Bar des Belle-Epoque-Restaurants »La Mascotte« in der Rue des Abbesses die Kaufleute, die eben die Rollbalken ihrer Läden hinuntergezogen haben. Damen mit aufmüpfigem Make-up, manche haben auch einen Mops wie eine Clutch unter den Arm geklemmt, kleben an der Bar. Bobos in Ringelshirts, die sich wie überall auf der Welt an ihre iPhones klammern, sitzen an den Tischen.
Ich habe noch nirgendwo auf der Welt so viele fantastisch aussehende Frauen mit einem solchen Talent für Exzentrik jenseits der siebzig gesehen wie in Paris.
Les Parisiennes haben aber ohnehin in jeder Altersgeneration »Mauerblümchen« nicht in ihrer Berufungsbezeichnung stehen. Das Schöne an den Damen von Paris ist, so erzählte einmal Michael Heltau, dass sie morgens vor dem Spiegel ausufernd zwirbeln, pinseln und sich schmücken, aber ihr Arrangement immer unangestrengt und wie aus der Hüfte geschossen wirkt.
Meine absolute Favoritin in dieser Klasse sollte Denise Acabo werden, die in einem verzauberten Schokoladeladen unweit der Place Pigalle Veilchenbonbons, Schokolade und Lakritzen verkaufte. Sie war knapp achtzig und zog sich wie ein Schulmädchen an: Krawatte, Zöpfchen, blauer Faltenrock. So hatte auch ihre Internatsuniform bei den Nonnen in der Dordogne ausgesehen. Und weil sie immer verlässlich unartig gewesen war, hatte sie am Freitag nie wie die anderen Mädchen Süßigkeiten bekommen. Ihr Geschäft war sozusagen die wunderschöne Rache an den hartherzigen Bräuten Gottes. Und ein anachronistisches Paradies. Zwei Jahre später sollte dieses anachronistische Paradies von einer Gasexplosion zerstört werden. Denise überlebte, aber sie würde die Kraft für einen Neustart nicht mehr finden. »Es ist immer jetzt«, heißt ein Chansonabend von Michael Heltau. Und nie habe ich diesen Satz besser verstanden als in diesem schneeverwehten März 2013 in Paris.
Während sich der feudale Speisesaal des »Mascotte« erst zögerlich zu füllen beginnt, vibriert das Leben im Eingangsbereich. Im Stehen werden Austern, die auch im freien Verkauf vor der Tür angeboten werden, mit einem Gläschen Sancerre umspült und dabei wird laut debattiert. Was denn dieser Hollande nicht für ein unentschlossener Schwachmatiker wäre. Wie man an dem Nationalheiligtum von neun Wochen Ferien überhaupt rütteln dürfe. Ob Strauss-Kahn jetzt schon zu Hause ausziehen musste oder ob er noch ein wenig geduldet wird.
An einem Tisch weiter hinten streitet sich ein Paar mit für alle hörbarer Leidenschaft. Sie knallt ihm eine Serviette um die Ohren und verlässt das Lokal mit der Ansage: »Va te faire cuire un oeuf!«
Wie mir später ein Barbesucher erklärte, käme die Aufforderung, er solle sich doch besser einfach ein Ei kochen gehen, idiomatisch der Bedeutung von wütendem Desinteresse für das Gegenüber gleich. An einem Ort, in dem so hingebungsvoll und gleichzeitig so selbstverständlich dem Hedonismus gefrönt wird, eine völlig nachvollziehbare Metapher.
Am nächsten Morgen ein Spaziergang durch die Rue Lepic, in der schon Van Gogh mit seinem Bruder Theo oder der Schriftsteller Céline wohnten und die auch der verhuschten Film-Amélie als Spielplatz diente. Fischhändler reihen sich an Käseboutiquen, in den Rôtisserien drehen sich knusprige Hühner, die wahrscheinlich sogar einen Vornamen hatten. In der »Épicerie du terroir« werde ich einen halbstündigen Vortrag über die besten Käsevariationen des Landes bekommen.
»Es ist unmöglich, ein Land, in dem es 365 Käsesorten gibt, zu regieren«, seufzte General Charles de Gaulle.
Da der durchschnittlich verdienende Mittelschicht-Pariser mit einer Wohnung von circa 45 Quadratmetern sein Auslangen finden muss, spielt sich das Leben in der gesamten Stadt vor allem draußen ab. Auch bei Eiseskälte. Die Pariser simulieren das ganze Jahr über Frühling und sitzen auch bei Schneeregen kettenrauchend unter den Heizlampen vor den Türen der Cafés und Bars. Drinnen wird getrunken und das Essen zelebriert, als ob man der Krise den Mittelfinger fröhlich zeigen wolle. »Zu dinieren heißt vor den Augen der Welt zu existieren«, hat der Paris-verrückte Honoré de Balzac geschrieben. Er war notorisch pleite, genussversessen, unvernünftig und erotoman – so wie die Stadt, die er in seinen Romanen mit nahezu pathologischer Verliebtheit beschrieben hat. Irgendwann in diesem Monat ging ich auch in das Haus, wo er sich die Finger bei Hektolitern von einem Whiskey-Kaffee-Gebräu wund geschrieben hat. Das hatte ich M versprechen müssen.
Ich dachte an die Rezeptur, die Yasmina Reza ihren Figuren bei Liebeskummer gern verordnete: »Zehn Kilo abnehmen und den ganzen Balzac lesen …« Doch es war weit und breit kein Kummer in der Gegend – in diesem schneeverwehten Frühfrühling 2013.
Ich habe M während dieser Zeit oft gesehen. Eines Abends saßen wir in der Rue du Cherche-Midi – unter einem puffroten Baldachin im »Rousseau«, es regnete Eis und Schnee, doch auch wir saßen natürlich kettenrauchend draußen, dicht gekuschelt an eine Heizlampe. »Dort drüben«, sagte M, »ist die Fischhandlung von unserem Chéri … Ich habe ihn schon seine Verkäuferinnen durch die Luft wirbeln sehen.« M war die ideale Lehrmeisterin für Paris. Paris war für sie keine Stadt, sondern ein Zustand. Über ihren Problemliebling, das »Chérichen« Gérard Dépardieu, wusste sie besonders viele Geschichten. Eines Nachmittags hatte sie wieder ihr Schreibbüro auf dem Gehsteig des »Rousseau« aufgeschlagen; das Auge dabei stets auf das schmiedeeiserne Tor des diskreten kleinen Palais geheftet, in dem Dépardieu unweit seiner todschicken Fischhandlung residierte. Laut geschminkte Damen fielen dort immer wieder ein, schrankgroße Pizzakartons wurden zugestellt und einmal kam der Problemliebling höchstpersönlich, eingezurrt in eine Ledermontur, herausgepoltert. Er zwinkerte M zu, ehe er sich seinen Helm aufsetzte und das Visier runterklappte. Dann brauste er auf seinem Motorrad davon. »Mon dieu, Dépardieu«, seufzte M, denn es war landesweit bekannt, dass er wenige Tage zuvor seinen Führerschein abgeben hatte müssen. M’s Herz für schlimme Buben war prinzipiell scheunentorweit offen.
Es sind inzwischen zwei Jahre vergangen. Und nichts ist wie vorher. Denn M ist nicht mehr da. Auf dem letzten Foto, das ich von ihr gemacht habe, steht sie vor einem Laden in der Rue du Bac, in dem es nichts als gerüschte Regenschirme gibt. Für die feinen Damen. Also nicht für uns. Ich dachte an unseren Ausflug mit dem 69er-Bus, mit dem wir quer durch die Stadt getuckert waren. Als wir Besen in Gambetta gekauft hatten. Durch die feine Tierhandlung bei Notre-Dame streiften, in der die Pariser die Schoßhündchen deponierten, derer sie überdrüssig geworden waren. Im »Deux Magots«, wo wir viel kardinalsroten Wein tranken, hätte M einmal um Haaresbreite den Kuschelköter von Fanny Ardant zu Brei getreten. Ich dachte an unseren Besuch der Victor Hugo-Wohnung auf der Place des Vosges. Eine feudale Zimmerflucht. Im Audienz-Vorraum war sie richtig wütend geworden, denn hier musste der für die vornehme Familie Hugo nicht salonwürdige Balzac oft stundenlang warten, ehe er zum alten Victor vorgelassen wurde: »Unser Maître, stell dir vor, wie einen dreckigen Hund hat ihn die alte Hugo behandelt!« Balzac war ihr heilig. Wahrscheinlich hatte sie in ihrem Leben nur unwesentlich weniger in unzähligen Zeitungen geschrieben als er. »Den Großmeister der Baustelle Mensch« nannte sie ihn. Und nächstes Mal, sagte sie oft, müssten wir unbedingt zu seinem Grab am Friedhof »Père Lachaise« und natürlich zu dem der Piaf und dem von Marie Trintignant, dort, wo immer Blumen liegen – »wie frisch geweint«. Nein, einsam fühlte sie sich hier nie: »Das Wort ist mir hier noch nie eingefallen. Und wenn, hat es eine solche Wärme, dass man nicht einmal den Tod fürchtet.«
Ich werde deinen geliebten Krummbeinigen allein besuchen müssen, im kommenden und allen anderen Frühlingen. Und mir einfach vorstellen, dass du nicht weit bist, M. Paris wird das schon irgendwie hinkriegen.
In meiner Geldbörse habe ich noch einen Zettel, auf den sie mir einen Satz von Colette gekritzelt hatte. Er stammte aus einem Tagebucheintrag der damals schon greisen Colette und lautete: »Was für ein herrliches Leben ich doch hatte! Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt.«
Es ist ein Satz, der eigentlich in keiner anständigen Geldbörse fehlen sollte.
Peter Henisch
Geburtstag in Istanbul
An meinem Geburtstag, dem kritischen dreißigsten, schlüpfe ich in die neue Hose, ziehe das frische, ebenfalls im Bazar gekaufte Hemd an und schau froh gelaunt in den damals noch wenig versmogten, also fast blauen Himmel über Istanbul. Sonja und ich, wir haben auf einer Dachterrasse geschlafen, hart aber gut, das heißt, jedenfalls wanzenlos, was unten in dem von uns zwar gemieteten, aber nur zum Waschen und Zähneputzen benutzten Zimmer nicht sicher wäre, aber das Hotel, in dem wir wohnen, ist trotzdem ein nettes. Habt ihr gut geschlafen?, fragt uns der Typ an der Rezeption in dem Allerweltsenglisch, das sich fast alle in diesem Viertel hier angeeignet haben, um mit den Folks, die hier vorbeikommen, zu kommunizieren. Und ja, sagen wir, natürlich haben wir gut geschlafen, es war nur ein bisschen heiß in unserem Zimmer, und darum sind wir aufs Dach ausgewichen. Sure, sagt er. I know.
Dann frühstücken wir im Puddingshop, dort bekommt man auch wirklich Pudding, und der war mir schon als Kind viel lieber als jede Torte. Ehrlich gesagt, sage ich, habe ich Torten nie wirklich leiden können. Obwohl es ein Foto gibt, auf dem ich eine Kerze auf einer Torte ausblase, nämlich die einzige Kerze auf einer vor mir aufgebauten Torte, offenbar an meinem ersten Geburtstag, und dieses Foto im Familienalbum haben diverse Tanten immer besonders lieb gefunden. Aber ich mag keine Torten, ich mag Pudding viel lieber, also sind wir genau am richtigen Ort.
Dann sitzen wir noch bei Yener, dem »King of Hippies«, und ich trinke mein Geburtstagsbier. Ist mir auch lieber als etwa Sekt, und das türkische Bier, finde ich, kann man durchaus trinken, sogar schon am Vormittag. Diesbezüglich war Gerd nicht meiner Meinung, aber der ist, Allah sei Dank, an meinem Geburtstag nicht dabei. Unsere Wege haben sich schon vor einem Monat oder wie lang das jetzt her ist (man verliert auf dem Hin und Her so einer Reise ein wenig das Gefühl für die Zeit), getrennt, das war an der Stadtausfahrt von Isfahan, wir schauten seinem Auto, in dem er uns so weit mitgenommen hatte, noch eine Weile nach, wie es im Staub der Straße verschwand, er hinterließ eine Staubwolke und wir standen da, aber wir atmeten auf.
Und jetzt ist er wahrscheinlich schon in Indien, dieser Gerd, oder auch nicht, aber vielleicht hat er es ja wirklich geschafft. Und wir stoßen auf ihn an, Sonja und ich, mit Bier und Ayran. Vor allem aber stoßen wir auf meinen Geburtstag an, 30, das ist schon komisch, dass man dieses Alter, in dem man den Ernst des Lebens endlich begreifen sollte, so wurde uns das jedenfalls prophezeit, eines Tages wirklich erreicht, Sonja hat ja noch vier Jahre Zeit, bis es mit ihr so weit ist. Aber ich bin schon jetzt so weit, das heißt, noch nicht ganz, denn wenn ich der Erinnerung meiner Mutter glauben soll, bin ich zu Mittag geboren, rechtzeitig zum Essen, hat sie erzählt, und wenn es wahr ist, hat sie mich dann gleich an die Brust genommen, eine schöne Vorstellung, allerdings muss man auch die Zeitdifferenz zwischen Istanbul und Wien berechnen, genau genommen schlägt meine nach mitteleuropäischer Zeit mittägliche Geburtsstunde hier erst zwei Stunden später.
Jetzt vor dreißig Jahren war ich also noch unterwegs, sage ich, gerade erst dabei, mich einigermaßen freizustrampeln. Auf der Suche nach dem Ausgang sozusagen. Und nachher bedauert man es ja, sage ich, irgendwie sein Leben lang im Halbbewusstsein. Dass man da raus wollte oder musste, aus dem Schlaraffenland des Mutterleibs.
Und dann quatschen wir noch mit einem Freak, der sich für falsches Geld eine Schlange gekauft hat, die er nun um den Hals trägt. Du darfst sie streicheln, sagt er zu Sonja, und die lässt sich das nicht zweimal sagen. Die glatte Haut der Schlange, ja, sie ist glatt, schimmernd, aber ganz trocken, sagt sie. Also streichle ich die Schlange auch, das bringt Glück, sagt der Freak, happy birthday. Der 30. Geburtstag. Es ist ja eigentlich unglaublich. Wenn einer in sein dreißigstes Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Er selbst aber … Mehr kann ich aus dem Stegreif nicht zitieren. Ach was, würde Gerd sagen, halt die Ohren steif!
Gerd, der schon einiges über dreißig war. Vielleicht dreiunddreißig. Oder fünfunddreißig. Möglicherweise sechsunddreißig. Also ungefähr halb so alt wie ich jetzt, da ich diesen Text schreibe. Aber uns kam er damals schon ziemlich alt vor.
Obwohl er anderseits so naiv war, fast kindisch. So dass wir uns ihm gegenüber ein wenig benehmen mussten wie Adoptiveltern. Immer ein bisschen wachsam sein, damit er keinen Blödsinn machte. Um ihn (und uns) vor möglicherweise schlimmen Folgen zu bewahren.
Gerd aus Düsseldorf oder Dortmund – oder war es Darmstadt? Den wir im Puddingshop kennengelernt hatten, wo es ein schwarzes Brett gab. Eine Pinnwand, an der Zettel mit Angeboten und Nachfragen bezüglich Mitfahrgelegenheiten angebracht waren. Angebracht mit Stecknadeln oder Reißnägeln mit bunten Köpfen.
Gerd war Bankangestellter gewesen. In Düsseldorf oder Darmstadt. Nein, ich glaube, es war eher Dortmund. Denn er träumte die ganze lange Strecke, die wir mit ihm fuhren, durch die ganze Türkei und den halben Iran, von seinem Lieblingsbier, dem Dortmunder Actien. Und mit dem war das Bier, das er in der Türkei bekam, nicht zu vergleichen, und in Persien gab es so ein unfrommes Getränk wie Bier erst gar nicht.
Nicht einmal das amerikanische Bud. Obwohl dort damals noch der Schah an der Macht war. Coca-Cola, ja, Bier, nein – oder jedenfalls nicht in normalen Lokalen. Vielleicht in Hotelbars oder Nachtclubs, aber da kamen wir nicht hin.
Dieser Gerd hatte seinen Job in der Bank also aufgegeben. Wozu mach ich denn das?, hatte er sich schon seit einiger Zeit (so ungefähr seit seinem dreißigsten Jahr) gefragt, was bringt mir das? Und dabei hatte er offenbar nicht nur an sein nach mehr als zehn Jahren am Bankschalter wahrscheinlich gar nicht so schlechtes Einkommen gedacht. Sondern an etwas anderes. Ja, was? Das liegt heute für viele, scheint mir, schlicht und einfach jenseits des Horizonts.
Sonja und ich hatten jedenfalls Glück, dass wir ihn trafen. Denn so einen Lift, so eine Mitfahrgelegenheit, gleich für rund zweieinhalb Tausend Kilometer, so etwas findet man nicht alle Tage. Gerd wollte nach Indien, das wollten damals viele. Wir eigentlich nicht, wir wollten vorerst nur nach Teheran, wo Adib daheim war, den wir dann gar nicht antrafen – aber alles der Reihe nach.
Gerd hatte sich von der Abfindung, die er von der Bank anscheinend bekommen hatte, einen alten Mercedes gekauft (Baujahr 1950 oder so). Und mit dem, nicht etwa mit einer so genannten Ente (Citroën 4CV) oder einem ähnlich alternativen Vehikel, wollte er nach irgendeinem besonders alternativen Ort, dessen Namen ich vergessen habe. Der Mercedes war zwar alt und auf der Höhe von Kayseri hatte er einen Schwächeanfall. Aber der ließ sich, Allah sei Dank, mithilfe improvisationsfähiger türkischer Mechaniker noch halbwegs heilen. So kamen wir mit diesem Gerd tatsächlich recht weit. Sogar über Teheran hinaus, wo Adib, der in Wien studierte, aber (ein braver Sohn) in den Ferien nach Haus fuhr, nicht auf uns gewartet hatte. Wenn ihr schon einmal in der Türkei seid, hatte er gesagt, könntet ihr doch auch ein Stück weiter fahren und mich und meine Familie besuchen. Anscheinend hatte er nicht wirklich damit gerechnet, dass wir beim Autostopp so viel Glück hätten.
Jedenfalls war er, als wir in Teheran ankamen, nicht da. Die Familie, erklärten uns die Nachbarn mit wenig Englisch und vielen Gesten, sei, wie übrigens jedes Jahr, auf Urlaub ans Kaspische Meer gefahren. Ja, die ganze Familie – Vater, Mutter, Tochter und natürlich auch der Sohn. Adib? Ja, genau: Adib (was, übersetzt, so viel heißt wie »der Literat«, also vielleicht auch »der Märchenerzähler?«). Das war die Lage.
So wären wir beinah mit Gerd weitergefahren. Nach Indien, ja, warum nicht, er hätte uns auch dorthin mitgenommen. Beinah Indien also. Wenn die Afghanen nicht gerade damals ihren König gestürzt hätten. Ein Ereignis, das welthistorische Folgen hatte.
Der König war weg, die Perser sperrten die Grenze. Dann müssen wir eben gleich über Pakistan fahren, sagte Gerd und bog ab, nach Süden, für ihn führten einfach alle Wege nach Indien. Dass wir, seine treuen Mitfahrer, ihm nicht bis dahin erhalten blieben, lag einfach daran, dass wir ihn nicht mehr aushielten.
Wahrscheinlich war er ja auch froh, uns los zu sein. Dort in Isfahan. Sah er uns noch im Rückspiegel? Obwohl er uns anfangs richtig ins Herz geschlossen hatte. Er sei ja so froh, hatte er schon in Istanbul gesagt, über deutschsprachige Reisegefährten.
Auch wenn er uns, wie sich bald herausstellte, kaum verstand, wenn wir im Dialekt miteinander redeten. Was redet ihr denn da, fragte er dann, was ich nicht hören darf, ist das eure Geheimsprache? Mein Gott, Gerd! Seine Mentalität und die unsere. Und seine Fixierung, sein Tunnelblick auf Indien!