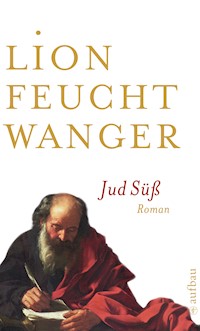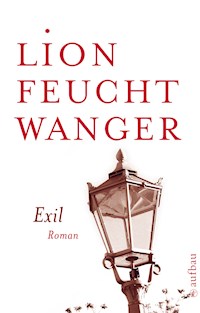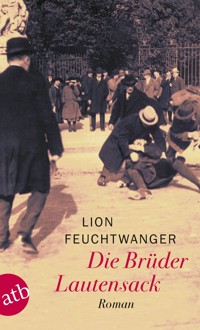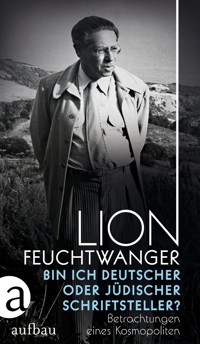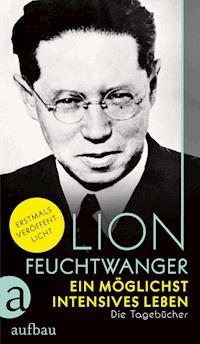9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Feuchtwanger GW in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
In diesem im Jahre 1940 in Frankreich spielenden Werk versuchte Lion Feuchtwanger, eine Brücke zwischen Jeanne d' Arc, der "Jungfrau von Orleans" und Retterin Frankreichs, und einer Fünfzehnjährigen in dem von Deutschen besetzten Land zu schlagen. Madame, schwarz und massig, betrachtet Simone eine kleine Zeit durch ihr Lorgnon. Ihr Gesicht verriet, was ihr Mund gleich sprechen würde: "Hochmütig, aufsässig, vorwitzig." Simone hatte sich eingemischt in die Geschäfte ihrer Verwandten. Es war passiert, nachdem sie Schriften über das Leben Jeanne d'Arcs gelesen hatte. Das tat sie oft, abends, vor dem Einschlafen. Diesmal aber war merkwürdiges geschehen.Im Traum hatte ihr toter Vater ihr einen Auftrag erteilt. Sie sollte dem Herrscher Frankreichs zeigen, wer die wirklichen Feinde des Landes sind: die Zweihundert Familien, die bereit waren, mit den Deutschen zu kollaborieren. Noch zweimal wird Simone in die Geschicke ihres Heimatlandes eingreifen. Jedesmal trägt sie dabei ihre dunkelgrünen Hosen; ein Indiz ihrer Aufsässigkeit, jedenfalls in den Augen Madames, der Stiefgroßmutter. Auch Jeanne d'Arc hatte man vorgeworfen,, sie verstoße durch ihre Männerkleider gegen die Gebote der Schrift. Als Onkel Prosper zögert, die Anweisung des Präfekten auszuführen und seinen Fuhrpark zu zerstören, damit er deutschen Truppen nicht in die Hände falle, handelt Simone. Sie zündet das Benzinlager an. Ein privater Racheakt, behaupten Madame und Onkel Prosper wider besseres Wissen, um die Gunst der Einflußreichen nicht zu verlieren und die Firma zu erhalten. - Eine patriotische Tat, wissen die Einwohner von Saint-Martin. Ihre Sympathie wird Simone helfen, die ihr "administrativ" auferlegte Strafe mit Würde zu tragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Lion Feuchtwanger
Lion Feuchtwanger, 1884-1958, war Romancier und Weltbürger. Seine Romane erreichten Millionenauflagen und sind in über 20 Sprachen erschienen. Als Lion Feuchtwanger mit 74 Jahren starb, galt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache. Die Lebensstationen von München über Berlin, seine ausgedehnten Reisen bis nach Afrika, das Exil im französischen Sanary-sur Mer und im kalifornischen Pacific Palisades haben den Schriftsteller, dessen unermüdliche Schaffenskraft selbst von seinem Nachbarn in Kalifornien, Thomas Mann, bestaunt wurde, zu einem ungewöhnlich breiten Wissen und kulturhistorischen Verständnis geführt. 15 Romane sowie Theaterstücke, Kurzgeschichten, Berichte, Skizzen, Kritiken und Rezensionen hatten den Freund und Mitarbeiter Bertold Brechts zum »Meister des historischen und des Zeitromans« (Wilhelm von Sternburg) reifen lassen. Mit seiner »Wartesaal-Trilogie« erwies sich der aufklärerische Humanist als hellsichtiger Chronist Nazi-Deutschlands.
Informationen zum Buch
In diesem im Jahre 1940 in Frankreich spielenden Werk versuchte Lion Feuchtwanger, eine Brücke zwischen Jeanne d'Arc, der »Jungfrau von Orleans« und Retterin Frankreichs, und einer Fünfzehnjährigen in dem von Deutschen besetzten Land zu schlagen.
Madame, schwarz und massig, betrachtet Simone eine kleine Zeit durch ihr Lorgnon. Ihr Gesicht verriet, was ihr Mund gleich sprechen würde: »Hochmütig, aufsässig, vorwitzig.« Simone hatte sich eingemischt in die Geschäfte ihrer Verwandten. Es war passiert, nachdem sie Schriften über das Leben Jeanne d'Arcs gelesen hatte. Das tat sie oft, abends, vor dem Einschlafen. Diesmal aber war merkwürdiges geschehen. Im Traum hatte ihr toter Vater ihr einen Auftrag erteilt. Sie sollte dem Herrscher Frankreichs zeigen, wer die wirklichen Feinde des Landes sind: die Zweihundert Familien, die bereit waren, mit den Deutschen zu kollaborieren.
Noch zweimal wird Simone in die Geschicke ihres Heimatlandes eingreifen. Jedesmal trägt sie dabei ihre dunkelgrünen Hosen; ein Indiz ihrer Aufsässigkeit, jedenfalls in den Augen Madames, der Stiefgroßmutter. Auch Jeanne d'Arc hatte man vorgeworfen, sie verstoße durch ihre Männerkleider gegen die Gebote der Schrift. Als Onkel Prosper zögert, die Anweisung des Präfekten auszuführen und seinen Fuhrpark zu zerstören, damit er deutschen Truppen nicht in die Hände falle, handelt Simone. Sie zündet das Benzinlager an. Ein privater Racheakt, behaupten Madame und Onkel Prosper wider besseres Wissen, um die Gunst der Einflußreichen nicht zu verlieren und die Firma zu erhalten. – Eine patriotische Tat, wissen die Einwohner von Saint-Martin. Ihre Sympathie wird Simone helfen, die ihr »administrativ« auferlegte Strafe mit Würde zu tragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lion Feuchtwanger
Simone
Roman
Inhaltsübersicht
Über Lion Feuchtwanger
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil: Bereitschaft
1 Die Flüchtlinge
2 Der Fuhrhof
3 Villa Monrepos
4 Die Bücher
5 Der Auftrag
Zweiter Teil: Aktion
1 Das Ereignis an der Brücke
2 Monsieur le Marquis
3 Muskat in der Sahnensauce
4 Der Flieger
5 Die Aktion
6 Ein Abend der Erwartung
7 Die ersten Folgen
Dritter Teil: Erkenntnis
1 Onkel Prospers Gesicht
2 Das bittere Warten
3 Der Ruf der Freiheit
4 Der große Verrat
5 Der schnöde Lohn
6 Der Fallensteller
7 Die Verleugnung
8 Das Unvergängliche
9 Das rauhe Haus
Zu diesem Band
Impressum
Ich bin gekommen zur Tröstung der kleinen Leute.
(Je suis venue pour la consolation des petits gens.)
Jeanne d’Arc
Erster Teil Bereitschaft
1. Die Flüchtlinge
2. Der Fuhrhof
3. Villa Monrepos
4. Die Bücher
5. Der Auftrag
1 Die Flüchtlinge
Noch ein paar Schritte, dann biegt der schmale Fußweg um und gibt den Blick frei auf die Fahrstraße. Simone geht diese paar Schritte mit einem Herzklopfen. Gestern hat sie den Zug der Flüchtlinge erst auf der großen Hauptstraße zu sehen bekommen. Heute wird er vielleicht schon den schmalen Nebenweg erreicht haben.
Drei Wochen lang ist jetzt von den Flüchtlingen die Rede. Im Anfang sind es nur Holländer und Belgier gewesen, dann floh vor dem eindringenden Feind auch die Bevölkerung Nordfrankreichs herunter nach dem Süden, immer mehr kamen, und seit einer Woche ist ganz Burgund überschwemmt. Als Simone gestern hinauf in die Stadt ging, um wie jeden Tag ihre Einkäufe fürs Haus zu machen, war kaum mehr durchzukommen, und heute hat sie ihr Fahrrad gar nicht erst mitgenommen.
Das Mädchen Simone Planchard hat eine schnelle Phantasie; als sie zuerst von den Flüchtlingen hörte, hat sie sich darunter eilige, erschreckte Leute vorgestellt, immer eilig, immer erschreckt. Was sie in den letzten Tagen gesehen hat, war einfacher und furchtbarer, und es läßt sie nicht los, es arbeitet weiter in ihr, es läßt sie des Nachts nicht schlafen. Sooft sie in die Stadt geht, fürchtet sie sich vor dem kläglichen Schauspiel, aber täglich auch, mit einer leidvollen, aufwühlenden Gier, sehnt sie sich danach.
Jetzt hat sie die Biegung erreicht und kann ein gutes Stück der Straße überblicken. Es ist eine schmale, verwahrloste Straße, sie liegt fast immer weiß und tot, sie führt nirgends hin, nur in das Bergnest Noiret mit seinen sechs Häusern.
Aber heute ist es, wie sie befürchtet hat: da sind Menschen. Der große Strom hat Tropfen sogar hierher verspritzt.
Simone steht und schaut. Ziemlich groß, stakig, steht sie da, die Fünfzehnjährige. Sie trägt das unauffällige, hellgrüne, gestreifte Kleid, das sie anzuhaben pflegt, wenn sie ihre Besorgungen macht, den großen, geflochtenen, verschlossenen Einholekorb hält sie an den Leib gepreßt, Arme und Beine kommen nackt, lang und mager aus dem Kleid heraus, sie ist in der letzten Zeit stark gewachsen. Das knochige, gebräunte, von dunkelblondem Haar gerahmte Gesicht ist gespannt, die dunklen, tiefliegenden Augen unter der nicht hohen, doch breiten und wohlgebildeten Stirn saugen gierig ein, was sich da im Staub vor ihr bewegt.
Es ist der Anblick, den sie kennt: hoffnungslos sich schleppende Menschen und Wagen, auf den Fahrzeugen sinnlos gestapelter Hausrat, Matratzen auf den Verdecken der Autos, hingebreitet zum Schutz vor den Maschinengewehren der tief tauchenden Flieger, Menschen und Tiere todmüde weiterkriechend, nicht wissend, wohin.
Da also steht Simone Planchard an der Wegbiegung, die schmalen, geschwungenen Lippen verpreßt, und schaut. Man kann nicht eigentlich sagen, daß sie schön sei, doch ihr intelligentes, besinnliches, etwas trotziges Gesicht mit dem kräftigen Kinn und der langen, leicht höckerigen, burgundischen Nase ist gut anzuschauen. Eine volle Minute steht sie so, die Flüchtlinge betrachtend, eine zweite, lange Minute, im Staub und in der schweren Hitze des frühen Nachmittags.
Dann aber riß sie sich los. Sie hatte zu tun, Madame hatte ihr vielerlei aufgetragen. Zwar hatte man sich in der Villa Monrepos, dem Hause der Familie Planchard, reichlich eingedeckt, doch in zwei, drei Tagen wird es soweit sein, daß man nirgends mehr etwas wird auftreiben können. So war denn die Liste, die Simone von Madame mitbekommen hatte, umfangreich, und es wird heute inmitten der allgemeinen Aufregung und Unordnung nicht leicht sein, die vielen Besorgungen zu erledigen. Sie ließ sich nicht aufhalten von dem Anblick der Flüchtlinge, sondern ging schnell und zielbewußt der Stadt zu.
Bald war sie am tiefsten Punkt ihres schmalen Seitenwegs angelangt, dort, wo er einbog in die Straße 6, die im Halbkreis um den Stadthügel von Saint-Martin herumführte. Was sie hier erblickte, war jämmerlicher als alle Erlebnisse der letzten Tage. Quer über die Straße standen Autos, vielleicht hatten sie in den Seitenweg abbiegen wollen, andere Wagen klemmten sie ein, der ganze, endlose Zug von Pferdefuhrwerken, Autos, Radfahrern, Maultieren, Fußgängern stand still, alles war rettungslos ineinander verknäuelt, man fluchte nicht einmal, man gab sich auch nicht sonderliche Mühe, den Knäuel zu entwirren. Resigniert in der schwülen Hitze hockten die Menschen, wo sie steckengeblieben waren, zusammengesunken, verkrümmt, Alte und Junge, Männer und Frauen, Soldaten und Zivilisten, Verwundete und Gesunde, in schwitzender, hoffnungsloser Untätigkeit.
Mit den ernsten, großen Augen, die ihr Gesicht über die Jahre hinaus erwachsen machten, schaute Simone auf den bestaubten, festgefahrenen Zug, der da vor ihr stand wie ein Bild, sonderbar lärmlos. Aber sie war im Lauf ihrer fünfzehn Jahre sehr vernünftig geworden, sie dachte an ihre Geschäfte, umgab sich mit Starrheit und richtete ihr Augenmerk darauf, durch den Zug der Flüchtlinge hindurch die Straße zu überqueren. Ihren großen Korb fest an sich pressend, kletterte sie über eingedrückte Kotflügel, über den rückwärtigen Teil eines Stellwagens, sich höflich entschuldigend bei den Insassen, die kaum auf sie achteten und in der schweren Hitze weiterdösten.
Endlich war sie jenseits der Straße. Sie schlug den alten, zerbröckelten Treppenpfad ein, der für Uneingeweihte kaum auffindbar war. Er führte, manchmal recht steil, in launischen Bogen den Berg hinauf, mit immer neuen, überraschenden Ausblicken auf die verfallenen Schanzwerke und Festungstore, welche die uralte Stadt umgaben; bei jeder Wendung eröffnete er eine neue Sicht hinunter in das Tal des gekrümmten Flusses Cerein. Die Landschaft, die sich da erschloß, war bunt und anziehend; weit und heiter, mit Reben, Oliven und Kastanien streckte sich das Tal, auf jedem Hügel zeigte sich eine uralte Siedlung, und von Osten her ragte finster das Waldgebirge herein. Zahllose Fremde kamen, sich des Anblicks zu erfreuen, und Simone, wenn sie zu andern Zeiten den Pfad erstieg, hatte diese Landschaft, so gut sie sie kannte, jedesmal von neuem mit wissenden, fühlenden Augen aufgenommen. Heute hatte sie kein Gefühl dafür. Heute mühte sie sich, das wegzudrängen, was sie auf der Straße gesehen hatte, und beinahe freute sie sich, daß der schwierige Pfad sie sehr in Anspruch nahm. An einigen Stellen mußte man geradezu klettern, das war nicht einfach mit dem großen Korb. Das nächste Mal, wenn sie in die Stadt muß, wird sie ihre Hosen anziehen. Manche Leute freilich finden es nicht angemessen, wenn Mädchen jetzt im Kriege Hosen tragen; Madame selber sieht es ungern.
Jetzt war Simone oben, durch die Porte Saint-Lazare betrat sie die Stadt. Sie überquerte den Platz vor der Kirche. Sonst lag der kleine Platz verlassen und friedlich; stille, alte Leute saßen auf den Bänken unter den Ulmen, dann und wann standen Touristen da und beschauten sich die berühmte Statue über dem Kirchenportal.
Heute war der Platz voll, viele von den Flüchtlingen waren heraufgekommen. Aber sie hatten kein Aug für den Heiligen, sie waren auf der Suche nach Benzin oder Lebensmitteln oder sonst Notwendigem. Sie tauschten die Erfahrungen aus, die sie hier in der Stadt und unterwegs gemacht hatten. Es waren bittere Erfahrungen. Fast allen fehlte es an allem, und hier in Saint-Martin war auch nichts aufzutreiben. Fast alle waren sie unterwegs in Todesnot gewesen. Sie standen und saßen da, und um sie herum standen Leute aus der Stadt, Simone unter ihnen, und hörten ihren Erzählungen zu.
Die Deutschen hatten die festgeklemmten Züge von ihren Flugzeugen aus beschossen, heruntertauchend, und man war ihnen schutzlos ausgesetzt gewesen; an den verstopften Kreuzwegen, auf den Brücken, vor gesperrten Bahnübergängen gab es keinerlei Deckung. »Wir bereuen es, daß wir geflüchtet sind«, berichteten die meisten, grimmig. »Zu Hause sitzen und nichts tun können und auf die Bomben und auf die Deutschen warten ist grauenvoll: aber das Unterwegs ist zehnmal schlimmer. Alles auf dieser Flucht ist furchtbar.«
Simone hörte zu, sie hörte das nicht zum ersten Mal. Sie ging weiter. Sie kam an dem Justizgebäude vorbei, einem alten, schönen Palais. Durch das Tor sah sie in die Halle. Dort hatte man Stroh hingebreitet, und da lagen jetzt Flüchtlinge, dicht gedrängt, erbärmlich. Simone wandte den Blick von ihnen; ein bißchen schuldbewußt, sich an den Häusern entlangdrückend, ging sie ihres Weges, der Rue de Sauvigny zu.
Die Rue de Sauvigny, eine schmale, gewundene Straße mit schönen, alten Häusern, war die Hauptgeschäftsstraße der Altstadt. Flüchtlinge irrten von einem Laden zum andern, doch sie fanden überall nur Inschriften: »Kein Brot«, »Kein Fleisch«, »Kein Benzin«, »Kein Tabak«. Die meisten Geschäfte waren geschlossen, und wenn die Rolläden nicht niedergelassen waren, dann stand wohl im Fenster einsam irgendeine Reklamefigur oder ein Gegenstand, mit dem niemand etwas anfangen konnte, eine kunstvolle Keramik, die ein Salzfaß vorstellen sollte, oder eine große Stallaterne, für die es keine Kerze gab. In der Auslage des Friseurladens von Monsieur Armand stand hämisch und allein eine riesige, leere Parfümflasche.
Aber wenn die Geschäfte geschlossen waren, so kannte Simone die rückwärtigen Eingänge, und sie kannte die Signale, auf welche die Ladeninhaber reagierten. Wenn für niemand sonst, für die alte Madame Planchard und für ihre Botin Simone war man zu sprechen, für die Familie Planchard fand sich immer noch etwas.
So holte denn Simone zusammen, was dazu dienen konnte, die reichen Vorräte der Villa Monrepos zu vermehren und ihre Bereitschaft für die Wochen der Dürre. Da war das Geschäft »L’Agréable et L’Utile«. Der Laden war ganz leer, selbst Monsieur Carpentier, genannt Monsieur L’Utile, hatte sich davongemacht, und vorhanden war nur mehr Monsieur Laflèche, genannt Monsieur L’Agréable. Aber für Simone hatte er noch einen Schlauch und einen Gartensprenger. Und im geschlossenen Laden Monsieur Armands gab es noch Rasierseife für Monsieur Planchard. Auch in die Galeries Bourguignonnes drang Simone ein, das Warenhaus der Stadt, das gut verbarrikadiert war. In dem weitläufigen Geschäft waren nur drei Angestellte, aber Mademoiselle Joséphine, die Vorsteherin der Putzabteilung, hatte gewisse Bänder und Stoffe, die für Madame Planchard hinterlegt waren. Während sie Simone die Waren aushändigte, teilte sie ihr geheimnisvoll und erregt mit, daß jetzt auch Monsieur Amiot, der Besitzer der Galeries Bourguignonnes, die Stadt verlassen habe. Sie zählte noch andere auf, die geflüchtet waren. Da waren Monsieur Raimu, der Lebensmittelhändler, Monsieur Laroche vom Crédit Lyonnais, eine ganze Reihe von Geschäftsleuten, Anwälten, Ärzten.
Simone hatte erst den kleineren Teil ihrer Geschäfte erledigt, sie verließ die altertümliche Innenstadt, passierte die Porte de l’Horloge und machte sich daran, die Geschäfte des neuen Stadtteils aufzusuchen, die zumeist in der Avenue de la Gare gelegen waren.
Ihr Weg führte über die Place du Général Gramont. Das war der größte Platz der Stadt; hier fand alljährlich die Messe statt, und am 14. Juli war der Platz illuminiert mit Transparenten und Lampions, und es wurde getanzt. Heute hatte sich hier ein Wagenpark angesammelt, umfangreicher als bei der großen Messe, Flüchtlinge offenbar, die es aufgegeben hatten weiterzukommen und die beabsichtigten, die nächsten Tage und Nächte hier in ihren Fahrzeugen zu verbringen. Das Denkmal des Generals Gramont war inmitten der Wagen kaum sichtbar. Jemand hatte Stricke gespannt vom Haupt und dem ausgestreckten Arm des Generals zu einigen der Wagen, und man hatte Wäsche daran aufgehängt.
Es war ein wüster, verwirrender Anblick. Da waren zwei Ambulanzen, wer weiß, wie sie sich hierher verirrt hatten. Die Tür der einen stand auf, Simone schaute hinein und schaute gleich wieder weg; der Kopf, der sich da inmitten von Tüchern und Verbänden zeigte, war kein Menschenkopf mehr. Die Sanitätssoldaten saßen auf dem Trittbrett, dösend. Ein hochbeladener Leiterwagen war da, die Pferde waren nicht ausgespannt. Vorne, auf dem Kutschersitz, hockte eine schwangere Frau; ganz oben, gefährlich, kauerte ein kleines Kind, flennend, unsäglich schmutzig, eine Katze im Arm. Soldaten saßen oder lagen zwischen den Fahrzeugen, viele hatten Teile ihrer Uniformen ersetzt durch zivile Kleidung, Überröcke, Hüte, Halstücher, viele hatten die Schuhe ausgezogen, so daß ihre blutigen, vom langen Marschieren kranken Füße sichtbar waren. Schubkarren waren da, Kinderwagen, bepackt mit seltsamer Habe. Ein Kinderwagen fiel Simone auf, ein Mädchen kratzte daran herum, abwesend und gleichwohl beflissen, sie versuchte, ihn inmitten der drangvollen Enge zu säubern von dem Dreck, mit dem er überkrustet war, und wo die Krusten abfielen, zeigte sich schreiendblauer Lack. Sehr viele der Flüchtlinge sahen krank und elend aus, alles war zerlumpt, überall fehlte es sichtlich am Notwendigsten; doch die Kleider, die jetzt verlumpt und in Fetzen hingen, waren häufig von Anfang an nicht die geeignetsten gewesen, es waren offenbar die Sonntagskleider. Und was mitgeschleppt wurde, war häufig nicht das Praktische, sondern Zufälliges, das im Augenblick lieb oder wertvoll erschienen sein mochte, ein stattlicher Brokatstuhl oder ein übergroßes Grammophon.
In ihrem hellgrünen, gestreiften Kleid stand Simone, den großen Korb überm Arm, und starrte auf den gespenstischen Knäuel der Wagen und Menschen. Das unheimliche Schauspiel zog sie an. Sauber und nett angezogen, wohlbehaust, mit Nahrung reichlich versehen, fühlte sie sich weit getrennt von denen da vor ihr, aber gerade deshalb bedrückte sie noch mehr jenes Schuldgefühl, das sie vorhin schon gespürt hatte.
Zögernd setzte sie ihren Weg fort. Ging die Avenue de la Gare hinunter. Doch hier in der Neustadt waren alle Geschäfte geschlossen, und in viele Läden fand selbst Simone keinen Eingang, die Besitzer hatten sich offenbar davongemacht.
Immerhin nahm auch hier der Inhalt ihres Korbes zu. Einiges freilich, Lebensmittel vor allem, fehlte noch. Sie entschloß sich, zurück in die Altstadt zu gehen, zum Hôtel de la Poste, ihrer letzten Zuflucht. Dort hat man Vorräte, und dort wird sie sicher was bekommen, die Familie Planchard hat Geschäfte mit dem Hotel, man ist dort den Planchards verpflichtet.
Der Koch aus Papiermaché, der einladend vor der Tür des berühmten Restaurants de la Poste zu stehen pflegte, lag kläglich auf dem Boden, er war umgefahren oder umgerannt, und Monsieur Berthier, der Besitzer des Hotels, verhandelte mit einer Gruppe von Flüchtlingen, die offenbar Essen wollten oder Nachtlager. Das Hôtel de la Poste hatte großen Namen. Hier hatte, auf seinem Weg zurück von Elba, Napoleon Station gemacht, das Zimmer, in dem er schlief, war erhalten in dem Zustand, in welchem es von dem Kaiser bewohnt wurde, Monsieur Berthier war ein direkter Nachfahr jenes Berthier, dem damals das Hotel gehörte, und er pflegte das Zimmer manchmal an Fremde zu vermieten, denen er besonders wohlwollte und die viel Geld hatten. Monsieur Berthier war ein Mann von guter Haltung, Präsident der Vereinigung der Hoteliers von Burgund und gewohnt, mit Leuten umzugehen. Diesmal aber hatte er es schwer, er schwitzte, er war aufgeregt, verzweifelt. Doch verzweifelter waren diejenigen, die es nicht glauben wollten, daß nichts da sei, die immer von neuem fragten, ob es denn gar keine Möglichkeit gebe.
Simone drückte sich an den Aufgeregten vorbei und ging um den Block herum zum andern Eingang. Der lag hinter dem kleinen, ummauerten Garten des Hotels in der Rue Malherbe. Es war eine unscheinbare Pforte, sie war natürlich verschlossen. Aber Simone wußte, was sie zu tun hatte; sie nahm einen Stein und klopfte mehrere Male, kurz, scharf, mit kleinen Pausen.
Auf der Gartenmauer aber hockten zwei, einer ein Junge von vielleicht vierzehn, der andere ein Mann in mittleren Jahren, und beide schauten ihr zu, der Mann abwesenden Blickes, doch der Junge aufmerksam. Simone wußte, jetzt wird sich gleich in dem Häuschen des Concierge ein Fenster auftun, und jemand wird verstohlen herunterschauen und mit dem Kopfe nicken, und der Junge, mit seinen starken, hellen Augen, wird es sehen. So geschah es auch. Der Junge sah das Fenster, er sah von dem Fenster zu Simone, er sah den Korb, und er sah, wie sich die Tür auftat. Simone wollte von dem Jungen wegschauen; aber in der Pforte, sie konnte nicht anders, wandte sie den Kopf und sah, daß der helle, starke Blick des Jungen noch immer auf sie gerichtet war, und sie schluckte.
In der Küche des Hotels zeigte sich, daß Simone hier von den Dingen auf der Liste wirklich noch einiges haben konnte. Man gab ihr einen Topf mit der Spezialpastete des Hauses, ein Stück herrlichen, geräucherten Schinkens und manches andere. Der Korb war voll, Simone mußte ein Stück Roblechonkäse, das sie noch erhielt, in Papier gewickelt, in der Hand tragen. So, mit dem schweren Korb am Arm und dem kleinen Paket in der Hand, trat sie aus der Gartentür. Die beiden Flüchtlinge hockten noch immer auf der Mauer; sie beobachteten sie aufmerksam. Da, mit einer schnellen, scheuen Bewegung drückte Simone dem Jungen den Roblechonkäse in die Hand. Der Junge schaute sie böse an, er sagte nicht danke, sie ging eilig weiter, als hätte sie unrecht getan.
Ihr war, als ob die beiden ihr böse nachschauten, bis sie um die Ecke war. Eine leise Furcht überkam sie. Wenn die Flüchtlinge wüßten, was in ihrem Korb war, sie würden über sie herfallen und ihr den Korb entreißen. Sie fürchtete sich, als sie sich das vorstellte, aber sie sagte sich, sie würde es den Hungrigen nicht einmal verdenken, und beinahe wünschte sie, es möchte ihr einer den Korb entreißen.
Simone war aufgewachsen in der Villa Monrepos in wohlhäbigen Verhältnissen. Seit zehn Jahren, seit dem Tod ihres Vaters, lebte sie dort, sie war die arme Verwandte, sie war geduldet. Sie hatte viel Arbeit, sie ersetzte das Dienstmädchen, andernteils aß sie mit bei Tisch, und Onkel Prosper, ihr Vormund, legte Gewicht darauf, sie so zu behandeln, daß sie sich zur Familie gehörig fühlte. Sie nahm beides, Pflichten und Rechte, als etwas Gegebenes hin, die Ansichten und Zustände der Villa Monrepos waren für sie unumstößlich wie der Wechsel von Tag und Nacht. Sie befolgte ohne äußern und innern Widerstand die Weisungen, welche Madame, Onkel Prospers Mutter, ihr erteilte. Es war selbstverständlich, daß eine gute Hausfrau in Zeiten wie diesen voraussorgte und das Haus mit Vorräten füllte. Trotzdem, ohne daß sie das Gedanke werden ließ, spürte Simone, daß jenes Schuldgefühl, welches sie die ganzen Tage her bedrückte, verknüpft war mit dem schweren Korb, den sie trug.
Sie hätte sich gerne gründlich ausgesprochen über das, was sie in den letzten Tagen erlebt hatte. Vor ganz kurzer Zeit noch, vorige Woche noch, hatte man in größter Sicherheit gelebt, im Schutz der Maginot-Linie, im Schutz der starken Armee; überall, trotz des Krieges, war Ruhe gewesen, Ordnung, das gewohnte, behagliche Dasein aus der Fülle. Und jetzt auf einmal, über Nacht, trotz Maginot-Linie, trotz starker Armee, stand der Feind mitten im Land, und ganz Frankreich war ein Haufen kläglicher, vor Elend halb verrückter Flüchtlinge. Man wurde krank vor Mitleid und Unruhe. Es bedrückte einen, daß man dieses ganze Kriegsjahr über so dumm und gemächlich vor sich hin gelebt hatte. Es zerrieb einen, daß man so gar nicht begriff, wie das alles zusammenhing. Man mußte darüber reden, mußte andere, Gescheitere, befragen. Aber sie wußte keinen, mit dem sie offen und von Herzen hätte reden können.
Onkel Prosper, der Halbbruder ihres Vaters, hatte sie sehr gern. Sie war ihm, der sie unter sein Dach aufgenommen hatte, von Herzen dankbar. Er war menschenfreundlich, wohltätig, ein guter Franzose, ein großer Patriot. Aber er beschäftigte sich nach wie vor mit den Fragen seines Transportunternehmens, als sei das die Hauptsache, und sosehr die schrecklichen Ereignisse ihn mitnahmen, es schien Simone, als wühlten sie ihn nicht so tief auf wie sie selber. Jedenfalls war das, was er zu den Ereignissen sagte, nicht das, was Simone gerne hätte wissen wollen, es erklärte ihr nichts, es verscheuchte nicht ihre tiefe, bedrückende Ratlosigkeit.
Madame gar, des Onkels Mutter, blieb völlig unberührt, die Geschehnisse glitten von ihr ab. Sie sperrte sich zu gegen das, was vorging, sorgfältig sperrte sie das Haus zu, sie ließ nichts hereindringen und prüfte alles nur darauf hin, wieweit es der Villa Monrepos nutzen oder schaden könnte. Ein Flüchtling etwa, der Simone ihren Korb entrisse, wäre Madame bestimmt als ein Räuber und Verbrecher erschienen und als nichts sonst, und wenn Simone versuchen sollte, ihn zu entschuldigen, so hätte Madame das als etwas ungeheuer Freches, Aufrührerisches angesehen; auch Onkel Prosper, trotz seines guten Herzens, hätte für einen solchen Entschuldigungsversuch bestimmt kein Verständnis gehabt.
Natürlich wird sie Madame kein Wort davon sagen, daß sie den schwer aufzutreibenden Roblechonkäse an den Flüchtlingsjungen weggeschenkt hat. In der Villa Monrepos würde man sie für wahnsinnig halten. Dabei hat sie der Junge dafür nur böse angeschaut.
Und trotzdem würde sie es jetzt von neuem genauso machen.
Den Kopf voll von Gedanken, nicht achtend auf den Weg, aber mit den langen Beinen kräftig schreitend, ging sie durch die bunten, verwinkelten, hügeligen Gassen. Ihre Besorgungen waren erledigt. Jetzt hatte sie noch ins Geschäft zu gehen, in das Transportunternehmen Onkel Prospers, um dort ihren Dienst an der Benzinpumpe zu verrichten.
Ihre Straße führte sie vorbei an dem Haus Etiennes. Wenn wenigstens der hier wäre; aber er ist fort, in Chatillon, in der Mechanikerwerkstatt.
Mit Etienne war Simone gut befreundet, er hing an ihr, er sah zu ihr auf und war ihr ergeben. Aber er war im Grunde ein kleiner Junge, sie fühlte sich älter als er, wiewohl er ein Jahr älter war, und wenn sie auch mit ihm alles, was sie dachte und spürte, offen hätte bereden können, so war sie doch gewiß, er wäre nicht imstande gewesen, ihr die verwirrenden Geschehnisse auszudeuten. Trotzdem wünschte sie sehr, er wäre da, denn er war der Bruder Henriettes.
Ihre Schulfreundin Henriette war der einzige Mensch gewesen, dem sie sich ganz nahe fühlte, und nun Henriette vor einem Jahr gestorben war, gab es eigentlich niemand mehr, dem sie ihr Letztes hätte anvertrauen können. Simone, wie sie so mit dem schweren Korb an dem Hause vorbeiging, in dem Etienne und Henriette gewohnt hatten, fühlte sich sehr allein.
Wenn sie sich mit Henriette über die Flüchtlinge hätte aussprechen können, dann wäre alles klar geworden. Vielleicht hätten sie gestritten, vielleicht hätte Henriette ihr böse Worte gesagt, aber sie hätten einander verstanden. Henriette war Simone entgegengesetzt gewesen, flink, launisch, immer zu Unerwartetem aufgelegt. Sie war streitsüchtig gewesen, es hatte ihr Freude gemacht, einem wehe zu tun. Simone hatte sich ein einziges Mal in der Schule geprügelt; das war, als Henriette eine verächtliche Äußerung über ihren Vater getan hatte. Da war die sonst so ruhige Simone über sie hergefallen und hatte die Kleinere, Schwächere wild geschlagen und zerkratzt. Und daraufhin war das Merkwürdige geschehen, Henriette hatte sie um Verzeihung gebeten, und sie waren Freundinnen geworden.
Die ganzen letzten Tage, obgleich sie oft an diesem Haus vorbeikam, hatte Simone nicht an Henriette gedacht. Das geschah manchmal so. Tagelang, ganze Wochen lang dachte sie nicht an Henriette, und dann beschimpfte sie sich um ihrer Treulosigkeit willen. Nicht einmal jetzt, da sie sich so heiß nach einem Gespräch mit Henriette sehnte, konnte sie sich die Freundin vorstellen. Der Anblick der Toten, wie sie mit sanftem, wächsernem Gesicht in ihrem Sarg lag, hatte sich tief in Simone eingesenkt, das Bild der Toten konnte sie jederzeit herbeirufen. Aber sich die Lebendige vorzustellen, deren zartes, blasses Gesicht immerfort gewechselt hatte, fiel ihr schwer. In Simones Erinnerung veränderte sich dieses Gesicht unaufhörlich; es war höhnisch, es war trostreich, es flößte Haß ein, es flößte höchstes Vertrauen ein. Ach, wenn sie doch Henriette hätte, um mit ihr zu reden.
Ihren Vater, ihren Vater müßte sie haben. Pierre Planchard, wiewohl er schon zehn Jahre tot ist, ist ihr lebendiger als Henriette. Fünf Jahre alt ist Simone gewesen, als er starb. Die Gerüchte über die Art, wie er unterging, werden nicht stumm. Pierre Planchard ist im Kongo umgekommen auf einer Forschungsreise, die er unternommen hatte, um die Bedingungen zu studieren, unter denen die Eingeborenen arbeiteten; er war immer ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Unterdrückten gewesen. Seine Freunde erklären, er habe ein Buch vorbereitet, das an Hand umfangreichen, schlüssigen Materials schwere Anklagen erheben sollte gegen die Ausbeutung der Schwarzen. Daraufhin hätten ihn die Konzessionäre auf einer Forschungsreise im Urwald verschwinden lassen. Pierre Planchards Manuskript war unauffindbar, und die amtliche Untersuchung über sein Ende hatte nichts zutage gefördert. Er ist verdorben und gestorben, hat einmal die alte Madame Planchard gesagt, Onkel Prospers Mutter. Für seine Freunde aber ist Pierre Planchard ein Held geblieben, ein Märtyrer.
Simones Erinnerungen an den Vater können wohl nicht sehr klar sein; sie war noch nicht fünf Jahre, als sie ihn zum letzten Mal sah. Trotzdem glaubt sie sich seiner genau zu erinnern. Ja, sie erklärt, sie habe seine Stimme noch im Ohr, eine klingende, tiefe und gleichwohl sehr junge Stimme. Und besonders deutlich ist ihr ein Erlebnis mit dem Vater, wie er sie nämlich hinaufnahm auf den Turm von Notre-Dame. Man war in größerer Gesellschaft. Natürlich konnte sie die dreihundertsechsundsiebzig Stufen nicht steigen. Lachend, nach einer Weile, sagten die andern, er solle das Kind doch zurückbringen. Er aber, immer unter der lachenden Abwehr der andern, trug sie ganz hinauf, und er zeigte ihr die bösen, grotesken Wasserspeier dort oben, die Teufel und Chimären, und er beruhigte ihre Angst vor den Ungeheuern, bis sie keine Furcht mehr hatte, nur mehr Neugier.
Im übrigen ist Simone angewiesen auf Bilder des Vaters, Photos, vergilbte Zeitungsausschnitte. Er hat ein hageres Gesicht, große, tiefliegende Augen und starkes Haar. Man hat Simone erzählt, daß diese Augen blaugrau waren, daß sie sehr zornig und sehr fröhlich sein konnten und daß das Haar rotblond war. Auf den Bildern sieht Pierre Planchard nicht jung aus, älter als er war. Aber wenn sich Simone an das Erlebnis von Notre-Dame erinnert, dann ist in ihrem Geist ein sehr junger Mann, der mächtig lacht, und die vielen Fältchen um die Augen machen ihn nicht älter. So ruft sie ihn oft vor sich, und sie sieht ihn dann so deutlich, als stünde er leibhaft vor ihr.
In der Villa Monrepos spricht man nicht gerne von Pierre Planchard. Zwar hat Onkel Prosper seinen Halbbruder bei allem Gegensatz der Meinungen geliebt und bewundert. Aber Madame spricht von Pierre, ihrem Stiefsohn, mit beklemmender Kälte, sie läßt es Simone merken, daß ihr Vater sie ohne einen Sou zurückgelassen hat, und Onkel Prosper duldet das. Doch die hochmütigen Äußerungen Madames bewirken nur, daß Simone zwiefach stolz auf ihren Vater ist.
Ja, er müßte dasein. Er würde es verstehen, warum ihr der Korb heute so schwer scheint und warum sie dem Flüchtlingsjungen den Roblechon gegeben hat.
Sie war jetzt vor dem Palais Noiret angelangt, einem alten, schönen Gebäude, in welchem Monsieur le Sous-Préfet seinen Sitz hatte. Man kannte sie gut in der Unterpräfektur, und sie stellte ihren schweren Korb bei dem Concierge ein, um ihn nicht den ziemlich langen Weg ins Geschäft schleppen zu müssen.
Leichten Schrittes, nun sie des Korbes ledig war, ging sie der Avenue du Parc zu, die zur Stadt hinaus und in das Geschäft führte. Allein noch ehe sie die Straße und mit ihr die Neustadt erreicht hatte, entschloß sie sich eines andern. Sie wird zu Père Bastide gehen. Sie muß jetzt ganz einfach mit irgendeinem befreundeten Menschen reden über das, was sie gesehen hat.
Der alte Buchbinder Père Bastide war in der Villa Monrepos nicht beliebt. Man sah es nicht gerne, wenn Simone mit ihm zusammen war, mit ihm oder mit seinem Sohn, Monsieur Xavier, dem Sekretär der Unterpräfektur. Onkel Prosper und Madame sprachen mit Naserümpfen von den politischen Ansichten der beiden, und den alten Buchbinder bezeichneten sie schlechthin als einen Trottel. Er war wohl auch ein wenig lächerlich, Père Bastide, schrullig, ein Querkopf. Er erregte sich über alles, er war maßlos in Lob und Tadel, und die Vergangenheit und das Heute gingen ihm oft durcheinander. Aber er glaubte an Frankreich, auch jetzt noch, wo so viele daran irre geworden waren; es tat ihr wohl, wenn er von Frankreich sprach. Und vor allem war er ein Freund ihres Vaters, er hatte ihn gut gekannt, und er erzählte ihr oft von ihm mit Stolz und Liebe. Nein, Simone hielt an dem Alten fest, und nach all dem Finstern und Trüben, was sie heute durchlebt hat, wird es ihr wohltun, ihn zu sehen.
Père Bastide wohnte bei der Petite Porte. Dort, auf dem äußersten Vorsprung des Stadthügels, auf dem höchsten Punkt, klebte sein kleines Haus, uralt, zehnmal zusammengeflickt, und schaute hinunter auf der einen Seite über die vielgestaltigen, kastanienfarbenen Dächer der Altstadt, auf der andern weit über das Tal des gekrümmten Flusses Cerein.
Simone kletterte die ausgetretene Treppe hinauf und schaute durch die Glastür in die Werkstatt. Père Bastide, wiewohl er sich zur Ruhe gesetzt hatte, band und kleisterte zuweilen zu seinem eignen Spaß und hielt sich am liebsten in der Werkstatt auf. Er liebte Bücher und hatte eine große Bibliothek.
In dieser Werkstatt, die vollgestopft war mit buntem Krimskrams und altertümlichem Hausrat, sah Simone den Alten denn auch heute sitzen. In seinem Lehnstuhl saß er, eingenickt. Zu Häupten des Sessels hing ein Bild des Jean Jaurès, des großen Sozialistenführers, den Père Bastide hoch verehrte. Jaurès war vor Beginn des letzten Krieges umgebracht worden von einem Fanatiker, den die Zeitungen der äußersten Rechten aufgehetzt hatten. Dem Buchbinder war Jaurès das Symbol der großen Vergangenheit, das Symbol Frankreichs. Auf dem Bild war er dargestellt vor einer riesigen Fahne, auf einem Podium, zu den Massen redend. Ungeschlacht stand er da, der dicke, gewaltige Rumpf ruhte auf etwas eingeknickten Beinen, der Hals war in den Schultern vergraben, der Kopf mit dem breiten, nicht sehr langen, fast viereckigen Bart war bedeckt von einem steifen, runden Hut, die Hände machten eine Bewegung, als wollten sie die unsichtbare Menge heraufholen. Mächtig schaute der Mann aus, ein Koloß, patriarchalisch und prophetenhaft, gutmütig und unwiderstehlich zugleich.
Eine kleine Weile stand Simone vor der Glastür und betrachtete den alten Buchbinder, wie er so in seinem Lehnstuhl saß, eingenickt unter dem Bilde. Er schien ihr verändert. Sonst hatte sie ihn immer sehr lebhaft gesehen, zappelig, voll Feuer, jetzt hockte er da, winzig, in dem großen Sessel, verschrumpft, uralt. Simone schaute auf ihn, traurig und zärtlich bewegt.
Sie nahm an, es werde ihm nicht lieb sein, daß sie ihn so überraschte. Sie ging die Treppe wieder hinunter, ließ die Haustür geräuschvoll zufallen und stieg von neuem hinauf, den Tritt so laut wie möglich.
Père Bastide stand denn auch quicklebendig da, den Kopf mit dem frischfarbigen Gesicht und dem strahlend weißen Haar gereckt. »Guten Tag, Kleine«, sagte er munter, ging zum Schrank, holte eine Flasche seines selbstgezogenen Nußschnapses heraus und bot ihr an. Sie nippte höflich.
Dann kam es, wie sie sich’s gedacht hatte. »Hör zu«, sagte er und drückte sie in einen Stuhl, ging selber auf und nieder und ließ sich erregt über die Geschehnisse aus.
»Weit haben wir es gebracht«, meditierte er zornig und wies auf das kleine Fenster, durch das man auf das Tal des Cerein sah. Dort, tief unten, kroch endlos und langsam der Zug der Flüchtlinge über die besonnte, staubige Straße. »Es ist der reine Wahnsinn«, sagte er, »daß sie geflohen sind; sie sind nur aus einer Gefahr in eine größere gelaufen. Und statt daß man sie zurückgehalten hätte, hat man sie aufgefordert, sich davonzumachen. Jetzt verstopfen sie die Straßen, und unsere Reserven können nirgends vorrücken. Man weiß nicht, ist unsere Regierung so unfähig, oder steckt böser Wille dahinter.« Der Alte schaute erregt, er gestikulierte lebhaft; wenn Simone ihn so sah, konnte sie’s kaum glauben, daß er noch vor wenigen Minuten so klein und krumm und uralt dagehockt war.
»Der Ministerpräsident«, sprach unterdes Père Bastide weiter, »hat im Radio erklärt, ganze Armeekorps seien einfach nicht da gestanden, wo sie hätten stehen sollen, Brücken seien gegen die Order nicht gesprengt worden. Er hat sechzehn Generäle entlassen. Er hat selber angedeutet, daß Verrat im Spiel sei. Viele sagen, auch mein Xavier sagt es, es hätten Leute in sehr hohen Stellungen, in den Industriellenverbänden, im Comité des Forges, in der Banque de France, von Anfang an damit gerechnet, daß die Boches siegen würden, und ein solcher Sieg, sagen sie, wäre diesen Leuten gar nicht unangenehm. Ich will das nicht glauben«, ereiferte er sich mit seiner hellen Stimme, in ohnmächtiger Wut. »Ich kann das nicht glauben mit meinem alten Kopf. Ich weiß, wozu Faschisten fähig sind. Seitdem sie Jaurès umgebracht haben, weiß ich, wessen die Zweihundert Familien fähig sind. Ich traue ihnen vieles zu, aber das doch nicht.«
Er hielt plötzlich an, blieb vor ihr stehen, wies auf das Bild des Jaurès, und: »›Es gibt‹«, zitierte er den abgöttisch geliebten Meister, »›ein historisches Gebilde, das sich Frankreich nennt. Es ist entstanden aus Jahrhunderten gemeinsamer Leiden und gemeinsamer Sehnsüchte. Gewiß, es gibt Klassenkämpfe, tiefe soziale Gegensätze, aber sie verändern nicht die Idee des Vaterlands.‹ Glaubst du«, fragte er Simone, geradezu drohend, »daß es Franzosen gibt, die es über sich bringen, Frankreich zu verraten in der Stunde der Gefahr? Die ihre Landsleute so auf die Straße schicken?« Und er zeigte hinunter auf den Zug der Flüchtlinge. »Ich glaub es nicht«, suchte er sich selber zu überzeugen. »Ich weigere mich, es zu glauben«, wütete er und schlug mit der Hand auf den Tisch.
Mit ihren ernsten, schönen Augen betrachtete ihn Simone. Er war aus dem alten Frankreich, er wollte es nicht wahrhaben, daß es dieses Frankreich nicht mehr gab. Klein, hilflos, tapfer und ein wenig lächerlich stand er da und kämpfte für seine toten Ideale.
»An allem sind die Advokaten schuld«, fuhr er fort und nahm seinen Gang wieder auf, »die Politiker und die Advokaten, die Frankreich regieren. Sie haben zugeschaut, wie die Boches rüsteten und wie unsere Finanzleute ihnen das Geld dazu gaben, sie haben zugeschaut, wie unsere Zweihundert Familien ihr Kapital nach Amerika verschoben und unsern Stahl an die Boches verschacherten, sie haben debattiert und verhandelt und nochmals verhandelt und nochmals debattiert: und jetzt haben wir das«, und er wies wieder hinunter auf die Straße mit den Flüchtlingen.
Mit bösem Wohlgefallen hörte Simone zu, wie Père Bastide auf die Advokaten schimpfte. Es waren Advokaten gewesen, die verhindert hatten, daß das Andenken ihres Vaters rein erhalten und nach Gebühr geehrt wurde. Advokaten hatten die Untersuchung über seinen Untergang im Urwald des Kongo verschleppt und schließlich versanden lassen.
Père Bastide wetterte noch eine Weile gegen die Advokaten. Dann, beinahe mitten im Satz, brach er ab, stellte sich vor sie hin und lächelte ihr zu; ja, er brachte inmitten all seiner Trauer und seines Grolles ein freundliches, freilich etwas krampfiges Lächeln zustande. »Aber dazu bist du wahrscheinlich nicht hergekommen, meine Kleine«, sagte er, »daß ich mein Herz vor dir ausschimpfe. Und nicht einmal von meinem Nußschnaps hast du genommen. Aber warte, ich hab was anderes für dich«, und mit seinem steifen, erzwungen flinken Schritt ging er ins Nebenzimmer.
Simone erriet, was er ihr bringen wollte. Sie war eine leidenschaftliche Leserin, sie verbrachte ihre ganze, spärliche Freizeit über Büchern; Père Bastide aber wußte das, er beriet sie und pflegte ihr Bücher zu leihen.
Da kam er auch schon zurück, Bücher unterm Arm. Mit geübten Bewegungen machte er ein Paket zurecht und verschnürte es. Sie dankte. Dann verabschiedete sie sich. Sie war länger geblieben, als sie beabsichtigt hatte.
Père Bastide stand wieder in der Nische des kleinen Fensters und starrte hinunter auf die ferne, tiefe Straße mit der Raupe der Flüchtlinge. »Schändlich, schändlich«, wütete er. »Aber«, tröstete er sich, »Frankreich war schon viel tiefer unten und hat es trotzdem wieder geschafft. Das Wunder ist gekommen, noch jedesmal.«
Seine Zuversicht rührte Simone an. Trotzdem fragte sie sich, woher wohl das Wunder kommen sollte, wenn man nichts tat als warten. Hatte er ihr nicht selber erst vor kurzem einen Spruch aus dem Osten zitiert: »Wer, wenn nicht du? Und wann, wenn nicht jetzt?«
2 Der Fuhrhof
Aber als sie schnellen Schrittes den Treppenweg hinunterging, der sie zurück ins Zentrum der Altstadt führte, waren ihre Zweifel verflogen. Es war gut gewesen, daß sie Père Bastide aufgesucht hatte. Sie fühlte sich leichter. Frankreich wird es schaffen.
Der Treppenweg mündete ein in die Rue de l’Arquebuse, und hier stand das stattlichste Haus der Altstadt. Es war das Haus Nummer 97, die Nummer 97 war mit großen, altmodisch verschnörkelten Ziffern gemalt. 97 Rue de l’Arquebuse. In der Schule hatte Simone gelernt, daß das schöne Palais einmal dem alten, edeln Geschlecht der Trémoille gehört hatte und später den Montmorencys. Jetzt verkündete ein großes, blankes Kupferschild, daß hier der Rechtsanwalt und Notar Charles-Marie Levautour seinen Beruf ausübte. Ja, das stattliche Haus gehörte dem Maître Levautour, und Simone, wie sie heute hier vorbeiging, verspürte einen noch stärkeren Widerwillen als sonst. Maître Levautour, ein Altersgenosse und Schulkamerad ihres Vaters, war einer jener Advokaten, welche verhindert hatten, daß dem Gedächtnis Pierre Planchards sein Recht wurde. Er hatte die Preß-Kampagne gegen Pierre Planchard mit immer neuem, giftigem Material gespeist, er hatte es verhindert, daß die Gemeinde Saint-Martin eine Gedenktafel für Pierre Planchard stiftete. Simone haßte ihn abgründig. Er gehörte zu denen, gegen die Père Bastide gewütet hatte. Er war einer von den Anwälten, die, angetan mit ihren schwarzen Roben und Baretten und weißen Halskrausen, das Volk mit hundert Tricks um sein Recht prellten, die die Schuld trugen an dem Unheil, das Frankreich jetzt heimsuchte.
Sie war wieder in der Avenue du Parc angelangt, wo der Weg ins Geschäft abbog. Es war spät, und es lag noch eine Menge Arbeit in Garten und Küche vor ihr. Sie sollte nach Hause, den Gang ins Geschäft könnte sie sich schenken. Sie hätte einen guten Grund: das Einholen hat besonders lange gedauert. Überdies scheint ihr heute der Dienst an der Benzinpumpe doppelt widerwärtig. Auch denkt sie mit Unbehagen an die frechen Blicke und die dreckigen Anmerkungen, die der Chauffeur Maurice bestimmt für sie in Bereitschaft hat.
Da stand sie also wieder an der Avenue du Parc, wo der Weg nach Hause und der Weg ins Geschäft sich schieden; unschlüssig stand sie und zögerte. Dann aber, wiewohl eigentlich alles dagegen sprach, ging sie die Avenue du Parc hinunter, den Weg ins Geschäft. Sie wollte nicht feig sein. Wenn sie sich nicht an ihre Pumpe stellt, dann denkt der Chauffeur Maurice, sie bleibe seinethalb fort, sie habe Angst vor seinen Reden. Nein, sie hat keine Angst.
Wiewohl sie schnell ging und der Weg abwärts führte, brauchte sie eine gute Viertelstunde. Das Transportunternehmen Planchard lag am äußersten Westrand der Neustadt, dort, wo die Hauptzufahrt nach Saint-Martin abzweigte von der großen Straße 6, die in weitem Halbkreis um den Stadthügel führte. Das Transportunternehmen Planchard lag nicht unmittelbar an der Straße, es nahm geräumiges Gelände ein und hatte seine eigene Zufahrt.
Onkel Prosper hatte sich gegen eine Überschwemmung durch die Flüchtlinge wirksam gesichert. Eine Kette sperrte die Zufahrtsstraße zu seinem Unternehmen, ein riesiges Schild war angebracht: »Sackgasse, führt nur zum Haus«, und zwei von seinen Packern hielten Wacht. An den verschlossenen Toren der Mauer, die den Fuhrhof umgab, stand in Riesenlettern: »Kein Benzin, keine Autoutensilien, keine Reparaturen, keine Landkarten.«
Auch hier gelangte Simone mittels eines Signals ins Innere. Sie meldete sich zuerst im Büro. Nach dem wüsten Gedräng der Straße wirkten die Räume leer und friedlich. Die bunten Plakate schauten heute sonderbar sinnlos von den Wänden; da rollten riesige Lastwagen auf gefährlich steilen Pfaden, da steuerten gewaltige Schiffe mit mächtigem Kiel durch schäumende Wellen, da schlängelten sich romantische Straßen durch zerklüftete Berge.
Für einen flüchtigen Augenblick wurde sich Simone bewußt, wie umfangreich das Unternehmen war, das Onkel Prosper aufgebaut hatte. Nicht nur besorgte das Transportunternehmen Planchard den ausgedehnten Lastverkehr des ganzen Departements, Verfrachtung von Holz und Wein vor allem, nicht nur betrieb die Firma verschiedene Autobuslinien, sie hatte auch Straßen gebaut in die dunkel romantische Gebirgslandschaft im Osten und einen blühenden Fremdenverkehr organisiert.
Simone war erstaunt, Onkel Prosper nicht gleich bei ihrem Eintritt wahrzunehmen. In welchem Winkel immer des großen Betriebes man sich aufhielt, von überallher pflegte man sonst den lebhaften Herrn zu sehen oder zu hören; er schien überall zugleich zu sein, in den Büros, in der weiten Garage, auf dem Fuhrhof, mit seiner tiefen, schallenden Stimme Weisungen gebend oder jovial schwatzend, und Simone hatte geglaubt, in dieser Zeit der Not werde er doppelt geschäftig sein.
Monsieur Peyroux, der Buchhalter, klärte sie auf. Der Chef hatte sich oben in sein Privatkontor eingeschlossen und wollte nicht gestört sein. Er verhandelte mit dem Châtelain, mit dem Marquis de Saint-Brisson. Der Herr Marquis, erzählte Monsieur Peyroux ehrfurchtsvoll flüsternd, habe sich, da das Telefon nicht funktioniere, in Person vom Schloß herunter zu Monsieur Planchard bemüht. Das Hasengesicht des Buchhalters sah töricht aus vor Respekt.
Mit Mademoiselle Simone sprach Monsieur Peyroux offen und vertraulich. Er hing an der Firma, er war stolz, ein Angestellter Monsieur Planchards zu sein, den er bewunderte, und in Mademoiselle Simone sah er eine Verwandte des Chefs. Er hielt es für selbstverständlich, daß sie es als hohe Ehre empfand, wenn ein Herr wie der Marquis de Saint-Brisson angewiesen war auf die Hilfe Monsieur Planchards. Die andern Angestellten des Büros aber lächelten und zwinkerten Simone zu; vermutlich machten sie bösartige Witze über die Geschäfte, die der Marquis, der »Faschist«, dem Onkel dort oben in seinem Privatkontor vorschlug.
Simone ließ sich den Schlüssel zur Pumpe geben und ging, ihren Dienst anzutreten. Sie überquerte den Hof. Sonst war hier viel Geschäftigkeit; Touristenwagen, Autobusse, große Frachtwagen kamen an und fuhren ab, wurden repariert, geprüft, befrachtet, entladen. Heute lag der weite Hof leer in der prallen Sonne. Auf der Bank im Schatten der Mauer hockten müßig der alte Chauffeur Richard, der Packer Georges und zwei andere. Aufatmend sah Simone, daß der Chauffeur nicht unter ihnen war.
Hier auf dem Fuhrhof hatte Simone keinen leichten Stand. Onkel Prosper behandelte seine Leute jovial, freundschaftlich, geradezu herzlich, er war großzügig in allem, was nicht das Geschäft betraf. Er war beliebt. Aber wenn es ums Geschäft ging, verstand er keinen Spaß, und jetzt, mit Berufung auf den Krieg, stellte er an seine Leute hohe Anforderungen. So gab es häufig scharfe Unzufriedenheit. Allein man war abhängig von dem Patron, es stand bei ihm, wen unter seinen Packern und Chauffeuren er für unabkömmlich erklären lassen und so vor dem Dienst an der Front retten wollte, man wagte nicht, gegen ihn aufzumucken. An Simone aber, der armen Verwandten, glaubte man den unterdrückten Groll auslassen zu können. Man sah in ihr keine Kameradin, sie gehörte zum Patron, man fühlte sich von ihr beaufsichtigt und bespitzelt, und gerade das wollte man sich nicht gefallen lassen. In ihrer Gegenwart am liebsten machte man sich Luft gegen den Patron.
Onkel Prosper seinesteils trug ihr gerne solche Geschäfte auf, die er andern Angestellten nicht anvertrauen oder nicht zumuten mochte. Auch ihr Geschäft an der Benzinpumpe war dieser Art.
Die Firma Planchard hatte große Mengen Benzin gehamstert, die ihr nach den Rationierungsvorschriften nicht zustanden. Monsieur Planchard hatte Sinn für den Sou, er verschmähte auch kleine Geschäfte nicht und gab von seinem schwarzen Benzin an Leute ab, welche dafür gepfefferte Preise zu zahlen willens und in der Lage waren. In diesen letzten Tagen war Benzin wertvoller als edelster Markenwein, und Monsieur Planchards Preise kletterten immer höher. Es hatte sich indes gezeigt, daß es, wenn er einen ausgewachsenen Angestellten das Benzin verkaufen ließ, zu peinlichen Szenen kam. Die Käufer schimpften und schrien, und es gab übles Geschwätz in der Stadt. Da zog es Monsieur Planchard vor, die Abgabe des Benzins auf eine einzige Nachmittagsstunde zu beschränken und an die Pumpe ein kleines Mädchen zu stellen, das von nichts wußte, sondern einfach einen Befehl ausführte.
Versperrten, trotzigen Gesichtes stellte sich Simone an ihre Pumpe. Da stand sie in ihrem netten, hellgrünen, gestreiften Kleid, und der rote Lack der Pumpe leuchtete grell in der prallen Sonne.
Ein Käufer kam, und wie sie ihm den Preis nannte, zuckte er zurück und fragte noch einmal und preßte die Lippen zusammen und zögerte und entschloß sich und schluckte und zahlte. Ein zweiter kam und war empört und ging. Ein dritter kam und schimpfte unflätig und zahlte.
Widerwärtig war Simone dieses Geschäft immer gewesen. Aber die zehn Jahre, während deren sie in der Villa Monrepos herangewachsen war, hatten sie durchtränkt mit der Überzeugung, Onkel Prosper sei ein großer, vorbildlicher Geschäftsmann, und was er tue, sei das Richtige. Wenn er sie an die Pumpe stellte, so war das recht. Wenn sie ihren Dienst an der Pumpe verrichtete, so war das das Geringste, was sie für einen Mann tun konnte, dem sie zu solchem Dank verpflichtet war.
Heute aber fiel ihr das Geschäft an der Pumpe besonders schwer. Es waren die Bilder hinter ihrer Stirn, die es ihr so schwer machten. Es waren vielerlei Bilder, und sie gingen ineinander: die verknäuelten Wagen mit ihren stumpfen, elenden Insassen, der hagere, rotblonde Kopf ihres Vaters mit den lustigen, zornigen, blaugrauen Augen und den vielen Fältchen herum, der Flüchtlingsjunge auf der Gartenmauer des Hôtels de la Poste, wie er ihr mit bösem Blick nachschaute, nachdem sie ihm den Roblechonkäse gegeben hatte, Père Bastide, klein, in der tiefen Nische seines Fensters stehend und auf die Straße hinunterschauend, hilflos, grimmig, rührend und lächerlich.
Allein ihr junges, knochiges Gesicht zeigte nichts von den Bildern hinter ihrer Stirn. Die andern schauten mißbilligend, ja verächtlich her, wie sie sich zu ihrem üblen Geschäft hergab, die Bettelprinzessin, die davon nicht einmal Dank und Gewinn hatte, die unwürdige Tochter Pierre Planchards. Sie aber stand da und hörte die Worte der Ausgeplünderten und bemühte sich, sie nicht zu hören, und sie bemühte sich, nicht auf die Reden der Packer und Chauffeure zu hören, und hörte doch darauf.
Ein Glück, daß wenigstens Maurice nicht da war.
Hinter ihr war die Front der sehr großen Garage. Aus dem offenen Fenster ganz in ihrer Nähe kam das Plätschern der Brause; hier lag der Waschraum der Chauffeure, an dem schwülen Nachmittag viel benutzt. Sie hörte, wie die Männer schnauften und prusteten. Leicht möglich war es, daß Maurice da drinnen war. Dann kann er jeden Augenblick herauskommen, und dann werden ihr seine bösen Reden nicht erspart bleiben.
So sehr peinigte sie diese Erwartung, daß sie beinahe froh war, als er in der Tür der Garage erschien.
Sie schaute steif vor sich hin. Doch im Geiste sah sie deutlich jeden Schritt, den er machte, sie sah sein massiges, kräftiges Gesicht, seine etwas untersetzte Gestalt, sie sah, wie er mit seinen breiten, lässigen, schaukelnden Schritten hinüber zu den andern schlenderte, wie er den andern zunickte und wie die auf ihrer Bank zusammenrückten, um ihm Platz zu machen.