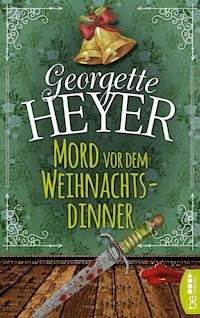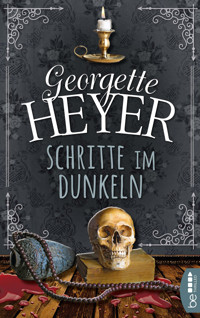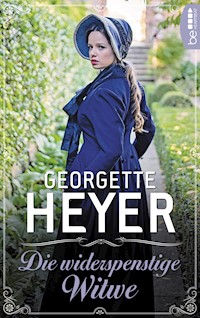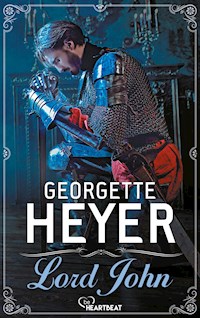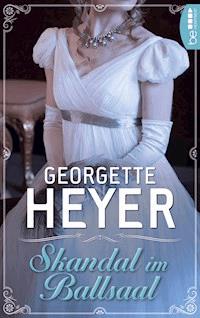
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Der wohlhabende Herzog Sylvester von Salford ist sich ganz sicher: Die junge Phoebe wünscht sich nichts sehnlicher, als ihn zu ehelichen. Schließlich ist er doch eine hervorragende Partie! Aber die rebellische Phoebe weigert sich, von ihren Eltern zur Ehe gezwungen zu werden. In einer stürmischen Nacht brennt sie mit dem Nachbarssohn Tom durch. Sylvester ist empört - eine solche Demütigung ist ihm noch nie widerfahren.
Doch er ahnt nicht die wahren Beweggründe des Mädchens: Nach ihrer ersten Begegnung hat Phoebe ihn als Schurken in ihrem Debütroman verewigt. Und nun steht die Veröffentlichung bevor und könnte einen Skandal in der Londoner High Society auslösen ...
"Skandal im Ballsaal" (im Original: "Sylvester") ist einer der humorvollsten Regency-Romane von Georgette Heyer. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT.
"Georgette Heyer schreibt witzig, scharfsinnig, manchmal boshaft, graziös und mit Zärtlichkeit." Die Welt
"Georgette Heyers Blick für das romantische Detail, ihre mit liebevoller Ironie gezeichneten Charaktere, ihr pointierter Sprachwitz und die genaue Schilderung historischer Hintergründe machen aus ihren spannenden Geschichten mehr als nur Urlaubslektüre." Westfälische Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Über dieses Buch
Der wohlhabende Herzog Sylvester von Salford ist sich ganz sicher: Die junge Phoebe wünscht sich nichts sehnlicher, als ihn zu ehelichen. Schließlich ist er doch eine hervorragende Partie! Aber die rebellische Phoebe weigert sich, von ihren Eltern zur Ehe gezwungen zu werden. In einer stürmischen Nacht brennt sie mit dem Nachbarssohn Tom durch. Sylvester ist empört – eine solche Demütigung ist ihm noch nie widerfahren. Doch er ahnt nicht die wahren Beweggründe des Mädchens: Nach ihrer ersten Begegnung hat Phoebe ihn als Schurken in ihrem Debütroman verewigt. Und nun steht die Veröffentlichung bevor und könnte einen Skandal in der Londoner High Society auslösen …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Skandal im Ballsaal
Aus dem Englischen von Renate Schaider
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1957
Die Originalausgabe SYLVESTER erschien 1957 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1970.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-5898-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Sylvester stand am Fenster seines Frühstückszimmers, stützte die Hände auf den Sims und starrte hinaus in die liebliche Landschaft. Von dieser Seite, der Ostfront von Chance, konnte man zwar den Zierteich nicht sehen, doch eine Zeder brach das Wogen des Rasens, der im Sommer von den Schnittern kurz gehalten wurde, und jenseits der Lichtung schimmerten im winterlichen Sonnenlicht die Stämme von Rotbuchen – Ausläufern des Home-Waldes. Sie übten noch immer ihre Anziehungskraft auf Sylvester aus, wenn sie ihn nun auch eher zu den Wildplätzen riefen als zu einem Land, wo jedes Dickicht einen Drachen barg und falsche Ritter die Reitwege heruntergesprengt kamen. Er und sein Zwillingsbruder Harry hatten die Drachen getötet und große Attacken gegen die Ritter ausgefochten. Nichts war mehr davon übrig; Harry war beinahe vier Jahre tot. Aber nun gab es dort Fasane, um Sylvester hinauszulocken, und sie lockten ihn wahrlich, denn eine Folge grimmiger Fröste hatte den Boden zu Stein werden lassen und ihm zwei Jagdtage geraubt; der stürmische Nordwind hätte selbst den passioniertesten Jäger abgehalten, ein Gewehr in die Hand zu nehmen.
Es war immer noch sehr kalt, aber der Wind hatte sich gelegt, und die Sonne schien; es war höchst unsinnig, dass er sich entschlossen hatte, dieser Tag solle wie all die unfreundlichen, die ihm vorangegangen waren, der Arbeit geweiht sein. Er konnte natürlich seine Absicht ändern, indem er seinem Butler befahl, den verschiedenen Leuten, die seiner Befehle harrten, mitzuteilen, dass er sie am kommenden Tage empfangen wolle. Sein Makler und sein Haushofmeister waren den ganzen Weg von London gekommen, ihm ihre Aufwartung zu machen; aber Sylvester kam nicht auf den Gedanken, sie könnten Grund zur Klage finden, wenn man sie ungeduldig warten ließ. Sie standen in seinem Dienst und hatten keine andere Funktion, als seinen Interessen zu dienen; sie würden seine geänderten Absichten als eine Grille hinnehmen, wie sie von einem vornehmen und wohlhabenden Herrn zu erwarten war.
Aber Sylvester war nicht launenhaft, und er hatte keineswegs die Absicht, dieser Versuchung zu erliegen. Launen brachten schlechte Diener, und für die Verwaltung ausgedehnter Besitztümer war eine gute Dienerschaft unbedingt vonnöten. Sylvester war gerade erst achtundzwanzig Jahre alt geworden, aber er hatte sein riesiges Erbe bereits angetreten, als er neunzehn war, und was immer für Dummheiten und Extravaganzen er begangen hatte, nie hatten sie ihn verleitet, das Erbe als Spielzeug zu behandeln oder sich der geringsten seiner Verpflichtungen zu entziehen. Er war für eine bedeutende Stellung geboren und dazu erzogen, sie in einer Art zu erfüllen, die der langen Reihe hervorragender Ahnen würdig war; und so wenig er nach seinem Recht fragte, all den Leuten Gehorsam zu befehlen, deren Namen auf seiner überwältigenden Lohnliste eingetragen waren, fragte er nach der Unentrinnbarkeit der Pflichten, die auf seine Schultern gelegt worden waren. Hätte man ihn gefragt, ob er über sein Ansehen erfreut war, er hätte wahrheitsgemäß erwidert, dass er das niemals bedacht hatte; aber er hätte es sicherlich sehr missbilligt zu sehen, wie es plötzlich dahinschwand.
Natürlich stellte ihm niemand je so eine Frage. Man hielt ihn allgemein für einen ausnehmend glücklichen jungen Mann, der mit einer hohen Stellung, Vermögen und Eleganz ausgestattet war. Keine böse Fee war zu seiner Taufe gekommen, um geheimnisvoll und mächtig sein Geschick mit der Gabe eines Buckels oder einer Hasenscharte zu beeinflussen. Obwohl nicht mehr als mittelgroß, war er gut proportioniert, mit breiten Schultern, einem Paar wohlgestalteter Beine und einem Aussehen, das einnehmend genug war, das Attribut »stattlich«, das häufig darauf angewendet wurde, nicht ganz lächerlich zu machen. Bei einem geringeren Mann hätte die Eigenart der Augen, die schiefgestellt schienen unter den fliehenden schwarzen Brauen, für einen Makel gegolten; dem Herzog von Salford verliehen sie natürliche Vornehmheit. Und jene, die seine Mutter in ihrer besten Zeit bewundern konnten, erinnerten sich, dass auch sie diese dünne, erhabene Augenbrauenlinie hatte. Es schien, als wären die Augenbrauen mit einem Pinsel zusammengefügt worden, in einer glatten Linie zu den Schläfen aufwärts gezogen. An der Herzogin war diese Besonderheit charmant; an Sylvester war sie weniger attraktiv. Sie verlieh ihm, wenn er ärgerlich war und die hochgezogene Linie durch ein Stirnrunzeln verstärkt wurde, den Anstrich eines Satyrs.
Er war gerade im Begriff, sich vom Fenster abzuwenden, als eine kleine, davoneilende Gestalt seine Aufmerksamkeit erregte. Aus dem Schutz einer Eibenhecke auftauchend, hastete ein kleiner Junge mit goldenem Lockenkopf über die Lichtung davon in Richtung des Home-Waldes. Seine in Nankinghosen steckenden Beine bewegten sich rasch über das Gras, und unter einem Ohr lugte die frischgewaschene Halskrause seines Hemdes zerknittert aus dem Wolltuchmantel, den eilige und ungeschickte Hände über seine kleine blaue Jacke gezogen hatten.
Sylvester lachte und schob das Fenster hoch. Seine erste Eingebung war, Edmund bei seinem Abenteuer Erfolg zu wünschen, aber als er sich hinauslehnte, besann er sich anders. Wenn Edmund auch nicht wegen seines Kindermädchens oder seines Erziehers stehen bliebe, so hätte er es doch getan, falls sein Onkel nach ihm riefe. Und da ihm seine Flucht vor diesen Leuten gelungen war, schien es unsportlich, ihn aufzuhalten, wenn sein Ziel in Sicht war. Ihn unter dem Fenster Zeit vergeuden zu lassen, hieß ihn der Gefahr auszusetzen, gefangen zu werden; und das würde, so überlegte Sylvester, zu einer jener Szenen führen, die ihn tödlich langweilten. Edmund würde um seine Erlaubnis bitten, in den Wald zu gehen, und ob er sie gab oder versagte, er wäre gezwungen, die Vorwürfe seiner verwitweten Schwägerin zu ertragen. Man würde ihn entweder beschuldigen, den armen kleinen Edmund mit brutaler Strenge oder mit herzloser Gleichgültigkeit zu behandeln; denn Lady Henry Rayne konnte sich nicht dazu durchringen, ihm zu verzeihen, dass er seinen Bruder überredet hatte (wie sie halsstarrig behauptete), Edmund seiner alleinigen Obhut zu überlassen. Es war für jedermann sinnlos, Lady Henry zu erzählen, Harrys Wille sei anlässlich seiner Heirat nur deshalb schriftlich aufgesetzt worden, um bei einem Unfall – den niemand für unwahrscheinlicher hielt als Harry selbst – sicherzugehen, dass ein Nachkomme des Paares unter dem Schutze des Familienoberhauptes geborgen sei. Für wie dumm Sylvester sie auch halten mochte, so war sie doch nicht so naiv, sich einzubilden, sein Anwalt hätte es ohne seinen ausdrücklichen Befehl gewagt, eine so schändliche Klausel einzufügen. Sylvester, den die Wunde von Harrys Tod noch schmerzte, hatte sich zu dem bitteren Vorwurf hinreißen lassen: »Wenn du glaubst, ich will diesen Balg am Halse haben, bist du noch naiver, als ich angenommen hatte!«
Er musste diese voreiligen Worte bedauern, denn obwohl er sie sofort zurücknahm, ließ man ihn sie nie vergessen. Und sie bildeten heute, da die Aufsicht Edmunds eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit geworden war, den Grundstein der Argumente Lady Henrys. »Du wolltest ihn nie«, erinnerte sie ihn. »Du hast es selbst gesagt!«
Es war natürlich zum Teil wahr gewesen: Außer der Tatsache, dass es Harrys Sohn war, hatte er sehr wenig Interesse für einen zweijährigen Jungen aufgebracht, und er hatte ihm nie mehr Aufmerksamkeit gezollt, als man es von einem jungen Mann erwarten mochte. Als Edmund jedoch dem Säuglingsalter zu entwachsen begann, achtete er schon mehr auf ihn, denn Edmunds erstes Ziel war, sich selbst so fest wie möglich an seinen prächtigen Onkel anzuschließen, wann immer dieser auf Chance war. Er hatte Eigenschaften, die Button, dem Kindermädchen Edmunds (sie hatte auch schon seinen Vater und seinen Onkel großgezogen), oder seiner Mama gänzlich fehlten. Sylvester zeigte keine Neigung, seinen Neffen zu verzärteln: Zerrissenen Kleidern gegenüber war er gleichgültig. Die Unterhaltung, die er mit Edmund führte, war kurz und sachlich; und wenn er ihm in ungnädiger Laune mit Nachdruck etwas über seine Pflicht zu sagen hatte, konnte es immer geschehen, dass er ihn vor sich in den Sattel setzte und in raschem Galopp mit ihm durch den Park flog. Diese Eigenschaften gingen Hand in Hand mit einer weniger liebenswürdigen denn gottähnlichen Eigenart: Er verlangte augenblicklichen Gehorsam für seine Befehle und hatte eine barsche Art, mit Widerspenstigen umzugehen.
Sylvester dachte, dass Janthe und Button ihr Bestes taten, um Edmund zugrunde zu richten; doch während er nicht zögerte, diesem durchtriebenen jungen Herrn klarzumachen, wie töricht es sei, bei ihm die Methoden anzuwenden, die in der Kinderstube Erfolg hatten, kam es selten vor, dass er sich wirklich in seine Erziehung einmischte. Er sah an Edmund keine Fehler, die sich nicht rasch geben würden, wenn er etwas älter war; und bis zu seinem sechsten Lebensjahr sollte er heranwachsen, wie es ihm gefiel, sowohl um seinet- als auch um seines Vaters willen.
Edmund war aus dem Blickfeld verschwunden. Sylvester zog das Fenster wieder herunter und dachte, er müsse dem Schlingel wirklich einen lebhafteren Hauslehrer geben als Reverend Loftus Leyburn, den ältlichen und ziemlich kraftlosen Kleriker, der sein, oder genauer gesagt, der Kaplan seiner Mutter war. Er hatte es als unzulängliches Übereinkommen betrachtet, als Janthe Mr. Loftus gebeten hatte, Edmund seine ersten Lektionen zu erteilen; aber kein hinreichender Grund erlaubte ihm, sie herauszufordern, indem er dem Plan seine Zustimmung verweigerte. Nun beklagte sie sich, dass Edmund die Pferdeställe häufig besuche und hier die vulgärste Sprache lerne. Was zum Teufel hatte sie denn erwartet, fragte er sich.
Er wandte sich vom Fenster ab, als die Tür geöffnet wurde und der Butler eintrat, gefolgt von einem jungen Diener, der die Reste eines ausgiebigen Frühstücks abräumte.
»Ich werde Mr. Ossett und Pewsey nachmittags empfangen, Reeth«, sagte Sylvester. »Chale und Brough können ihre Bücher zur selben Zeit zu mir hereinbringen. Ich werde jetzt Ihrer Gnaden einen Besuch machen. Sie können eine Botschaft an Trent hinuntersenden und ihm mitteilen, dass ich –« Er hielt inne und warf einen Blick zum Fenster. »Nein, lassen Sie das! Um vier Uhr wird es nicht mehr hell genug sein.«
»Es ist schade, dass Euer Gnaden an einem so prächtigen Tag im Arbeitszimmer eingesperrt sein sollten«, sagte Reeth beschwörend.
»Sehr traurig, aber dem ist nicht abzuhelfen.« Er bemerkte, dass er sein Taschentuch fallengelassen hatte und dass der Diener sich beeilte, es für ihn aufzuheben. »Danke sehr«, sagte er, als er es nahm, und begleitete die Worte mit einem leichten Lächeln. Er hatte ein ungemein charmantes Lächeln, und es sicherte ihm, ungeachtet wie anspruchsvoll seine Forderungen sein mochten, die Anstrengungen seiner Diener ohne ein Wort der Klage. Er wusste das ganz genau, wie er sich auch des Wertes eines lobenden Wortes bewusst war, das genau im richtigen Augenblick ausgesprochen wurde; und er hätte es für außerordentlich unklug gehalten, das zu unterlassen, was ihn so wenig kostete und so wünschenswerte Erfolge zeitigte.
Er verließ das Frühstückszimmer, ging zur großen Halle und damit (hätte man glauben mögen) in ein anderes Jahrhundert. Denn dieser Mittelteil des Gebäudes, das sich ziemlich weit ausdehnte, war alles, was von dem ursprünglichen Bauwerk übrig geblieben war. Raue Balken, getünchte Wände und ein Fußboden aus ungleichmäßigen Steinplatten standen hier in seltsamem, aber nicht unglücklichem Kontrast zur glatten Eleganz der modernen Teile des großen Hauses. Die Flügeltreppe aus der Tudor-Zeit, die von der Halle hinauf zu einer Galerie führte, wurde von zwei Figuren in voller Rüstung bewacht; die Wände waren mit Gruppen alter Waffen geschmückt; die Glasfenster trugen Wappen; und unter einer riesigen Kaminhaube nährte ein Gluthaufen mehrere lodernde Holzscheite. Vor diesem Feuer lag ein braun und weiß gefleckter Spaniel in einer Haltung aufmerksamer Erwartung. Als er Sylvesters Schritt hörte, hob er den Kopf und begann mit dem Schweif zu wedeln; als Sylvester aber die Halle betrat, ließ der Hund den Schweif sinken; obwohl er seinem Herrn entgegenjagte und anbetend zu ihm aufblickte, als dieser sich bückte, um ihn zu tätscheln, sprang er weder um ihn herum noch stieß er ein Bellen freudiger Erwartung aus. Sylvesters Diener war kaum vertrauter mit der Garderobe seines Herrn als der Spaniel, und der Hund wusste wohl, dass Pantalons und Schaftstiefel keine andere Hoffnung verhießen, als höchstens zu Füßen seines Herrn in der Bibliothek zu liegen.
Das Appartement der Herzogin umfasste außer ihrem Schlafzimmer und dem Ankleideraum, in dem ihre Kammerfrau regierte, ein Vorzimmer, das in ein riesiges sonniges Gemach führte, das dem Haushalt als Salon der Herzogin bekannt war. Sie verließ diesen Salon selten, denn sie war viele Jahre lang das Opfer arthritischer Beschwerden gewesen, die keiner der hervorragenden Ärzte, die sie behandelt hatten, und auch nicht irgendeine der Kuren, denen sie sich unterzogen hatte, zu lindern vermochte. Sie konnte sich mit Hilfe ihrer Diener noch von ihrem Zimmer in ihren Salon schleppen, aber einmal in ihren Sessel gesunken, gelang es ihr nicht mehr, sich ohne fremde Hilfe daraus zu erheben. Was für ein Ausmaß an Schmerzen sie erdulden musste, wusste niemand, denn niemals beklagte sie sich oder bat um Mitleid. »Ganz gut«, war ihre beständige Antwort auf besorgte Fragen nach ihrem Wohlbefinden; und wenn jemand die Eintönigkeit ihres Daseins bedauerte, lachte sie und sagte, Mitleid sei auf sie verschwendet und wäre besser auf jene angewendet, die um sie bemüht waren. Was sie betraf, so glaubte sie, man solle sie eher beneiden als bemitleiden: mit einem Sohn, der ihr all den Londoner Klatsch zu Gehör brachte; einem Enkel, der sie mit seinen Possen amüsierte; einer Schwiegertochter, die mit ihr die neuesten Moden diskutierte; einer geduldigen Cousine, die ihre Grillen ertrug; einer ergebenen Dienerin, die sie verhätschelte, und einem alten Freund, Mr. Leyburn, der mit ihr in ihren Büchern schmökerte. Außer ihren engsten Freunden gegenüber erwähnte sie ihre Gedichte nicht, aber es entsprach den Tatsachen, dass die Herzogin Schriftstellerin war. Mr. Blackwell hatte zwei Bände ihrer Verse veröffentlicht, und diese hatten sich ziemlicher Beliebtheit unter den Mitgliedern der guten Gesellschaft erfreut; denn obwohl sie natürlich anonym veröffentlicht wurden, enthüllte sich das Geheimnis ihrer Autorschaft bald und schien ihnen beträchtliches Interesse zu sichern.
Als Sylvester das Zimmer betrat, war die Herzogin mit Schreiben beschäftigt, und zwar auf einem Tisch, der vom Gutszimmermann so klug angefertigt war, dass er quer zu den Armstützen ihres Lehnstuhles passte. Als sie sah, wer eingetreten war, legte sie ihre Feder nieder und begrüßte Sylvester mit einem Lächeln, das charmanter war als sein eigenes, denn es zeigte mehr Wärme. Sie rief aus: »Ah, wie reizend! Aber sehr lästig für dich, mein Lieber, am ersten guten Jagdtag, den wir seit einer Woche haben, zu Hause bleiben zu müssen!«
»Tödlich langweilig, nicht wahr?«, erwiderte er und beugte sich über sie, um ihre Wange zu küssen. Sie streckte die Hand aus, um sie auf seine Schulter zu legen, und er hielt einen Augenblick inne und prüfte ihren Gesichtsausdruck. Offensichtlich war er mit dem, was er sah, zufrieden, denn er ließ seine Augen zu dem hübschen Spitzenhäubchen, das auf ihrem silbrig-schwarzen Haar saß, schweifen und sagte: »Ein neuer Stil, Mama? Das ist eine ganz bezaubernde Haube!«
Ein leichtes Lächeln erschien in ihren Augen. »Gestehe, dass dir Anna den Wink gab, von meinem Putz Notiz zu nehmen!«
»Aber nein! Meinst du, deine Kammerfrau müsse mich erst aufmerksam machen, wenn du in voller Schönheit erstrahlst?«
»Sylvester, du machst so charmant den Hof, dass ich fürchte, du musst der zügelloseste Herzensbrecher sein!«
»Oh, nicht zügellos, Mama! Arbeitest du an einem neuen Gedicht?«
»Bloß ein Brief. Liebster, wenn du den Tisch wegschiebst, kannst du diesen Sessel ein wenig heranziehen, und wir können uns bequem unterhalten.«
Er wurde an der Ausführung durch den eiligen Eintritt von Miss Augusta Penistone gehindert, die aus dem angrenzenden Zimmer kam und ihn bat, sich nicht zu bemühen, da sie diese Arbeit ausschließlich als ihre eigene betrachte. Dann schob sie den Tisch auf die Seite des Zimmers, und statt sich zurückzuziehen, wie er es stets wünschte, zauderte sie und lächelte ihn liebenswürdig an. Sie war eine steife, ziemlich unbeholfene Frau, ebenso freundlich wie treuherzig; und sie diente der Herzogin, deren Verwandte sie war, als Gesellschafterin. Ihre Gutmütigkeit war unerschöpflich, aber unglücklicherweise war sie bar jeglicher Intelligenz und versäumte selten, Sylvester dadurch zu reizen, dass sie ihm Fragen stellte, deren Antworten offenkundig waren, oder dass sie Selbstverständliches erklärte. Er ertrug es sehr gefasst, denn seine Manieren waren außerordentlich gut. Sie stellte fest, dass er nicht zum Jagen ausgegangen war, erinnerte sich aber, dass man nach einem strengen Frost nicht jagte, und bemerkte, fröhlich über ihren Fehler lächelnd: »Nun, das war aber sehr töricht von mir, das zu sagen, nicht wahr?« Darauf konnte er sich nicht enthalten, mit vollendeter Verbindlichkeit zu erwidern: »Allerdings.«
Bei diesem Stand des Zwiegesprächs griff die Herzogin ein und forderte ihre Cousine auf, den Sonnenschein draußen zu genießen, solange er noch anhielt. Um sicherzugehen, sagte Miss Penistone, sie würde es sich wirklich erlauben, wenn der liebe Sylvester bei seiner Mama zu bleiben beabsichtigte, woran sie nicht zweifle. Sie wies darauf hin, dass Anna kommen würde, wenn die Herzogin die Glocke läutete, und ging zur Tür, die Sylvester offen hielt. Dort fühlte sie sich bemüßigt, innezuhalten, um ihm mitzuteilen, sie verlasse ihn, damit er mit seiner Mama plaudern könne. Sie fügte hinzu: »Denn ich bin sicher, Sie wollen mit ihr allein sein, nicht wahr?«
»Richtig, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie das erraten haben, Cousine!«, erwiderte er.
»Oh«, erklärte Miss Penistone fröhlich, »das wäre ja noch schöner, wenn ich nach all den Jahren nicht wüsste, was Sie beabsichtigen! Nun, ich werde Sie jetzt verlassen – aber Sie sollten sich nicht bemühen, mir die Tür zu öffnen! Das hieße, mich wie eine Fremde zu behandeln! Ich sage Ihnen das ja immer, nicht wahr? Aber Sie sind ja stets so zuvorkommend!«
Er verneigte sich und schloss die Tür hinter ihr. Die Herzogin sagte: »Ein unverdientes Kompliment, Sylvester. Mein Lieber, was veranlasste dich, so zu sprechen? Gar nicht nett!«
»Ihre Torheit ist kaum zu ertragen!«, sagte er gereizt. »Warum duldest du eine derart konfuse Person um dich? Sie muss dich über jedes erträgliche Maß belästigen!«
»Sie ist natürlich nicht besonders klug«, räumte die Herzogin ein. »Aber ich könnte sie doch nicht gut wegschicken.«
»Soll ich es für dich tun?«
Sie war bestürzt, aber da sie annahm, dass er aus gedankenloser Gereiztheit sprach, sagte sie nur: »Alberner Junge! Du weißt, du könntest es genauso wenig wie ich.«
Er hob eine Braue. »Natürlich könnte ich es tun, Mama! Was sollte mich daran hindern?«
»Das kann nicht dein Ernst sein!«, rief sie aus, halb geneigt, noch über ihn zu lachen.
»Aber ich bin absolut ernst, meine Liebe! Sei offen mit mir! Wünschst du sie nicht dorthin, wo der Pfeffer wächst?«
Sie sagte mit einem reumütigen Augenzwinkern: »Nun ja, manchmal! Erzähl das nicht weiter, bitte. Ich habe wenigstens den Anstand, mich zu schämen!« Sie bemerkte, dass er Überraschung zeigte, und sagte in ernstem Ton: »Natürlich ärgert es dich, wie auch mich, wenn sie einfältige Dinge sagt und nicht das Taktgefühl hat, uns zu verlassen, wenn du zu einem Besuch kommst; aber ich versichere dir, ich schätze mich glücklich, sie zu haben. Es kann nicht sehr unterhaltsam sein, an einen Kranken gefesselt zu sein, weißt du; aber sie ist niemals ärgerlich oder übler Laune, und worum immer ich sie bitte, sie macht es willig und so fröhlich, dass sie mich in Gefahr bringt zu glauben, es freue sie, mir zur Verfügung zu stehen.«
»Das will ich hoffen!«
»Nun, Sylvester ...«
»Meine liebe Mama, sie hat sich an deine Kittelfalten gehängt, solange ich mich erinnern kann, und das nicht wenig! Du hast ihr immer ein Gehalt bewilligt, das weit höher war, als du einem Fremden gezahlt hättest, der dir zur Gesellschaft engagiert worden wäre.«
»Du sprichst, als missgönntest du es ihr!«
»Wenn du meinst, dass sie es verdient, dann missgönne ich es ihr nicht mehr, als ich meinen Diener um seinen Lohn beneide. Ich zahle meinen Dienern hohe Gehälter, aber ich behalte niemanden in meinem Dienst, der seinen Lohn nicht verdient.«
Ein verstörter Blick traf ihn, aber die Herzogin sagte nur: »Das kann man nicht vergleichen, aber wir wollen nicht darüber zanken! Du kannst mir glauben, es würde mich sehr unglücklich machen, Augusta zu verlieren. Ich wüsste wirklich nicht, wie es dann mit mir weitergehen sollte.«
»Wenn das so ist, Mama, brauchst du nichts mehr zu sagen. Glaubst du, ich würde nicht jedem, den du um dich haben willst, das Doppelte – ja das Dreifache – bezahlen, was du Augusta gibst?« Er sah, dass sie die Hand nach ihm ausstreckte, und ging sofort zu ihr. »Du weißt, ich würde nie etwas tun, das nicht in deinem Sinn ist! Schau nicht so unglücklich, Liebste!«
Sie drückte seine Hand. »Ich weiß das ja. Achte nicht auf mich! Es ist nur, dass es mich ein wenig erschreckte, dich so hart sprechen zu hören. Aber niemand hat weniger Grund, Härte an dir zu beklagen, als ich, mein Liebling.«
»Unsinn!«, sagte er und lächelte zu ihr hinunter. »Behalte deine langweilige Cousine, Liebe, aber erlaube, dass ich wünsche, du hättest jemand um dich, der dich besser unterhalten – besser an dem teilnehmen könnte, was dich interessiert!«
»Nun, ich habe Janthe«, erinnerte sie ihn. »Sie teilt nicht gerade meine Interessen, aber wir kommen gut miteinander aus.«
»Ich bin glücklich, das zu hören. Aber es scheint so auszusehen, als solltest du nicht länger das zweifelhafte Glück ihrer Gesellschaft genießen.«
»Mein Lieber, wenn du mir vorschlagen willst, ich solle eine zweite Dame zu meiner Gesellschaft aufnehmen, ersuche ich dich, deine Worte zu sparen!«
»Nein, das hätte keinen Zweck.« Er hielt inne und sagte dann unbewegt: »Ich denke daran, mich zu verheiraten, Mama!«
Sie war so außer sich vor Überraschung, dass sie ihn nur wortlos anstarrte. Er genoss den Ruf eines gefährlichen Schürzenjägers, doch sie hatte beinahe die Hoffnung aufgegeben, er könne sich entschließen, einer Dame die Hand zur Ehe zu reichen. Sie hatte Grund zu der Annahme, er habe mehr als eine Geliebte gehabt – einige von ihnen waren sehr kostspielige Jüngerinnen der Venus gewesen, wenn man ihrer Schwester glauben konnte! –, und es schien, als ob er diese Art zu leben einer geordneteren Existenz vorzöge. Als sie sich von ihrer Bestürzung erholte, sagte sie: »Mein Lieber, das kommt höchst unerwartet!«
»Nicht so unerwartet, wie du denkst, Mama. Ich beabsichtigte schon seit einiger Zeit, mit dir darüber zu sprechen.«
»Ach du meine Güte! Und ich habe es nie vermutet! Setz dich, bitte, und erzähle mir alles darüber.«
Er blickte sie forschend an. »Wärest du erfreut, Mama?«
»Natürlich wäre ich das!«
»Dann, denke ich, ist das in Ordnung.«
Das brachte sie zum Lachen. »Man stelle sich nur vor! Sehr gut! Du hast meine Zustimmung, erzähle mir alles!«
Er sagte, indem er stirnrunzelnd in das Feuer starrte: »Ich weiß nicht, ob es da so viel zu erzählen gibt. Ich nehme an, du hast vermutet, ich könne mich nicht mit dem Gedanken befreunden, gebunden zu sein. Ich traf bisher keine Frau, an die ich gekettet sein wollte. Bei Harry war das anders, und wenn mich etwas in meinem Entschluss bestärken konnte –«
»Mein Lieber, lass das!«, unterbrach sie. »Harry war glücklich in seiner Ehe, vergiss das nicht! Ich glaube sogar, dass Janthe, wenn ihre Gefühle auch nicht tief waren, ihm doch aufrichtig zugetan war.«
»Ihm so sehr zugetan, dass sie binnen eines Jahres nach seinem Tode den Anblick eines Ballraumes herbeisehnt und binnen vier Jahren plant, einen unwürdigen Laffen zu heiraten! Das geht nicht, Mama!«
»Sehr gut, mein Lieber, aber wir sprechen von deiner Heirat, nicht von der Harrys, nicht wahr?«
»Allerdings! Nun, ich hielt mir vor Augen – oh, schon länger als ein Jahr! – es sei meine Pflicht, zu heiraten. Nicht sosehr um eines Erben willen, da ich ja schon einen habe, aber –«
»Sylvester, setz Edmund diesen Gedanken nicht in den Kopf!«
Er lachte. »Er würde sich kaum große Sorgen machen! Sein Ehrgeiz ist es, Postkutscher zu werden – oder war es, bis ihm Keighley den Zinnsoldaten als Spielzeug gab! Nun kann er sich nicht entscheiden, Postkutscher oder Schildwache zu sein. Er würde es für ziemlich uninteressant halten, wenn man ihm sagte, er wäre stattdessen verpflichtet, in meine Fußstapfen zu treten!«
Sie lächelte. »Ja, jetzt vielleicht, aber später –«
»Nun, das ist einer meiner Gründe, Mama. Wenn ich zu heiraten beabsichtige, sollte ich es tun, bevor Edmund alt genug ist zu glauben, dass er aus dem Sattel gehoben wurde. So habe ich mich vor einigen Monaten umzusehen begonnen.«
»Du bist wirklich höchst seltsam! Das nächste Mal wirst du mir erzählen, du habest eine Liste der Eigenschaften aufgestellt, die deine Frau besitzen muss!«
»Mehr oder weniger«, gab er zu. »Du magst lachen, Mama, aber du wirst zustimmen, dass bestimmte Eigenschaften unerlässlich sind! Sie muss, zum Beispiel, aus guter Familie sein. Ich meine nicht unbedingt eine großartige Partie, aber ein Mädchen meines eigenen Standes.«
»Oh ja, darin stimme ich mit dir überein! Und weiter?«
»Nun, vor einem Jahr hätte ich gesagt, sie müsse schön sein«, antwortete er sinnend. (Sie wird wohl keine Schönheit sein, dachte die Herzogin.) »Aber nun bin ich geneigt zu glauben, es sei wichtiger, dass sie intelligent ist. Ich vermute, dass ich eine Frau mit dem Verstand eines Huhnes nicht ertragen könnte. Außerdem will ich dir keinen weiteren Narren ins Haus bringen.«
»Ich bin dir sehr verbunden!«, sagte sie, ziemlich amüsiert. »Klug, aber nicht schön: sehr gut! Fahre fort!«
»Nein, einen gewissen Grad an Schönheit fordere ich schon. Sie muss wenigstens erträglich aussehen und die Art von Eleganz besitzen, die du hast, Mama!«
»Versuch nicht, mir den Kopf zu verdrehen, du Schmeichler! Hast du unter den Debütantinnen eine entdeckt, die mit allen diesen Eigenschaften ausgestattet ist?«
»Auf den ersten Blick vielleicht ein Dutzend, aber letzten Endes nur fünf.«
»Fünf!«
»Nun, nur fünf, mit denen ich es vielleicht ertragen könnte, einen Großteil meines Lebens zu verbringen. Da ist Lady Jane Saxby: Sie ist hübsch und gutmütig. Dann ist da die Tochter Barninghams: Sie besitzt sehr viel Lebhaftigkeit. Miss Bellerby ist ein schönes Mädchen, mit ein wenig Zurückhaltung, was ich nicht missbillige. Lady Mary Torrington – oh, ein Diamant reinsten Wassers! Und zuletzt Miss Orton: Nicht schön, aber ganz einnehmend, und sie hat ein liebenswürdiges Betragen.« Er hielt inne, den Blick weiterhin auf die glimmenden Holzscheite geheftet. Die Herzogin wartete gespannt. Er blickte nach einiger Zeit zu ihr auf und lächelte sie an. »Nun, Mama?«, sagte er freundlich. »Welche von ihnen soll es sein?«
Kapitel 2
Nach einem Augenblick der Überraschung sagte die Herzogin: »Liebster, treibst du deinen Spaß mit mir? Du kannst mich doch nicht im Ernst bitten, für dich zu wählen!«
»Nein, nicht direkt wählen. Ich möchte vielmehr, dass du mich berätst. Du bist mit keiner von ihnen bekannt, aber du kennst ihre Familien, und solltest du eine bestimmte Vorliebe haben ...«
»Aber Sylvester, hast du denn keine Vorliebe?«
»Nein, das ist das Teuflische daran: Ich habe keine. Wann immer mir eine geeigneter erscheint als die anderen, entdecke ich todsicher irgendeinen Fehler oder eine Eigenheit an ihr, die ich nicht mag. Lady Janes Lachen zum Beispiel; oder Miss Ortons entsetzliche Harfe! Ich habe für Musik keinen Sinn, und das endlose Klimpern einer Harfe in meinem eigenen Haus erdulden zu müssen – nein, das hieße, es doch ein wenig zu toll treiben, nicht wahr, Mama? Und Lady Mary ...«
»Danke, ich habe genug gehört, um dir meinen Rat geben zu können!«, unterbrach seine Mutter. »Mach keiner von ihnen einen Antrag! Du bist nicht verliebt!«
»Verliebt! Natürlich bin ich das nicht. Ist das so notwendig?«
»Höchst notwendig, mein Lieber! Ich bitte dich, biete niemandem die Ehe an, dem du nicht auch Liebe bieten kannst!«
Er lächelte sie an. »Du bist zu romantisch, Mama.«
»Bin ich das? Du hingegen scheinst überhaupt keine romantische Ader zu haben!«
»Nein, ich suche Romantik jedenfalls nicht in der Ehe.«
»Nur in leichterer Gesellschaft?«
Er lachte. »Du schockierst mich, Mama! Das ist etwas anderes. Man sollte es wohl nicht Romantik nennen – eher das erste Abenteuer eines Mannes. Und selbst als ich ein Grünschnabel war und mich in den verwirrendsten kleinen Paradiesvogel verliebte, den man jemals sah, glaube ich nicht, dass ich mir wirklich einbildete, eine bleibende Leidenschaft empfunden zu haben. Vielleicht bin ich zu unbeständig und daher –«
»Das ist es nicht! Du warst nur noch nie so glücklich, das Mädchen zu treffen, für das du eine dauerhafte Leidenschaft empfinden könntest.«
»Tatsächlich, das war ich nicht! Und da ich seit nahezu zehn Jahren in der Stadt lebe und man wirklich behaupten kann, dass ich unter all den zu Gebote stehenden Debütantinnen, die alljährlich auf dem Heiratsmarkt erscheinen, meine Auswahl treffen konnte, müssen wir schließen, dass ich, wenn nicht zu flatterhaft, in meinen Anforderungen zu wählerisch sein muss. Um offen zu dir zu sein, Mama, du bist die einzige Dame meiner Bekanntschaft, mit der ich mich nicht bald von Herzen langweile!«
Ein unmerkliches Stirnrunzeln erschien zwischen ihren geschwungenen Augenbrauen, als sie diese Worte hörte. Trotz seines neckenden Tones war sie beunruhigt. »Deine Auswahl, Sylvester?«
»Ja, ich denke. Ich muss alle Heiratsfähigen gesehen haben, nehme ich an.«
»Und du hast nicht wenige von ihnen zum Gegenstand deiner Aufmerksamkeit gemacht – wenn man den Dingen, die ich hörte, glauben darf.«
»Meine Tante Louisa«, sagte Sylvester, nicht irregehend. »Was für eine unverbesserliche Klatschbase deine Schwester ist, meine Liebe! Nun, wenn ich auch hie und da eine Vorliebe gezeigt habe, kann sie mir doch zumindest nicht den Vorwurf machen, meine Aufmerksamkeit so konzentriert zu haben, um im Busen irgendeiner Maid falsche Hoffnungen zu erwecken!«
Die Andeutung des Lachens war aus ihren Augen verschwunden. Das Bild, das sie von ihrem geliebten Sohn hegte, trug plötzlich einen Makel; ein Gefühl der Unruhe ließ sie für den Augenblick nicht die rechten Worte finden. Als sie zögerte, kam es zu einer Störung. Die Tür wurde geöffnet, und eine hübsche, klagende Stimme sagte: »Darf ich hereinkommen, Mama Herzogin?« Auf der Schwelle erschien ein Bild der Schönheit, gekleidet in einen pelzverbrämten Mantel aus blauem Samt, während ein Hut mit einer hohen geschwungenen Krempe den Rahmen für ein entzückendes Gesichtchen bildete. Ringellocken von hellem Gold umspielten die rosenroten Wangen; riesige blaue Augen waren von zarten Brauen überwölbt; die kleine Nase war vollkommen gerade, der rote Mund anmutig geschwungen.
»Guten Morgen, meine Liebe. Natürlich darfst du hereinkommen!«, sagte die Herzogin.
Die Schönheit hatte unterdessen ihren Schwager bemerkt. Sie kam zwar herein, sagte aber mit merkbar verringerter Herzlichkeit: »Oh! Ich wusste nicht, dass Sylvester bei Ihnen ist, Ma’am. Ich bitte um Verzeihung, aber ich kam nur, um festzustellen, ob Edmund hier wäre.«
»Ich habe ihn heute Morgen nicht gesehen«, erwiderte die Herzogin. »Ist er nicht bei Mr. Leyburn?«
»Nein, und das ist besonders ärgerlich, weil ich ihn auf einen Besuch zu den Arkholmes mitnehmen will! Sie wissen, dass ich schon seit Tagen beabsichtige, nach Grange zu fahren, Ma’am, und nun, am ersten schönen Morgen, den wir seit langer Zeit haben, weiß niemand, wo Edmund ist!«
»Vielleicht hat er sich zu den Ställen davongeschlichen, der kleine Spitzbube!«
»Nein, das habe ich zwar auch erwartet, denn seit Sylvester ihn derart ermutigt, die Ställe zu besuchen –«
»Meine Liebe, das tun doch alle Kinder, und ohne die geringste Ermutigung!«, warf die Herzogin ein. »Meine taten es auch – sie waren die erbärmlichsten kleinen Schelme! Sag mir, ist dieser reizende Mantel aus einem jener Samte, die wir letzten Monat nach den uns übersandten Mustern wählten? Wie hübsch er geworden ist!«
Der Versuch, die Gedanken der Schönen in andere Bahnen zu lenken, schlug fehl. »Ja, aber denken Sie nur, Ma’am!«, rief Janthe aus. »Ich ließ davon einen Anzug für Edmund machen, den er tragen soll, wenn er mit mir ausgeht – ganz schlicht, aber in der Art jenes roten Gewandes, das der Knabe auf dem Gemälde von Reynolds trägt. Ich vergaß, wo ich es sah, aber ich dachte sofort, wie gut Edmund darin wirken würde, wenn es bloß nicht rot, sondern blau wäre!«
»Würde für ihn kaum passen!«, murmelte Sylvester.
»Was hast du gesagt?«, fragte Janthe argwöhnisch.
»Nichts.«
»Ich vermute, es war irgendetwas Boshaftes. Ich habe natürlich niemals angenommen, dass du es für hübsch halten würdest!«
»Du irrst. Das Bild, das ihr beide gewöhnlich bietet, wäre hübsch genug, einem den Atem zu rauben. Vorausgesetzt natürlich, Edmund könnte überredet werden, sich dementsprechend zu benehmen. In deinem Arm lehnend, mit diesem seelenvollen Ausdruck im Gesicht – nein, das geht nicht. Den hat er nur, wenn er auf Unfug sinnt. Nun –«
»Sylvester, willst du wohl still sein?«, bat die Herzogin, bemüht, ein Lachen zu unterdrücken. »Achte nicht auf ihn, mein liebes Kind! Er neckt dich bloß!«
»Oh, ich weiß das, Ma’am!«, sagte Janthe, und ihre Farbe vertiefte sich merklich. »Ich weiß auch, wer es ist, der den armen kleinen Edmund lehrt, nicht auf mich zu hören!«
»Oh, guter Gott, was denn noch alles?«, rief Sylvester aus.
»Das tust du!«, beharrte sie. »Und es zeigt, wie wenig Zuneigung du für ihn empfindest! Wenn er dir nicht völlig gleichgültig wäre, würdest du ihn nicht ermutigen, in weiß der Himmel welche Gefahr zu laufen!«
»Was für eine Gefahr?«
»Irgendwas kann ihm doch geschehen!«, erklärte sie. »Gerade in diesem Augenblick kann er auf dem Grunde des Sees liegen!«
»Er ist keineswegs in der Nähe des Sees. Wenn du es unbedingt wissen willst: Ich sah ihn zum Home-Wald rennen!«
»Und du hast nicht die geringste Anstrengung unternommen, ihn zurückzurufen, schließe ich!«
»Nein. Als ich mich das letzte Mal in Edmunds unerlaubte Vergnügungen einmischte, war ich für dich drei Tage lang ein Monster an Unmenschlichkeit.«
»Ich habe nie etwas dergleichen gesagt, außer dass – und überhaupt kann er seine Absicht ändern und am Ende doch zum See gehen!«
»Sei unbesorgt: Er wird es nicht tun! Jedenfalls nicht, solange er weiß, dass ich zu Hause bin.«
Sie sagte verdrießlich: »Ich hätte wissen sollen, wie es kommen würde! Ich möchte nun überhaupt nicht mehr nach Grange fahren, und ich würde es auch nicht, hätte ich nicht die Pferde anspannen lassen. Aber ich werde nicht einen Augenblick des Seelenfriedens haben wegen der Ungewissheit, ob mein armes verwaistes Kind in Sicherheit ist oder auf dem Grund des Sees ruht!«
»Sollte er verabsäumen, rechtzeitig zum Dinner zu erscheinen, werde ich den See mit Netzen absuchen lassen«, versprach Sylvester, ging zur Tür und öffnete sie. »Inzwischen, wie unbesorgt ich wegen meines Neffen auch sein mag, wegen meiner Pferde bin ich nicht so nachlässig, und ich bitte dich inständig, wenn du ein Paar hast anspannen lassen, soll es bei dieser Witterung nicht stehen!«
Diese Bitte erzürnte Janthe so sehr, dass sie in höchster Erregung aus dem Zimmer stürzte.
»Erbaulich!«, bemerkte Sylvester. »Obwohl sie ihren verwaisten Sohn auf dem Grunde des Sees glaubte, fährt diese liebevolle Mutter auf eine Vergnügungsreise!«
»Mein Lieber, sie weiß sehr gut, dass er nicht auf dem Grund des Sees liegt! Könnt ihr euch denn niemals begegnen, ohne aneinanderzugeraten? Ich muss schon sagen, du bist ebenso ungerecht zu ihr wie sie zu dir!«
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Wenn ich jemals eine Spur ihrer vielgerühmten Liebe zu Edmund bemerkt hätte, könnte ich sie geduldig ertragen, aber das war niemals der Fall! Wenn er ihre Liebkosungen artig erträgt, gefällt ihr die Vorstellung, in ihn vernarrt zu sein, wenn er aber laut wird, ist es geradezu eine Komödie zu sehen, wie rasch sie Kopfschmerzen bekommt, damit Button geholt werden muss, um ihren Liebling zu entfernen! Sie mied seine Nähe, als er die Masern hatte, und als sie seine Zahnschmerzen zum Vorwand nahm, ihn nach London zu bringen, und dann den Zahn des Bengels eher in seinem Kopf verfaulen lassen wollte, als sich der Mühe zu unterziehen, ihn zum Zahnziehen zu zwingen –«
»Ich wusste, wir würden darauf kommen!«, unterbrach die Herzogin und hob die Hände. »Lass dir sagen, mein Sohn, es braucht sehr viel Mut, ein widerspenstiges Kind zum Zahnarzt zu schleppen! Ich brachte ihn nie auf! Es fiel Button zu, dieser schrecklichen Verpflichtung nachzukommen – so wäre es auch in Edmunds Fall geschehen, bloß war sie zu dieser Zeit krank!«
»Du darfst mir keinen Vorwurf machen, Mama«, sagte er lachend. »Denn ich habe diese schreckliche Verpflichtung übernommen, erinnere dich!«
»Ja, tatsächlich! Armer Edmund! Sich im Park auf ihn zu stürzen, ihn in dein Karriol zu zerren und zur Folterkammer davonzurasen in so grausamer Weise! Wahrlich, mein Herz blutete für ihn!«
»Es wäre gut gewesen, hättest du sein Gesicht gesehen, so wie ich! Ich vermute, die einfältige Kammerjungfer, die ihn in Obhut hatte, erzählte dir, dass ich mich auf ihn stürzte? Ich tat nichts anderes, als sofort mit ihm zu Tilton zu fahren, und dazu war nicht Mut, sondern Standhaftigkeit nötig! Nein, Mama, verlange von mit nicht, Janthes Zuneigung zu ihrem Bengel ernst zu nehmen, denn das widert mich an! Ich möchte nur wissen, wer der Hornochse war, der ihr damit schmeichelte, wie reizend sie mit ihrem Kind in den Armen aussähe. Auch dass ich Narr genug gewesen war und mich hergab, Lawrence zu beauftragen, sie in dieser ergreifenden Pose zu malen!«
»Du tatest es, um Harry eine Freude zu machen«, sagte die Herzogin sanft. »Ich habe mich immer in der Hoffnung gewiegt, das Porträt würde rechtzeitig vollendet, dass er es noch sehen könnte.«
Sylvester schritt zum Fenster hinüber und blickte hinaus. Nach einigen Minuten sagte er: »Es tut mir leid, Mama. Ich hätte das nicht sagen sollen.«
»Nein, natürlich nicht, Liebster. Wenn du nur versuchen würdest, nicht so hart zu Janthe zu sein, denn sie ist wirklich zu bedauern, weißt du. Du hast es missbilligt, als sie am Ende des ersten Trauerjahres mit ihrer Mama wieder in Gesellschaft zu gehen begann. Nun, ich habe es auch missbilligt, aber wie könnte man von so einem vergnügungssüchtigen kleinen Geschöpf erwarten, nach all dem hier trübsinnig herumzusitzen? Es war bei ihr nicht unschicklich, dass sie ihre Trauerkleidung ablegte.« Sie zögerte und fügte dann hinzu: »Es ist bei ihr auch nicht unpassend, wenn sie nun wieder zu heiraten wünscht, Sylvester.«
»Ich habe sie nicht der Ungehörigkeit beschuldigt.«
»Nein, aber du machst es ihr schrecklich schwer, mein Lieber! Sie mag ja Edmund nicht so innig lieben, aber ihn ihr völlig wegnehmen –«
»Wenn das geschehen sollte, ist das ihre Sache, nicht meine! Sie kann sich hier häuslich einrichten, solange sie will, oder sie kann mit Edmund im Dower House wohnen. Ich habe bloß verlangt, dass Harrys Sohn auf Chance aufgezogen wird, unter meinen Augen! Wenn Janthe wieder heiratet, ist ihr Besuch bei Edmund jederzeit willkommen. Ich habe ihr sogar gesagt, dass er in regelmäßigen Abständen bei ihr sein kann. Aber etwas werde ich nie tun: erlauben, dass er unter Nugent Fotherbys Obhut aufwächst! Lieber Gott, Mama, wie kannst du es für möglich halten, ich würde das Vertrauen meines Zwillingsbruders so missbrauchen?«
»Ah, nein, nein! Aber ist Sir Nugent wirklich so entsetzlich? Ich war mit seinem Vater flüchtig bekannt – er war so freundlich, dass er zu allem ja und amen sagte! Aber ich glaube, ich habe den Sohn nie getroffen.«
»Das brauchst du nicht zu bedauern. Ein wohlhabender Laffe, zu drei Teilen Idiot, und der vierte – lassen wir das! Ein hübscher Hüter wäre ich, wenn ich Edmund seiner und Janthes Erziehung überließe! Weißt du, was Harry mir sagte, Mama? Es waren nahezu die letzten Worte, die er zu mir sprach: ›Du passt auf den Jungen auf, Dook.‹« Er hielt inne, und seine Stimme brach beim letzten Wort. Nach einem Augenblick sagte er mit belegter Stimme: »Du weißt, er rief mich gern so – mit diesem Zwinkern in den Augen. Es war keine Frage oder Forderung. Er wusste, ich würde es tun, und er sagte es nicht, um mich zu erinnern, sondern weil es für ihn ein beruhigender Gedanke war. Er sagte mir immer, was er gerade dachte.« Er sah, dass seine Mutter die Augen mit einer Hand bedeckte, und er schritt durch den Raum zu ihr, nahm ihre andere Hand und hielt sie fest. »Vergib mir! Ich musste es dir zu verstehen geben, Mama!«
»Ich verstehe doch, Sylvester, aber wie kann ich es für richtig ansehen, das Kind hierzubehalten mit niemandem außer der alten Button, die nach ihm sieht, oder mit einem Hauslehrer, für den er viel zu jung ist? Wenn ich nicht nutzlos wäre –« Sie unterbrach sich plötzlich.
Da er sie kannte, unternahm er keinen Versuch, auf das zu antworten, was unausgesprochen geblieben war, und sagte ruhig: »Ja, ich habe das auch bedacht, und das ist für mich auch ein wichtiger Grund für die Heirat. Ich nehme an, Janthe würde sich bald mit dem Gedanken einer Trennung von Edmund anfreunden, könnte sie ihn nur in der Obhut seiner Tante lassen. Sie würde dann nicht den Makel der Herzlosigkeit auf sich laden, nicht wahr? Es ist ihr ja sehr wichtig, was die Leute über sie reden – und ich muss zugeben, ich verstehe nicht, wie sie Edmund der Gnade seines bösen Onkels überlassen kann, nachdem sie der Welt ein Bild von sich in der Rolle der zärtlichen Mutter geboten hat. Von meiner Frau könnte man, wie du weißt, sehr wohl denken, sie habe meine Laune besänftigt.«
»Nun, Sylvester ...! Sie kann niemals gesagt haben, du seist böse.«
Er lächelte. »Sie mag wohl nicht genau diesen Ausdruck verwendet haben, aber sie hat jedermann mit der Schilderung meiner mangelnden Sorge für Edmunds Wohlergehen und der häufigen Brutalität ihm gegenüber ergötzt. Man wird vielleicht alles glauben, aber ich habe Grund zur Annahme, sogar ein Mann von so klarem Verstand wie Elvaston denkt, ich behandle den Jungen mit unverdienter Strenge.«
»Nun, wenn Lord Elvaston seine Tochter nicht besser kennt, um die Lügenmärchen, die sie erzählt, zu glauben, habe ich von seinem Verstand eine geringe Meinung!«, sagte die Herzogin ziemlich scharf. »Hören wir doch endlich auf, über Janthe zu sprechen, mein Lieber!«
»Gern! Ich möchte lieber über meine eigenen Angelegenheiten sprechen. Mama, was für eine Frau soll ich heiraten?«
»In deiner gegenwärtigen Verfassung wünsche ich nicht, dass du irgendein weibliches Wesen heiratest. Wenn du klüger geworden bist, natürlich die, die du selbst heiraten möchtest.«
»Du bist nicht im Mindesten hilfreich!«, beklagte er sich. »Ich dachte, Mütter schmiedeten immer Heiratspläne für ihre Söhne.«
»Und erlitten daher einige herbe Enttäuschungen. Die einzige Heirat, die ich jemals für dich plante, war die mit einem Baby von drei Tagen, als du acht Jahre alt warst.«
»Was du nicht sagst! Das ist herrlich!«, sagte er aufmunternd. »Wer war sie? Kenne ich sie?«
»Du hast sie nicht erwähnt, aber ich nehme an, du hast sie zumindest gesehen, denn sie wurde dieses Jahr vorgestellt und hatte ihre erste Season. Ihre Großmutter schrieb es mir, und ich wollte dich beinahe bitten –«, sie brach ab, über sich selbst ärgerlich, und änderte den Satz, den sie gerade aussprechen wollte, »– ihr eine freundliche Nachricht von mir zu überbringen, tat es aber nicht, denn man kann von ihr kaum erwarten, dass sie sich an mich erinnert. Sie ist die Enkelin von Lady Ingham.«
»Was, meine verehrte Frau Mama? Eines der Ingham-Mädchen? Nein, meine Liebe! Ich bedaure unendlich, aber – nein!«
»Nein, nein, Lord Marlows Tochter!«, erwiderte sie lachend. »Er heiratete Verena Ingham, die meine liebste Freundin und das bezauberndste Wesen war.«
»Das klingt schon besser!«, stimmte er zu. »Warum bin ich niemals der bezaubernden Lady Marlow begegnet?« Er hielt inne und runzelte die Stirn. »Aber ich bin es ja. Ich bin mit ihr nicht bekannt – und tatsächlich erinnere ich mich nicht, dass ich jemals mit ihr gesprochen habe, aber ich muss dir sagen, Mama, was immer sie in ihrer Jugend gewesen sein mag –«
»Guter Gott, jene grässliche Frau ist Marlows zweite! Verena starb, als ihr Baby noch nicht vierzehn Tage zählte.«
»Sehr traurig. Erzähl mir von ihr!«
»Ich glaube nicht, dass du viel klüger sein wirst, wenn ich es tue«, antwortete sie und fragte sich, warum er versuchte, ihre Gedanken von den Erinnerungen, die er selbst heraufbeschworen hatte, abzulenken. »Sie war nicht schön oder gebildet oder wenigstens modisch, fürchte ich! Sie vereitelte jede Anstrengung, sie in eine vornehme junge Dame zu verwandeln, und war niemals elegant, außer in ihrem Reitdress. Sie machte die verrücktesten Dinge, und niemand nahm ihr das übel – nicht einmal Lady Cork! Wir wurden in derselben Season vorgestellt und waren die besten Freundinnen; aber während ich so glücklich war, Papa zu treffen – und mich auf den ersten Blick in ihn zu verlieben, wie ich dir sagen muss –, wies sie jedes Angebot ab, das man ihr machte – Dutzende davon, denn es fehlte ihr nie an Bewerbern! –, und erklärte, sie zöge ihre Pferde jedem Mann, den sie getroffen hätte, vor. Die arme Lady Ingham war verzweifelt! Und zu guter Letzt heiratete sie ausgerechnet Marlow! Ich glaube, sie muss ihn wegen seiner Reitkunst geliebt haben, denn ich bin sicher, sonst war nichts Liebenswertes an ihm. Keine sehr aufregende Geschichte, leider! Warum wolltest du sie hören?«
»Oh, ich wollte wissen, was für eine Frau sie war. Ich kenne doch Marlow und würde meinen, seine Tochter müsse unerträglich langweilig sein. Aber das Kind deiner Verena könnte gerade die richtige Frau für mich sein, glaubst du nicht? Du wärest geneigt, sie gern zu haben, was eine wichtige Voraussetzung ist; und obwohl ich mir nicht eine Frau aufbürden möchte, die Führung braucht, könnte ich mir vorstellen, von Marlows Blut müsse genug in dem Mädchen sein, um, was immer an Wildheit sie von ihrer Mutter geerbt haben mag, zu mäßigen. Überspanntheit mag amüsant sein, Mama, aber sie ist nicht am Platz bei einer Ehefrau, noch dazu bei meiner Frau!«
»Mein Lieber, was für einen Unsinn du sprichst! Wenn ich annehmen würde, das wäre deine ehrliche Überzeugung, müsste ich ernstlich beunruhigt sein.«
»Aber ich meine das wirklich! Ich dachte, du wärest auch erfreut! Was könnte romantischer sein, als ein Mädchen zu heiraten, das mit mir in der Wiege verlobt wurde?«
Sie lächelte, schien aber nicht sehr erfreut. Seine Augen suchten ihr Gesicht; er sagte in dem schmeichelnden Ton, den er nur ihr gegenüber anschlug: »Was bedrückt dich, meine Liebe? Erzähl es mir!«
Sie sagte: »Sylvester, du hast von fünf Mädchen gesprochen, die vielleicht zu dir passen könnten; und nun sprichst du von einem Mädchen, von dessen Existenz du vor zehn Minuten keine Ahnung hattest – und zwar so, als hättest du nur zwischen ihnen zu entscheiden! Mein Lieber, kam dir nie der Gedanke, du könntest abgewiesen werden?«
Sein Antlitz erhellte sich. »Ist das alles? Nein, nein, Mama, ich werde nicht abgewiesen werden!«
»Bist du dir da so sicher, Sylvester?«
»Natürlich bin ich sicher, Mama! Oh, nicht bei Miss Marlow! Möglicherweise könnte ihr Herz nicht mehr frei sein.«
»Oder sie könnte dich mit Abneigung aufnehmen«, gab die Herzogin zu bedenken.
»Mich mit Abneigung aufnehmen? Warum sollte sie das?«, fragte er überrascht.
»Wie soll ich das erklären? So etwas kommt, wie du weißt, tatsächlich vor.«
»Wenn du meinst, sie könnte sich nicht in mich verlieben – nun, vielleicht wirklich nicht, obwohl ich keinen Grund sehe, warum sie es nicht tun sollte – oder mich jedenfalls leidlich gern haben. Glaubst du, es mangelt mir so an Lebensart, dass ich mich nicht liebenswürdig zeigen kann, wenn ich will? Pfui über dich, Mama!«
»Nein«, sagte sie. »Aber ich wusste nicht, dass du so viel Lebensart hättest, nicht weniger als fünf Mädchen von Rang und Namen zu bezaubern, bereitwillig einen Antrag von dir anzunehmen.«
Er konnte nicht widersprechen. »Nun, Mama, du sagtest selbst, dass ich so charmant den Hof mache«, murmelte er.
Das entlockte ihr ein Lächeln, denn sie konnte diesem strahlenden Blick nie widerstehen. Trotzdem schüttelte sie den Kopf und sagte: »Schäm dich, Sylvester! Willst du für einen Hanswurst gehalten werden?«
Er lachte. »Natürlich nicht! Um offen zu dir zu sein, es gibt nicht fünf, sondern ein Dutzend junger Damen von Rang und Namen, die sicher geneigt sind, einen Antrag von mir anzunehmen. Du weißt, ich bin nicht so schwer zu behandeln, obwohl ich nicht bezweifle, dass ich ebenso viele Fehler habe wie irgendjemand. Meine sind jedoch angenehmer; kaum wahrnehmbar unter der prächtigen Hülle, die sie bedeckt!«
»Wünschst du eine Frau, die dich um deines Vermögens willen heiratet?«, fragte die Herzogin und hob die Brauen.
»Ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen einzuwenden hätte, vorausgesetzt, wir wären beide damit einverstanden. So eine Frau würde mir wahrscheinlich keine Szenen machen; und Szenen, Mama, würden ganz gewiss binnen zwölf Monaten zu unserer Trennung führen. Ich könnte das nicht ertragen!«
»Szenen, mein Sohn, sind kein unbedingter Begleitumstand von Liebesheiraten«, sagte sie trocken.
»Wer sollte das besser wissen als ich?«, gab er zurück, und sein Lächeln umfing sie. »Aber wo sollte ich nach deinem Gegenstück suchen, meine Liebe? Zeige sie mir, und ich verspreche dir, mich hoffnungslos in sie zu verlieben und sie zu heiraten, ohne Angst vor bösen Folgen!«
»Sylvester, du bist doch zu albern!«
»Nicht so albern, wie du denkst! Im Ernst, Mama, obwohl ich einige Liebesheiraten kenne, die glücklich waren, kenne ich sehr viele, die es sicher nicht waren. Oh! Zweifellos würden einige Ehepaare meiner Bekanntschaft große Augen machen, wenn sie von mir hörten, ich hielte sie für alles andere als glücklich! Vielleicht finden sie Vergnügen an Eifersüchteleien, Ärger, Streitigkeiten und dummen Missverständnissen: ich nicht! Die wohlerzogene Frau, die mich heiratet, weil sie sich einbildet, dann eine Herzogin zu sein, wird sehr gut zu mir passen und wahrscheinlich ihre Stellung wunderbar ausfüllen.« Seine Augen neckten sie. »Oder möchtest du gern, dass ich mich völlig verändere und mich in bescheidener Vermummung wie ein Prinz im Märchen auf den Weg mache? Ich habe nie viel von so einem Prinzen gehalten, wie du weißt! Welch einfältiger Junge, denn wie konnte er hoffen, als gewöhnliches Wesen verkleidet irgendwelchen Frauenzimmern außer solchen zu begegnen, die absolut nicht in Frage kamen und die er unmöglich heiraten konnte?«
»Sehr wahr!«, erwiderte sie.
Er achtete stets darauf, ob sie ihm aufmerksam zuhörte. Es schien ihm nun, als sähe sie plötzlich müde aus; sofort sagte er voller Gewissensbisse: »Ich habe dich zu Tode erschöpft mit meinem Unsinn! Aber warum ließest du mich reden, bis du Kopfweh bekamst? Soll ich Anna zu dir schicken?«
»Nein, bitte nicht! Ich versichere dir, mein Kopf schmerzt nicht«, sagte sie und lächelte zärtlich zu ihm auf.
»Ich wünschte, ich könnte dir glauben!«, sagte er und beugte sich über sie, um ihre Wange zu küssen. »Ich werde dich ruhen lassen, bis Augusta dich wieder überfällt: Erlaube ihr nicht, dich zu peinigen!«
Er verließ sie, und die Herzogin blieb zurück, versunken in ihre Gedanken, bis sie durch die Rückkehr ihrer Cousine daraus aufgerüttelt wurde.
»Ganz allein, liebe Elizabeth?«, rief Miss Penistone aus. »Nun, wenn ich das bloß gewusst hätte – aber im Allgemeinen glaube ich doch, Sylvester bliebe immer bei Ihnen, wenn ich nicht verpflichtet wäre, endlich hereinzukommen! Ich habe sicher schon hundertmal gesagt, dass ich keinen derart aufmerksamen Sohn kenne. Und wie rücksichtsvoll! So etwas hat es noch nie gegeben!«
»Ah, ja!«, sagte die Herzogin. »So rücksichtsvoll zu mir, so unendlich liebenswürdig!«
Sie schien ein wenig traurig, was ungewöhnlich an ihr war. Miss Penistone, die beinahe in dem aufmunternden Tone sprach, den Button verwendete, um Edmund abzulenken, wenn er widerspenstig war, sagte: »Heute hat er besonders gut ausgesehen, nicht wahr? So eine ausgezeichnete Figur, und welch distinguiertes Wesen! Es wird große Trauer herrschen, wenn er sich endlich einer Frau ergibt!«
Sie lachte liebenswürdig über diesen Gedanken, aber die Herzogin schien nicht amüsiert. Sie sagte nichts, Miss Penistone sah jedoch, wie ihre Hände sich auf der Lehne ihres Sessels krampfhaft schlossen und wieder öffneten, und auf einmal schien ihr, die Herzogin müsse ohne Zweifel fürchten, dass ein so guter Fang wie Sylvester von irgendeiner nichtswürdigen und hinterlistigen Kreatur, die seiner Aufmerksamkeit ganz unwert war, gekapert werden könnte. »Und keine Besorgnis wegen seiner Heirat, wie man zu sagen pflegt«, meinte Miss Penistone strahlend, aber mit einem besorgten Blick auf die Herzogin. »Bei so vielen Mädchen, die auf ihn Jagd machen, müssten Sie sich freilich einigermaßen ängstigen, wäre er nicht so vernünftig. Dieser Gedanke kam mir einmal – wie töricht! –, und ich erwähnte ihn Louisa gegenüber, als sie im Sommer hier war. ›Nicht er!‹, sagte sie – Sie kennen ihre schroffe Art. ›Er kennt seinen Wert zu gut!‹ Was mich ganz beruhigte, wie Sie sich denken können.«
Es schien nicht die gleiche wohltuende Wirkung auf das Gemüt der Herzogin auszuüben, denn sie hob eine Hand, um ihre Augen zu bedecken. Miss Penistone wusste sogleich, was ihr fehlte: Sie hatte eine ihrer unruhigen Nächte gehabt, die arme Elizabeth!
Kapitel 3
Sylvester erwähnte seine Heiratspläne nicht weiter; er war sich auch nicht darüber im Klaren, dass seine Mutter sich um ihn sorgte, da sie es nicht verabsäumte, heiter zu sein, wann immer er sie besuchte. Im gegenteiligen Fall hätte er nur angenommen, sie verabscheue den Gedanken an seine Heirat, und es wäre ihm nicht schwergefallen, derartige Hirngespinste zu zerstreuen. Hätte sie ihm erzählt, sie sei beunruhigt durch die Angst, er wäre hochmütig geworden, dann hätte er sich gesorgt, irgendetwas gesagt zu haben, was diese Vorstellung hervorgerufen hatte, und er hätte sein Bestes getan, sie davon zu befreien. Er war mit verschiedenen Leuten bekannt, für die das Beiwort »hochmütig« wohl passen mochte, und er hielt sie für unausstehlich. Zwar waren wenige Männer verhätschelter und umschmeichelter als er; auch gab es nur wenige Gastgeberinnen, die ihm solche Geringschätzung nicht vergeben hätten, die ihnen nicht selten von verwöhnten Männern von Rang und Namen zugefügt wurde. Aber keine Gastgeberin hatte jemals Grund gehabt, sich über einen Mangel an Sylvesters Höflichkeit zu beklagen; und keine noch so unbedeutende Person, die ihm auch nur den geringfügigsten Dienst leistete, hatte Grund, ihn für verachtenswert zu halten. Seine Höflichkeit für Leute von Bedeutung aufzusparen, war ein Zeichen schlechter Erziehung, schimpflich für einen selbst, ebenso widerlich, wie mit seiner Wichtigkeit zu prunken oder einen Diener wegen einer Ungeschicklichkeit zu tadeln. Sylvester erschien nicht allzu spät auf Gesellschaften, weigerte sich nie, an einem Kontertanz teilzunehmen, verabschiedete sich nicht schon gelangweilt nach nur einer halben Stunde, ließ Einladungen nie unbeantwortet, starrte keinen seiner Pächter grußlos an oder versäumte es etwa, an Gesellschaftstagen auf Chance mit jedem seiner Gäste ein Wort zu wechseln. Er war daher durchaus nicht geneigt zu glauben, der Vorwurf der Arroganz, der gegen ihn erhoben wurde, sei etwas anderes als bloße Verleumdung, wahrscheinlich von einem Speichellecker in Umlauf gesetzt, den er abgewiesen hatte, oder von irgendeinem unverschämten Emporkömmling, dessen Anmaßung in die Schranken zu weisen er sich verpflichtet gefühlt hatte.
Die Herzogin wusste das und war daher verlegen. Sie hätte gern jemand um Rat gefragt, der sich diese Angelegenheiten so sehr zu Herzen nahm wie sie selbst und besser wissen musste als sie (die Sylvester nur in ihren eigenen Räumen sah), wie er sich in Gesellschaft benahm. Es gab nur einen solchen Menschen; aber obwohl sie Hochachtung wie auch Zuneigung für Lord William Rayne, Sylvesters Onkel, empfand, der zwei Jahre lang sein Vormund gewesen war, bedurfte es kaum einer Überlegung, sie zu überzeugen, dass jeder Versuch, ihn an ihren unklaren Befürchtungen teilhaben zu lassen, sie nur als das Opfer von Grillen erscheinen ließ, wie sie wohl einen Kranken befallen konnten. Lord William war altmodisch, sehr gutmütig und freundlich, aber auch sehr förmlich. Er hatte einigen Einfluss auf Sylvester, den er ebenso gern hatte wie er auf ihn stolz war: Ein Wort von ihm würde schwer wiegen, aber unglücklicherweise konnte ein Vergehen seines Neffen gegen seine Stellung in der Gesellschaft eher Lord Williams Vorwürfe hervorrufen als Sylvesters übertriebene Selbsteinschätzung.
Er weilte zu Weihnachten auf Chance. Weit davon entfernt, die Herzogin zu beruhigen, machte er sie noch niedergeschlagener, obwohl das nicht in seiner Absicht lag. Er fand für Sylvester nichts als uneingeschränktes Lob. Er sagte der Herzogin, der Junge handle gerade so, wie er sollte, und seine Manieren seien außerordentlich korrekt. »Sehr leutselig und höflich, aber er weiß auch den geziemenden Abstand zu wahren«, sagte Lord William. »Du brauchst nicht zu fürchten, dass er vergessen wird, was er seiner Stellung schuldet, liebe Schwägerin! Er sagte mir, dass er daran denkt, sich zu vermählen. Sehr gut so. Höchste Zeit, dass er die Kinderschuhe abstreift! Er scheint in diesem Falle vorzugehen, wie es richtig ist, aber ich gab ihm einen Wink. Wohlgemerkt, ich glaube nicht, dass es nötig war, aber ich sähe es nicht gern, wenn er sich zum Narren machte, da ihm ein guter Rat fehlt. Aber er hat Gott sei Dank keine jämmerlichen romantischen Ideen!«
Es war unabänderliche Sitte des Hauses von Rayne, dass sich so viele Mitglieder wie möglich zu Weihnachten unter dem Dach des Hausherrn versammelten. Da die Familie riesengroß war und die meisten von denen, die auf Chance zusammenkamen, einen Monat blieben, hatte Sylvester wenig Muße und sah weniger von seiner Mutter, als ihm lieb war. Er war ein ausgezeichneter Gastgeber und hatte eine vortreffliche Stütze in seiner Schwägerin, die neben ihrem Sinn für Unterhaltung mit großer Freude als Bevollmächtigte der Herzogin handelte. Ihre Freude wurde nur durch Sylvesters Weigerung, Sir Nugent Fotherby zu der Gesellschaft einzuladen, getrübt. Sie wendete ein, dass er, wenn er ihren Vater und ihre Mutter einladen konnte, mit gleichem Recht auch ihren Bräutigam einladen konnte; aber jede Absicht, die sie gehabt haben mochte, diese Klage vorzubringen, wurde durch das Eingreifen beider Eltern zunichte gemacht. Lord Elvaston, dem Sir Nugent widerwärtig war, teilte ihr mit, er fahre sofort nach Hause, wenn er dem Burschen auf Chance begegne, und Lady Elvaston, die zwar geneigt war, Sir Nugent wegen seines unerhörten Reichtums zu akzeptieren, sagte ihr, wenn sie Sylvester damit umstimmen wolle, dass sie ihm Gelegenheit böte, diesen liebenswerten Dandy aus nächster Nähe zu beobachten, wäre sie nichts als ein Dummkopf.
Sylvester verließ Chance gegen Ende Januar, einen Tag später als sein letzter säumiger Gast. Er wollte nach Blandford Park, wohin er seine Jäger geradewegs von Leicestershire geschickt hatte; zuerst fuhr er jedoch nach London, was keinerlei Überraschung hervorrief, da er seiner Mutter erzählte, er habe Geschäfte zu erledigen. Da er Blandford Park der Jagd und nicht der Heirat wegen besuchte, hegte sie bei seiner Abreise keinerlei Befürchtung, er könne einer der fünf zur Wahl stehenden Kandidatinnen seine Hand anbieten. Keine dieser Damen würde in Blandford Park sein; und es war in höchstem Maße unwahrscheinlich, dass sie gegen Ende Januar in London zu finden waren. Die Herzogin glaubte, er hätte wenig Gelegenheit, seine beabsichtigte Unklugheit vor Beginn der Season auszuführen. Aber er hatte ihr nicht erzählt, was sein Hauptanliegen in der Stadt war: Er wollte seiner Patin einen Morgenbesuch abstatten.