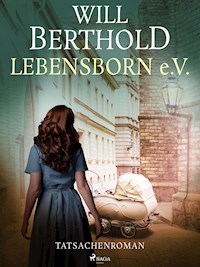Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Professor Andy Steuben, Chef einer renommierten Münchner Klinik, genießt als Herzchirurg einen hervorragenden Ruf. Seine teilweise unkonventionellen und mutigen Eingriffe haben schon viele Menschenleben gerettet, und seit kurzem wird er als Anwärter für den Nobelpreis für Medizin gehandelt. Er und seine ebenfalls erfolgreiche Frau Julia, die nach der Hochzeit ihre Karriere als Innenarchitektin weiter verfolgt hat, sind verliebt wie am ersten Tag und mit ihrem zwölfjährigen Sohn Martin eine glückliche Familie. Doch dann erkrankt Julia schwer und die wohlbehütete Familienidylle gerät ins Wanken. Steuben gerät an die Grenzen seiner medizinischen Kompetenz. Droht die Familie an diesem Schicksalsschlag zu zerbrechen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Solang wir leben
Arztroman
SAGA Egmont
Solang wir leben
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany(www.ava-international.de).
Originally published 1985 by Goldman Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711727089
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Die Luft im überfüllten Wartezimmer war verbraucht. Das Fenster durfte nicht geöffnet werden, weil einige Patienten Fieber hatten. Sie waren Opfer eines paradoxen Zustands: Nie in der langen Geschichte der Medizin hatte der Mensch eine größere Chance, wieder gesund zu werden, doch nie auch kränkelte das Krankenhauswesen mehr als in unserer Gegenwart. Die Kosten haben sich in der Bundesrepublik innerhalb von zehn Jahren verdreifacht.
Die meisten, die hier seit Stunden saßen, waren schon seit Wochen oder Monaten bei dem berühmten Herzspezialisten angemeldet. Dabei gehörte Professor Andy Steuben zu den Ärzten, die sich nur schwer damit abfinden, daß der Tag in ein Zwangskorsett von vierundzwanzig Stunden gepreßt ist; er verlängerte ihn, indem er sein Privatleben noch mehr verkürzte.
Seine Patienten, die er nicht im Stich lassen wollte, vergötterten ihn, aber er war kein Modearzt und schon gar kein Scharlatan. Sooft sich die Türe öffnete, hoben die Wartenden die Köpfe. Der Professor rief sie weder über Lautsprecher auf, noch ließ er sie durch seine Assistentin holen. Seine Behandlung begann damit, daß er jeden persönlich abholte und in den Ordinationsraum geleitete.
»Ich hab’ das ausgeschnitten«, sagte die rundliche Frau im Lodenkostüm. Sie setzte ihre Brille auf und las laut im gehobenen Tonfall: »Wie unser Stockholmer Korrespondent aus sicherer Quelle erfährt, gehört der Münchener Kardiologe und Chirurg Andy Steuben – zugleich Gastprofessor an der Harvard University in den USA – zu den aussichtsreichsten Anwärtern des diesjährigen Nobelpreises für Medizin. Der hervorragende Mediziner, dem man nachsagt, er vereine deutsche Gründlichkeit mit amerikanischer Unbekümmertheit, soll sowohl als Forscher wie als Therapeut ausgezeichnet werden. Er ist 43 Jahre alt, lehrt in Deutschland und in den USA und ist in München als Chefarzt der renommierten Heinrich-Kreckel-Klinik tätig.«
Sie nickte stolz, als hätte sie ihrem Arzt die Auszeichnung verliehen. »Ist das nicht großartig?« kassierte sie allgemeine Zustimmung und faltete den Ausschnitt sorgfältig zusammen wie einen Gebetszettel.
»Ich kenne keinen besseren Arzt«, sagte eine Fünfzigerin mit einem verhärmten Gesicht, »und ich kenne viele Ärzte.«
Es war das Stichwort zu einem Erfahrungsaustausch, bei dem die Halbgötter in Weiß nicht allzugut abschnitten.
Zwischendurch öffnete sich die Türe des Ordinationsraumes. Der eintretende Professor unterbrach Lob und Tadel seines Standes. Er hatte die Reihenfolge im Kopf und rief seine Patienten auf, wie sie gekommen waren, ob er sie nun zum Nulltarif behandelte oder zur höchsten ADGO-Gebühr.
Zwei Stunden später hatte der Professor seine letzte Patientin verabschiedet; mit ihr verließ er den Ordinationsraum ohne jede Erklärung.
»Klar, heute ist ja Dienstag«, sagte seine Sekretärin zur Assistentin. »Er geht zur Kinderstation.«
Sie sah unwillig zur Tür, wo zur Unzeit noch ein Patient erschien.
»Mich schickt Frau Professor Steuben«, sagte der ein wenig zu modisch gekleidete Mann. »Gütlein, Arno Gütlein.« Er betrachtete die beiden Vorzimmermädchen; aber sie zeigten sich nicht beeindruckt. »Ich bin Herrenausstatter«, half er nach. »Vielleicht haben Sie meinen Namen schon einmal gehört?«
»Sicher«, versetzte die blonde Sekretärin. »Bitte nehmen Sie Platz.«
»Ich beanspruche den Herrn Professor höchstens zehn Minuten.«
»Bitte«, komplimentierte sie den Modeschöpfer leicht ungehalten in den Warteraum. »Der Herr Professor wird sich so bald wie möglich um Sie kümmern.«
Es gab nur ein Wartezimmer. Für Andy Steuben waren alle, die Hilfe suchten, Privatpatienten, im Gegensatz zu anderen Kapazitäten, die nur Privatpatienten annahmen. Er war ein Titan, ein Himmelsstürmer. Nicht der Ehrgeiz trieb ihn an, sondern die Verzweiflung. Er konnte den Tod nicht abschaffen, aber Freund Hein in seine Schranken weisen. Besessen, doch ohne Verblendung arbeitete Andy Steuben daran, die Grenzen der modernen Medizin immer weiter hinauszuschieben.
Jeden Morgen wurde in der Klinik operiert – am Wochenende nur Notfälle –, und der Mittwoch war der Blue-Baby-Tag. Die Kleinen, die an der würgenden Blausucht litten, dem Herzfehler, der ohne Reparatur mit Sicherheit zum Tod führte, hielten sich schon seit Tagen in den freundlichen Einzelzimmern auf, um körperlich und seelisch für die gefährliche Operation aufgerüstet zu werden.
Die Mütter und Väter waren von einer energischen Stationsschwester soeben verabschiedet worden. Gleich würden die kleinen Patienten ein mildes Schlaf- und ein sorgfältig dosiertes Beruhigungsmittel erhalten. Bevor es ihnen verabreicht wurde, erschien, wie immer am Vorabend, Professor Steuben, der Hausherr.
Er kam allein, legte den Ärztekittel ab, wie um zu unterstreichen, daß es sich um einen privaten Besuch handelte. Er war schlank und wirkte dadurch noch größer, als er mit I Meter 80 eigentlich war. Er hatte ein schmales Gesicht, einen knappen Mund, eine hohe Stirne, mittelblondes Haar und Augen, die mehr grau als blau waren. Er wirkte weit jünger als 43 und sah aus wie ein intelligenter Leistungssportler. Aber sein Sport war sein Fach, und sein Fach war das Herz, ein Perpetuum mobile, solange es schlägt, ein Riesenzwerg mit einer unvorstellbaren Arbeitskraft.
Als Internist wie als Chirurg hatte Andy Steuben Weltruf. Er galt als medizinisches Wunderkind: Mit 24 Arzt, Doktorarbeit »summa cum laude«, mit 30 Dozent und Facharzt, mit 35 bereits Ordentlicher Professor in Deutschland wie in Amerika. Er arbeitete in der Praxis, war aber auch weiterhin noch für die Forschung tätig. Im Herzzentrum von Houston in Texas stand der Jüngere fast gleichberechtigt neben den legendären Pionieren Denton Cooley und Michael DeBakey.
Daß er den Müttern in die Augen sehen mußte, vor und nach der Operation, rüttelte bei Andy Steuben ein wenig an dem Grundsatz, daß vor dem Arzt alle Patienten gleich seien. Er tat für alle Kranken alles, aber für die Kinder noch ein wenig mehr – so schien es wenigstens.
Er betrat das erste Krankenzimmer, nickte lächelnd dem siebenjährigen Rudi zu, den er morgen unter das Messer nähme. Der Professor konnte sich im Alltag nie einen Namen merken, zerstreut wie er war durch Konzentration; aber wie seine kleinen Patienten hießen, wußte er genauso, wie er ihre Krankengeschichten im Kopf hatte.
Der Junge versuchte sich aufzurichten; es strengte ihn an.
»Bleib liegen, Rudi«, sagte der Professor. »Kraftakte machen wir erst nach der Operation. Hast du Angst?«
»Nee«, erwiderte der Junge. »Ein Indianer kennt keinen Schmerz.«
»Du kommst nicht an den Marterpfahl«, versicherte der Besucher. »Es tut überhaupt nicht weh.«
»Hat mir Mutti auch schon gesagt«, antwortete Rudi und lächelte tapfer.
Maria, die zweite Patientin, war eingeschlafen mit ihrer Puppe im Arm. Nebenan der vierjährige Otto war aufgeregt, weil ihm seine Eltern ein Fahrrad versprochen hatten, mit Gangschaltung und Kilometerzähler.
»Prima«, entgegnete der Chefarzt. »Und nach deiner Entlassung besuchst du mich. Du radelst am Haupteingang vor.« Er nickte Otto aufmunternd zu. »Aber nur am Nachmittag, damit du mich nicht aus dem OP-Raum rufen lassen mußt.«
»Abgemacht«, versetzte der Junge.
Michael, der nächste, hatte keinen Vater mehr und war das jüngste von fünf Kindern. Der Professor maß seinen Puls, nickte und setzte sich auf das Bett.
»Ich hab’ nur einen Wunsch«, sagte der Kleine. »Ich möchte einmal mit meinen Brüdern Fußball spielen.«
»Gut«, antwortete der Arzt. »Wenn du morgen nach der Operation aufwachst, dann liegt auf deinem Nachttisch ein echter Bundesligaball.«
Michaels Augen wurden vor Begeisterung naß, und der Professor ging zu Tatjana, der jüngsten Patientin, einem beinahe hoffnungslosen Fall. Den anderen vier war durch eine Voroperation eine Frist zur körperlichen Kräftigung geschenkt worden; bei der Vierjährigen blieb dafür keine Zeit mehr.
Andy Steuben setzte sich neben Tatjana. Ihre Lippen wirkten bläulich; ihr Gesicht hatte stärker als das der anderen den verräterischen Schimmer. Sie konnte sich überhaupt nicht bewegen und nur röchelnd sprechen. Bei ihr war das gurgelnde, anormale Herzgeräusch bereits ohne Stethoskop zu hören. Wie ihre vier Mitpatientinnen war Tatjana ein ausgesprochen anmutiges Kind. Es schien, als wollte die Natur, die sich so an den Blue Babies vergangen hatte, durch besondere Schönheit eine Art Wiedergutmachung üben.
Sie kommen mit einem angeborenen, meist vierfachen Herzfehler zur Welt. Durch ein Loch in der Herzscheidewand vermengt sich das Blut, das vom Herzen kommt, mit dem, das zurückströmt und mit neuem Sauerstoff aufgeladen werden soll. Es kommt zu einer dauernden Unterversorgung. Solche Kinder leben ständig in Atemnot.
Der Professor streichelte der Kleinen die Stirne; er sagte nichts, um sie nicht anzustrengen. Einen Moment lang spürte er Mutlosigkeit. Durfte er die Operation überhaupt wagen? Laut Statistik stirbt jedes fünfte Blue Baby an den Folgen. Aber Andy Steuben wehrte sich gegen eine makabre Lotterie: Tatjana, Rudi, Otto, Michael oder Maria? Er wollte keinen Todesrabatt von zwanzig Prozent. Er forderte fünfmal das Leben. Zu hundert Prozent.
Die Statistik ist widerwärtig, und sie lügt, wenn sie Zahlen ausspuckt, dachte er. Seine Erbitterung entstammte der Sorge. Er war so zerstreut, daß er den Gruß eines Oberarztes übersah, denn der Kampf um Tatjanas Leben hatte bei ihm schon begonnen.
Es war Dienstag, sein Krisentag. Julia erwartete ihn abends fast immer, selbst wenn es noch so spät wurde; heute aber auf jeden Fall. Julia war großartig. Wenn es zwei Dinge in seinem Leben gab, an deren Richtigkeit er nie gezweifelt hatte, so waren es die, die Medizin zu seinem Beruf gemacht und Julia geheiratet zu haben.
Einen Moment lang sah er sie vor sich, ihr zärtliches Gesicht, die dunklen Augen, groß und sprechend. Wie sie sich kleidete, wie sie sprach und sich bewegte: Es war ein einzigartiger Einklang des Geschmacks.
Geschmack war auch beruflich das Metier der gefragten Innenarchitektin. Freilich hatte Julia ihren Beruf zunehmend der Berufung geopfert, seine Frau zu sein. Andy Steuben gestand sich, daß er ein Egoist war, allerdings zugunsten seiner Patienten.
Er erreichte seinen Ordinationsraum, ging ins Vorzimmer. »Ich brauche einen Bundesligafußball«, sagte er zu seiner Sekretärin. »Bis morgen Mittag um zwölf.«
»Und wie ist das zu verrechnen?« fragte sie.
»Privat natürlich«, antwortete der Professor, und dann lagen die fünf Kinderzimmer hinter ihm, und er konzentrierte sich mit der ihm eigenen Fähigkeit auf jeden Einzelfall. Oft genügte es, mit dem Patienten, den seine Mitarbeiter bereits sorgfältig untersucht hatten, nur noch ein persönliches Wort zu sprechen. Der Chefarzt konnte sich auf seinen Stab verlassen. Bei Andy Steuben machte man als junger Arzt entweder Karriere, oder man flog; in dem einen wie dem anderen Fall war die Entscheidung gerechtfertigt.
Eine gute Stunde früher als sonst rief der Professor den letzten Patienten auf.
Arno Gütlein war nicht gewohnt zu warten. Er wollte seinen Zorn auspacken, aber Steubens suggestive Art ließ ihn erst einmal verstummen. »Mich schickt Ihre Gattin«, sagte er dann, mühsam beherrscht.
»Ja, ich weiß –«, erwiderte der Arzt und bedeutete ihm, seine Jacke auszuziehen und das Hemd hochzukrempeln.
»Es handelt sich um Ihre Reise nach São Paulo«, nahm der Herrenausstatter einen neuen Anlauf.
»Wir werden uns gleich eingehend über Ihre Krankengeschichte unterhalten«, entgegnete der Professor. »Jetzt möchte ich Sie bitten, nicht zu sprechen.« Er setzte das Stethoskop an die Brust Gütleins. »Bitte kräftig durchatmen.«
Der Modeschöpfer wollte explodieren, doch auf einmal grinste er. Wo je bekäme er – auch noch gratis – einen so berühmten Arzt für eine Vorsorgeuntersuchung? Er ließ seine Herztöne abhören, seinen Blutdruck messen.
»Leicht überhöht«, stellte Andy Steuben fest.
»Warten Sie einmal zweieinhalb Stunden in Ihrem Warteraum, Herr Professor –«
»Das stimmt«, versetzte der Arzt lächelnd. »Aber es läßt sich leider nicht ändern.« Er richtete sich auf. »Was sind Sie von Beruf?«
»Ich bin aus der Modebranche«, antwortete Arno Gütlein.
»Machen Sie bitte zehn Kniebeugen … richtige, ja?«
Schnaufend kam der Herrenausstatter der Aufforderung nach und ließ dann wiederum seine Herztöne abhören.
Die erste Grunduntersuchung machte der Chefarzt bei neuen Patienten persönlich, um von vornherein eine Vertrauensbasis herzustellen. »Wie leben Sie?« fragte er. »Arbeiten Sie viel?«
»An die sieben Stunden am Tag«, entgegnete Arno Gütlein. »Fünf Tage. Das Wochenende ist mir heilig.«
»Gut. Machen Sie auch Urlaub?«
»Zweimal im Jahr.«
»Dann«, erwiderte Andy Steuben, »leben Sie jedenfalls gesünder als Ihr Arzt.«
Der Modeschöpfer mußte nun auch die Hose hochkrempeln. Er wurde im Nebenraum auf eine Bahre gelegt und an Elektroden angeschlossen.
Der Professor verfolgte die Herzstromkurven des Elektrokardiogramms. »Alles ganz normal«, sagte er dann, »Was haben Sie denn für Beschwerden?«
»Keine«, erwiderte Arno Gütlein.
»Und warum kommen Sie dann zu mir?«
»Weil Ihre Gattin der Meinung ist, daß Ihre Anzüge für Ihre Reise nach São Paulo ergänzt werden müssen. Ihre Gattin denkt an Tropical-Stoffe, und –«
»Ihr Herz scheint besser in Ordnung zu sein als meine Garderobe«, antwortete Andy Steuben lachend, während seine Assistentin die EKG-Anschlüsse löste.
»Danke bestens«, erwiderte der Modeschöpfer. »Und dann darf ich Sie bitten, Herr Professor, Ihr Honorar von meiner Rechnung abzusetzen.«
Sie lachten beide, und jetzt zog der Professor seine Jacke aus, um Maß nehmen zu lassen, und wenn sich die Sache lange hinzog, würde sich nun sein Blutdruck leicht erhöhen.
Arno Gütlein bot dem Professor an, ihn im Wagen mit nach Hause zu nehmen. »Ich wohne auch in Bogenhausen«, sagte er. »Übrigens ganz in Ihrer Nähe.«
»Woher kennen Sie eigentlich meine Frau?«
»Aber Ihre Gattin hat doch mein Geschäft – den Salon und die Vorführräume – eingerichtet. Haben Sie es denn nicht in der Zeitung gelesen?« Der Modemann sprach sich in Rage: »Die Presse hat sich förmlich mit ihrem Lob überschlagen.«
»Nein«, erwiderte der Professor schuldbewußt. »Ich komme leider kaum zum Zeitunglesen.«
Die Steuben-Villa lag am Hochufer der Isar, nur einen Steinwurf vom Fluß entfernt, sie war nach Westen ausgerichtet. Auf der anderen Seite lag der Englische Garten. Von außen wirkte das Haus gediegen, gemäßigt modern, innen war es ein Schmuckstück: kein Museum, eine Wohnstätte.
Schöne, alte Stücke waren ohne Stilbruch mit dem modernen Interieur kombiniert worden und bewiesen, daß Geschmack keine Glückssache ist. Oder, wie die Kritiker der bekannten Innenarchitektin übereinstimmend feststellten: »Sie verfügt bei ihren Schöpfungen über die Gabe zu untertreiben, ohne zu unterschlagen.«
Julia öffnete selbst. Sie stand an der Tür. Sie trug ein anthrazitfarbenes, raffiniert-schlicht geschnittenes Wollkleid mit einem dezenten Ausschnitt, der gerade so viel Haut zeigte, daß er Appetit auf die ganze Julia machte. Ihren Mann erregte und beglückte ihr Anblick wie in den Flitterwochen, und das war nach dreizehn Jahren Ehe ein Kompliment – für sie wie für ihn.
Julia war mittelgroß. Sie mußte sich auf die Fußspitzen stellen, als sie bei der Begrüßung ihre Arme um seinen Nakken legte. Sie hatte ein reizvolles Gesicht von pikanter Blässe, die von den blauschwarzen, asymmetrisch frisierten Haaren noch unterstrichen wurde. Sie war eine leicht ätherische Erscheinung, fast ein Hauch Unwirklichkeit in einer lautaufdringlichen Zeit.
Vielleicht schätzte das ihr Mann besonders an ihr, aber im Grunde schätzte er alles an Julia. »Mein Gott«, sagte er zerknirscht, »so elegant. Hab’ ich unseren Hochzeitstag schon wieder vergessen?«
»In diesem Jahr noch nicht«, antwortete sie lächelnd.
»Wie machst du das? Du wirst jeden Tag schöner.«
»Und du jeden Tag alberner«, erwiderte Julia. Sie sah auf die Uhr. »Schon wieder reichlich spät«, sagte sie ohne Tadel. »Du hättest wirklich besser eine Ärztin geheiratet – dann bräuchtest du überhaupt nicht nach Hause.«
Sie lachten beide.
Hätte sie ihren Mann nicht schon geliebt, würde sie sich täglich neu in ihn verlieben. In ihrer Ehe hatte es keine Abnützung, keine Krisen, keine Probleme gegeben. Es sei denn, daß der Beruf ihren Mann weitgehend der Familie entzog. Andy hatte wenig Zeit für seine Frau, aber für andere Frauen schon gar keine. Für ihn gab es keine Versuchungen, keine Fallstricke.
»Ich gratuliere zu deinem Erfolg beim Herrenausstatter«, sagte er.
»Also hat Gütlein geplaudert«, entgegnete sie.
»Bin ich eigentlich so schlecht angezogen?« fragte er.
»Schlecht nicht–«, erwiderte Julia und wendete das Steak.
»Wie geht es dir?« fragte er. »Fühlst du dich wohl?«
»Ausgezeichnet«, antwortete die Sechsunddreißigjährige.
»Du siehst heute frischer aus als gestern«, sagte ihr Mann.
»Gestern war ich etwas überarbeitet«, erwiderte Julia.
»Vielleicht solltest du dich mehr schonen.«
»Vielleicht«, entgegnete sie, »aber dann bitte nach dir.«
Andy Steuben war ihr Mann, nicht ihr Arzt. Falls Julia oder sein Junge erkrankten, stellte er sich abseits und zog einen Kollegen heran. Er hing, wie er sagte, so sehr an seinen Angehörigen, daß er bei ihnen nicht sachlich bleiben konnte. Nur Laien empfinden diese Scheu als Schrulle. Viele Ärzte alarmieren – durchaus nicht aus Unsicherheit – einen fremden Arzt, wenn die eigene Frau erkrankt.
Im Eßzimmer war schon gedeckt. Es schloß an die Wohnhalle an, und hier saß der zwölfjährige Martin vor der Mattscheibe. Er sprang auf, begrüßte seinen Vater, mehr flüchtig als zärtlich, was nicht ein Mangel an Gefühl war, sondern an der TV-Sendung lag. »Sieh dir das an, Vater«, sagte der staksige Junge, der Julias feines Gesicht und ihre Augen hatte und dazu reichlich Sommersprossen und hellblonde Haare. »Die stellen hier noch eine Verbindung zwischen der Arteria Mammaria und dem Herzen her, als ob dieser Vineburg nicht längst überholt wäre.«
Der hochbegabte, frühreife Martin war das schlecht verhohlene Entzücken seiner Eltern. Sein Zimmer glich einem Ordinationsraum. Er las keine Comic-strips und keinen Karl May; ihn interessierte nur medizinische Fachliteratur, Sportsendungen im Fernsehen ließen ihn so kalt wie die Sesamstraße. Er zog den Gärtner und die Raumpflegerin auf seine Bude; er braute aus der Anamnese ihre Krankengeschichte zusammen, »behandelte« sie, unblutig, doch meistens richtig. Wenn er kein anderes Versuchskaninchen fand, traktierte er seinen berühmten Vater, kontrollierte seinen Herzrhythmus, maß den Blutdruck und erklärte dabei Julia den Unterschied zwischen Systole und Diastole.
Zuerst hatte es den stolzen Vater amüsiert, dann wuchs ihm die Geschichte über den Kopf. Martins Eltern machten sich Sorge, daß dieses schon beinahe manische Hobby seine natürliche Entwicklung stören könnte. Sie wollten ihn in ein Internat geben, aber da protestierte der Junge, während er sich sonst mühelos fügte. Sie hatten das Wagnis unternommen, ihn von klein auf beinahe gleichberechtigt zu behandeln, und dieses Experiment, das so häufig mißlingt, war – bislang – geglückt. Freilich gab es innerhalb des Trios noch eine heimliche Koalition Mutter – Sohn. Seinen berühmten Vater liebte und bewunderte Martin. Mit der Mutter war er gefühlsmäßig verbunden, als hinge er noch an der Nabelschnur.
»Wissenschaftliche Steinzeit«, sagte der Zwölfjährige verächtlich. »Bis so eine neue Blutbahn funktioniert, dauert es mindestens drei Monate, und dann ist die geförderte Blutmenge doch noch viel zu gering, oder?«
Der Professor gab keine Antwort. Es gelang ihm nicht ganz, den Stolz auf seinen frühreifen Filius zu unterdrücken – aber Martin brauchte eher eine Dämpfung als eine Ermunterung.
»Für einen Laien verstehst du von Medizin ziemlich viel«, stellte der Professor fest und wurde dann pädagogisch. »Doch wie stehťs mit Mathematik?« fragte er. »Hast du deine letzte Arbeit schon zurückbekommen?«
»Nicht sehr gut«, antwortete der Junge. »Ungenügend.«
»Solltest du dich dann nicht ein bißchen mehr für dieses Fach interessieren als für TV-Operationen?«
»Wie warst denn du in Mathe, Vater?« fragte der Junge aufmüpfig.
»Es war nicht mein Glanzfach –«
»Trotzdem bist du ein glänzender Arzt geworden.«
»So«, versetzte der Vater gedehnt. »Und woher willst du das wissen?«
»Steht doch in allen Zeitungen.«
»Und was in den Zeitungen steht, ist immer richtig?«
»Nicht immer«, schränkte der Zwölfjährige ein, »aber meistens, seitdem Zeitungen für kritische Leser gedruckt werden. Sag mal«, kam der Junge wieder auf sein Glanzfach zurück, »ich hab’ doch recht mit meiner Meinung über diese unsinnige Operation?«
»Eigentlich ja«, erwiderte der Vater, leicht widerwillig.
»Und uneigentlich?«
»Gehörst du ins Bett«, antwortete Andy Steuben lachend.
»Und wie soll ich dich sonst unter der Woche sehen?« fragte Martin. »Wenn überhaupt, dann doch höchstens am Dienstagabend, wenn du Bammel vor deinen Mittwochoperationen hast.«
»Martin!« wies ihn Julia zurecht.
»Verzeihung«, sagte der Junge und ging aus der Entschuldigung in den Angriff über. »Du bist ein großartiger Arzt, Vater. Patienten aus aller Welt kommen zu dir, und du tust für sie viel, nicht? Aber was tust du für dich? Für uns? Kein Wochenende, keine Rede von Urlaub, Tag und Nacht nur Dienst.« Er wartete, bis der Vater ihn voll ansah. »Fremde Herzen reparierst du, dein eigenes trittst du mit Füßen«, setzte er hinzu.
»Du hast ja ganz recht, Martin«, erwiderte der Professor.
»Und wenn du jetzt schön den Mund hältst, fahren wir nächsten Sonntag in den Bayerischen Wald.«
»Zu Doktor Rübezahl?« fragte der Junge aufgeregt. »Nach Zwiesel?«
»Das gilt«, versprach der Vater.
»Und wenn bei deinen Blue Babies postoprative Komplikationen auftreten?« fragte Martin mißtrauisch.
»Das kann ich nicht ausschließen«, erwiderte der berühmte Arzt. »Was würdest du dann tun, wenn du an meiner Stelle stündest?«
»Ich würde mich natürlich um die Patienten kümmern«, versetzte der Junge.
»Und was soll ich denn tun?«
»Dasselbe«, gestand der Zwölfjährige widerwillig ein.
»Siehst du, Martin, Arzt sein ist, zumindest wie wir beide es auffassen, Beruf wie Schicksal.«
Der Junge nickte ernst.
»Vielleicht solltest du dich unter diesen Umständen doch auch mehr für andere Fächer interessieren.«
Martin ging zu Bett. Eine Stunde später folgen Julia und Andy. Arm in Arm schliefen sie ein. Sie schliefen beide schlecht und versuchten, es voreinander zu verhehlen. Während eines Alptraums tauchten die Gesichter von Otto, Tatjana, Rudi, Maria und Michael auf, und der Professor konnte sich nicht entschließen, welches der Kinder er zuerst operieren sollte. Prompt gab es Komplikationen, und bevor er scheiterte – oder mit ihnen fertig wurde –, wachte Andy Steuben auf und merkte, daß Julia seine schweißnasse Stirn mit einem Taschentuch abtupfte.
Endlich schlief er wieder ein und durch bis um sechs Uhr. Er brauchte keinen Wecker. Wie immer wollte er sich heimlich aus dem Schlafzimmer stehlen; doch Julia folgte ihm, um das Frühstück zu richten.
Sie trug einen schicken Morgenrock, wirkte verspielt und unbekümmert. Andy Steuben wußte sehr wohl, daß seine Frau notfalls auch eine sehr gute Schauspielerin sein konnte. Wie sehr sie in diesem Fach reüssierte, sollte er erst erfahren, als es zu spät war; bald schon – und doch viel zu spät.
»Wie fühlst du dich?« fragte Julia.
»Wie immer«, erwiderte er.
»Also schlecht«, entgegnete sie.
»Das ist nicht ganz das richtige Wort«, antwortete Andy. »Sagen wir lieber: unsicher.«
»Unsinn«, antwortete Julia. »Du tust, was du kannst. Wenn du auf Grenzen stößt, liegt es jedenfalls nicht an deinem Unvermögen.«
»Vielen Dank, Julia«, entgegnete der Arzt und küßte sie flüchtig, und um auf ein anderes, durchaus nicht unwichtiges Thema zu kommen, fragte er: »Was machen wir bloß mit unserem Wunderkind?«
»Das ist mir richtig peinlich«, antwortete sie. »Dir muß sich der Gedanke aufdrängen, ich hätte den Jungen dazu angestiftet.«
»Nein«, widersprach Andy. »Aber es ändert nichts daran, daß Martin recht hat.« Er lächelte matt. »Vielleicht sollten wir uns wirklich von ihm erziehen lassen?«
»Und wie stellst du dir das vor?«
»Daß du zum Beispiel mit mir zu diesem Kongreß nach São Paulo fliegst.«
»Vielleicht«, entgegnete Julia zögernd. »Es hängtvon meinen Verhandlungen in London ab.« Etwas hastig setzte sie hinzu: »Du weißt, daß es darum geht, eine ganze englische Hotelkette einzurichten –«
»Und wann entscheidet sich das?«
»Voraussichtlich bereits in den nächsten Tagen«, antwortete sie.
Um sieben Uhr kam das Taxi. Als Andy Steuben es bestieg, war seine Dienstagskrise endgültig überwunden. Der Professor hatte wieder sein kühl-distanziertes Verhältnis zum Tod gefunden. Als Mediziner wußte er, daß ihm Freund Hein als stiller Teilhaber aufgezwungen war, aber er konnte und wollte sich nicht damit abfinden, daß der von dem französischen Arzt Fallot entdeckte Vierfachherzfehler Kinder verschlang wie einst der Götze Baal.
Die von einer hochherzigen Stiftung unterhaltene, angesehene Privatklinik war keine ausgesprochene Herzstation, auch ihre internistische Abteilung verfügte über einen hervorragenden Ruf. In München gab es seit Jahren ein leistungsfähiges Herzzentrum, aber es war – wie alle anderen Spezialkliniken in Deutschland – dem Ansturm der Patienten nicht gewachsen. Die endlose Warteliste drohte vom Tod redigiert zu werden, deshalb hatte sich Professor Steuben entschlossen, auch in seinem Haus Operationen am offenen Herzen vorzunehmen, wie er sie aus den Staaten als Alltagsroutine kannte.
In den USA ging man seit vielen Jahren mutig an das Herz, während in Deutschland immer noch ein wenig die Warnung des berühmten Chirurgen Theodor Billroth – der einst als erster die Magenresektion vorgenommen hatte – umging: »Ein Arzt, der sich am Herzen vergreift, verliert die Achtung seiner Kollegen.«
Diese These, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ausgesprochen, war längst vom Fortschritt überrundet worden, und Mediziner wie Steuben hatten sie etwa so verändert: Ein Arzt, der in hoffnungslosen Fällen, wie bei der kleinen Tatjana, nicht zum Skalpell greift, verliert das Leben seiner Patienten.
Freilich war damit in keiner Weise eine Gewähr verbunden, daß das Kind einen operativen Eingriff tatsächlich überstehen würde. Aber ein Arzt, der sich nicht gegen den Tod auflehnt, war nach Andy Steubens Auffassung ein Feigling.
Er schlüpfte in seinen Ärztekittel, machte die Morgenvisite, während im OP-Raum der Anästhesist bereits die Narkose des kleinen Michael vorbereitete und der weiße Fußball mit den schwarzen Tupfen schon bereit lag, längst bevor sicher war, daß der Kleine aus der Narkose erwachen würde.
Der Chefoperateur machte sich steril, schlüpfte in den grünen OP-Kittel, legte sich die Gazemaske an; er nickte seinem Team zu. Die Gespräche brachen ab. Jeder trat an seinen Platz wie auf Gefechtsstation. Jetzt hatte der Anästhesist das Sagen. Die Techniker bestätigten, daß die Herz-Lungen-Maschine einsatzbereit sei. Wenn das Herz des kleinen Patienten für die Dauer der Operation dem Körper entnommen war, würde eine automatische Oxygenatorpumpe die Arbeit des natürlichen Organs übernehmen und den Kreislauf weiter betreiben.
Der Herzspezialist würde wie immer kämpfen und wie meistens siegen. Seine Mitarbeiter begrüßten ihn wie Musiker ihren Dirigenten, und dabei war jeder von ihnen ein Solist. Um acht Uhr zehn begann der erste Eingriff, und ohne Pause würden sich die anderen anschließen.