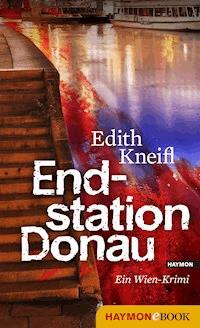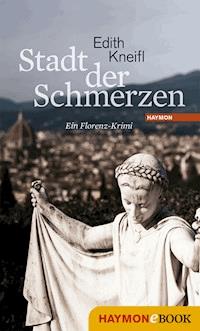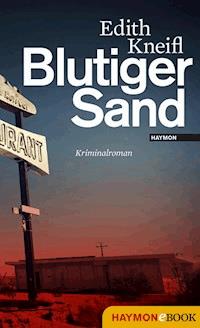Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was haben Ikaria, Buenos Aires und Istrien gemeinsam? Strände und Sonnenstunden? Naja, das auch. In Edith Kneifls Urlaubskrimis gibt es aber noch eine Gemeinsamkeit: Überall fallen Tourist*innen und Einheimische ihren mordlüsternen Mitmenschen zum Opfer. Und das nicht nur mit Meerblick, sondern etwa auch im geschichtsträchtigen Marrakesch, im pulsierenden New York oder im idyllischen Thames Valley. Und eines ist klar: Überraschende Wendungen und ein ironisches Augenzwinkern sind in diesem Urlaubskrimi-All Inclusive-Paket natürlich mit dabei. Bitte einmal um die Welt! Edith Kneifl entführt uns an 17 Sehnsuchtsorte und lässt sie uns aufsaugen, die Atmosphäre, die diese Orte so besonders macht. Wir sehen das Hitzeflimmern im Death Valley, spazieren durch die pittoreske Altstadt von Triest und tauchen unter im kultigen Gänsehäufelbad in Wien. Wir riechen die Gewürze auf orientalischen Märkten, lassen uns vom mondänen Flair Monte Carlos mitreißen und bestaunen das Bergpanorama im Berner Oberland. Kurzurlaub in der Mittagspause Edith Kneifls Kurzkrimis sind ein Kurzurlaub vom Alltag, vor allem dann, wenn man nicht die Zeit und Muse hat, sich in einen dicken Roman zu vertiefen; also perfekt für die unbeschwerten Tage, die wir so sehr lieben, oder jene Tage, die ein bisschen Urlaubsfeeling vertragen können: egal ob auf Reisen, am See oder im Bett mit heruntergelassenen Jalousien. Kurzum: Ein Sommer ohne diese Krimi-Anthologie ist möglich, aber sinnlos!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Kneifl
Sonnige Grüße aus dem Jenseits
Krimis aus aller Welt
Inhalt
Das Haus am Fluss (Thames Valley, England)
Royal Hawaiian Motel (Sonora-Wüste, USA)
Ferragosto (Grado, Italien)
Asche der Erinnerung (Buenos Aires, Argentinien)
Schnee in Piräus (Piräus, Griechenland)
Pizza Capricorno – ein alpenländisches Melodrama (Tirol, Österreich)
Schlaflos in New York (New York, USA)
Grand Hotel (Portorož, Slowenien)
Penthesilea oder Katzen haben sieben Leben (Ikaria, Griechenland)
Siesta (Costa Brava, Spanien)
Belinda (Mojave-Wüste, USA)
Tête-à-Têteli (Berner Oberland, Schweiz)
Jackpot (Monte Carlo, Monaco)
Der Traummann (Opatija, Kroatien)
Straße der Männer (Triest, Italien)
Gänsehäufel (Wien, Österreich)
Das Flüstern des Morgengrauens (Marrakesch, Marokko)
Au revoir! (Nizza, Frankreich)
Das Haus am Fluss
Das einstöckige Haus an der Themse stand seit langem leer. Hin und wieder sah man Harry im Garten die Hecken stutzen. Er war nicht mehr der Jüngste. Sein Haar war ergraut und spärlich geworden, aber er hatte sich sein kindliches Lächeln bewahrt. Harry kam jeden Tag hierher, so wie früher, als Miss Guinney noch hier wohnte. Er war ihr Mädchen für alles gewesen.
Eines Nachts war sie von einem Ausflug nach London nicht mehr zurückgekehrt.
Nach ihrem Verschwinden tauchten zwei Polizisten auf und stellten Harry Fragen, die er nicht beantworten konnte. Er beteuerte nur immer wieder, nicht zu wissen, wo sich seine Herrin aufhielt.
Nach dem Besuch der Polizei machten viele böse Geschichten die Runde. Harry hörte den Männern im Pub aufmerksam zu, äußerte sich aber nicht dazu, obwohl er Miss Guinney als Einziger näher gekannt hatte. Selbst wenn es stimmte, was die Leute erzählten, seine Miss würde schon ihre Gründe gehabt haben.
Miss Guinney war eine attraktive Frau, groß und schlank und mit breiten Schultern wie ein Mann. Das Schönste an ihr waren ihre langen blonden Haare. Sie trug sie nie offen, sondern immer straff nach hinten gekämmt und hochgesteckt, was sie sehr streng aussehen ließ. Man konnte sich jedoch vorstellen, wie prachtvoll es sein musste, wenn sie über ihren muskulösen Rücken flossen. Harry hätte zu gerne ihr Haar einmal offen gesehen, aber er wagte es nicht, sie heimlich beim Kämmen zu beobachten.
All ihre Zimmer lagen im Obergeschoss, ein Schlafzimmer, ein Kabinett, das ihr als Ankleideraum diente, ein Bad und noch ein Raum, der immer versperrt war. Im Erdgeschoss befanden sich die Küche, ein Esszimmer und ein geräumiger Salon, der einer überdimensionalen Rumpelkammer glich. Sosehr Harry sich auch bemühte, Ordnung zu schaffen, Miss Guinney gelang es immer wieder in kürzester Zeit, ein Chaos zu hinterlassen. Jeden Vormittag fand er schmutzige Gläser, leere Tonic- und Gin-Flaschen und überquellende Aschenbecher im Salon. Auf dem Orientteppich lagen die Kleider, die sie am Vortag getragen hatte. Er ließ sie jede Woche reinigen, obwohl er wusste, dass Miss Guinney sie ohnehin kein zweites Mal mehr anziehen würde.
Die Fenster des Salons gingen zum Fluss hinaus. Der Blick auf das liebliche Themse-Tal war fantastisch. Der Fluss schlängelte sich durch zwei steinerne Brücken, die von Trauerweiden umrahmt wurden. Die prächtigen Herrenhäuser am anderen Ufer ließen sich allerdings nur erahnen. Sie versteckten sich in verwunschenen Parkanlagen. Aus der Ferne grüßte ein Kirchturm. Dahinter erhoben sich sanfte grüne Hügel. Ins nächste Dorf brauchte man zu Fuß eine Viertelstunde. Doch Miss Guinney pflegte nicht oft zu Fuß zu gehen. Sie stand nie vor Mittag auf. Nachmittags saß sie dann meist draußen auf der überdachten Veranda und gab sich dem Müßiggang hin. Den prächtigen Garten, der bis zur Themse hinunterreichte, betrat sie nur selten, er war Harrys Reich.
Liebevoll kümmerte er sich um die Rosen, Hortensien und Rhododendronsträucher. Er hatte nur Blumen in Miss Guinneys Lieblingsfarben Pink und Violett gepflanzt. Verirrte sich hin und wieder ein andersfarbiges Gewächs hierher, wurde es sofort von ihm entfernt.
Während ihrer Mußestunden durfte er sich im Garten nicht blicken lassen. Als er es einmal wagte, nachmittags den Rasen zu mähen, erhob sie ihre Stimme. Es war das einzige Mal in all den Jahren, dass er ein scharfes Wort zu hören bekam. Daraufhin ließ er sich zwei Tage nicht bei ihr blicken.
Sonst sprach sie immer mit leiser Stimme, in der ein gewisses Gähnen lag. Es schien, als würde sie das Sprechen langweilen. Harry sprach auch nicht gern, nicht nur weil die meisten Leute lachten, wenn er den Mund aufmachte, sondern weil er nichts zu sagen hatte. Anfangs dachten die Dorfbewohner, Miss Guinney müsse immens reich sein oder irgendwo einen reichen Ehemann versteckt halten, denn sie besaß Unmengen von Schmuck und teuren Kleidern. Sie zog sich nicht nur täglich zweimal um, sondern trug auch jeden Tag etwas anderes. Man sah sie nie zweimal im selben Kleid. Sie hatte das Haus vor nunmehr sieben Jahren relativ günstig erstanden, weil es sehr nahe am Fluss lag, feucht war und schon halb verfallen, als sie einzog. Früher hatten Überschwemmungen Haus und Garten übel mitgespielt, doch seit flussaufwärts ein Staudamm errichtet worden war, gab es keine Probleme mehr mit dem Hochwasser. Die Grundstückspreise waren mittlerweile stark gestiegen.
Das romantische Thames Valley war eine begehrte Wohngegend, nicht nur wegen der Nähe zu Schloss Windsor und der Universitätsstadt Oxford, sondern auch, weil die Hauptstadt des Britischen Empires mit dem Auto in einer guten Stunde erreichbar war.
Das entzückende Cottage stammte aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Es war umgeben von üppiger Vegetation und sah sehr hübsch aus, nachdem Harry es renoviert hatte. Doch in letzter Zeit ließ Miss Guinney es wieder verkommen. Sie wollte ihre Ruhe haben und erlaubte Harry weder das undichte Dach zu reparieren noch die verrostete Gartenpforte zu erneuern. Die Gerüchte über ihr sagenhaftes Vermögen verstummten. Eine Frau mit Geld würde doch so ein schmuckes Häuschen nicht verwahrlosen lassen, sagten sich die Nachbarn, und die Neider wurden weniger. Miss Guinneys Alter ließ sich schwer schätzen. Sie hatte sich in den sieben Jahren, die sie hier lebte, kaum verändert. Die Meinungen über ihre Schönheit waren jedoch geteilt. Manche fanden sie früher hübscher, andere wieder behaupteten, sie würde von Jahr zu Jahr schöner. Auffällig war, dass sie keinen Mann hatte. Sie ließ sich nicht nur Miss nennen, sondern man sah sie auch nie mit einem männlichen Wesen. Außer mit Harry natürlich, aber der war ein armer Narr. Böse Zungen unterstellten ihr, dass sie nur so viel Sorgfalt auf ihr Aussehen verwendete, um sich einen Mann zu angeln. Im Dorf lebte ein Mann, der es besser wusste. Er hatte sich ein Jahr lang vergeblich um ihre Gunst bemüht. Obwohl er nicht übel aussah und sogar über das nötige Kleingeld verfügte, um einer anspruchsvollen Frau fast jeden Wunsch erfüllen zu können, hatte sie ihn ebenso abgewiesen wie alle anderen, die es bei ihr versucht hatten.
Miss Guinney war nicht unfreundlich zu ihren Verehrern, sie behandelte alle gleich oder, besser gesagt, gleichgültig. Sie war nicht arrogant, sondern einfach nur desinteressiert an anderen.
Kein Mensch, außer Harry, überschritt je die Schwelle ihrer Haustür. Sie empfing keine Gäste, hatte keine Freunde, nicht einmal Bekannte. Den Nachbarn schenkte sie ein kurzes Nicken, wenn sie ihnen zufällig auf der Straße begegnete. Da sie selten ausging, brauchte sie auch nicht oft zu nicken. Direkte Nachbarn hatte sie sowieso keine. Das nächste Haus lag mindestens hundert Meter entfernt. Ohne komplizierte Ausreden zu erfinden, lehnte sie jede Einladung ab. Während der letzten Jahre belästigte man sie nur mehr selten mit Einladungen. Das Interesse an ihr flaute ab.
Ihr Tagesablauf war ohnehin allen bekannt. Fast bis auf die Stunde genau wusste jeder, was Miss Guinney machte. Erfreut über das Interesse und die geheuchelte Sympathie für seine Miss hatte Harry den Leuten bereitwillig alles erzählt, was sie wissen wollten. Jahrelang war sie das Lieblingsgesprächsthema im dörflichen Pub. Jeder wusste inzwischen, dass sie nicht nur für Kleider, Schmuck und Kosmetika eine Menge Geld ausgab, sondern auch für Gin und Zigarillos. Sie rauchte mindestens zehn pro Tag.
Harry berichtete den interessierten Dorfbewohnern auch, dass Miss Guinney täglich viele Stunden in ihrem Badezimmer verbrachte. Wenn sie mittags zum Frühstück herunterkam, war sie immer sorgfältig geschminkt. Sie sei jeden Tag erneut ein höchst erfreulicher Anblick, beteuerte er.
Nach dem Frühstück, das nur aus schwarzem Kaffee, einem weichen Ei und Toast bestand, setzte sie sich wie gewöhnlich auf die überdachte Veranda, rauchte und trank ihren ersten Gin Tonic. Harry sah sie nie mit einem Buch, einer Zeitung oder einem Mobiltelefon in der Hand. Sie saß einfach nur da und starrte auf den Fluss, der sich träge dahinwälzte. Manchmal kamen kleinere Ausflugsboote vorbei und die Touristen winkten der Schönen auf der Veranda ausgelassen zu. Sie winkte nie zurück.
Miss Guinney besaß selbst ein altes Boot mit einem Außenbordmotor. An besonders heißen Tagen fuhr sie hinaus und ließ sich von der Strömung flussabwärts treiben. Sie war dann oft stundenlang unterwegs, da die Rückfahrt mit dem schwachen Motor mühselig war. Auch während dieser Bootsfahrten war sie immer elegant gekleidet. Harry hatte sie noch nie in Shorts oder gar in einem Badeanzug gesehen.
Er genoss vor allem die Ruhe in ihrem Haus. Es gab nicht viel zu tun. Nur selten trug sie ihm Besorgungen auf. Sie war auch nicht anspruchsvoll, was das Essen betraf, sondern begnügte sich meistens mit Salat, Sandwiches oder Fish & Chips.
Wenn es draußen kühl wurde, begab sie sich in ihre Zimmer im ersten Stock und erschien erst zum Abendessen wieder, entsprechend gekleidet und noch schöner als am Tag. Harry servierte ihr das Dinner im Esszimmer. Er aß in der Küche, bekam aber das Gleiche wie sie. Nach dem Essen ging er nach Hause. Er wohnte unten am Fluss in einem vermoderten Bootshaus, das ebenfalls zum Cottage gehörte. In den Wintermonaten ließ ihn der Wirt in einem Abstellraum des Pubs schlafen. Harry war in all den Jahren nie auf die Idee gekommen, Miss Guinney zu fragen, ob er nicht in der Küche auf der Bank des riesigen Kachelofens schlafen dürfe. Was sie an den langen Abenden allein zu Hause machte, wusste er nicht. Vielleicht sah sie fern? Es brannte immer sehr lange Licht im ersten Stock, aber die dunklen Vorhänge waren zugezogen, in dem einen verschlossenen Raum auch tagsüber.
An den Wochenenden hatte Harry frei. Anfangs war er auch samstags erschienen. Sie hatte ihm jedoch freundlich, aber bestimmt zu verstehen gegeben, dass sie ihn bis Montagmittag nicht zu sehen wünschte. Harry hasste die Wochenenden. Er vertrieb sich die Tage mit Fischen und hing abends meistens im Pub herum.
Die Leute waren bald dahintergekommen, dass Miss Guinney jeden Samstag das Dorf verließ. Nachmittags, immer um die gleiche Zeit, stieg sie in ihren alten pinkfarbenen Bentley und raste die Landstraße hinunter. Einer ihrer Verehrer hatte einmal versucht, ihr nachzufahren. Bis nach London war er ihr gefolgt. Am Stadtrand hatte sie ihn abgeschüttelt. Auch bei seinem zweiten Versuch war sie ihm entwischt.
Anfangs munkelte man allerlei über diese regelmäßigen Ausflüge von Miss Guinney. Dann einigte man sich darauf, dass sie schließlich irgendwann ihre Einkäufe erledigen musste. Ab diesem Zeitpunkt galt der Samstag als Miss Guinneys Einkaufstag. Allerdings kehrte sie oft erst in den frühen Morgenstunden aus London zurück. Manchmal war es bereits hell, wenn Harry den Motor ihres Wagens hörte. Den Bentley parkte sie immer neben dem Cottage unter einer alten Esche.
Der Garten war umgeben von hohen Hecken und nur von der Themse aus einsehbar. Ein besonders hartnäckiger Bewunderer hatte eine Zeitlang versucht, sich ihr vom Fluss her zu nähern. Doch sie hatte sich sofort in ihr Haus zurückgezogen, wenn sein Boot aufgetaucht war. Schließlich gab er auf. Ebenso wie die gefürchteten anglikanischen Frauenvereine bald aufgaben, Miss Guinney als Mitglied gewinnen zu wollen. Sie wurde für verrückt erklärt, nicht so verrückt wie Harry, aber auch sie schien eben nicht ganz richtig im Kopf zu sein. Die Damen verloren das Interesse an ihr und ihren Ausflügen nach London.
Bis sie eines Tages nicht mehr zurückkam. Man wartete einen Tag, zwei Tage, nahm an, sie wäre verreist. Aber Harry schien nichts von einer Reise zu wissen. Als sie nach zwei Wochen noch immer nicht aufgetaucht war, begann die Polizei erneut Nachforschungen anzustellen. Sie brachen die Haustür auf, da Harry behauptete, keinen Schlüssel mehr zu haben. Miss Guinney hatte ihm alle Schlüssel abgenommen, als sie ihn hinausgeworfen hatte. Nach ihrer letzten London-Tour hatte sie Harry in ihrem Bett vorgefunden und kurzerhand vor die Tür gesetzt.
Die Polizisten machten selbst vor dem ersten Stock nicht halt. Harry versuchte, die Police officers daran zu hindern, Miss Guinneys Schlafzimmer zu betreten, denn sie hätte niemals geduldet, dass diese wildgewordene Horde in ihr kleines privates Reich eindrang. Nicht einmal er hatte den ersten Stock betreten dürfen. Aber gegen diese Meute von Scotland Yard hatte er keine Chance. Verzweifelt klammerte er sich an die Beine eines Inspektors. Dieser versetzte ihm einen heftigen Stoß und Harry stürzte die Treppe hinunter. In dem mysteriösen Zimmer im ersten Stock entdeckten die Männer von Scotland Yard dann Anzüge in allen Größen, Maßhemden, Lederschuhe, goldene Uhren und leere Brieftaschen.
Miss Guinney hatte sich ein sonderbares Museum eingerichtet. Zuerst dachte die Polizei, sie hätte diese Sachen nur gestohlen. Später stellte sich heraus, dass die Besitzer dieser hübschen Sachen als vermisst gemeldet waren, verschollen in der fernen Großstadt, manche schon vor Jahren.
Die Gerüchte überstürzten sich. Die schöne Miss Guinney musste sehr wählerisch gewesen sein. Anscheinend hatte sie sich nur mit wohlhabenden Männern eingelassen.
Der Londoner Nobelstrich wirkte verwaist ohne sie, „die Lady im Bentley“, wie sie von ihren Kolleginnen respektvoll genannt worden war, da sie ihren Kunden immer in ihrem schönen Wagen zu einem letzten Genuss verholfen hatte.
Als Harry abends aus dem Pub in das Bootshaus zurückkehrte, erzählte er Miss Guinney, dass die Polizei heute nicht nur die Leichen von drei ihrer ehemaligen Kunden, sondern auch ihren alten pinkfarbenen Bentley im Stausee gefunden hatte.
Miss Guinney antwortete ihm nicht. Sie konnte nicht, lag sie doch unter den morschen Brettern des Bootshauses, friedlich schlummernd im Schlammbett des Flusses. In ihrem weißen langen Hals steckte eine Heckenschere. Der Knoten in ihrem Haar hatte sich gelöst. Die langen blonden Strähnen breiteten sich auf den sanften Wellen der Themse aus. Harry entfernte zwei Bretter. Er konnte sich nicht sattsehen an ihrem wundervollen Haar, das sie endlich offen trug.
Royal Hawaiian Motel
„Meine besten Jahre habe ich dir geopfert, aber du bist und bleibst ein Versager.“
Die heiße, stickige Luft trieb ihr den Schweiß auf die Stirn. Das mausgraue Haar hing ihr ins Gesicht und der Kaugummi quietschte zwischen ihren Zähnen. Obwohl die Fenster des alten Buicks geschlossen waren, drang Sand in das Innere des Wagens.
Die Sonne stand tief im Südwesten. Das verdorrte Gras am Straßenrand reflektierte die Sonnenstrahlen wie Chrom, als hätte jemand Silberfäden ins triste Graubraun gewoben. In diesem weiten Land, in dem kaum Regen fiel, wurde das Gras nie richtig grün.
„Nicht einmal einen neuen Wagen mit funktionierender Klimaanlage können wir uns leisten“, schimpfte sie weiter. Seit sie Buttonwillow, ein tristes Kaff in der Nähe von Bakersfield, verlassen hatten, jammerte sie pausenlos über die schreckliche Hitze, den fürchterlichen Verkehr und vor allem über seinen Fahrstil. Er legte eine CD ein. Mühelos überschrie sie den Countrysänger.
Es gab so viele nette Mädchen in Kalifornien, ausgerechnet an ihr hatte er hängen bleiben müssen. Sie war nicht einmal hübsch, sondern viel zu dünn für seinen Geschmack. Und beim Anblick ihres schmalen, knochigen Gesichts musste er immer an einen kleinen gierigen Vogel denken.
Er vermied es, sie anzusehen, konzentrierte sich lieber auf die Fahrbahn.
Bald nach der Hochzeit hatte sie begriffen, dass diese Ehe eine Fehlinvestition war. Da sich jedoch nichts Besseres ergab, blieb sie bei ihm. Manchmal sehnte sie sich nach einer Affäre. In dem trostlosen Ort, in dem sie lebten, fand sich jedoch keiner, der ihren Vorstellungen auch nur annähernd entsprach. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als diesen schmierigen Vertreter von Klimageräten aus Buttonwillow weiterhin zu ertragen.
Sie hatte darauf bestanden, ihn dieses Mal auf seine Geschäftsreise nach Las Vegas zu begleiten. Dass er vorher noch nach Tucson musste, gestand er ihr erst während der Fahrt. Sie war stinkwütend, hatte keinen Bock auf diesen riesigen Umweg. Erst als er ihr eine zweite Nacht in Las Vegas versprach, beruhigte sie sich ein bisschen.
Während er dort seine Geschäfte abwickeln würde, wollte sie sich die Zeit in den Casinos vertreiben. Urlaub in der Stadt, in der das Glück auf der Straße liegt. Alles, was man brauchte, war ein scharfes Auge und eine schnelle Hand.
In den Casinos hoffte sie endlich jene interessanten Leute kennenzulernen, denen sie bisher nur in Fernsehserien begegnet war. Schwarzhaarige, glutäugige Abenteurer, kultivierte Bohemiens, reiche Geschäftsleute mit grauen Schläfen, charmante Salonlöwen und heiratswillige Millionärssöhne. Sie malte sich aus, wie sie, umgeben von all diesen Traummännern, an einem der großen Roulettetische sitzen und mit ihren Augen den eleganten Bewegungen des Croupiers folgen würde. Die wundersame Vermehrung der bunten Chips vor ihr, das aufregende Geräusch der rollenden Kugel … Sie hatte ihre gesamten Ersparnisse mitgenommen. Aber davon wusste er nichts. Und das war auch gut so. Denn ihr Mann besaß keinerlei Verständnis für ihre Spielleidenschaft. Zu oft musste er auf sein Abendessen verzichten, weil sie sich nicht von ihren Computerspielen trennen konnte. Selbst beim Fernsehen legte sie ihr Tablet nicht weg. Sie befürchtete allerdings, dass ihre neunhundert Doller nicht lange reichen würden. Der Gedanke an ihr kurzes, enganliegendes und tief dekolletiertes Cocktailkleid beseitigte ihre Zweifel. Jeder Mann würde ihr Kredit gewähren. Ein versonnenes Lächeln erschien auf ihren schmalen Lippen. Wenn sie lächelte, sah sie hübscher und vor allem jünger aus.
Ihr Mann nahm dieses Lächeln nicht wahr. Er hing seinen eigenen Träumen nach.
Die untergehende Sonne verwandelte die Wüste in ein glühendes Meer und ließ die gigantischen Felsen in fantastischen Farben leuchten. Wind und Wasser hatten ihr eigenes Spiel mit den geologischen Schichten getrieben und bizarre Formen entstehen lassen, riesige Giftpilze, gewaltige Trommeln und nebeneinander aufgereihte, versteinerte alte Männchen mit wulstigen Speckfalten um die Mitte. Jeder kleine Kaktus warf einen Schatten wie ein Baumriese. In Summe malten sie kuriose Muster auf die kahlen Hügel. Auf den abfallenden Hängen schrumpften die Schatten dann zu winzigen Punkten.
Sie schenkte diesem faszinierenden Schauspiel von Licht und Schatten keinerlei Beachtung. Mit geschlossenen Augen döste sie am Beifahrersitz vor sich hin.
Sie hatten die Wüste Mojave längst hinter sich gelassen, waren bereits mitten in der Sonora-Wüste, einer der größten Wüsten der Welt. Zum Glück hatte sie nicht mitbekommen, wie er die Interstate nach Tucson verließ. Bis zur mexikanischen Grenze war es nicht mehr weit. Mannshohe Sagueros begrüßten sie am Straßenrand.
Es wurde rasch dunkel. Die Nacht schlich sich nicht an wie in den Städten, sie kam schnell, ohne Vorwarnung. Die Kandelaberkakteen tauchten in der Finsternis unter.
Wenn er in diesem Tempo weiterfuhr, würden sie bald bei der Trump Wall landen. Dieses mehr als zehn Meter hohe Konstrukt aus eng nebeneinanderstehenden Stahlträgern kannte sie aus dem Fernsehen. Zwar war es mit ihren Geografie-Kenntnissen nicht weit her, aber selbst sie würde dann kapieren, dass sie sich an der Grenze zu Mexiko befanden anstatt in Tucson.
„Hier in der Nähe gibt es ein billiges Motel“, sagte er. „Ich habe keine Lust, bis spät in die Nacht hinein zu fahren, ich bin todmüde. Der Termin in Tucson ist erst morgen mittags.“
Sie wollte lautstark protestieren, hatte sie doch auf ein kleines Spielchen in einem der Casinos in Tucson gehofft. Als sie seine geröteten und leicht geschwollenen Augen bemerkte, überlegte sie es sich anders und schlug vor, ihn am Steuer abzulösen.
Er ließ sich nicht erweichen. „Ich brauche dringend ein paar Stunden Schlaf.“
Aus war der Traum!
Das Royal Hawaiian Motel kam ihr bekannt vor. Alle Motels in dieser Preiskategorie sahen gleich aus. In einer dieser Holzhütten hatte sie ihre Hochzeitsnacht verbracht und auch schon einige Nächte vorher. Sie war verärgert und sprach kein Wort mehr mit diesem Spielverderber.
Ihm war ihr Schweigen nur recht. Er ließ den Buick bei der Einfahrt stehen, begab sich zur Rezeption und trug sich als Jonathan Smith ein, obwohl er George Malcome hieß.
Seine Frau, die schmollend im Auto geblieben war, erwähnte er vorsichtshalber nicht.
Der zugekiffte Typ an der Rezeption verlangte keinen Ausweis, steckte die achtzig Dollar in seine Hosentasche und verschwand wieder hinter seiner Spielkonsole.
Mr. Malcome atmete erleichtert auf. So einfach hatte er es sich nicht vorgestellt. Jetzt musste er nur noch auf eine günstige Gelegenheit warten. Es sollte wie ein Unfall aussehen. Die Geschäftsreise nach Las Vegas war nur ein Vorwand. Da er wusste, wie verrückt sie nach diesem Spielerparadies war, hatte er damit gerechnet, dass sie mitkommen wollte. Sein Chef wähnte ihn in San Francisco und erwartete ihn nicht vor dem Wochenende zurück. Es blieb ihm also eine knappe Woche Zeit, um sich ihrer zu entledigen und danach spurlos zu verschwinden. Er wollte in Mexiko untertauchen, sich in der Grenzstadt Nogales neue Papiere besorgen, ein neues Outfit und vielleicht auch eine neue Frau. Eine temperamentvolle, kurvige Mexikanerin wäre ganz nach seinem Geschmack.
Ursprünglich hatte er daran gedacht, mit seiner Frau auf einem einsamen Self-Service-Campingplatz im Saguaro-Nationalpark zu übernachten. Ihre Leiche hätte er dann entweder in den Algodones-Dünen oder in einer der Salzpfannen entsorgt. Nicht zufällig nannte man die Sonora auch die Wüste der Verdursteten. Hunderte Migranten erlagen hier jährlich dem Hitzetod.
Aber es wäre sicher schwierig, wenn nicht gar unmöglich gewesen, sie zu bewegen, eine Nacht im Auto zu verbringen. Das Royal Hawaiian Motel war für seine Zwecke ebenso gut geeignet. Hier kümmerte sich keiner um den anderen. Gäste kamen und gingen, ohne einander überhaupt wahrzunehmen. Niemand würde sich an den kleinen dicken Mann in einem beigen Buick erinnern.
Er hatte nicht viel Gepäck, trug nur das Nötigste bei sich. Bald würde er sich alles, was sein Herz begehrte, leisten können.
Mr. Malcome hatte sein gesamtes Vermögen von der Bank geholt und zusammen mit den Provisionen, die er den Geschäftspartnern in San Francisco in bar auszahlen sollte, waren es immerhin hunderttausend Dollar, die er zwischen seiner Wäsche versteckt hatte. Das Apartment befand sich am Ende der Anlage.
Er fuhr mit dem Wagen ganz nahe an die Eingangstür heran. Das Zimmer nebenan stehe leer, hatte ihm der Kiffer versichert, und auf der anderen Seite gab es nichts als Wüste.
Die Luft in dem düsteren Raum fühlte sich ebenso stickig an wie draußen. Der altmodische Ventilator diente nur Dekorationszwecken.
Das dünne Sommerkleid klebte unschicklich an Mrs. Malcomes magerem Körper. Sie sehnte sich nach einer Dusche und eilte gleich ins Bad.
„George!“, kreischte sie. „Komm sofort her!“ Äußerst widerwillig kam er ihrem Befehl nach.
In dem kleinen Badezimmer wimmelte es von ekelhaften Käfern. Die rosa Kacheln verschwanden fast völlig unter der schwarzen, krabbelnden Masse. Sie krochen aus allen Löchern, aus dem Klo, dem Waschbecken, dem Abfluss, der Dusche. Egal wie viel kostbares Nass sie auf die armen Tierchen verschwendeten, sie wurden dieser Invasion nicht Herr. Bald stand das ganze Bad unter Wasser, aber einige Käfer bewegten sich noch immer.
„Hier bleibe ich keine Sekunde länger! Besorge uns sofort ein anderes Zimmer!“, schrie Mrs. Malcome.
„Sie haben kein anderes mehr frei“, log er und bemühte sich, sie zu beruhigen. Eine hysterische Frau passte nicht in sein Konzept.
Sorgfältig suchte er Bett und Polstermöbel nach dem scheußlichen Ungeziefer ab. Der weiche hochflorige Teppichboden kam ihm besonders verdächtig vor. Schwer schnaufend kniete er sich auf den Boden und strich mit seinen klobigen Fingern über den Synthetikbelag. Sein Blutdruck erreichte ungeahnte Höhen. Er war nicht mehr der Jüngste und viel zu dick für seine Größe. Aber er musste Ruhe bewahren, durfte sie nicht reizen. Ihr Geschrei war das Letzte, was er brauchen konnte.
Sie stand am Fenster und starrte auf den hell erleuchteten Swimmingpool. Schweißüberströmt und mit hochrotem Kopf kam er unter dem Bett hervor, legte seine Hände auf ihre Schultern und streichelte zaghaft ihren Nacken.
Sie ließ seine Zärtlichkeiten regungslos über sich ergehen. Seine Finger schlossen sich um ihren Hals. Er zögerte einige Sekunden zu lang.
Sie riss die Terrassentür auf und rief so laut, dass die beiden jungen Leute im Pool sie hören konnten: „Ich halte es in diesem elendigen Loch nicht aus, lieber verbringe ich die Nacht im Pool. Dir würde ein Bad auch nicht schaden, du stinkst drei Meilen weit gegen den Wind!“
Resigniert ließ er seine Hände sinken.
„Gut, ich komme mit. Aber lass uns warten, bis die Leute weg sind. Außerdem habe ich mir nach dieser verdammten Käferjagd zuerst einmal einen Drink verdient.“
Er nahm eine Flasche Bourbon aus seiner Reisetasche und bot auch ihr ein Gläschen an.
Ihre Laune besserte sich zusehends. Sie schlug vor, noch etwas fürs Abendessen einzukaufen. „Der Tankstellenshop hat bestimmt rund um die Uhr geöffnet.“ Mr. Malcome erblasste. Womöglich würde sie mit jemandem ins Gespräch kommen. Er musste um jeden Preis verhindern, dass sie das Apartment verließ.
„Wir könnten ja nach dem Schwimmen noch eine Kleinigkeit im Schnell-Restaurant essen.“
Ob dieser Großzügigkeit verschlug es ihr beinahe die Sprache. Sie gingen so gut wie nie zusammen essen. Was war bloß heute in ihn gefahren? Zuerst die zärtlichen Annäherungsversuche, dann der Drink und jetzt auch noch diese Einladung? Sie musterte ihn argwöhnisch. Mit einer Kleinigkeit würde sie sich aber nicht abspeisen lassen. Er würde seine Freigebigkeit schon noch bereuen.
Die Stimmen am Pool waren verstummt, die Unterwasserscheinwerfer ausgeschaltet. Er vergewisserte sich, dass die Vorhänge an den Fenstern der anderen Apartments zugezogen waren, dann schlüpfte er in seine Badehose und wartete, bis auch sie sich umgezogen hatte. Als sie dann in ihrem ausgeleierten Bikini vor ihm stand, musste er unwillkürlich an die vollbusige Mexikanerin denken, die er sich demnächst anlachen würde. Sie setzte ihre grellgelbe Bademütze auf, schließlich hatte sie erst gestern siebzig Dollar beim Friseur gelassen.
Das Wasser war sehr kalt. Anscheinend war es gerade frisch eingelassen worden. Erschrocken stellte sie fest, dass sie nur am Rand stehen konnte.
Er nahm einen kurzen Anlauf und sprang kopfüber in den Pool, tauchte sie mit dem ganzen Gewicht seines massigen Körpers unter. Prustend und wild um sich schlagend kam sie wieder hoch.
„Du Idiot weißt doch, dass ich nicht richtig schwimmen kann“, keuchte sie.
Ihr Mann war nirgends zu sehen. Zitternd klammerte sie sich an den Beckenrand.
„George, wo bist du?“
Ein sanftes Platschen bestätigte ihr, dass sie nicht allein im Pool war. Sie bildete sich ein, dass sich unter der Wasseroberfläche eine dunkle Silhouette abzeichnete. Aber es war zu finster, um Genaueres erkennen zu können.
„Lass die dummen Spielchen!“ Sie zitterte vor Angst, befürchtete, er würde sich ihr unter Wasser nähern, sie an den Füßen packen und in die Tiefe ziehen. Verzweifelt strampelte sie mit den Beinen.
Plötzlich vernahm sie ein leises Röcheln.
„Hör sofort mit diesem Blödsinn auf!“, schrie sie. Als sie endlich begriff, dass der Kopfsprung ins eiskalte Wasser zu viel für sein schwaches Herz gewesen war, tastete sie sich am Rand des Beckens bis zur Leiter vor und verließ rasch den Pool. Sie hatte keine Lust, ihrem Mann beim Sterben zuzusehen.
Hatte sie ihn nicht wiederholt gewarnt, dass sein Herz eines Tages nicht mehr mitspielen würde? Zu viele Hamburger, zu viel Alkohol. Aber er hatte ja nicht auf sie hören wollen. Ohne sich noch einmal nach der gespenstischen Silhouette, die sich nur undeutlich vom Wasser abhob, umzusehen, ging sie ins Haus.
Nach diesem Schock brauchte sie unbedingt einen Schluck Bourbon. Die angebrochene Flasche stand auf dem Nachtkästchen neben dem Bett, das er nun nicht mehr benützen würde. Als sie nach der Flasche griff, fiel ihr Blick auf die Schachtel mit seinen schnell wirkenden Herztabletten. Zögernd nahm sie die kleinen orangeroten Kugeln aus der Packung und betrachtete sie mit einem seltsamen Lächeln, bevor sie die Wunderpillen im Klo hinunterspülte.
Dann stärkte sie sich mit einem großen Schluck aus der Flasche, zog sich wieder an, holte die Taschenlampe aus dem Handschuhfach des Wagens und sah noch einmal nach ihrem Mann. Vorsichtig beugte sie sich über den Swimmingpool und vergewisserte sich, dass sie tatsächlich Witwe war.
Sie verständigte weder die Rettung noch die Polizei. Sie hasste Scherereien.
Wieder zurück im Apartment packte sie ihre Sachen und beseitigte alle Spuren, die sie hinterlassen hatte. Sogar die Bourbonflasche wischte sie ordentlich ab. Zuletzt durchsuchte sie noch die Taschen seines Anzugs. Die Motelrechnung lautete komischerweise auf einen Jonathan Smith. Sie dachte nicht lange darüber nach, legte die Rechnung auf den Tisch und steckte seine Papiere ein. Es würde wohl eine Weile dauern, bis man den Toten in der Badehose identifizierte.
In seiner Brieftasche befanden sich vierhundert Dollar. Das Kleingeld ließ sie drinnen. Zusammen mit ihren eigenen Ersparnissen besaß sie nun eintausenddreihundert Dollar. Ein hübsches Sümmchen. Für ein paar schöne Tage in Las Vegas würde es reichen, und wer weiß, vielleicht begann ja jetzt endlich ihre lang ersehnte Glückssträhne.
Beinahe vergnügt stieg sie in den Buick, denn sie fuhr gerne nachts.
Seine hunderttausend Dollar schwere Reisetasche hatte sie im Royal Hawaiian Motel zurückgelassen. Sie wollte sich mit seinen alten Sachen nicht belasten.
Ferragosto
Feinkörniger Sand, silbern glitzerndes Meer, farbenfrohe Sonnenschirme in Reih und Glied.
Drei ältere Damen aus Wien genossen seit Jahren im Hochsommer gemeinsam eine Woche am Strand von Grado. Anfangs hatten sie nur das Nötigste miteinander gesprochen. Erst bei ihrem zweiten Aufenthalt in Grado stellten sie fest, dass sich Astrids große Altbauwohnung unweit des Juweliergeschäfts von Judiths Mann in der Josefstadt befand. Beate war stolze Besitzerin eines mehrstöckigen Hauses in Ottakring, in dem auch die Baufirma ihres Mannes untergebracht war. Trotz der räumlichen Nähe trafen sich die drei Damen nur selten in Wien. Sie verkehrten in unterschiedlichen Kreisen. Dass sie ausgerechnet ihre Urlaube miteinander verbrachten, lag eher daran, dass sie befürchteten, sich allein am Strand zu langweilen. Außerdem wollte keine der drei abends allein essen gehen.
Sie wohnten allerdings immer in verschiedenen Hotels. Astrid, die mit einem Arzt verheiratet war, stieg in den Villen Bianchi ab. Judith bevorzugte das Grand Hotel Astoria. Beate stieg jeden Sommer in einem anderen 4-Sterne Hotel ab. Heuer logierte sie im Hotel Fonzari.
*
Die Damen breiteten ihre Hamamtücher auf den Liegen aus, hängten ihre Badetaschen unter den Schirm und schlüpften aus ihren Kleidern.
Judith schob ihre Liege in die Sonne. Sie war ein dunkler Typ. Mit ihren langen schwarzen Haaren, ihren dunkelbraunen Augen und ihrer tiefgebräunten Haut besaß sie eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Romni. Beate hütete sich, diesen Vergleich zu äußern, da Judith aus ihren Vorurteilen gegenüber Roma und Sinti keinen Hehl zu machen pflegte. Astrid konnte es sich jedoch nicht verkneifen, ihrer Bekannten einen Vortrag über die Schädlichkeit von UV-Strahlen zu halten. Beate stimmte ihr zu. Als ehemals echte Blondine hatte sie eine sehr empfindliche Haut. Deshalb beanspruchte sie auch vollen Schatten für ihre Liege, während Astrid sich mit dem Halbschatten zufriedengab und ihre bleichen Beine der Sonne entgegenstreckte. Ihre Strandtage liefen immer nach dem gleichen Ritual ab. Sie trafen sich pünktlich um zehn beim ersten Eingang des Spiaggia principale, verließen den Strand um dreizehn Uhr und kehrten nach einer ausgiebigen Siesta um sechzehn Uhr wieder zurück. Judith verzichtete manchmal auf Mittagessen und Siesta, blieb den ganzen Tag am Strand, legte sich allerdings in der Mittagszeit auch unter den Schirm.
Die Ärztegattin und die Frau des Juweliers ließen Beate hin und wieder spüren, dass sie gesellschaftlich weit unter ihnen rangierte. Die mollige Blondine war nicht dumm, sondern nur ein bisschen naiv. Sie erledigte jahrzehntelang die mehr als komplizierte Buchhaltung für die Baufirma ihres Mannes und hielt sein Büro in Schuss, während er den großen Macker mimte und das Geld mit beiden Händen hinauswarf. Ohne sie wäre er längst bankrottgegangen. Er dankte es ihr nicht. Im Gegenteil, je mehr sie für ihn schuftete, desto schlechter behandelte er sie. Früher hatte er sogar manchmal die Hand gegen sie erhoben. Seit sie ihm mit einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung gedroht hatte, wagte er es nicht mehr, sie zu schlagen. Aber er trank weiterhin zu viel, rauchte zu viel und stopfte zu viele Süßigkeiten in sich hinein.
Letzten Sommer hatte sich Beate einmal bei Astrid über ihr Ehemartyrium beklagt. Als Frau eines Psychiaters hatte Astrid schnell eine passende Diagnose parat gehabt.
Beate hatte sich daraufhin im Internet über Masochismus schlaugemacht und sich in einigen Fallbeschreibungen wiedergefunden. Im Grunde war es auch masochistisch, sich jeden Sommer mit diesen beiden arroganten Ladies zu treffen. Bestimmt konnte sie in Grado nettere und lustigere Gesellschaft finden. Doch Astrid imponierte ihr. Gerne hätte sie mehr von deren Klugheit und Selbstbewusstsein gehabt.
Astrid hatte vor ihrer Ehe als Krankenschwester gearbeitet. Sie hielt sich fit, hatte für ihr Alter eine ausgezeichnete Figur und bevorzugte sportlich-elegante Kleidung. Vor kurzem war sie sechzig geworden. Ihr verhärmtes Gesicht und ihr grauer Bob trugen jedoch dazu bei, dass sie keinen Tag jünger wirkte.
Die mollige Beate war drei Jahre älter. Ihr beinahe faltenloses Gesicht und ihre blond gefärbten Haare ließen sie aber jünger aussehen. Gekleidet war sie eher unauffällig, meistens trug sie weite sackartige Sachen, um ihre Rundungen zu verstecken.
Judith machte aus ihrem Alter ein großes Geheimnis. Sie war sehr schlank, fast dünn, kleidete sich betont sexy und war selbst am Strand mit viel Schmuck behangen. Trotz der starken Schminke waren die Sonnenschäden auf ihrer faltigen Haut deutlich sichtbar. Auch ihr Hals und ihre Hände verrieten, dass sie ihren Sechziger längst hinter sich hatte.
Da Astrid offensichtlich einen Narren an Judith gefressen hatte, nahm Beate die Gesellschaft dieser eitlen Person gezwungenermaßen in Kauf. Sie konnte sich nicht erklären, warum sich diese beiden unterschiedlichen Frauen so gut miteinander verstanden. Judith war weder besonders intelligent noch amüsant oder charmant. Allerdings schaffte es die Juweliersgattin meistens, im Mittelpunkt zu stehen. Geschickt flocht sie prominente Namen ins Gespräch ein, tat so, als würde sie die High Society von Wien persönlich kennen, und schien Astrid mit all den kulturellen Events, an denen sie teilnahm, zu beeindrucken. Judith pflegte fast jeden Abend auszugehen, sei es ins Theater, in die Oper, zu Konzerten oder Vernissagen. In Beates Augen war sie eine unerträgliche Angeberin.
Die ehemalige Schmuckverkäuferin, so bezeichnete Beate sie in Gedanken, war am Freitag in ihrem schicken BMW in Grado eingetroffen. Astrid war erst Samstagabend angekommen. Sie war mittags, ebenfalls mit ihrem eigenen Wagen, aus Wien losgefahren. Keine der beiden hatte angeboten, Beate mitzunehmen. Auch deshalb war diese schon am Mittwoch angereist. Sie wollte mindestens zehn Tage bleiben, wenn nicht länger. Je nachdem, wie sich alles entwickeln würde …
Wie jedes Jahr hatte sie den Zug bis Udine genommen. Auf den Bus zur Weiterfahrt hatte sie dieses Mal gerne verzichtet und sich von Udine aus ein Taxi nach Grado geleistet. Beate war vor einigen Monaten Witwe geworden. Da ihr Mann kein Testament hinterlassen hatte, war sie Alleinerbin. Die Baufirma hatte sie mittlerweile verkauft. Sie war jetzt Millionärin, konnte tun und lassen, was sie wollte, und hatte beschlossen, fortan das Leben in vollen Zügen zu genießen.
*
Während Beate auf ihrer Liege vor sich hin döste, tauchten Erinnerungen an den letzten Sommer auf.
Die Damen ließen damals ihren Grado-Urlaub mit einem feuchtfröhlichen Abend in einem Fischrestaurant an der Piazza Duca d’Aosta, wo sich ein Lokal an das andere reihte, ausklingen. Sie waren alle drei schon leicht beschwipst, als sich Judith über ihren knausrigen, misanthropischen Ehemann zu beklagen begann. Wenn Judith einen über den Durst getrunken hatte, hörte sie nicht mehr auf zu reden und war kaum zu bremsen. An diesem Abend jedoch fiel ihr Astrid ins Wort und schilderte den anderen beiden ausführlich ihre eigenen Eheprobleme.
Astrids Mann arbeitete als Psychiater im AKH. Seine Wahlarzt-Ordination in der Josefstadt hatte er vor Kurzem aufgegeben. Er hatte etwas von Work-LifeBalance geschwafelt. Der wahre Grund hieß Michaela, war gerade neununddreißig geworden und Neurologin. Der fesche Herr Doktor war ein Womanizer. Jahrelang hatte Astrid über seine zahlreichen Affären hinweggesehen, doch dieses Mal drohte die Geschichte aus dem Ruder zu laufen. Er bildete sich ein, ernsthaft in seine jüngere Kollegin verliebt zu sein, und hatte bereits das Wort Scheidung in den Mund genommen.
„Deiner ist wenigstens noch ein Mann“, unterbrach Judith sie. „Mein Alter hat mich seit Jahren nicht mehr angerührt.“
„Das kommt davon, wenn man einen viel älteren Mann heiratet“, sagte Astrid schnippisch. Die neue Geliebte ihres Mannes war auch mindestens zwanzig Jahre jünger als er.
Judith hatte ihren ersten Mann und ihre Tochter wegen ihres um siebzehn Jahre älteren Chefs verlassen. Mit ihrer Tochter stand sie nur mehr lose in Kontakt. Astrid war ebenfalls Mutter einer Tochter. Die Kleine hatte eine gute Partie gemacht, einen amerikanischen IT-Menschen geheiratet und lebte in New Jersey. Sie besuchte ihre Eltern jedes Jahr. Astrid war auch schon öfters in den Staaten und zeigte den Damen jeden Sommer die neuesten Fotos von ihren beiden wohlgeratenen Enkelkindern.
Beate hatte sich immer Kinder gewünscht, aber keine bekommen. Als sie erfuhr, dass nicht sie an ihrer Kinderlosigkeit Schuld trug, wie ihr Mann behauptet hatte, sondern er wegen seiner langjährigen Zuckerkrankheit zeugungsunfähig war, begann sie, ihn zu hassen.
An diesem Abend vor einem Jahr war jedoch weder von Kindern noch Enkelkindern die Rede. Astrid war sehr erbost über ihren Mann, vergoss sogar ein paar Tränen der Wut.
Beruhigend legte Beate die Hand um ihre bebenden Schultern.
Astrid schob ihre Hand weg und fauchte: „Am liebsten würde ich ihn umbringen!“
Judith stieß einen höhnischen Lacher aus.
„Leider gibt es keinen perfekten Mord.“
„Sag das nicht“, widersprach Astrid. „Da würde mir schon einiges einfallen.“
„Lass hören.“
Astrid erwähnte gewisse Medikamente, die, in zu hoher Dosis verabreicht, zum Tod führen könnten.
„Mein Alter ist herzkrank und schluckt jede Menge Pillen. Er würde es bestimmt nicht bemerken, wenn ich einige austauschte …“, murmelte Judith nachdenklich.
„Nimmt er auch ein Medikament, das Digitalis-Glykoside beinhaltet?“, fragte Astrid.
Judith zuckte mit den Achseln.
„Wie wäre es mit Giftpflanzen? Zwei, drei Blätter vom Roten Fingerhut können tödlich sein“, mischte sich Beate ein.
Judith zog ihre perfekt gezupften Brauen hoch und sah sie belustigt an. „Du liest zu viele Krimis“, sagte sie.
„Leidet er auch an Diabetes? Eine Überdosis Insulin lässt sich schwer nachweisen“, warf Astrid ein.
„Bei einer Pilzvergiftung denkt man auch nicht gleich an Mord“, sagte Beate leise. „Jedes Jahr sterben Leute, die sich mit Schwammerln nicht auskennen. Bei euch draußen in Seebenstein wimmelt es doch nur so von Schwammerln in den Wäldern.“
Astrid sah sie stirnrunzelnd an.
„Und bei einem Juwelier wäre eher ein Raubüberfall naheliegend.“ Beate war jetzt in ihrem Element. Ihr schien dieses Gedankenspiel Spaß zu machen. Sie liebte die Romane von Agatha Christie und ließ keine Verfilmung im Fernsehen aus.
Ihr Vorschlag stieß nicht auf Zustimmung. Judith forderte sie sogar auf, endlich den Mund zu halten, und bezeichnete sie als „dumme Gans“.
Während sich Astrid und Judith damals weiter über den perfekten Mord austauschten und die unterschiedlichsten Mordmethoden diskutierten, hing Beate leicht eingeschnappt ihren eigenen Gedanken nach.