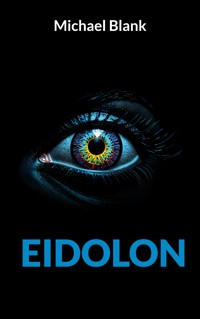Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist mehr als eine Sammlung von Geschichten - es ist ein Teil von mir. In Splitterwerk erzähle ich von Momenten, die das Leben prägen: vom Finden und Verlieren, von Hoffnung und Schmerz, von Tragik und der unerwarteten Komik des Alltags. Die Geschichten, die Sie hier finden, spiegeln Bruchstücke wider - meiner Gedanken, meiner Fantasien, vielleicht auch meiner Erinnerungen. Sie führen an düstere Orte, zu strahlenden Augenblicken und manchmal an die Kante der Wirklichkeit. Nicht jede Erzählung hat ein Happy End. Manchmal bleibt nur der Nachklang einer unbeantworteten Frage. Doch jede Geschichte ist ein Fragment, das für sich steht und doch ein größeres Ganzes erahnen lässt. Willkommen in Splitterwerk - meiner Welt in Worten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der erste Splitter
Der Fund
Im Schatten des Schützen
Das Flüstern hinter der Schwelle
Im Schatten der Gasse
Unter dem Schatten der Stadt
Im Getrennten vereint
Der Glanz, der ihn verließ
Warum Snoopy mich töten wollte
Der Pfad zwischen den Schatten
Zwischen Schiefen Tönen und Seifenblasen
Ein Herz unter jeder Schicht
Die leuchtenden Fäden
Ein Stück des Himmels
Im Schatten des Nordwinds
In den Flammen gefunden
Der Stulp des Universums
Der Vergessene Garten
Die Uhrmacherin
Das Leere Café
Der Letzte Brief
Das Flüstern der Sterne
Der Club der Unwahrscheinlichen
Die Anonyme Selbsthilfegruppe
Die Kunst des Scheiterns
Für immer und nie
Der Funke
Zugriff verweigert
Im Schatten der Freundschaft
DER ERSTE SPLITTER
Liebe Lesende,
herzlich willkommen zu Splitterwerk, meiner Sammlung von Kurzgeschichten! Ich bin 47 Jahre alt und habe in den letzten 30 Jahren mehr oder weniger intensiv an diesen Geschichten gearbeitet. Was als persönliches Schreibprojekt begann – eine Art Tagebuch für meine Gedanken, Gefühle und verrückten Einfälle – hat sich zu einer vielseitigen und lebendigen Sammlung entwickelt.
Schreiben war für mich stets mehr als nur ein Hobby. Es diente als Therapie, als Quelle der Freude, als kreatives Ventil für all die unterschiedlichen Emotionen, die das Leben mit sich bringt. In den verschiedenen Lebensphasen habe ich Geschichten verfasst – mal autobiografisch, mal völlig erfunden, oft mit einem Schuss Humor und manchmal auch einer Prise Sarkasmus. Jede Kurzgeschichte ist in sich abgeschlossen und lädt dich ein, zwischen den Zeilen zu lesen – mal zum Schmunzeln, mal zum Nachdenken. Nicht alle Splitter haben es in dieses Buch geschafft, ich habe diejenigen ausgesucht die in irgendeiner Weise auch nach all der Zeit noch mit mir gesprochen haben.
Splitterwerk spiegelt die vielen Facetten meines Lebens wider. Der Titel selbst symbolisiert die vielfältigen „Splitter“ oder Fragmente meiner Erfahrungen und Vorstellungen, die sich zu einem größeren Ganzen verbinden. Diese gesammelten Werke begleiten mich durch einen großen Teil meines Lebens. Ursprünglich nur für mich selbst geschrieben, möchte ich nun auch dich, den geneigten Leser oder die geneigte Leserin, daran teilhaben lassen. Die Geschichten sind bunt gemischt und bieten dir die Freiheit, nach Lust und Laune zu stöbern oder die Erzählungen hintereinander zu genießen. Egal, ob du zwischendurch eine kurze Auszeit suchst oder dich tief in eine Geschichte vertiefen möchtest – hier findest du für jede Stimmung das Passende.
Obwohl die Geschichten alle unterschiedlich sind, haben sie eines gemeinsam: Sie sind ein Stück von mir. Jede Erzählung reflektiert einen Teil meiner Persönlichkeit und meiner Erfahrungen, wodurch sich ein facettenreiches Bild meiner selbst entfaltet. In Splitterwerk findest du sowohl humorvolle Anekdoten als auch nachdenkliche Reflexionen, die dich dazu einladen, zwischen den Zeilen zu lesen und eigene Gedanken zu entwickeln.
Ich hoffe, dass du in diesen Seiten Momente findest, die dich zum Lachen bringen, dich zum Nachdenken anregen oder dich einfach nur unterhalten. Vielen Dank, dass du dich auf diese Reise durch mein Splitterwerk begibst. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
Herzlichst,
Michael Blank
DER FUND
Die Wohnung war still. Eine unnatürliche, lastende Stille lag auf den spärlich möblierten Räumen, als handle es sich um den Innenraum einer vergessenen Krypta. Draußen, hinter grauen Vorhängen, schien die Welt seit Stunden in ein bleiernes Grau getaucht, ein Winter, der sich seit Tagen wie eine unsichtbare Hand um die Stadt legte. Das Zimmer, in dem sich der Mann befand, war karg eingerichtet: ein schmaler Tisch aus Holz, dessen Kanten abgestoßen waren, ein einzelner Stuhl mit fleckigem Stoffbezug, ein Bücherregal an der Wand – schief montiert, einige Bretter zitterig eingehängt. Auf dem Regal standen wahllos durcheinandergewürfelte Bände, lose Blätter, Notizbücher, einige Aktenordner. In einer Ecke ein Mülleimer, bis zum Rand gefüllt mit zerknülltem Papier. Kein Fernseher, kein Radio, kein Computer, nur ein schwacher Glühbirnenschimmer von der Deckenlampe, der die Szenerie in ein fahles, fast krankhaftes Licht tauchte.
Der Mann am Tisch – nennen wir ihn Elias Roth, auch wenn die Geschichte seinen Namen vielleicht nie preisgegeben hätte – saß vor einem Stapel Papiere, handschriftlich eng beschrieben, mit Rändern voll kleiner Notizen, Pfeilen, Ausrufezeichen, kryptischen Markierungen. In seiner rechten Hand hielt er einen Stift, dessen Mine kurz vor dem Austrocknen stand; seine linke Hand lag flach auf dem Papier, als wolle er es daran hindern, davonzufliegen. Sein Gesicht, eingefallen, die Wangen hohl, die Augen tief in den Schädel gesunken, verriet eine innere Unruhe. Er trug ein zerknittertes Hemd, zu groß, an den Ellbogen ausgebleicht, die Manschetten ausgefranst. Die Hosen waren dunkel, form- und farblos, ohne klaren Schnitt. Er wirkte wie ein Mann, der sich seit Tagen nicht rasiert hatte, der kaum noch schlief, der seine ganze Existenz auf diese Blätter vor sich konzentrierte.
Draußen irgendwo auf der Straße kreischte eine Bremse, dann war es wieder still. Elias beachtete es nicht. Seine Gedanken kreisten um das, was er hier niederschrieb. Er war kein gewöhnlicher Schriftsteller. Dafür sprach die Art, wie sein Stift über das Papier raste, wie die Buchstaben ineinanderflossen, wie sein Atem manchmal stockte, als müsse er etwas Außergewöhnliches zu Papier bringen. Vielleicht war er ein Wissenschaftler, ein Forscher, ein Mann, der an Dingen arbeitete, die er nicht hätte berühren sollen. Etwas war in seinen Kopf gekrochen, etwas, das ihn verzehrte, und er versuchte es nun verzweifelt herauszuschreiben, um es in Worte, Formeln, Diagramme zu pressen.
In einem Nebenzimmer, so gut wie leer, stand ein alter Kleiderschrank mit kaputten Scharnieren, eine Matratze auf dem Boden, daneben einige leere Flaschen mit abgestandenem Wasser. Ein beißender Geruch von Schweiß, Angst und Konzentration lag in der Luft. Der Mann, Elias, hörte seine eigene Atmung in den Ohren. Wieder setzte er den Stift an, kratzte über das Papier, als würde er dem unsichtbaren Feind in seinem Kopf die Stirn bieten. Man konnte fast die Pulsader an seinem Hals pochen sehen.
Stunden vergingen – oder waren es nur Minuten? Die Zeit in dieser Wohnung war seltsam gedehnt, verschoben, als läge sie außerhalb der normalen Welt. Ab und an hob Elias den Blick, starrte auf die Wand, auf eine schwache Verschmutzung im Putz oder auf die Bücher im Regal, als könnte er dort Antwort finden. Dann setzte er fort: Krakelnde Buchstaben, fließende Sätze, Fragmente von Formeln, die sich über den Rand hinaus entfalteten. Man sah daran, dass er etwas Unfassbares bändigen wollte, etwas, das weitaus größer war als diese Seite, größer als dieser Raum, größer als seine Möglichkeiten, es zu verstehen.
Mit der Zeit wurden seine Bewegungen hektischer, manischer. Sein Atem schneller, seine Hand verkrampfter. Der Stift stieß auf Widerstand, als wollte das Papier selbst die Aufnahme dieser Botschaft verweigern. Er flüsterte dabei Worte, kaum hörbar: „Nein … das kann nicht … unmöglich …“ Dann lauter: „Verdammt! Wieso passt es nicht? Wieso… wieso…“ Er biss sich auf die Lippe, bis ein kleiner Blutfleck auf dem Papier erschien. Doch er schrieb weiter, rutschte immer tiefer in eine Erkenntnis, die in seinem Kopf loderte wie ein blindwütiges Feuer.
Plötzlich hielt er inne. Der Stift erstarrte. Sein Blick fiel auf das Geschriebene. Für Sekunden – oder waren es Minuten? – regte er sich nicht. Nur sein Atem war zu hören, flach und stoßweise. Dann ließ er den Stift fallen, das Klappern auf der Tischplatte hallte durch die Stille. Elias richtete sich langsam auf, der Stuhl knarrte, als hätte er Schmerzen. Er stand vor dem Tisch, starrte auf die Seiten, auf die sorgfältig angehäuften Blätter, die Notizen, die Randbemerkungen. Sein Blick war leer, fast tot, wie von jemandem, der gerade seine eigene Verdammnis niedergeschrieben hat.
Er hob eine Hand, fuhr sich mit den Fingern durch das Haar. Dann ging er langsam durch den Raum, zielgerichtet, als würde er etwas suchen. In einer Schublade, einer Kommode oder vielleicht hinter einem Stapel alter Zeitungen – es war nicht ganz klar, woher – zog er plötzlich eine Schere hervor. Eine schlichte Haushaltsschere mit stumpfen, abgenutzten Klingen. Auf den ersten Blick kein sonderlich gefährlicher Gegenstand, doch in seiner Hand wirkte sie wie ein Werkzeug reinen Wahnsinns.
Zurück am Tisch beugte er sich leicht vor, sein Atem klang jetzt rasselnd, so als ringe er mit sich selbst. Sein Blick schweifte zwischen Manuskript und Schere hin und her. Er sprach kein Wort. Seine Hand, die die Schere hielt, zitterte. Dann, fast lautlos, richtete er die Spitze der Schere gegen seinen eigenen Unterarm. Man konnte sehen, wie sie ein wenig in die Haut drückte, wie sie zögerte. Dann ein Ruck – und die Klinge ging hinein. Elias’ Gesicht verzerrte sich in stummem Schmerz. Er zog die Klinge heraus, der erste Tropfen Blut fiel auf die Blätter, tiefrot und verräterisch.
Doch er hörte nicht auf. Mit beängstigender Entschlossenheit stach er erneut zu, diesmal tiefer, an einer anderen Stelle, an seinem Brustkorb, seinem Unterbauch, als wolle er in sich selbst einen Weg freischneiden. Sein Atem verwandelte sich in ein qualvolles Keuchen. Er keuchte, stöhnte, rang nach Luft. Das Manuskript vor ihm wurde von dunkelroten Spritzern befleckt. Ein verstörendes Bild: Der Mann, der erschafft – oder entschlüsselt – und gleichzeitig zerstört, sich selbst aufschlitzt, als wäre seine eigene Existenz das letzte Hindernis zwischen der Erkenntnis und der Welt.
Irgendwann sank er auf die Knie, die Hand immer noch fest um den Griff der Schere geklammert. Sein Blick verschwamm, sein Körper erschlaffte. Er kippte langsam seitlich um, schaffte es kaum noch zu atmen. Die Blutlache unter ihm wuchs, floss in Richtung des Tisches, der Stuhlbeine, konnte aber nicht die stummen Zeilen auf dem Papier mehr unkenntlich machen. Die Worte waren da, festgehalten in Tinte und Blut. Elias’ Augen rollten nach oben. Mit einem letzten, halb gurgelnden Atemzug schied er aus dieser Welt. Das Manuskript, seine letzte Botschaft, blieb zurück.
Tage vergingen. In der Stadt erblasste der Winter nicht, eher wurde er drückender. Menschen hasteten über nasse Gehwege, wärmten sich die Hände an Pappbechern, während draußen in dieser tristen, billigen Mietwohnung ein toter Mann am Esstisch lag. Die Nachbarn hatten schon seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gehört. Es roch eigentümlich im Flur, eine muffige Ausdünstung, doch in Häusern wie diesem scherte sich kaum jemand um seltsame Gerüche. Die Stadt war voll von Vernachlässigung und Ignoranz. Vielleicht hatte jemand geklopft, vielleicht hatte der Postbote seine Briefe einfach unter der Tür hindurchgeschoben.
Irgendwann, nach einem halben Dutzend verstrichener Tage, wurde das Klopfen an der Tür energischer. Es war kein zaghaftes Warten mehr, sondern ein forderndes Pochen. Niemand antwortete. Die Tür – verschlossen. Wer immer draußen stand, gab nicht auf. Ein entschiedener Tritt an das morsche Holz, dann ein zweiter. Schließlich brach das Türschloss mit einem hässlichen Geräusch. Die Tür schwang auf, und ein Mann in einem langen, dunklen Mantel trat ein. Sein Gesicht halb im Schatten, eine Narbe an der Wange, Augen wachsam und kühl, so als sähe er solche Szenen nicht zum ersten Mal.
Er sah sich um. Der Geruch von Verwesung und geronnenem Blut lag in der Luft. Der Mann verzog keine Miene, legte nur eine Hand über den Mund, atmete flach durch die Nase. In seiner anderen Hand hielt er etwas, vielleicht einen Ausweis oder ein Foto. Sein Blick glitt durch den Raum, blieb an dem reglosen Körper am Boden hängen. Er schritt langsam näher, achtete penibel darauf, wohin er trat. Sein Mantel berührte beinahe die Tischkante, als er sich vorbeugte, um den Toten zu betrachten.
Das Opfer lag bereits im Zustand zunehmender Verwesung, das Gesicht wächsern, die Augen offen, aufgerissen in einem letzten, stummen Schrei. Die Wunden, die die Schere hinterlassen hatte, waren deutlich zu erkennen. Der Mann im Mantel drückte die Lippen aufeinander. Er kannte so etwas. Er wusste, dass dies kein gewöhnlicher Vorfall war. Zu gezielt, zu absurd. Da hatte jemand etwas entdeckt, etwas verstanden, etwas niedergeschrieben – und es hatte ihn in den Wahnsinn getrieben.
Der Mann in Mantel richtete sich auf, wandte sich dem Tisch zu und musterte die Notizen, die verstreuten Papiere. Einige Blätter klebten an der Platte, verklebt vom getrockneten Blut. Andere lagen auf dem Boden. Er holte ein Taschentuch hervor, um die Seiten vorsichtig anzuheben, ohne Spuren zu zerstören. Seine Augen huschten über die Buchstaben, die Zeichnungen, die kryptischen Vermerke. Von Zeit zu Zeit runzelte er die Stirn, als würde er etwas erkennen, das ihm nicht geheuer war.
Das Manuskript bestand aus Dutzenden, vielleicht Hunderten von Seiten. Darin fanden sich Texte, die eher wie Auszüge aus wissenschaftlichen Abhandlungen wirkten, gespickt mit Fachtermini, mathematischen Formeln, anatomischen Skizzen, geografischen Koordinaten, Hinweisen auf historische Dokumente. Aber auch merkwürdige Bemerkungen, als hätte der Schreiber im Fieberwahn versucht, das Unaussprechliche mit Worten zu fassen.
Während der Mann im Mantel las, wurde sein Gesicht immer blasser. Die Schatten unter seinen Augen vertieften sich, seine Hand zitterte leicht, als würde ihn die Last dieser Worte erdrücken. Er entdeckte Passagen, in denen Elias offenbar auf etwas stieß, das jenseits seiner bisherigen Vorstellungskraft lag. Ein Muster, eine Theorie, ein Geheimnis, das die Grundfesten dessen, was wir wissen, erschütterte.
Ein leises Knacken war im Flur zu hören – vielleicht ein Nachbar, der neugierig die Nase an die Tür steckte. Der Mann im Mantel drehte den Kopf, lauschte einen Moment, sagte aber nichts. Dann widmete er sich wieder dem Manuskript. Je weiter er las, desto klarer schien ihm zu werden, dass Elias etwas herausgefunden hatte, das in falschen Händen katastrophale Folgen haben könnte. Oder war es etwas, das man gar nicht kennen sollte? Sein Blick schweifte zur Leiche, dann zurück zu den Zeilen. Es war, als hätte der Tote den Schlüssel zu einer schrecklichen Tür gefunden und diese weit aufgestoßen, nur um dahinter einen Abgrund zu erblicken, in den er schließlich selbst stürzte.
Der Mann in Mantel holte schließlich sein Mobiltelefon hervor. Er wählte eine Nummer, ohne den Blick von den Seiten zu lösen. Sein Atem war jetzt flach, er versuchte, Fassung zu bewahren. Als am anderen Ende jemand abhob, sagte er mit gepresster Stimme: „Ich brauche sofort ein Team hier … Er hat es gefunden.“ Dann schwieg er. Hörte zu. Nickte. Legte auf.
Er wusste, er durfte nicht mehr allein hierbleiben. Dies war kein Fall für irgendeine gewöhnliche Einheit. Dies musste diskret behandelt werden. Er schob einen Finger zwischen zwei Seiten, um eine bestimmte Stelle im Manuskript zu markieren, die ihn besonders erschüttert hatte. Dann trat er einen Schritt zurück, betrachtete das Gesamtbild. Der Tote, der Tisch, das Blut, das Manuskript. Ein stilles Arrangement, wie eine Installation in einer obskuren Galerie des Grauens.
Die Heizung in der Wohnung war abgedreht, die Luft feucht und kalt. Es roch nach Verfall, nach etwas, das nicht hätte geschehen dürfen. Der Mann im Mantel griff in eine Innentasche und zog ein kleines Notizbuch hervor, in das er mit einem Kugelschreiber ein paar Stichworte kritzelte. Er verriet sich nicht, kein Laut, kein Zögern – aber man sah ihm an, dass sein Verstand auf Hochtouren lief, dass er versuchte, die Bruchstücke dieser Entdeckung in einen Kontext zu setzen.
Draußen sirrte eine Neonröhre im Hausflur. Er hörte Schritte im Treppenhaus, vielleicht Kollegen, vielleicht Leute seines Teams, denen er kurz zuvor Bescheid gegeben hatte. Er konnte sich nicht sicher sein. Dieser Mann wirkte nicht wie ein normaler Ermittler. Zu ruhig, zu geübt im Umgang mit dem Unerklärlichen. Vielleicht war er von einer Behörde, von der selbst die Polizei nichts wusste. Vielleicht handelte es sich um ein internationales Netzwerk, das darauf spezialisiert war, solche Funde unter Verschluss zu halten. Vieles blieb im Dunkeln.
Doch er war nicht hergekommen, um Mitleid zu empfinden oder Gerechtigkeit zu suchen. Er war hier, weil Elias etwas Niedergeschriebenes zurückgelassen hatte, etwas, von dem die Öffentlichkeit nichts erfahren durfte. An manchen Rändern der Seiten waren Zahlenkolonnen zu sehen, deren Logik nicht erkennbar war. An anderen Stellen kryptische Verweise auf längst untergegangene Kulturen oder vergessene Archive. Wieder anderswo Hinweise auf Versuche in geheimen Laboren. Eine interdisziplinäre Irrfahrt durch Wissen, das nie für die breite Masse bestimmt war.
Der Mann trat an das Bücherregal, ließ die Finger über die Buchrücken gleiten. Nichts Besonderes: ein paar veraltete Lexika, ein Roman in einer fremden Sprache, ein zerfleddertes Mathematik-Kompendium. Er suchte nach Hinweisen, nach etwas, das Elias benutzt hatte, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Ein Lesezeichen, ein Foto, ein Brief. Doch nichts dergleichen. Es schien, als habe der Mann alles Relevante in sein Manuskript gepackt. Oder er hatte es nie nötig gehabt, auf externe Quellen zurückzugreifen. Vielleicht war alles schon in seinem Kopf gewesen.
Zurück am Tisch hob der Mann im Mantel vorsichtig ein blutgetränktes Blatt an. Darauf eine Zeichnung – eine Art Diagramm, grob hingekritzelt, kaum zu erkennen. Es schien eine geometrische Anordnung zu zeigen, Kreise, Dreiecke, von Pfeilen durchzogen. Daneben ein Wort, das ohne weiteren Kontext absurd erschien. Der Mann runzelte die Stirn. Diese Dinge ergaben für ihn nur bedingt Sinn, aber er wusste, wer sie entschlüsseln konnte. Er brauchte sein Team – Experten in verschiedenen Disziplinen, die das Unerklärliche untersuchten und verborgene Wahrheiten aus den Tiefen geheimer Archive zerrten.
Ein leises Klopfen an der offenen Tür. Zwei Gestalten tauchten auf, ebenfalls in dunklen Mänteln, der eine mit schmaler Gestalt, der andere breitschultrig. Sie traten ein, grüßten wortlos. Der Mann nickte ihnen zu, zeigte mit einer knappen Geste auf die Leiche und dann auf das Manuskript. Die beiden anderen begannen wortlos mit ihrer Arbeit: Sie fotografierten, machten Notizen, sammelten Dokumente ein, zogen Handschuhe an, um die Papiere vorsichtig in Plastikfolie zu hüllen. Einer von ihnen berührte einen Rand des Manuskripts, schreckte kurz zurück, als hätte er sich an einer unsichtbaren Kante geschnitten. Er sagte nichts, aber man spürte die Anspannung.
Der Mann im Mantel stand nun etwas abseits, beobachtete seine Kollegen. Er überlegte, wie Elias an dieses Wissen gelangt war. Vielleicht durch Experimente, vielleicht durch Zufall, vielleicht durch einen Hinweis in einem alten Archiv. Egal wie, der Mann war letztlich daran zerbrochen. Er war nicht stark genug, diese Last zu tragen, und als er bemerkte, was er da entdeckte, war es vermutlich schon zu spät. Das Manuskript war wie ein Spiegel, in dem er sein eigenes Ende sah, ein verhängnisvolles Fenster in eine Welt, die niemand betreten sollte.
Die beiden Helfer packten schließlich alle Dokumente ein, versiegelten sie in stoßfesten Behältern. Das Manuskript würde an einen Ort gebracht werden, wo es hinter dicken Türen verschwinden würde, fern von neugierigen Blicken. Die Leiche sollte man später diskret abtransportieren. Einen offiziellen Polizeibericht würde es geben, aber nur in zensierter Form. Man würde etwas von einer tragischen Selbsttötung murmeln, vielleicht von psychischen Problemen. Die Öffentlichkeit durfte nichts von dem erfahren, was in diesen Seiten stand.
Der Mann im Mantel vergewisserte sich, dass alle Hinweise eingesammelt waren. Er überprüfte die Ecken des Raumes, die Schubladen, die Nischen. Dann trat er vorsichtig an Elias’ leblosen Körper heran, schaute ihm einen Moment in die toten Augen. Er hob eine Augenbraue, fast so, als wollte er sich entschuldigen. Vielleicht dachte er: „Du warst zu nahe dran. Du hast etwas gesehen, das wir vor der Welt verbergen müssen. Es tut mir leid, dass es so enden musste.“ Doch laut sagte er kein Wort. Er wusste, Toten sind Worte egal.
Ein leises Summen seines Telefons. Er zog es erneut hervor, las eine kurze Nachricht auf dem Display, die ihm bestätigte, dass der Transporter in wenigen Minuten eintreffen würde. Draußen war es längst Abend geworden, die Straßenlaternen flimmerten im schmutzigen Licht, Passanten eilten vorbei, ahnungslos. Die Welt drehte sich weiter, als wäre nichts geschehen.
Die beiden Helfer verließen den Raum, um sich im Flur mit weiteren Mitgliedern des Teams abzusprechen. Der Mann im Mantel blieb kurz allein, ließ den Blick nochmals über den Tatort schweifen. Er dachte darüber nach, wie oft er schon in ähnlichen Wohnungen gestanden hatte: Männer und Frauen, die etwas entdeckt hatten, das jenseits ihres Verständnisses lag. Sie waren alle daran zerbrochen. Kein Mörder musste Hand anlegen, kein Komplott musste sie zum Schweigen bringen – ihre eigene Erkenntnis hatte sie vernichtet.
Er erinnerte sich vage an eine ähnliche Szene vor einigen Jahren, in einer Dachgeschosswohnung in einer anderen Stadt. Auch dort ein Manuskript, seltsame Formeln, ein Toter, der an seinen eigenen Schreien erstickt war. Er fragte sich, ob all diese Fälle zusammengenommen ein Bild ergeben würden, eine Art Mosaik einer Wahrheit, die seine Organisation – wer auch immer sie war – seit Jahrzehnten vor der Öffentlichkeit verbarg. Vielleicht würde er eines Tages das ganze Ausmaß verstehen. Vielleicht auch nicht.
Er trat ans Fenster, spähte durch einen schmalen Spalt in die Straße hinunter. Da war ein schwarzer Lieferwagen, unauffällig, ohne Kennzeichen. Zwei Männer stiegen aus, blickten sich um. Sie würden sich in wenigen Augenblicken um die Leiche kümmern. Die Nachbarn würden das Poltern hören, vielleicht die Stimmen. Aber am Ende würden sie nichts wissen, nur Gerüchte hätten. In dieser Gegend interessierte sich kaum jemand für die Hintergründe. Die Leute hatten ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Geheimnisse.
Der Mann im Mantel seufzte leise, bevor er sich wieder umdrehte. Er ging zum Tisch zurück, fuhr mit einem Handschuhfinger über die getrockneten Blutspuren, als wolle er eine letzte Spur aufnehmen. Dann verließ er den Raum, schloss die Tür so gut es ging hinter sich, obwohl das Schloss aufgebrochen war. Im Flur traf er seine Kollegen, die ihm zunickten. Wortlos machten sie sich an ihre Arbeit. Innerhalb weniger Minuten würde dieser Ort ebenso leer und karg sein wie zuvor, nur um einen Toten ärmer und um ein Geheimnis reicher, das nun wieder im Dunkeln lag.
Während sie die Räumlichkeiten verließen, blieb ein schwerer Nachhall zurück: die Vorstellung, dass irgendwo in diesen Zeilen etwas lag, das die Fundamente des Verstehens erschüttern konnte. Etwas, das die Welt, wie man sie kannte, infrage stellte. Doch der Mann im Mantel wusste genau, dass solche Dinge niemals an die Öffentlichkeit dringen durften. Zu gefährlich waren sie, zu zerstörerisch.
Am Ende blieb die Erinnerung an einen Wissenschaftler, der von einer Erkenntnis überwältigt wurde, an einen geheimnisvollen Fund, dessen Natur verborgen bleiben sollte, an einen schattenhaften Mann im Mantel, der wusste, an wen er sich wenden musste, um alles unter Kontrolle zu halten. Das Manuskript, das die Ursache dieses Dramas war, würde vielleicht in einem Safe enden, tief unter der Erde, oder in einem Hochsicherheitsarchiv, in dem jede Seite einzeln unter Verschluss gehalten wurde. Wer immer darauf stieß, würde schweigen müssen, so wie Elias nun für immer schwieg.
Draußen begann es zu regnen. Feine Tropfen prasselten gegen die Fenster. Der Mann im Mantel stieg die Treppe hinab, sein Team im Schlepptau. Unten auf der Straße ließ er den Kragen seines Mantels hochklappen, so als wollte er sich nicht nur vor dem Regen schützen, sondern auch vor den Blicken der Welt. Er ging an den Lieferwagen heran, wechselte ein paar leise Worte mit den Männern, die dann wortlos in das Gebäude verschwanden, um die Leiche abzuholen.
Später, als er im Inneren eines anderen Fahrzeugs saß, blickte er auf das Handy, auf die kurze Nachricht, die er geschickt hatte: „Er hat es gefunden.“ Keine weiteren Details. Man würde ihn verstehen. Ein verschlüsseltes Codewort würde an die richtigen Stellen weitergeleitet, ein Apparat würde in Gang gesetzt. Nicht zum ersten Mal. Und vermutlich nicht zum letzten.
Die Dunkelheit wuchs, und die Lichter der Stadt verflossen zu einem verschwommenen Gemälde. Wer in dieser Nacht an dem Haus vorbeiging, in dem Elias gelebt hatte, würde nichts Außergewöhnliches bemerken. Kein Blaulicht, kein Absperrband, kein sensationeller Medienrummel. Nur das fahle Leuchten einer Straßenlaterne, ein nasses Pflaster und ein paar Schritte in der Dunkelheit. Die Welt würde sich weiterdrehen, als wäre nichts geschehen. Und in den Archiven einiger weniger Eingeweihter würde das Manuskript still daliegen, aufbewahrt wie ein unheilvoller Schatz, dessen wahre Natur ein Mysterium bleiben sollte – genau so, wie es immer geplant war.
Und so endete diese Geschichte, ohne dass irgendjemand jemals erfuhr, was Elias wirklich herausgefunden hatte. Die Seiten waren beschriftet, die Tinte getrocknet, das Blut verkrustet. Die Erkenntnis blieb ein Geheimnis, bewacht von jenen, die um sein Existenzrecht wussten, und begraben mit dem Mann, der nicht stark genug gewesen war, das Erfahrene zu ertragen. Keine Auflösung, kein finales Licht ins Dunkel. Nur das flackernde Nachglühen einer furchtbaren Einsicht, die ungesagt bleiben musste.
Am Ende blieb nur die Stille. Die gleiche Stille, die schon zu Beginn über der Wohnung gelegen hatte. Doch diesmal war sie noch schwerer, noch dichter. Eine Leerstelle, in der einmal eine Wahrheit funkelte, die nun wieder hinter verschlossenen Türen schlief. Die Wände würden dieses Geheimnis nicht preisgeben. Es würde dort verrotten, im Gedächtnis einiger weniger, die schworen zu schweigen.
Irgendwo in der Ferne heulte ein Hund. Der Regen prasselte weiter. Und die Nacht fraß die letzten Spuren einer Offenbarung, die besser niemals gemacht worden wäre.
IM SCHATTEN DES SCHÜTZEN
Der Tag begann, wie so viele Tage im grauen Herbst dieser vergessenen Provinzstadt: mit einem bleiernen Himmel, der seit Stunden so tat, als wolle er jeden Moment losweinen, aber es nicht fertigbrachte. Kühlfeuchter Wind strich über die weitläufigen Felder hinter dem Militärstützpunkt, wo im Morgengrauen etwas Ungeheuerliches geschehen war. Ein paar Gänse kreisten über die Baumreihen, stießen krächzende Laute aus, als würden sie die Nachricht, die die Runde machen würde, hinaus in die Welt tragen. Auf dem verlassenen Trainingsgelände, nur wenige hundert Meter hinter den Kasernenbauten, lag eine Leiche: eine Soldatin, in Tarnuniform, mit aufgerissenen Augen und einem feinen Loch im Schädel.
Es war nicht der erste Mord, den Kommissar Claus W. Kropka in seiner langen Laufbahn gesehen hatte, aber vielleicht würde es einer der letzten sein. Der alte Hase wirkte müde, schon bevor er richtig vor Ort war. Man erzählte sich unter den jüngeren Beamten, dass Kropka einst ein vorbildlicher Ermittler gewesen sei, scharfzüngig, zäh, mit einem unfehlbaren Instinkt für die Dunkelheit im Herzen der Menschen. Doch diese Zeiten lagen weit zurück. Mittlerweile schleppte er sich durch die Tage, brütete über alten Akten, trank mehr Kaffee, als ihm guttat, und sprach nur noch selten über die Dämonen, die ihn nachts heimsuchten. Niemand wusste, wofür das „W“ in seinem Namen stand, und keiner wagte, ihn danach zu fragen.
An diesem Vormittag stand er am Rand des Trainingsareals und zog an seiner Zigarette, obwohl das Rauchen hier offiziell verboten war. Der Stützpunktkommandant, ein untersetzter Mann mit grauem Bürstenhaarschnitt, starrte ihn von der Seite an, wagte aber nichts zu sagen. Kropka nahm den letzten Zug, schnippte die Zigarette in den Dreck und ging langsam auf die Leiche zu. Ein paar Feldjäger standen nervös herum, versuchten professionell zu wirken. Der Ermittler kniete sich neben den Körper, betrachtete das blasse Gesicht der toten Soldatin. Sie hatte noch ihre Dog Tags um den Hals und in ihrer verkrampften Hand hielt sie etwas Glänzendes. Ein Medaillon. Darauf war ein Bogenschütze eingraviert, dessen Pfeil in eine unbekannte Ferne zeigte.
„Wie heißt sie?“, fragte Kropka, ohne den Blick von der Toten abzuwenden. Ein junger Leutnant blickte in seine Unterlagen: „Obergefreiter Karin Strauch, 27 Jahre. Schießausbildung, Einheiten für Spezialeinsätze.“ Kropka nickte stumm. Die Frau hatte jemandem vertraut, oder war über etwas gestolpert, das sie nicht hätte sehen dürfen. Er betrachtete den Einschuss: ein sauberer Kopftreffer. Professionalität oder Glück? Er war sich nicht sicher.
Der Kommandant begann zu reden, mit einer Stimme, die so klang, als wolle er die Verantwortung für alles loswerden: „Wir haben keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Das Gelände ist weitläufig, überall diese alten Erdwälle, Schießstände, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Man kann hier leicht unbemerkt verschwinden. Die Soldatin war heute Morgen noch beim Frühsport, dann muss sie in dieses Areal gegangen sein. Warum, wissen wir nicht.“
Kropka erhob sich langsam, klopfte den Staub von seiner abgegriffenen Jacke. Er trug kein schickes Sakko, sondern einen alten, abgetragenen Mantel, der aus einer anderen Zeit zu stammen schien. Sein Hut hatte bessere Tage gesehen, doch er schien an ihm zu hängen wie an einem Talisman. Die Kollegen aus der Mordkommission mieden seine Fragen nach seinem Privatleben – zu düster waren die Gerüchte, die sich um sein früheres Wirken als verdeckter Ermittler rankten. Man erzählte sich, dass er einst Dinge getan habe, die ihm nun in stillen Nächten die Kehle zuschnürten.
„Haben Sie irgendwelche Hinweise auf Feinde, interne Konflikte, Liebschaften, Streit um Informationen?“, fragte er den Kommandanten. Der Mann zuckte mit den Schultern, wirkte unbehaglich: „Die meisten hier sind Profis. Streit gibt’s immer mal, aber Mord? Das ist was anderes. Wir werden Ihnen jede Liste geben, die Sie brauchen. Namen, Einheiten, Stationierungen. Aber Sie müssen bedenken, dass manches hier streng vertraulich ist. Wir erwarten Diskretion.“
Kropka lachte leise, ein bitteres Geräusch, das keine Heiterkeit verriet: „Diskretion ist mein zweiter Vorname, Herr Kommandant.“ Dann ging er fort, Richtung Kaserne, während der Spurensicherungstrupp hinter ihm die Arbeit begann. Er musste mit den Soldaten sprechen, ihren Gesichtern in die Augen sehen, hören, wie sie logen oder versuchten, etwas zu verbergen. Manchmal war es so einfach: Man las in der Stimme, in der Mimik, in den unruhigen Fingern. Aber er hatte gelernt, dass Soldaten ein hartes Pflaster waren. Sie hielten dicht, konnten schweigen wie Steinwände, vor allem, wenn sie an etwas beteiligt waren, von dem sie niemals erzählen durften.
Die Kaserne bestand aus langgezogenen, grauen Gebäuden, umgeben von Stacheldraht und einem Kordon aus Wachtürmen. Drinnen roch es nach Reinigungsmitteln, nach Schuhwichse, nach eintönigen Menüs aus der Kantine. Kropka hatte ein kleines Büro im Verwaltungstrakt zugewiesen bekommen: ein leerer Raum mit einem Schreibtisch, einem Stuhl und einem Telefon, der aussah, als würde er sonst als Abstellkammer dienen. Er schlug eine Akte auf, die ihm der Leutnant ausgehändigt hatte. Namen, Dienstgrade, Fachgebiete. Er suchte nach etwas, das zu dem Medaillon passen könnte – der Bogenschütze, ein Symbol. War es ein Wappen, ein Zeichen einer geheimen Einheit, eine persönliche Vorliebe?
Während draußen die Winde pfiffen, lud er einige Soldaten zum Gespräch. Der erste war ein Gefreiter namens Himmelreich, ein schlaksiger Bursche mit nervösen Augen. Er wusste angeblich nichts, war zur Tatzeit im Schlafsaal. Die zweite, eine Unteroffizierin, wirkend kühl und distanziert, versicherte Kropka, dass Karin Strauch allseits beliebt gewesen war, eine fleißige Soldatin, unauffällig. Der Kommissar glaubte kein Wort. Niemand war wirklich unauffällig. Jeder trug ein Geheimnis.
Nach und nach wurden weitere Soldaten vorgeladen: Ein Stabsfeldwebel, der gerne zu viel trank und sich bei Nacht in der Kantine herumdrückte, ein Hauptmann, der große Pläne hatte und lieber heute als morgen versetzt werden wollte, ein einfacher Schütze, der im Maschinenraum arbeitete. Die meisten hatten Alibis, manche nicht. Doch nichts fühlte sich an wie der zündende Funken. Kropka spürte eine innere Unruhe in sich aufsteigen. Dieser Mord war sauber ausgeführt. Vielleicht zu sauber. Er kannte solche Fälle – militärische Auftragsarbeiten, Querschläger oder Sabotage.
Während er Befragungen durchführte, verließ ihn ein Gedanke nicht: das Medaillon mit dem Bogenschützen. Er hielt es gerade zwischen Daumen und Zeigefinger, als er eine kurze Pause einlegte. Die Gravur war fein, stilisiert, zeigte eine Figur, die einen Pfeil auf ein unsichtbares Ziel abschoss. Es erinnerte ihn an ein Sternzeichen: Schütze. Ein dummer Zufall? Die Soldatin hatte es in ihrer Hand gehalten, als sie starb. Vielleicht hatte sie es dem Mörder entrissen, vielleicht sollte es ein letzter Hinweis sein.
Gegen Abend ging er über den Kasernenhof. Der Himmel war noch immer wolkenverhangen, und die Lichter der Scheinwerfer ließen den Stützpunkt wie eine Kulisse aus einem trostlosen Kriegsfilm wirken. Kropka dachte an frühere Zeiten, an andere Einsätze, die er einst durchgeführt hatte. Damals, in jener Operation, die er seit Jahrzehnten nicht einmal in seinen Träumen beim Namen nannte. Er hatte Blut an den Händen gehabt, es im Regen von sich abgewaschen, aber der Gestank haftete noch immer an seiner Seele.
Eine junge Soldatin kam auf ihn zu, nervös, als sie sah, wie er etwas in der Hand hielt. „Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, darf ich fragen, was Sie da haben?“ Kropka versteckte das Medaillon instinktiv in seiner Manteltasche: „Nur ein Hinweis. Kennen Sie dieses Symbol?“ Die Soldatin schüttelte den Kopf, wirkte dabei aber so, als wüsste sie mehr. Er lächelte schmal: „Hören Sie, Sie wollen doch nicht, dass noch mehr passiert, oder? Wenn Sie etwas wissen, reden Sie mit mir.“ Aber sie wand sich heraus, sagte, sie müsse zurück in ihre Einheit.
In den folgenden Tagen sprach Kropka mit Dutzenden Soldaten. Er versuchte, die Vergangenheit von Karin Strauch zu ergründen: Wo war sie stationiert gewesen, mit wem hatte sie engen Kontakt gehabt, gab es besondere Einsätze, an denen sie beteiligt war? In den Akten fand er spärliche Hinweise auf Einsätze in Waldgebieten, verdeckte Übungen, Simulationen. Immer wieder stieß er auf den Begriff „Sonderauftrag Nr. 4c“, der ohne Erklärung blieb. Die Verantwortlichen mauerten. Der Kommandant tat ahnungslos, andere taten unbeteiligt.
Kropka kratzte sich am Kinn, spürte seine Bartstoppeln. Er schlief schlecht in diesen Nächten. Der Stützpunkt stellte ihm ein karges Zimmer zur Verfügung – ein kleiner Schlafraum neben einem Büro. Dort wälzte er sich auf einer harten Matratze, während draußen Wachposten patrouillierten. Er erinnerte sich an ein Gespräch mit einer ehemaligen Informantin, längst vergangen. Sie hatte ihm damals erklärt, dass Symbole manchmal als geheime Erkennungszeichen innerhalb von Einheiten benutzt wurden. Der Bogenschütze – könnte es etwas damit zu tun haben? Eine Gruppe, die sich selbst „die Schützen“ nannte? Oder war es ein rein persönliches Schmuckstück, das Strauch trug, vielleicht ein Geschenk eines Geliebten, einer Geliebten, eines Freundes?
Er suchte nach Soldaten, die für Scharfschützentätigkeiten ausgebildet waren. Die Liste war kurz. Scharfschützen auf dem Stützpunkt gab es nur wenige, und einige waren derzeit abkommandiert. Aber einer war vor Ort: Oberleutnant Marcus D. Behring. Ein Mann mit kühlem Blick, der während der Befragung seltsam abwesend wirkte. Behring war angeblich zur Tatzeit in der Waffenkammer, aber niemand hatte ihn dort gesehen. Kropka merkte sich den Namen.
Er sprach mit Behring erneut, diesmal in einem leeren Korridor zwischen Ausrüstungsräumen. „Karin Strauch ist tot. Sie kann uns nicht mehr sagen, was sie hierhergeführt hat. Aber vielleicht wissen Sie es“, sagte Kropka. Behring zuckte mit den Schultern: „Ich kannte sie kaum. Es tut mir leid.“ Seine Stimme war ruhig, vielleicht zu ruhig. Die Hände locker, kein Zucken im Gesicht. Ein Profi. Kropka wandte sich ab, ohne ein Wort. Er spürte: Der Mann wusste etwas.
In der Kantine traf er später einen älteren Feldwebel, der bei einem Bier – offiziell verboten, aber wen kümmerte das nach Dienstschluss – ein paar Brocken loswurde: „Die Strauch war mal bei einer Übung, in der ein geheimes Szenario durchgespielt wurde. Da gab es angeblich so eine Gruppe, die sich intern ‚die Schützen‘ nannte. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber Gerüchte gibt’s viele. Vielleicht wollte sie auspacken, vielleicht hat sie etwas gefunden, das nicht für ihre Augen bestimmt war.“
Kropka notierte sich das Wort „die Schützen“. Es passte zum Medaillon. Vielleicht eine geheime Zelle? Ein Zirkel von Soldaten, die etwas zu verbergen hatten. Er grub tiefer in den Unterlagen, stieß auf verschlüsselte Hinweise, auf Berichte mit geschwärzten Passagen. Immer wieder tauchte das Bild des Bogenschützen auf. Doch keiner gab offen zu, davon zu wissen.
Es war am dritten Tag nach dem Fund der Leiche, als Kropka beschloss, seiner Intuition zu folgen. Er war ein Mann, der sich sonst an Indizien klammerte, aber in diesem Fall blieb so vieles im Dunkeln, dass er sein Gefühl walten lassen musste. Etwas in ihm sagte, dass Behring eine Schlüsselrolle spielte. Er erzählte niemandem von seinem Verdacht, nicht einmal seinem Kollegen von der Spurensicherung. Er wusste, dass es Lecks geben konnte. Vielleicht waren die „Schützen“ mächtiger, als er ahnte.
Des Nachts, als die Kaserne in einen unruhigen Schlaf fiel, beobachtete er Behring aus der Ferne. Der Oberleutnant schlich aus dem Gebäude, bog hinter die Trainingshallen und verschwand in Richtung des ehemaligen Felsbunkers, der hinter den Schießständen lag. Dieser Bunker stammte aus alten Zeiten, kaum genutzt, düster, feucht, ein Ort, an dem man niemanden finden wollte. Kropka folgte ihm lautlos, trat vorsichtig über feuchten Boden, mied das Licht der Scheinwerfer.
Der Bunker war ein graues Ungetüm, halb in den Hügel gegraben, von Moos und Flechten überzogen. Drinnen war es dunkel, nur schwache Lampen spendeten ein fahles Licht. Kropka lauschte: Schritte hallten, ein Schatten huschte über die Wände. Er zog seinen Dienstrevolver, hielt ihn tief unten, fast versteckt im Mantel. Er wusste nicht, was ihn erwartete, aber er spürte, dass er kurz davor war, etwas aufzudecken, das nicht für seine Augen bestimmt war.
Er fand Behring in einem hinteren Abschnitt des Bunkers, bei alten Munitionskisten. Der Soldat stand mit dem Rücken zu ihm, als würde er auf etwas warten. Kropka trat näher, versteckte sich hinter einer Betonsäule, beobachtete. Plötzlich hörte er Schritte von der anderen Seite. Noch jemand war hier. Eine Gestalt, in Dunkelheit gehüllt, schloss sich Behring an. Sie sprachen leise, übertönt von einem Tropfen, der in einer Ecke des Bunkers von der Decke fiel.
Kropka konnte nicht jedes Wort verstehen, aber er hörte Fetzen: „… musste verschwinden … zu nahe dran … sie hatte das Medaillon …“ Dann Antwort in scharfer Tonlage: „… müssen die Spuren beseitigen … der Kommissar ist auf uns aufmerksam geworden …“ Kropka spürte einen Kälteschauer. Er war hier unbewaffnet in der Überzahl? Nein, er hatte eine Waffe, aber gegen mehrere Gegner stand er schlecht da. Doch er konnte nicht ewig warten.
Er trat vor, die Pistole in der Hand: „Hände hoch! Keine Bewegung, Polizei!“ Das Echo seiner Stimme hallte durch die feuchten Betonwände. Behring fuhr herum, erschrocken. Die andere Gestalt trat einen Schritt ins Licht – ein Hauptfeldwebel, den Kropka tags zuvor befragt hatte, angeblich ein unbescholtener Typ. Beide sahen ihn an, als wäre er ein Eindringling, den es zu beseitigen galt.
Behring hob die Hände nur langsam, ein hämisches Grinsen auf den Lippen: „Ich hatte gehofft, Sie würden kommen, Kommissar.“ Der Hauptfeldwebel machte einen halben Schritt zurück. Kropka war nervös, aber er hielt die Waffe fest: „Was haben Sie mit Karin Strauch zu schaffen? Warum musste sie sterben?“ Behring zuckte mit den Schultern: „Sie war am falschen Ort, hat etwas gesehen, das ihr nicht gehörte. Dieses Medaillon – sie hat es als Warnung entwendet. Wir sind die ‚Schützen‘, Kommissar, und wir dulden keine Neugierigen.“
Der Kommissar war zornig: „Und was ist das für ein Geheimbund? Schmuggelt ihr Waffen, verkauft ihr Informationen, mordet ihr im Auftrag?“ Behring antwortete nicht sofort, stattdessen lachte er leise, und der Hauptfeldwebel war wie versteinert. „Das spielt keine Rolle mehr. Sie sind allein hier, Kropka. Niemand weiß, wo Sie sind. Und Sie wissen jetzt zu viel.“
Kropka wich einen Schritt zurück. Seine Vergangenheit flackerte in seinem Kopf auf wie ein altes Störsignal: dunkle Operationen, zwielichtige Deals, Blut im Matsch eines namenlosen Dorfes. Er hatte einmal geglaubt, das Monster in ihm begraben zu haben. Doch jetzt, in diesem Bunker, umgeben von kaltem Beton und Fäulnis, spürte er, dass er wieder in seiner alten Welt angelangt war – eine Welt, in der Loyalitäten bedeuteten, dass man schwieg oder starb.
Mit einem Ruck griff Behring nach seiner Hüfte. Kropka schrie: „Keine Bewegung!“, aber es war zu spät. Der Mann zog eine Pistole, schnell wie ein Viper Biss. Der Hauptfeldwebel huschte zur Seite, sodass Kropka kurz abgelenkt war. Er feuerte einen Warnschuss, der in die Betonwand einschlug und Funken stoben ließ. Behring lachte, als wäre alles ein Spiel.
„Denken Sie, Sie haben eine Chance?“, fragte Behring, während er mit der Waffe auf Kropka zielte. „Sie sind zu alt dafür, zu müde, zu kaputt.“ Der Kommissar atmete schwer, spürte, wie Schweiß seinen Nacken hinabrollte. Er wusste, es gab kein Entkommen. Er hatte keinen Funkkontakt, keine Verstärkung. Es war seine Schuld, dass er niemanden eingeweiht hatte. Sein Instinkt sagte ihm, er müsse fliehen oder kämpfen, aber wohin?
Der Hauptfeldwebel blieb im Schatten, beobachtete. Behrings Augen glänzten im schwachen Licht wie die eines Raubtiers. Kropka versuchte, das Medaillon in seiner Tasche zu erfühlen, als würde es ihm Kraft geben. „Warum der Bogenschütze?“, fragte er leise, um Zeit zu schinden. Behring lächelte: „Der Schütze trifft immer sein Ziel. Er ist geduldig, er wartet, bis der richtige Moment gekommen ist. Ein Symbol für unsere Gruppe, unsere Methode. Still, zielsicher, lautlos.“
Kropka dachte an Karin Strauch, an ihr verzerrtes Gesicht, an die hoffnungslose Geste, wie sie das Medaillon umklammerte. Sie musste versucht haben, Kropka einen Hinweis zu geben. Jetzt verstand er: Sie wollte ihm sagen, mit wem er es zu tun hatte. Der Schütze – ein Sternzeichen, ein Symbol, eine verschworene Gemeinschaft. Und nun stand er selbst vor dem Tod, allein, umgeben von Mördern.