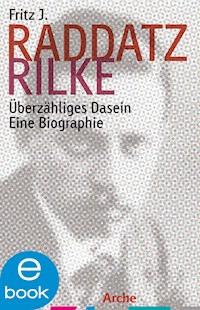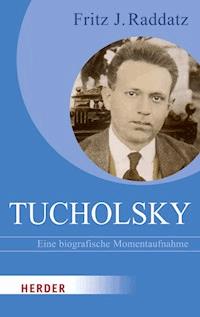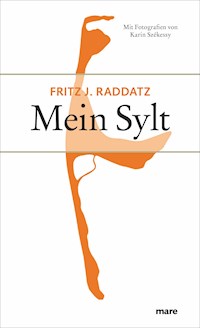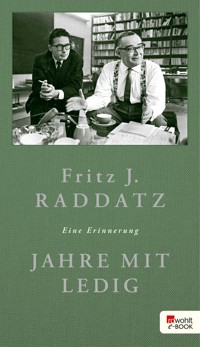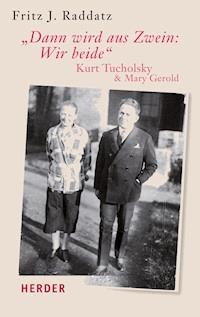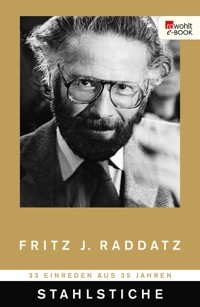
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Glosse und Buchbesprechung, Essay, Portrait und Interview – die Formen, derer sich Fritz J. Raddatz journalistisch bedient, sind so vielfältig wie seine Tonarten und Interessen, und so eröffnet «Stahlstiche» ein Spektrum, in dem sich das ganze 20. Jahrhundert mit seinen Erfahrungen wiederfindet. Politische Ideen, Literatur und Kunst: der Weltkrieg und das Verhältnis der beiden deutschen Staaten, die Rolle Brechts und die Kontroversen um Grass, Apartheid, Pazifismus, Wiedervereinigung ... Aus der Fülle der Themen sind eine Reihe klassischer Zeitungsstücke aus der Glanzzeit des deutschen Feuilletons hervorgegangen, Stücke, wie nur Raddatz sie schreiben konnte. Hat ein anderer Journalist die Wiedervereinigung so begleitet wie er, isoliert innerhalb der Linken, zugleich hellsichtiger im politischen Urteil durch die eigenen Erfahrungen in Ostberlin? Hat ein anderer so entschieden nach zwanzig Jahren moralische Bilanz gezogen? Gibt es noch Interviews wie die, die Fritz J. Raddatz mit Nadine Gordimer oder Alfred Hrdlicka geführt hat? Das Buch faßt Raddatz' publizistische Arbeit aus dreieinhalb Jahrzehnten zusammen und dokumentiert damit eines der großen journalistischen Lebenswerke der Nachkriegszeit. Als solches tritt es neben die 2010 erschienenen, vielfach gefeierten Tagebücher von Fritz J. Raddatz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Fritz J. Raddatz
Stahlstiche
33 Einreden aus 35 Jahren Mit einem Vorwort von Ijoma Mangold
Über dieses Buch
Glosse und Buchbesprechung, Essay, Portrait und Interview – die Formen, derer sich Fritz J. Raddatz journalistisch bedient, sind so vielfältig wie seine Tonarten und Interessen, und so eröffnet «Stahlstiche» ein Spektrum, in dem sich das ganze 20. Jahrhundert mit seinen Erfahrungen wiederfindet. Politische Ideen, Literatur und Kunst: der Weltkrieg und das Verhältnis der beiden deutschen Staaten, die Rolle Brechts und die Kontroversen um Grass, Apartheid, Pazifismus, Wiedervereinigung ... Aus der Fülle der Themen sind eine Reihe klassischer Zeitungsstücke aus der Glanzzeit des deutschen Feuilletons hervorgegangen, Stücke, wie nur Raddatz sie schreiben konnte. Hat ein anderer Journalist die Wiedervereinigung so begleitet wie er, isoliert innerhalb der Linken, zugleich hellsichtiger im politischen Urteil durch die eigenen Erfahrungen in Ostberlin? Hat ein anderer so entschieden nach zwanzig Jahren moralische Bilanz gezogen? Gibt es noch Interviews wie die, die Fritz J. Raddatz mit Nadine Gordimer oder Alfred Hrdlicka geführt hat?
Das Buch faßt Raddatz’ publizistische Arbeit aus dreieinhalb Jahrzehnten zusammen und dokumentiert damit eines der großen journalistischen Lebenswerke der Nachkriegszeit. Als solches tritt es neben die 2010 erschienenen, vielfach gefeierten Tagebücher von Fritz J. Raddatz.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
(Umschlagabbildung: Digne M. Marcovicz, Ullstein Bild)
ISBN 978-3-644-03401-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Kaltnadelradierungen
Warum ich Pazifist bin
Bruder Baader?
Ist Gott Antisemit?
Der rote Teppich
Kindesmißbrauch
Mein Tod gehört mir
Panoramen
Mein Versagen als Bürger der DDR
Deutschland, bleiche Mutter
Eiserner Vorhang, kalte Zeit
Geh doch rüber!
Sozialistischer Feudalismus
Tucholsky, in Ost und West zensiert
Prosa als Fahrkarte ins Gefängnis
Koeppen tief im Sumpf
Klerikale Beißer
Widerständler war ja jeder
Im Land des Zwinkerns
Der Kalte Krieg ist ausgekämpft
Die linke Krücke Hoffnung
Die zage Gabe der Liebe
Kassiber
Hinterglasmalerei. Erzählbilder
Erzählbild Brecht
«Ich bitte Helli, folgendes zu veranlassen»
Entwurf zu einem Menschen
Schwierigkeiten beim Sprechen der Wahrheit
Das große Weib Welt
Vervielfachung und Kühle
Erzählbild Grass
Erfolgs- und Skandalautor
Ein Mann, der den Zierat nicht braucht
Scham und Schande
«Ich habe mich verführen lassen»
Ein behutsamer Freund
Fazit am Abend
Portraits
Sex bei offenem Fenster
Prophet des Zeitgeistes
Höllenritt und Totentanz
Theologe des Verbrechens
Ich bin von allem ein Teil – und nehme Anteil an nichts
Weihnachten gingen wir zu Brecht
Er war eine Fackel
Der Mann
Das Werk
Das Leben
Über Rolf Hochhuth
Zynismus ist nie das letzte Wort
Der falsche Feind
Der andere Hochhuth
«Ich lehne mich auf, darum bin ich»
Chronist der Epoche
Für Christa Wolf
Der Tod einer Instanz
Über Stephan Hermlin
Der Mann ohne Goldhelm
Zeuge und Zeugnis
Ein Fest fürs Leben
Spiegelbilder
«Ich bin nicht liberal – ich bin radikal»
«Ich bin über mich tief enttäuscht»
«Ich bin keine Amerikanerin»
«Schreiben ist Leben»
«Kunst beruht auf der Angst vor dem Tod»
Personenregister
Vorwort
Als Fritz J. Raddatz 2003 mit seinem Erinnerungsbuch «Unruhestifter» auf Lesereise war, bin ich ihm das erste Mal begegnet. Es war im Restaurant des Münchner Literaturhauses nach seiner Lesung. Ich wurde ihm vorgestellt, und damit er, der gut gelaunt war und geradezu in Fahrt, sich ein Bild von dem jungen Literaturkritiker, der sein Tischnachbar war, machen konnte, fragte er mich: «Was war Ihr letzter Verriß?» Seine Augen funkelten dabei, und die Frage stand im Raum wie ein guter Aufschlag beim Tennis, aus dem sich alle weiteren Bewegungen wie von selbst ergeben.
Doch die Frage irritierte mich. Nicht etwa, weil mir mein letzter Verriß nicht einfallen wollte, sondern weil ich das Gefühl hatte, daß meine Antwort nie jene Höhe erreichen würde, auf die Raddatz’ Frage zielte. «Was war ihr letzter Verriß?», meinte ja nichts anderes als: An einem Verriß zeigt sich der ganze Mensch! Der Verriß ist nicht einfach eine Textsorte, die mehr oder minder virtuos ins mediale Rauschen eingespeist wird, den Leser amüsiert und den Autor vor erlittener Ungerechtigkeit aufstöhnen läßt, sondern er ist eine Regierungserklärung, ein Machtanspruch, ein Fehdehandschuh, eine Selbstoffenbarung und eine Selbstinszenierung zugleich, ein Manifest, das die geistige Welt dazu zwingen will, alles, was sie bisher für wahr und richtig gehalten hat, in einem neuen Licht zu sehen.
Natürlich schrieb ein Literaturkritiker auch im Jahr 2003 noch Verrisse, doch waren sie, meinte ich, schon lange nicht mehr jene amtliche Erkennungsmelodie, mit der sich ein Kritiker in der Umlaufbahn der großen Fixsterne des literarisch-kulturellen Universums positionierte – und zwar, weil es ein solches Fixstern-Universum nicht mehr gibt. Raddatz’ Autorität, sein Glanz, ja sein Glamour hingegen speisen sich aus dem unbeirrbaren Willen, an dieses Fixstern-Universum zu glauben. Raddatz ist auf eine geradezu übermenschlich gesunde Art immun gegen die hochinfektiöse Krankheit des Relativismus. Seine ganze geistige Lebensform, das Flamboyante, das Virtuose, das Ballerinenhafte und auch das Hochmögende, setzen einen Kosmos voraus, in dem ein Name wie Jean Genet als Erkennungszeichen, ein Name wie Susan Sontag als Respekt einflößende Einschüchterungsformel funktioniert. Solche intellektuellen Stichwortgeber und exemplarischen geistigen Existenzen sind der Goldstandard, zu ihnen mag man sich kontrovers positionieren, aber an ihrer Relevanz, ihrer geradezu physikalischen Sonnenhaftigkeit besteht kein Zweifel. Es gibt bei Raddatz immer wieder – vor allem in seinen einzigartigen Tagebüchern – Töne der Niedergeschlagenheit, der Melancholie, ja der umfassenden Lebensenttäuschung, aber nie ergreift ihn die Resignation, der Gegenstand seiner Leidenschaft, die Literatur, sei womöglich nur ein Glasperlenspiel und nicht der Nabel der Welt.
Jede Sache ist so wichtig, wie man sie nimmt. Raddatz’ Vitalität, sein Enthusiasmus und sein Spieltrieb waren immer so groß, daß unter seinen Händen die Literatur nie klein geworden ist. Noch sein im vergangenen Jahr veröffentlichtes «Bestiarium der deutschen Literatur» legt davon Zeugnis ab: Natürlich ist es ein großer Spaß, wie Raddatz da die Literaten der deutschen Gegenwartsliteratur von Rang beschreibt, als wären sie zoologische Arten mit charakteristischen Eigenschaften, was ihr Beuteschema, ihre Täuschungsstrategien und ihr Reproduktionsverhalten betrifft. Doch liegt diesem Spaß die ernste Überzeugung zugrunde, daß jede wahrhafte Schriftstellerexistenz zugleich so individuell wie allgemein gültig ist, daß sie es verdient, in den Rang einer zoologischen Art erhoben zu werden.
Das ist bei Raddatz ein höchst produktives Wechselverhältnis: Die Literatur ist ganz selbstverständlich der gesellschaftliche Leitdiskurs, und daraus leitet sich ebenso selbstverständlich das Selbstbewußtsein des Kritikers ab. Das vorliegende Buch versammelt feuilletonistische und literaturkritische Texte aus fünf Jahrzehnten. Raddatz portraitiert Schriftsteller von Flaubert bis Faulkner, von Böll bis Hermlin. Er interviewt Nadine Gordimer und Arthur Miller. Er schlägt sich mit der deutschen Zeitgeschichte herum, wenn er Thomas Manns berühmte Selbstbefragung «Bruder Hitler» während des deutschen Herbstes als «Bruder Baader» neu auflegt. Er wehrt sich nach dem Mauerfall mit heißem Herzen gegen die linke Skandalisierung der bevorstehenden Wiedervereinigung und fragt mit unkokett entblößter Brust nach seinem eigenen Versagen, als Bürger der DDR in den fünfziger Jahren nicht mehr Mut bewiesen zu haben. Aber all den Texten gemeinsam ist die unangefochtene Autorität, die die Namen der Schriftsteller von Brecht bis Grass, von Sartre bis Susan Sontag als zentrale Referenzgrößen der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung ausstrahlen.
Raddatz pflegt mit der Literatur einen Umgang wie mit alten Freunden, die man in- und auswendig kennt, auf die man stolz, aber auch eifersüchtig ist, mit denen einen viele gemeinsame Abenteuer verbinden, von denen man manches Geheimnis kennt und viele Briefe aufbewahrt hat. Ob die Autoren noch leben oder schon tot sind, ändert dabei nichts an ihrer intellektuellen wie emotionalen Zeitgenossenschaft. Sie sind Familie. Und so, wie Raddatz über sie schreibt, sind sie nicht nur für ihn Familie, sondern für alle, die im Wirbel der Geschichte und der Geschichten suchende und irrende Menschen sind. In ihren Macken und Mickrigkeiten, in ihren Idealen und Größenphantasien erkennen wir unsere eigenen Impulse wieder. Wir sind opportunistisch wie Johannes R. Becher, wir sind romantische Alkoholiker wie William Faulkner, egoistische Frauenausbeuter wie Brecht, schwule Verbrecher (zumindest in unseren erhabenen Träumen) wie Genet und große Selbstbetrüger wie am Ende fast alle von Sartre bis Hermlin. Sämtliche Modelle des sittlichen wie des unsittlichen, des kleinen wie des großen Lebens kommen für Raddatz fast naturgemäß aus der Literatur. Deshalb gibt es in seinen Texten nie den Tonfall der Gleichgültigkeit oder Indifferenz, aber auch nicht den der Angst vor Desinteresse oder mangelnder Relevanz.
Diese Selbstverständlichkeit macht mich staunen. Um sie beneide ich ihn. Vermutlich wird er mein Staunen nicht verstehen. Als er einst Feuilletonchef der ZEIT war, sprach man andächtig vom «Raddatz-Feuilleton». Ich glaube, im Kern muss damit ein völliges Fehlen kleinmütiger Selbstmarginalisierung gemeint gewesen sein; die Überzeugungskraft, ohne Anfechtungen an die Allgemeingültigkeit des Fixstern-Universums zu glauben. Wie realistisch oder unrealistisch das ist, ist nicht kampfentscheidend. Im Zweifel besteht Größe gerade in der feurigen Ignoranz aller realistischen Relativierungen.
Und es stimmt: Wenn man auf die Haltbarkeit von Namen schaut, schneiden die Dichter und Denker in the long run weitaus besser ab als die Global Player und Strippenzieher der Macht und wer sonst noch auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten um Aufmerksamkeit ringt. «Name und Werk von Schiller oder Picasso oder Grass sind vorhanden», schreibt Raddatz. «Wie hießen die Richter von Oscar Wilde? Wer hat Victor Hugo ins Exil getrieben, und wer nennt die Namen derer, die Thomas Mann nicht – keine Silbe, kein Wort – aus der Emigration heimriefen? Der Atem der Geschichte hat ihre Namen gelöscht wie der Wind Spuren im Sand.» Und einmal warmgelaufen, ruft Raddatz aus: «Ich plädiere für ein Aufkündigen der Bescheidenheit.» Konkret wehrt sich Raddatz in diesem Text gegen die kleinmütigen Realpolitiker, die als «Hiwis der Macht» vor der Wiedervereinigung warnen, weil diese das Mächtegleichgewicht des Kalten Kriegs durcheinanderbringen könnte. Tatsächlich aber atmen seine Sätze eine Grundsätzlichkeit, mit der der Feuilletonist allen konkurrierenden Weltmächten ins Stammbuch schreibt, wo sub specie aeternitatis der Hammer des Ruhms hängt.
Die sechziger und siebziger Jahre, in denen Raddatz zu großer Form auflief, mögen links und bilderstürmerisch gewesen sein, sie waren aber gerade dort, wo sie sich an bildungsbürgerlichen Werten abarbeiteten, eben auch noch dies: bildungsbürgerlich, schriftgläubig. Mit jedem Klassiker, den man vom Sockel riß, wurde von Walter Benjamin bis Herbert Marcuse ein neuer Säulenheiliger inauguriert. Das war die ideale Bühne für Fritz J. Raddatz’ Doppelnatur: rebellisch und kultiviert, extravagant und gebildet, kulinarisch und intellektuell, mondän und ein Bücherwurm, Sylt und Ostberlin.
Und doch erklären die Zeitumstände allein nicht die Behauptungskraft, von der seine Texte getragen werden. Ich glaube, sie kommt daher, daß es sich nur auf den ersten Blick um Literaturkritiken oder Feuilletondebattenbeiträge handelt, im innersten Kern aber um Liebesgeständnisse. Daher die Kraft, der tollkühne Übermut, daher die Hitze des Gefechts wie die Anhänglichkeit der Erinnerung. Da liebt einer und will selber geliebt werden. Da will sich einer im Namen der Literatur öffnen und hofft auf die Offenheit derer, die er so hingebungsvoll liest. Raddatz kann polemisch sein, hochfahrend, schneidend und selbstverliebt, aber die Sehnsuchtstonlage, die sein Schreiben sucht, ist die Zärtlichkeit. Dorthin zu gelangen, wo jeder Mensch verletzlich ist. Schönheit und Wahrheit werden von Raddatz so ernstgenommen, weil er überzeugt ist, daß sich im Schönen und Wahren Wege öffnen zur Zartheit der Menschen.
In seinem Nachruf auf den Maler Paul Wunderlich schreibt er: «Manchen war ich sehr nahe wie James Baldwin oder Günter Grass oder Alberto Moravia. Geliebt habe ich diesen einen.» Um Nähe geht es ihm immer – in seinen großen Interviews wie in seinen Portraits. Und an solcher Nähe will er als Dritten den Leser teilhaben lassen, als hätte die Nähe und die Zartheit die Kraft, die ganze Welt zu verwandeln. In einem der schönsten Stücke dieses Bandes erzählt Raddatz die verrückte, obsessive Affäre, die William Faulkner mit dem Hollywood-Scriptgirl Meta hatte, die aber nie mehr als eine Affäre werden konnte, weil Faulkner die Tatkraft oder die Gewissenlosigkeit nicht hatte, seine Frau – ein Lebenswrack – und sein Kind zu verlassen. Da spricht Raddatz von Faulkners «kindlich-unstillbarem Bedürfnis nach Zärtlichkeit» – und man merkt sofort, wie nah er den Worten seines Protagonisten ist. «Zwischen Gram und Nichts entscheide ich mich für den Gram», heißt es in Faulkners «Wilden Palmen». Das wäre auch Raddatz’ Präferenz, der die sublime Schwäche liebt, weil sie seine Gabe des Erbarmens zuallererst zum Zuge kommen läßt.
Wie anders sieht das bei Brecht aus, der Raddatz ein Leben lang begleitet, ohne daß je Nähe aufkäme, stets nur Faszination.
Und das große Weib Welt, das sich lachend gibt
Dem, der sich zermalmen lässt von ihren Knien
Gab ihm einige Ekstase, die er liebt
Aber Baal starb nicht: Er sah nur hin.
Raddatz resümiert die Brecht-Haltung so: «Es gilt wohl für beide Lebensbereiche – die ästhetische Summe hieß dann ‹gestisch› –, für Erotik wie Revolution: Er sah nur hin.» Für Raddatz gilt das nicht: Seine Texte künden von seiner Bereitschaft, mehr als nur hinzuschauen, sich vielmehr gern von den Knien des «Weibes Welt» zermalmen zu lassen. Seine irritierte Bewunderung für Brecht hat mit dessen Kälte- und Distanz-Habitus zu tun, den Raddatz’ untaktisch überfließendes Herz nicht kennt. «Es ist eine Prosa», schreibt Raddatz über Brechts Tagebücher, «wie Eisblumen, zu deren Entstehen es bekanntlich einiger Kälte bedarf. Und die, kommt man ihnen zu nahe, zerstört werden.» Die Eisblume ist nicht Raddatz’ ästhetisches Ideal. Er schätzt die Artistik, aber noch mehr liebt er die Nähe.
Fasziniert lauscht Raddatz Ruth Berlau, die davon berichtet, wie Brecht versucht, sie gegen die Risiken des Enttäuscht-Werdens zu impfen: «Als ich einmal über einen Menschen sehr enttäuscht war, weil er nicht hielt, was wir uns von ihm versprochen hatten, nahm Brecht einen Bleistift und zeichnete mir auf: Von einem Menschen kannst du zum Beispiel so viel erwarten, von einem anderen so viel und einem dritten nur so viel. Du darfst nie beleidigt oder enttäuscht sein, wenn deine Vorstellungen nicht erfüllt werden. Dann hast du Vorurteile gehabt.» Doch diese emotionale Sicherheitsschranke, wie sie Brechts Klugheitslehre anrät, hat Raddatz nie besessen, das kann man auf jeder Seite seiner Tagebücher überprüfen. Immer wollte er sich Freunden und Kollegen verschenken, immer blieb er enttäuscht, daß so wenig zurückkam, nie wurde er klüger, nie verhärtete er sich.
Ein Bild von Fritz J. Raddatz wäre allerdings unvollständig, wenn man nicht auch seiner durchaus hechelnden Liebe zu Frau Welt Erwähnung täte. Jenes rauschhafte Verfügen über die Luxusgüter der Welt, wie es das Geld ermöglicht, jenes Vergnügen am Tratsch, der einer Gesellschaft gilt, auf deren Festen man sich zumindest zeitweilig im Mittelpunkt wähnen darf, jenes kennerhafte Bescheidwissen über die Geheimtipps des gehobenen Geschmacks – das alles erhitzt Raddatz zu sehr, als daß er seine Hingabe an die Welt erfolgreich camouflieren könnte. Zwar macht er sich, der sich zum Adel des Geistes zählt, mit gebotenem Spott lustig über die mondänen Statussymbole, aber es ist dabei ein Überschuß des Bescheidwissens, der den heimlich Liebenden verrät: «Wir sind ja nun alle so schrecklich kosmopolitisch und wissen: Der Martini im Rainbow Room des Rockefeller-Center ist der beste, die Kacheln an dieser einen Pforte von Fez die schönsten, und wer in Harry’s Bar in Venedig oben statt unten zum Essen plaziert wird, muss sich erschießen.» Er kann das so locker schreiben, weil er keinen Anlaß hat, sich erschießen zu müssen. Schmallippige Protestanten ohne Festkultur kennt der deutsche Kulturbetrieb genug. In diesem Umfeld war Raddatz’ verspielter Snobismus schon fast so etwas wie sexuelle Befreiung: «Das Hübsche girrt auf den Laufstegen dieser Welt, schwankender Boden der Leichtfertigkeit.» O ja!
Doch ist seine Lust an der Weltlichkeit immer überschattet von einer Melancholie, die den Kern seiner kulturellen Existenz ausmacht: die niederschmetternde Erkenntnis, daß es die falsche Welt ist, weil die wahre Welt nach 1933 ins Exil vertrieben wurde und nie wieder heimkehrte. Kein Motiv wird man darum in diesen Texten so häufig finden wie Raddatz’ Wut über ein Deutschland, das kein Gespür für seine Verluste hatte und den Emigranten keinen roten Teppich ausbreitete, der sie zur Heimkehr hätte bewegen können. Das ist Raddatz’ größter Liebesverlust. Was bleibt, ist Lion Feuchtwangers Haus in Kalifornien, ein Museum jener Welt von gestern, in der sich Fritz J. Raddatz, wäre sie nicht 1933 zu Ende gegangen, ganz gewiß wie ein Fisch im Wasser bewegt hätte.
Ijoma Mangold
Kaltnadelradierungen
Warum ich Pazifist bin
Die erste Waffe war ein russisches Bajonett mit eingesägten Scharten, sie hatte ihm den einen Lungenflügel zerrissen; sie lag mit den vom nie gereinigten Metall aufgesogenen Blutflecken in einem bestimmten Fach des Schreibtischs, zusammen mit anderen Kriegserinnerungen («den Iwan habe ich mit meiner Pistole erledigt»), und wurde dem Sohn – man nannte das wohl preußische Erziehung – bei besonderen Anlässen gezeigt; Mitternacht hatte ich ihm noch den blutigen Schaum von den Lippen gewischt, morgens um fünf war er tot, und ich band mit einem Küchentuch den heruntergeklappten Kiefer hoch: mein Vater. Da war ich dreizehn.
Die zweite Waffe war eine ertrunkene Panzerfaust. Am Morgen zuvor hatte ich mit einem blauen Emailleeimer Wasser aus dem Feuerlöschteich im Park geholt, um den die kleinen Bürgerhäuser der Siedlung gruppiert waren; in dem ausbetonierten Teich schwammen, mittendrin wie ein sinnloser Quirl, die Panzerfaust, die aufgedunsenen Leichen zweier deutscher Soldaten, die hatten das Gymnasium schräg gegenüber verteidigt, in dem ich nichts gelernt hatte. Mit dem Teichwasser wurde Gerstensaft gekocht. Und die Suppe aus einem Stück Pferd, daran noch das braune, lockige Fell haftete – es war gerade fertig mit dem Sterben, als wir es mit dem Taschenmesser zerfetzten.
Die dritte Waffe war eigentlich die erste, Angst hatte sie aus der Erinnerung verdrängt: Phosphor. Der hatte den mittäglichen Frühlingshimmel über Berlins Innenstadt erst schwarz gemacht in kurzen Minuten; dann, in langen Stunden, brannte die Stadt in so rasendem Feuer, daß der Asphalt schmolz. Ich steckte – mitten auf der Friedrichstraße – in einem saugenden Moor, konnte mich nicht retten vor den Flammen rechts und links, die gegeneinanderschossen in einem von sich selber entfachten Kaminzug. Niemand hörte mein Schreien – oder doch? Eine fremde Frau hatte über meinen Kopf mit versengten Haaren, Brauen, Wimpern eine nasse Decke geworfen. Da war ich elf – und das erste Mal betrunken in meinem Leben.
Die vierte Waffe hatte ich im Mund, jene Ewigkeit lang, die es dauert, bis drei Rotarmisten fünf Frauen vergewaltigt haben; einer hielt mir den Lauf seiner Pistole in den Hals, damit ich schön still hielt beim Zusehen. Da war ich immer noch dreizehn, und einen Sexualkundeunterricht brauchte ich nun nicht mehr.
Die fünfte Waffe stand im Garten unseres zerbombten Hauses; mit ihr feuerten unter trunkenem «Gitläh-kaputt»-Gegröle Sowjetsoldaten vierundzwanzig Stunden ohne Unterlaß ins Zentrum, auf die Reichskanzlei – wo sich der Verbrecher gerade trauen ließ. Das entsetzliche, jaulende Geräusch machte mir solches Grauen, daß ich mich unter den Koksberg im Keller verkroch. Diese Waffe hieß «Stalinorgel» – es waren die ersten Raketengeschosse – und die Logik, daß sie ja nicht mich treffen konnten, half meiner Angst nicht.
Wie mir heute, ziemlich viel älter und vielleicht ein bißchen weniger dumm, auch die Logik nicht hilft zu verstehen, daß eine Waffe, die Neutronenbombe heißt, eine Atombombe sei, die keine Atombombe ist.
Ich will diese sechste Waffe nicht, gar keine.
Haben wir denn vergessen, was hinter uns liegt? Die Leiber, das Elend, die Mütter ohne Fassung und die Frauen ohne Männer? Haben wir das alles aufgespult und weggelegt wie den Ferienfilm aus Mallorca oder die Beatles-Kassette? Riecht denn das niemand mehr – diese von heißem Eisen bittere Luft, diesen süßlichen Gestank, hervorquellend aus Schutt und Mörtel und Asche? Hört das niemand mehr – das Schreien der Zwanzigjährigen ohne Beine, das Wimmern der Frauen mit dem erfrorenen Kind auf dem Arm? Sieht das denn niemand mehr – den Arm ohne den Menschen dran unter den Trümmern von Dresden, den Elendstreck von Millionen quer durch Europa? Sind denn unsere Tiefkühltruhen für das Gedächtnis unserer Seelen gebaut, und ist das Wort Klarsicht reserviert für die Verpackung von Hühnerbrüsten?
Ich weiß – man wird sagen: emotional, irrational, irreal; unsere Politiker können ja so gut Latein. Und wenn eben noch das Wort Sympathisant – kommt es nicht von mitleiden? – das Schimpfwort der Saison war, dann ist es jetzt der Pazifist. Diese Denunziation hat für mich dieselbe Überzeugungskraft, mit der vor allem jene Leute zum Gürtel-enger-Schnallen aufrufen, um deren wohlbeleibt-pensionsberechtigte Bäuche nun aber auch gar kein Gürtel mehr paßt. Warum sollen wir eigentlich den Herren mit den prall gefüllten Hosenträgern glauben? Die «Kohlenklau»-Rufer saßen auch immer schön warm.
Die Verweigerung gegen ein «Vernunft»-Argument ist nicht zwangsläufig vernunftlos; es gibt auch eine Kraft des Nicht-Vernünftigen. Man stelle sich vor, wie viel Leid unserem Jahrhundert erspart, wie viel Millionen Menschen am Leben geblieben wären durch eine einzige winzige Tat: wenn alle Mütter und Frauen ihre Söhne und Männer einfach nicht hätten ziehen lassen. Unsere Welt sähe anders aus.
«Das geht nicht» – ich höre es schon. Aber wer sagt das? Die, die uns jetzt Europa mit neuen Höllenmaschinen vollstellen wollen, ein Kontinent als Raketen-U-Boot vor Anker? Wieso müssen wir deren Logik glauben, denen, für die dies hier zu «persönlich» gesprochen ist, weil man ja nur noch MIRV und SALT und MX und SS-20 stottern darf?
Die härtere Abwehr heißt dann meist: «Das ist Literatur.» Das haben sie einst auch zu Jean-Jacques Rousseau gesagt – doch seine utopischen, so «unrealistischen» Worte, und nicht die von Generälen oder Bürokraten, prägten der Welt damals freiheitlichste Verfassung: die der jungen Vereinigten Staaten von Amerika. Das hätten sie wohl auch zu einem gesagt, der vor fast zweitausend Jahren geboren wurde – «das läuft nicht» – und an den sie sich erinnern einmal im Jahr mit einem Glitzern im Auge und kleinen Päckchen in der Hand. An diesem einen Abend schweigen ja auch die Waffen – eine Obszönität wie das Wort von der humanen Bombe?
Sich oder andere daran zu erinnern, ist nicht aufgeschminkte Frömmigkeit noch Mißbrauch tief eingesetzter Werte; weit über die Bergpredigt hinaus. Insofern ist es kein Zufall, daß ein deutscher Dichter, dem wir die schönsten Antikriegsgedichte dieses Jahrhunderts verdanken, seine Tradition in dieser «Literatur» sah. Auf die Frage, welches für ihn das wichtigste Buch der Welt sei, antwortete Bertolt Brecht: «Die Bibel».
DIE ZEIT, 42/9. 10. 1981
Bruder Baader?
Redlich wünsche ich diesem öffentlichen Vorkommnis einen Untergang in Schanden … Der Bursche ist eine Katastrophe; das ist kein Grund, ihn als Charakter und Schicksal nicht interessant zu finden.
THOMAS MANN, «Bruder Hitler»
Hier soll nicht soziologischer Kaffeesatz gelesen, nicht zu Schalmeienklang rechtsherum getanzt werden, nicht «Archipel Buback» auf Fähnchen gestickt, die im linken Wind flattern; sondern von Menschen wird gesprochen. Bisher hat niemand versucht – niemand gewagt? –, an Gemeinsamkeiten zu erinnern mit einem von denen, die «über den Fluß gegangen» sind. Eine Nation hat den Kopf in den Sand gesteckt, hat sich nicht erinnern wollen – weder an die eigene Geschichte noch an die Personen.
Ein Doppelsalto, der schließlich mit gebrochenem Rückgrat und Paralyse endet; denn sich erinnern, das ist eine moralische Kategorie. Damit eine politische. Und sei es nur im Hinzeigen, wie selten die beiden Begriffe zusammengehen. Sich erinnern, das heißt nach Gemeinsamkeiten forschen. Durchaus im Sinne jenes heiklen Essays von Thomas Mann.
Seltsam doch: Erst wenn einer der schießenden Desperados in Haft war, erfuhr man von einer Mutter, einem Bruder, einer Geliebten, einem Freund. Nie vorher. Identifizierung muß nicht immer den Fingerabdruck meinen, sondern das Forschen nach Gemeinsamem; nur daraus kann die wahre Absage kommen, das trauervoll schneidende Nein, überzeugender als alle Deklamationen. Sympathein heißt nämlich nicht in erster Linie «innerlich billigen», heißt in seiner Grundbedeutung erst einmal «mitfühlen». Also das Gegenteil jener Peinlichkeit auf halbmast wehender Mercedes-Fahnen. Automobilfabriken sollten bilanzieren, nicht flaggen, halbmast schon gar nicht. Eine Firma kann nicht trauern. Aber ein Mensch. Emphase, Teilnahme, Urteil: Das ist nur möglich, wenn Erbarmungslosigkeit sich nicht in der Aburteilung eines einzelnen erschöpft, sondern zum Beurteilen einer Gesellschaft führt. Die Frage bleibt letztlich: Ist die Gesellschaft schuld?
Es ist die entscheidende Frage. Sie muß beantwortet werden. Der Terrorist, der den Bankier Ponto erschoß, ist so gut Produkt dieser Gesellschaft wie der Bankier Ponto. Auch Fehlentwicklungen sind Entwicklungen. So töricht es ist, jedes legasthenische Kind als «Versagen der Gesellschaft» vorzuführen, so ohne Moral und Verantwortung ist es, ihr ersichtliches Versagen hinwegzumogeln.
80000 drogenabhängige Jugendliche. 82000 Jugendliche ohne Arbeitsplatz. 300000 Jugendliche zwischen 14 und 29 Jahren alkoholgefährdet. Die höchste Rate an Kinderselbstmorden in Westeuropa (500 jährlich). Die höchste Rate an stellungslosen Akademikern in Europa (etwa 40000), 40 Prozent der Studenten in psychiatrischer Behandlung. Die niedrigste Rate von studierenden Arbeiterkindern in Europa (13 Prozent) – und das alles soll keine Folgen haben? Und das alles, dieser Rostfraß unter dem Lack der Produktgesellschaft, soll nicht Ursache sein? Jeder neunte Jugendliche in der Bundesrepublik lehnt das bestehende Gesellschaftssystem ab, und einer, der es wissen muß, der Ex-Terrorist Hans-Joachim Klein, dokumentiert: «Ich weiß von Siebzehn- und Achtzehnjährigen, die würden heute am liebsten ein Inserat in der FAZ aufgeben, um eine Knarre zu kriegen und in den Terror einzusteigen.»
Die sich da zu Tode fixen (84 allein im Jahr 1977 in Berlin); die sich da zu Tode trinken; die da schließlich andere totschießen – mit denen haben wir alle nichts zu tun? Unterwelt, Abschaum, Ratten? Auch wenn es unsere Söhne und Töchter sind, die die saturierten Vorstadthäuschen verlassen haben, ins Nirgendwohin?
Hier ist zweierlei zu sagen. Wer diese Gebärde der Wegwerfgesellschaft zur Verfügung hat, der handelt unmoralisch. Menschen sind keine Einwegflaschen. Dem liegt eine verborgene Erbarmungslosigkeit zugrunde.
Es liegt aber noch etwas anderes zugrunde, das vielleicht Schlimmere, kaum mehr verborgen: die gänzliche Unfähigkeit, analytisch zu denken, simpelste kausale Abfolgen zu erkennen. Das betrifft auch – oder gerade – die, bei denen ständige winzige Verletzungen des Menschlichen eines Tages das Unmenschliche hervorrufen. Wo die Titelzeile «Kennedy erschossen» garniert ist mit «Kein Schälen, kein Schneiden, keine Tränen! – Thomys Röst-Zwiebeln»; wo das Foto vom Mord an einem Vietcong garniert wird mit sekttrinkender Fürstenhochzeit und BMW-Reklame; wo das Wort «Dichtkunst» in ganzseitigen Anzeigen nur noch im Zusammenhang sanitärer Abdichtungen und das Wort «revolutionär» für Schrankwände verwendet wird; wo Mannequin-Passagiere der «Landshut» eine Woche nach Mogadischu ihre läppischen «Erinnerungen» pfennigweise verkaufen – da muß doch, leise, langsam, unmerkbar erst, eine Verbiegung von Wahrnehmungen, ein Zerklirren von Werten stattfinden. Wie mühelos ließe sich eine Anthologie der ekelhaftesten «Gedankenlosigkeiten» zusammenstellen, Bilder verhungerter Kinder neben Kaviarreklame und Aufnahmen der Vergifteten von Seveso neben Chemiewerbung. In Wahrheit gibt es, bei wachen Aufnahmeapparaturen, keinen Tag ohne Schock. Schock heißt Angst. Angst heißt Haß.
Unserer bürgerlichen Welt begegnet eine ganze Generation in dieser Schock-Angst-Haß-Mischung. «Diese Menschen leben nur noch körperlich anwesend», hieß es kürzlich in einem höchst eindrucksvollen Aufsatz. Sie leben in einem anderen Staat – wenn wir Glück haben: abgekapselt von der Wirklichkeit in einer selbsterrichteten Kunstwelt, eine Hohn- und Ekelmeile legend zwischen sich und das, was für sie alles dasselbe ist; Waschmittelwerbung oder Kanzlerinterview. Wer je erlebt hat, mit welch gleichgültiger Selbstverständlichkeit oder feixender Verachtung der Fernseher abgedreht wird in einer Runde dieser jungen Leute, der weiß, wie recht Nobert Klugmann mit dem erwähnten Artikel in der «Frankfurter Rundschau» hat:
Richtig ist: Von hier droht kein Bombenwurf; Entführungen werden nicht geplant, Molotow-Cocktails nicht gebastelt. Aber: Von hier wird dem Staat und seinen Repräsentanten in unheimlich schweigender Manier der Prozeß gemacht, wird ihm seine Berechtigung abgesprochen, weiterhin in unerträglich penetranter Weise das alles umfassende Gemeinwohl für sich zu reklamieren. Der Zug ist schon abgefahren: Es gibt heute einen Staat im Staat. Einen anarchistischen, völlig gewaltlosen, unverbundenen Zusammenhang in Großstädten, schwächer bis sehr schwach in der Provinz (aber das wird noch werden), der praktisch nicht mehr angreifbar (= unansprechbar) ist. Dieser Staat begeht keine Rechtsbrüche (ich hüte mich, die wenigen idyllischen zu nennen), er nimmt auch kaum Rauschgifte zu sich, und wenn, dann des Staates Lieblingsgift Alkohol. Dieser Staat im Staat wird nie eine Organisation haben, eine Führung schon gar nicht. Womit auch die vordergründige – zugegeben naheliegende – Assoziation vom Staat im Staat als einem funktionierenden, irgendeinem gewohnten Zweck nutzbar zu machenden Ratio-Gegenstand ad absurdum geführt wäre. Der Ausdruck Staat im Staat soll lediglich ein (Aus-)Maß an Abschottung ausdrücken.
Sie sehen sich als eine Generation «Gewähr bei Fuß». Eine Million von ihnen wurde als Bewerber für den öffentlichen Dienst überprüft; 285 Periodika, für die sie sich interessieren – vom «Argument» über das «Kursbuch» bis zur «Sozialistischen Zeitschrift für Kunst und Gesellschaft» –, wurden auf Schnüffellisten des Verfassungsschutzes festgehalten; 239 ihrer Bünde und Organisationen ebenso – von «Amnesty International» bis zum «Werkkreis Literatur der Arbeitswelt». Nach der Schleyer-Entführung – keine deutsche Zeitung, lediglich die «New York Times» nannte ihn «a once hated SS-man» – wurde jeder von ihnen – jeder zwischen 20 und 30 –, der nach Frankreich fuhr, überwacht; selbst Mitglieder der Jungen Union. Gewiß das am besten geeignete Mittel, Trauer und Abscheu angesichts eines Ermordeten zu erzeugen. Die gräßliche Schnippischkeit des Berliner Witzes «Andreas und Gudrun heiraten – einen Schleyer haben sie schon» ist das dünnste Resultat. Die Einführung des Wortes «Berufsverbot» ins Umgangsenglisch und -französisch ein anderes. Selbst die nicht direkt linkslastige «Financial Times» schreibt: «Westdeutschland leidet an einem leichten Anfall von Autoritarismus.»
Die Liste der Vergehen, derer man diesen Staat anzuklagen hat, wäre lang – von der untersagten Carl-von-Ossietzky-Namensgebung für eine deutsche Universität (gleichsam ein zweites Todesurteil für den pazifistischen Schriftsteller) bis zum entlassenen linken Armeekoch, eine Farce, die selbst Conrad Ahlers fragen läßt: «Hat er zu oft rote Bete serviert?» Nur gefriert einem das Witzeln; wer von kritischen Geistern als von «Ratten und Schmeißfliegen» spricht – Ungeziefer, das man gemeinhin mit Gas ausrottet –, der ist nicht mehr zu bespötteln. Darunter liegt eine deutsche Sehnsucht nach Katastrophe und Untergang, die ihn mit derselben Intensität herbeibeschwört, wie sie Demokratie als das normale Miteinander von Gegensätzen nicht versteht, also zugrunde verteidigt.
Vakuum des historischen Bewußtseins ist immer auch Vakuum der Moral. Das ist beweisbar bis ins winzigste Detail von Redeweisen: Wer von «Zusammenbruch» spricht, ist das Ende der Hitler-Herrschaft gemeint, der bedauert etwas. Zusammenbruch ist nichts Herbeigewünschtes, gar selber Herbeigeführtes. Zusammenbruch ist erlittene Naturkatastrophe.
Heute liest sich das so: «Bald ist es soweit! Die Neue Partei wird gegründet. Sie soll NSPD, Nationalsozialistische Partei Deutschlands, heißen. Noch werden echte Mitbegründer mit Nationalstolz gesucht!» Das ist kein Witz. Das steht, zwischen der Einladung der Kant-Gesellschaft und «scharfen Attraktionen hübscher Girls», am 18. Januar 1978 als Annonce in der «Mainzer Allgemeinen Zeitung». (Die Partei wurde am 28. Januar 1978 in Oberwesel am Rhein gegründet.) Kein Witz, keine Ausnahme. Im selben Frühjahr werden im Eisstadion von Berlin-Wilmersdorf Hakenkreuz-Anstecknadeln verkauft; wird das DKP-Kreiszentrum mit hakenkreuzverziertem Aufkleber «Kauft nicht bei Juden» beklebt; liest man eine Annonce «An Sammler: Adolf-Hitler-Büste, 190 mm hoch, für 250 DM abzugeben»; meldete der «Tagesspiegel»: «Vom Eisernen Kreuz über NSDAP-Parteiabzeichen bis hin zum Ritterkreuz zum Preis von 365 DM, all das bot ein privater Händler auf der 4. Internationalen Sammlerbörse am Funkturm am Wochenende an. Nachdem er am Sonnabend über acht Stunden lang unbehelligt sein umfangreiches Sortiment verkauft hatte, wurde die Börsenleitung auf ihn aufmerksam, die seinen Tisch räumen ließ»; meldete der «Kölner Stadtanzeiger»: «Tyra Reichsgräfin Klenau von Klenova und Arnhard Reichsgraf Klenau von Klenova hatten in einer Versteigerung ein paar hübsche Dinge anzubieten: eine Sturmfahne in der frühen Form, komplett mit Stange und Fahnenspitze, aus dem Sturm 11 der Standarte 40 für 1300 Mark; eine ‹Kinderpuppe in SA-Uniform› für 150 Mark; zwei ‹SA-Trommeln› für 120 Mark oder den ‹Dienstdolch M 33› komplett mit ‹Scheide und Gehänge› für 400 Mark»; konnte der Westberliner Filmproduzent Brauner von einer Party berichten, auf der zwei Damen Hakenkreuze als Halsschmuck – eines davon mit Diamanten besetzt – trugen; erschien als «Sonderausgabe zum 89. Geburtstag des Führers» der «Völkische Beobachter», runengeschmückt, mit der Balkenüberschrift «Botschafter der arischen Rasse Adolf Hitler».
Das kriecht wieder hervor und wimmelt und regt sich. Fast wöchentlich muß man Überschriften in der liberalen bürgerlichen Presse lesen: «Neonazis haben ihr Waffenarsenal gefüllt», «Gewaltverherrlichung neonazistischer Gruppen», «Mit Braunhemd und deutschem Gruß», «Alte Nazis werden umschwärmt», «Nazi-Literatur und Hitler-Symbole offen gehandelt». Der Londoner «Observer» faßt das zusammen, am 26. Februar 1978: «Germanys new Nazis come into the open.»
Die kritiklose Geschwindigkeit, mit der ein unverdauter, in Schnellkochkursen angerührter Instant-Marxismus eingeschlürft wurde, und die schneller, schärfer werdende Rechtspirouette: sie haben eine Wurzel. Das Wort «Sinngebung» mag heikel sein; doch die Tatsache ist nicht hinwegzuretuschieren, daß einer neuen Generation, die nichts kennt als unsere Demokratie, deren Sinn und Wert nicht vermittelt wurde. Junge Menschen sind empfindlich gegen Lüge und Obszönität – ob es nun die kläglichen Winkelzüge des Marinerichters Filbinger oder die PS-Sehnsüchte des eigenen bürgerlichen Elternhauses sind oder Alfred Dreggers Satz: «Ich gebe mich mit dem Quatsch der Umfragen nicht ab – ich möchte vor allem regieren.» Wo Ideale nicht geboten werden, greift man zu Idolen: im Glücksfall Elvis oder die Beatles; im Mißverständnis Mao oder Che; im schlimmsten Fall Hitler.
Weil diese Gesellschaft monologisch statt dialogisch strukturiert ist, hat sie eine Generation aus dem Gespräch entlassen, sich der Möglichkeit zur Aussprache begeben. Ob RAF, Tunix oder Wikingerbund: Haben wir das Recht, den Stab zu brechen? Ich habe kürzlich in einer Illustrierten zwei Seiten von Fotos junger Leute gesehen, die mit Berufsverboten belegt sind: Es sah aus, exakt, wie die Fahndungsliste von morgen. Wenn diese Gesellschaft keine anderen politischen Angebote machen kann als die an Schüler, beim Verfassungsschutz mitzuarbeiten, an Studenten, vor geschlossenen Numerus-clausus-Türen zu stehen, und an Lehrer, arbeitslos zu sein – wer von uns könnte da aufrichtig von sich sagen, er gehörte nicht vielleicht auch auf eine solche Fotoliste der Verbotenen oder Gesuchten? Hat sich jeder von uns geprüft, wie er als junger Mensch reagiert hätte auf diese Welt von lächelndem Eis und samtenem Gift, die Angebot mit Sortiment verwechselt und Fragen mit Nachfrage, ein flimmerndes Riesenrad, dahinrasend zwischen Unbarmherzigkeit, Sentimentalität und Gnadenlosigkeit?
Die Väter dieses Staates sind es, die ihn zu unterwühlen beginnen. Sie ertragen nicht Zweifel an sich noch an der von ihnen gezimmerten Gesellschaft – und sie begreifen nicht, daß unterdrückter Zweifel zu Verzweiflung gerinnt. Sie haben einmal ihr Lied gesungen vom Weitermarschieren, bis alles in Trümmer fällt; nun sie die herbeigesungenen Trümmer beseitigt haben, ergreift sie Panik vor Unordnung, die ihrem Leben den Sinn nähme; denn Gesetz und Ordnung, wie sie sie begreifen, ist ihre Sinngebung. Sie haben das große Falsche in ihrem Leben einmal «bewältigt» – also nicht, weil sie nicht einmal die Wortwurzel «Gewalt» in diesem Vorgang entdeckten. Noch einmal wollen sie nicht unrecht haben, und wenn man wieder «bewältigt», damit dem Recht zu seinem Recht verholfen wird. Die jüngste deutsche Geschichte war ja ein Unfall, nicht etwa interpretierbare, erklärbare, schuldhafte Entwicklung. Gegen Unfälle hilft eine Lebensversicherung. Man vergißt, daß dies eines der probaten bürgerlichen Zudeckworte ist – die sichert ja nicht das Leben, sondern wird ausgezahlt nach dem Tode. So wird die Police zur Polizei. Sie gilt nun als die große Lebensversicherung, und der übermächtige Glaube an sie macht aus einem zu überwachenden Staat einen Überwachungsstaat. Geschichtliche Prozesse so kartographieren zu wollen, gleicht dem Weltverständnis der ersten Geographie-Mönche des Mittelalters. Wie jene schreiben nun diese über die ihnen unzugänglichen, unerforschlichen Gebiete: Hic sunt leones.
DIE ZEIT, 42/13. 10. 1978
Ist Gott Antisemit?
Der Papst war also in Auschwitz. Benedikt XVI. – vormals Kardinal Joseph Ratzinger – trug dort ein Gebet vor, das sich eher wie eine Rede liest. Keine gute.
Schon die im Ganzen drei Mal wiederholte Formulierung, er sei «ein Sohn des deutschen Volkes», schmeckt nach Festzeltansprache. Wie das? Ist er nicht Sohn eines Vaters und einer Mutter? Wie geht das, «Sohn» eines «Volkes» zu sein? Bereits mit dieser Intonierung beginnt die Schwammigkeit – Zuweisung zu schwer definierbaren, möglichst anonymen Gemeinschaften; war er dann auch der Sohn von Mördern und Verbrechern, von Tätern? Genau die Antwort auf diese Frage aber delegiert der Papst: bereits zu Beginn seiner Ansprache, die irgendeine diffus benannte Clique haftbar macht, erteilt er eine Reinwaschung, die keinem politisch-historischen Forschungsergebnis und keiner moralischen Prüfung standhält; da heißt es: «Ich stehe hier als Sohn des deutschen Volkes … als Sohn des Volkes, über das eine Schar von Verbrechern mit lügnerischen Versprechungen, mit der Verheißung der Größe, des Wiedererstehens der Ehre der Nation und ihrer Bedeutung, mit der Verheißung des Wohlergehens und auch mit Terror und Einschüchterung Macht gewonnen hatte, so daß unser Volk zum Instrument ihrer Wut des Zerstörens und des Herrschens gebraucht und mißbraucht werden könnte.»
Das ist nicht wahr. Das ist pure Geschichtsklitterung. Da exekutierte nicht nur eine «Schar» – im Sprachgebrauch also eine kleine Gruppe. Es waren vielmehr willfährige Millionen, darunter unzählige Christen, die den Gewaltapparat bedienten, allein in und für die Metzelmaschine Auschwitz viele Vieltausende – die Waggons der Reichsbahn beluden sich ja nicht von selbst, sie hielten an Bahnhöfen vor Zeugen und Mittätern, die Weichen wurden nicht automatisch gestellt, und kein Zug mit den vor Angst halb Irren, mit den verdreckten halb Verhungerten ward von allein entladen. Die Geschichtsforschung gibt längst Auskunft über die riesige Heerschar der Mittäter, von den sich prügelnden Nachbarn; ging es um das geraubte Hab und Gut, das vor aller Augen und in jedermanns Hände versteigert wurde, über die grausigen Mordkommandos von Hitlers Armee, ja: bis zu den applaudierenden und denunzierenden katholischen Würdenträgern: slowakische, kroatische, polnische – aber auch deutsche und französische.
Die Mitschuld der christlichen Kirchen ist inzwischen einwandfrei nachgewiesen und dokumentiert, und Daniel Goldhagen hat mit seiner (prompt gescholtenen) Intervention vollkommen recht, wenn er anmahnt: «Ausführlich rätselte Benedikt, wo Gott damals gewesen sei. Die Frage eines Kirchenmannes. Auffällig dagegen sein Versagen, danach zu fragen, wo denn die Kirche damals war. Benedikts Verweis auf die Rätselhaftigkeit von Gottes Wegen verschleierte so noch die meistdiskutierten Aspekte des Verhaltens von Kirche und Papst während des Holocaust: Warum sie ihre Stimme nicht erhoben. Warum sie nicht mehr taten, um den Juden zu helfen. Mit solchen Ausflüchten und Verdrehungen kommt ein moralischer Führer seiner moralischen Verantwortung nicht nach, von der moralischen Verpflichtung der Kirche zu Reue und Wiedergutmachung ganz zu schweigen.»
Die Worte des Papstes waren nicht nobel noch anständig, noch wahrhaftig. Die Hauptfrage, mehrfach gestellt, heißt: «Wo war Gott?» Benedikt XVI. umschlingert sie, mehr schlau als hehr. Er spricht von Gott («dem wir glauben») als einem Gott der Vernunft, als einem Gott, «der selbst in die Hölle des Leidens abgestiegen» sei. Wann? Wo? In Auschwitz? Und warum hat dieser Gott das Massaker gerade an den Juden beschwiegen, geschehen lassen? So fahrlässig formuliert ist der Glaube eine klingende Schelle. Denn keineswegs war es eine schwer benennbare Anzahl «Unschuldige», die ausgerottet werden sollten und wurden. Von den 1,1 Millionen Auschwitz-Opfern war 1 Million jüdisch. Alle durch die Hand einiger von «einer Schar» Mißgeleiteter gemeuchelt? Gab es nicht Wurzeln? Das Wort Antisemitismus kommt bei den 2300 Wörtern des redenden Gebets nicht vor. Also gab es keinen christlichen, kirchlichen, katholischen Antisemitismus. Das hat den schalen Beigeschmack der Schläue.
Nun ist der Herr Ratzinger keine Dumpfbacke; vielmehr hochintelligent. Folglich fügt er den bewegenden Psalm 44 ein, das Flehen der zum Untergang Geweihten: «Du hast uns verstoßen an den Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis … Um deinetwillen werden wir getreten Tag für Tag, behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Wach auf, warum schläfst du, Herr?»
Doch der Papst, in hartnäckiger Schönschreiberei, verweigert auch nur den Versuch einer Antwort; geschweige denn – was seine Vorgänger durchaus taten – ein Schuldeingeständnis. So wird eine Todesfabrik ins Unbegreifbare weggeschunkelt. Das ist Frömmelei-Geschwätz, Soutanen-Salbaderei. Jeder Vater, der seinen Sohn ohne Beine aus Vietnam zurückbekam; jede Mutter im Kongo, die ihren toten Kindersoldaten beweint; jeder Bruder, dessen Nächster in Tel Avivs Schnellrestaurant von einem Selbstmordattentäter zerfetzt wurde, fragt: «Wo war Gott?» Wer auf dem Stuhle Petri sitzt, hat die Pflicht, diese Frage nicht hinter weihrauchverhangenen Phrasen verschwinden zu lassen: Er muß sich – für uns – des Themas annehmen, ob es einen bösen Gott gibt, einen abweisenden und abwesenden Rachegott; ob da ein Gott ist, der ein ganzes Volk – das jüdische – seit Jahrtausenden ins Elend verstoßen hat, in Not, Tod und Untergang. Der Papst hat versagt; er hat sich ins Huldvolle zu retten versucht – nicht einmal den Begriff «Sünde» (immerhin von den französischen Bischöfen 1977 eingestanden) hat er gefunden. Hat Gott auch versagt? Ist er ohne Huld?
«DAS PLATEAU», 2. 10. 2006
Der rote Teppich
Was eigentlich sind «militärische Ehren»? Es werden etwa verdiente Politiker mit «militärischen Ehren» beigesetzt; andere – allzu oft weniger verdiente – mit «militärischen Ehren» empfangen. Nicht nur Bundespräsident Köhler schritt bei seinem ersten Auslandsbesuch an einem Spalier zirkusreif ausstaffierter Polen entlang, possierlich anzuschauen in weißen Gamaschen, weißen Handschühchen und Patronentaschen aus weißem Lackleder, wie er seinerseits am 10. November 2005 den chinesischen Präsidenten, der viele ICE-Züge kaufen will, mit «militärischen Ehren» empfing; auch Papst Benedikt XVI. wurde bei seinem Köln-Besuch am 18. August 2005 von einer Ehrenkompanie empfangen, der Hirte der guten Seelen, dem der italienische Kulturminister Rocco Buttiglione bescheinigte «Der Papst hält jeden Krieg für falsch»; er ließ sich von Uniformierten begrüßen, die zum Töten erzogen werden – ein Wunder, daß er nicht noch die Waffen segnete.
Haben Soldaten also eine andere Ehre als Schornsteinfeger, Autohändler oder Romanschriftsteller? Worin bestünde sie dann? Oder verleihen sie – Toten und Lebendigen – eine Ehre, die anderen Menschen nicht gebührt, recte: abgesprochen wird? Sind es nur diese wie einst Hotelpagen geschmückten Operettensoldaten, gerne verwendet man Matrosen dazu, die diese besondere Ehre haben und weiterreichen – und ölverschmierte Panzerfahrer oder die ja auch recht adretten Piloten nicht? Und was tun die eigentlich, wenn sie nicht diesen albernen roten Teppich säumen, auf dem dann ernsten Gesichts der ehemalige Geheimdienstmann Putin entlangschreitet oder ein in dramatische Gewänder gehüllter Potentat aus Afrika? Verrichten die schmucken jungen Burschen tagsüber Kasernendienst in Waschräumen, unter defekten Lkw oder in der schwitzigen Mannschaftskantine? Fragen wird man ja mal dürfen. Vielleicht sind es – auf unsere, der Steuerzahler, Kosten – geheimnisumwitterte Eliteeinheiten, die Tag und Nacht, wenn sie nicht gerade «das Gewehr über» paradieren müssen, unentwegt ihre Handschuhe waschen, ihre Gamaschen bügeln, ihre schneeweißen Koppel wichsen und sich jene starre Kopfhaltung antrainieren lassen, die sie zu Puppen eines längst vergangenen Kults machen.
Nun hat es gewiß seine aparte Komik, trifft die Queen of England in Berlin ein, wo sie mit 30 Kammerzofen, Büglerinnen, Make-up-Damen und Ankleidedomestiken ein bis zwei Etagen im Hotel Adlon belegt. Das hat immerhin noch den Charme ihrer kühnen Hüte in gewagtesten Bonbon-Farben, und die begrüßenden Böllerschüsse (was übrigens ist ein Böller?) auf dem Flugplatz Tegel sind das ferne Echo einer ehemaligen Großmacht, die mit Karossen-Ritual, Krone und Hermelin noch immer so tut, als ob. Eine leere, aber lustige Winke-winke-Zeremonie, ein Museum mit der Eigenart, daß die Bilder sich bewegen; außer der berühmten Handtasche, in der nichts ist – kein Hausschlüssel, keine Kreditkarte, keine Puderdose: wird die auf den Tisch gestellt, sind Essen, Festreden und Gespräch – sogar das über Pferde – beendet, und man hat zu gehen. Ein possierliches Märchen unter dem Motto «Es war einmal …».
Doch der Genosse Putin, der Mr. Bush, der dubiose Signor Berlusconi, der Teleprompter-erfahrene Herr Köhler? Das sind doch unsere Angestellten, nichts anderes! Sie sind Gehaltsempfänger mit Dienstwagen wie jeder FAZ-Redakteur. Sie sind weder gesalbt noch gebenedeit, nicht erwählt, sondern (auf Zeit) gewählt. Ich kann vor dem vielfachen Lügner Herbert Wehner nicht mehr Respekt aufbringen als vor Paul Celan. Aber jene – Wehner u.a. – werden per Staatsbegräbnis geehrt.
Sie haben keine andere Ehre als wir (manche mögen Verdienste haben; die hat ein Chirurg auch) – und es gebührt ihnen keine andere Ehre, kein anderer Respekt als der Krankenschwester oder dem Opernregisseur. Sie tragen oft große Verantwortung, gewiß, und der Unterschied der Entscheidung, ob man sein Land an einem Krieg teilnehmen läßt oder ob man das im Fernsehen lediglich kommentiert – der sei gerne zugegeben. Aber das ist ihr Job, sie haben sich darum beworben, niemand wird gezwungen, Außenminister oder Kanzler(in) zu werden – und sie werden dafür ordentlich bezahlt. Basta.
Die bigotte Ufa-Film-Staffage dieser neckisch herausgeputzten Oberkellner mit Flinte statt der Weinkarte ist auf ärgerliche Weise überflüssig. Es ist gleichsam ein historischer Blinddarm: Würde er entfernt, der Organismus des Staates fiele nicht zusammen.
«DAS PLATEAU», 93/1. 2. 2006
Kindesmißbrauch
Das Wort bereits würgt einen im Halse. Selten sind sich wohl alle Menschen so einig in ihrem Abscheu vor einer Untat – im Wald, in der Garage, auf des Onkels Sofa – wie im Fall der Schändung eines Kindes; gleich, ob Mädchen oder Junge.
Zugleich aber werden wir täglich «Tatzeuge» geldgierigen Verschacherns von Kindern, deren Eltern sich ganz offenbar nicht schämen: in der Fernsehwerbung nämlich. Es gibt buchstäblich so gut wie kein Produkt, für das nicht ein niedlich gelocktes Kind Werbung macht: ob die fürsorgende Hausfrau im Fleischerfachgeschäft die Ware prüft, Baby im Arm; ob die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften für sich – «klotzen, nicht kleckern» – werben, indem ein Herzchen mit Bauklötzen spielt; ob für Renault-Autos (bekanntlich besonders geeignet für Kinder), Yoghurt oder Hohes C: Es ist allemal ein «O-Gott-wie-süß»-Schnäuzchen, das irgendein pfiffiger Werbefachmann uns so reizend ins Wohnzimmer schickt. Ein beschmierter Kindermund vor Knorrs Fertiggerichten wird in diesem ekelhaften Kinderhandel ebenso (auf Litfaßsäulen) eingesetzt wie ein scheinbar sehr frühreifes Wesen, das bereits für die Postbank zu werben hat (aber, natürlich, gar nicht weiß und wissen kann, was eine Bank ist). Egal, egal – eine mächtige Industrie schert sich nicht um diesen Kinderhandel, benutzt ihn vielmehr. Wo die Nackte auf dem Kühler des flotten neuen Cabrios vielleicht ihre Reize schon verbraucht hat – da ist die liebe Kleine für den Melitta-Kaffee noch allemal «frisch». Iglo-Gemüse, Jacobs-Kaffee, Disc-Kekse – es scheut sich keine Firma vor dieser Kinderpornographie. Denn das genau ist es; die offenbar ungebremste Gier nach Geld ist ebenso rücksichtslos wie manch Kranker, der kaum weiß, was er tut. Diese aber wissen, was sie tun: die Hand aufhalten.
Viele profitieren doch wohl davon, ob nun dieser abgehalfterte Blondlockenkopf, der den Mißbrauchten seine Haribo-Süßigkeiten in den Mund quasselt – oder Vatern und Muttern, die ohne Anstand ihr Kind verscherbeln. Sie wollen alle eine neue Waschmaschine oder einen Flachbildfernsehapparat: Folglich schicken sie die Winzlinge auf den Werbe-Strich; und kassieren. Es gibt ja inzwischen seriöse Untersuchungen darüber, wie Kinder schon sehr früh in einer mit Marken vollgestopften Welt leben, wie die Unternehmen vor allem die Eltern benutzen, um das Verhalten der künftigen Konsumenten zu prägen. Da fängt man halt so früh es geht an; wer so putzig-patschig nach den Spaghetti patscht oder Vati noch rasch vom Gartentor zuwinkt, braust der mit dem neuen Wagen los: der ist schon gewonnen für die Warenwelt. Wenn neuerdings ein «Kinderfrühwarnsystem» eingerichtet werden soll, um Unheil, Verwahrlosung und Gewalt abzuwenden – dann sollte vorher erst einmal ein «Elternfrühwarnsystem» installiert werden für jene, die ihre Kleinen auf dem Markt schamlos verkaufen; die Patschhändchen sind an der Lockschnur von Grapschhänden.
Allenthalben wird über die «Verwahrlosung der öffentlichen Verantwortung» geklagt, daß «Vater Staat» seine Kinder im Stich lasse. Aber was einmal aus diesen zu Possierlichkeitsmaschinchen gedrillten Kleinen werden soll – das fragt sich offenbar niemand. Man darf sich das einmal vorstellen, wie es in so einem Atelier des jeweiligen Werbefotografen zugeht – sehen die Eltern eigentlich dabei zu? –, wie die Kinder, «und nun noch einmal lächeln», kujoniert werden, «leck doch noch mal an dem Eis» oder «Du mußt tüchtig mit dem Löffel um den Mund herumschmieren»: diese Kommando-Hübschheit, worüber bereits laufstegmüde Models klagen; Filmschauspieler ohnehin, die 32mal denselben Take drehen müssen. Doch das sind halbwegs erwachsene Menschen, so hält sich unser Mitleid in Grenzen.
Hier aber werden noch ganz kleine Seelen zermanscht in einer Profitmaschinerie – sie können ja Wirklichkeit und Gaukelei noch nicht auseinanderhalten. Es ist kein Geheimnis, daß viele Kinder glauben, Kühe seien lila – das suggeriert ihnen irgendeine Schokoladenwerbung. Inzwischen müssen sie gleichsam selber die Kuh lila anmalen; damit Mutti am nächsten Tag ihre Freundin anrufen kann: «War unser Schatz nicht goldig?» Und damit Vati die Dukaten zählen darf. Es ist ein Vergehen. Brutalität läßt sich nicht ausschließlich an blauen Flecken verprügelter Vierjähriger erkennen. Es gibt auch diese Form der Züchtigung. Und niemand schreitet ein. Was soll nicht alles verboten werden – das Rauchen im Restaurant, das Rauchen im Auto, wenn Kinder mitfahren, das Autofahren ohne Winterreifen, ein Kopftuch oder ein silbernes Kreuzchen an der Halskette; bald wird uns der Staat die Form der Brillen und die Farbe der Oberhemden vorschreiben. Aber gefilmte Obszönität wird tagtäglich zum Schlabbern ausgeboten; denn obszön ist nicht, was zwei Erwachsene im Schlafzimmer (oder anderswo) miteinander tun. Obszön ist, sich an Wehrlosen zu vergreifen und zu behaupten, es mache ihnen ja so viel Spaß. Es ist der glitschige Weg vom Kommunismus zum Konsumismus. «Die Revolution frißt ihre Kinder» hieß einmal ein wichtiges politisches Buch. Band II könnte heißen «Der Kapitalismus frißt seine Kinder».
«DAS PLATEAU», 1. 12. 2006
Mein Tod gehört mir
Es ist die verklebte Bürgerlichkeit, gegen die ich mich verwahre. Goethes Selbstmörderbestseller «Werther» ist Schullektüre so gut wie Schillers «Kabale und Liebe» oder Fontanes ergreifende Novelle «Schach von Wuthenow»; mit frischer Dauerwelle und wohlgekleidet applaudiert man in der Oper der Selbstmörderin «Tosca»; ehrfurchtsvoll sieht der Museumsbesucher die Werke von Kirchner oder Rothko, die sich töteten; einer der bedeutendsten deutschen Literaturpreise heißt nach Heinrich von Kleist, der sich erschoß; weder war Ernest Hemingway unheilbar erkrankt, noch litt Jean Améry an Krebs – sie wollten nicht mehr leben, wie Wladimir Majakowski, Yukio Mishima oder Virginia Woolf: pars pro toto Repräsentanten unserer Kultur, akzeptiert in ihrem Schicksal wie gepriesen für ihr Werk. Jeder von ihnen aber nahm «Sterbehilfe» in Anspruch, ob Gift, Pistole oder Samurai-Schwert. Die – auch von Matthias Kamann in seinem Artikel «Die Leichtfertigkeit der Sterbehelfer» in der «Welt» vom 24. März 2012 – vorgeführte, ja: anempfohlene Doppelmoral ist zutiefst verstörend. Als der bedeutende Literaturwissenschaftler Hans Mayer mit dem Satz «Es ist genug» beschloß zu sterben, wurde ihm – er verweigerte Nahrung und Flüssigkeit – selbstverständlich geholfen; alle Eingeweihten wissen, wer ihm nobel zur Seite stand. Auch Hannelore Kohl starb nicht an Schokoladenpudding – selbstverständlich hatte sie einen «Sterbehelfer», der ihr die Präparate besorgte und sie einwies, wie sie das tödliche Mittel per Strohhalm zu sich nehmen mußte. All diesen, von mir ob ihres letzten Mutes bewunderten Menschen zollte die Öffentlichkeit verdienten Respekt. Selbst dem Illustrierten-illustren Gunter Sachs – doch die Pistole, mit der er seinem Leben ein Ende setzte, hatte er gewiß nicht bei Amazon bestellt. Er muß einen «Sterbehelfer» gehabt haben. Meinetwegen mögen sie «Beschaffer» heißen. Als der dieser Tage anläßlich seines 85. Geburtstags zu Recht hochgepriesene Martin Walser jüngst öffentlich eingestand, er werde sich, «wenn es so weit ist, in Zürich einen anständigen Tod besorgen» (recte: kaufen) – da erhob sich keineswegs ein Sturm der Entrüstung.
Da haben wir also nicht nur eine Zweiklassenmedizin, sondern sollen uns offenbar an einen Zweiklassentod gewöhnen. Der Millionär von Brauchitsch «darf» sich in der Schweiz sein freiwilliges Ende «kaufen» wie die «Bundesliga-Legende» Timo Konietzka; diese Sterbehilfe wird – bedauernd – akzeptiert. Es gilt offensichtlich eine stillschweigende gesellschaftliche Übereinkunft. Aber muß man ein reicher Industrieller, ein bekannter Fußballsportler, eine Politikergattin, ein berühmter Schriftsteller sein, um die ansonsten inkriminierte aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu dürfen? Die dürfen – sie müssen nicht Aids noch Krebs, noch multiple Sklerose haben – nach freiem Entschluß ihrem Leben ein Ende setzen? Und der Briefträger, der Kfz-Schlosser, der Maurer – die haben sich gefälligst von der Brücke zu stürzen? Ich meine mich nicht falsch zu erinnern: Marilyn Monroe hatte kein von Hautkrebs unheilbar entstelltes Gesicht; doch eine Welt behält sie in trauernd-enthusiastischem Gedächtnis.
Wer bestimmt da, was jemand wann und auf welche Weise «darf»? Der Staat? Ich spreche dem Staat rundweg jegliches Recht dazu ab. Ich bin niemandes Eigentum.
Der Staat hat mir mein Leben nicht gegeben, er hat von mir keinen Auftrag, über das Ende zu wachen. Es ist das alte deutsche Mißverständnis, der Staat und seine Vollzugsbeamten seien höhere Wesen. In Wahrheit ist es umgekehrt: Bis hinauf ins höchste Amt sind sie meine Angestellten (und die von ca. 80 Millionen Bürgern), wir bezahlen sie. Ob Bundeskanzler(in), Minister oder, Gott bewahre, die spesengefütterten EU-Beamten in Brüssel – sie haben in meinem Leben, auch meinem Lebensende, nichts zu suchen. Ich bin kein Untertan. Doch nach wie vor herrscht da eine Verducktheit. Mühelos könnte ich ein Dutzend mir bekannte Menschen nennen – «Prominente» wie sogenannte «Normalbürger» –, die sagen: «Wenn es so weit ist, finde ich hoffentlich einen verständnisvollen Arzt, der …»
So ein Arzt wäre aber kein Cocteauscher Todesengel, wozu ihn unausgesprochen der Journalist Kamann macht. Auch der ehemalige Hamburger Innensenator Dr. Roger Kusch – den der Aufsatz kriminalisiert – ist das nicht. Ich kenne mehrere durchaus reflektierte Publikationen von ihm, nicht zuletzt seine ernste Auseinandersetzung mit dem (wohl unverdächtigen?) katholischen Moraltheologen Hans Küng. Der hat die Debatte auf ein beachtliches und verantwortliches Niveau gehoben; in seinem mit Walter Jens gemeinsam verfaßten Buch «Menschenwürdig sterben» heißt es gleich eingangs: «Dabei hilft es in keiner Weise, wenn man besonders in Deutschland schon die vernünftige Diskussion darüber mit dem Hinweis auf die Nazi-Zeit tabuisiert und alle, die hier differenziert zu argumentieren suchen, in die Nähe der Nazi-Mörder rückt» – um dann fortzufahren: «Selbstbestimmung meint nicht Willkür, sondern Gewissensentscheidung! … Das Recht auf Weiterleben ist keine Pflicht zum Weiterleben, das Lebensrecht kein Lebenszwang.»
Küng wäre kein Theologe, wenn er uns nicht daran erinnerte, daß «selbst der erste König Israels, Saul, in seinem Königtum gescheitert und von seinen Feinden besiegt, sich schließlich in sein eigenes Schwert stürzte». Kein Mißverständnis: Hans Küng ist kein Propagandist der aktiven Sterbehilfe; eher ein Verteidiger der passiven – sei sie vom Arzt aus Barmherzigkeit gewährt, sei sie aus (selbstverständlich nicht kommerzieller) erbetener Hilfe geleistet. Der Salzburger Philosoph und Theologe Emmanuel J. Bauer hat auf ähnliche Weise über die Würde nachgedacht, die auch dem Menschen zusteht, der seinen Lebensbogen aus ganz individuellen Gründen für ausgeschritten hält: Man möge ihn nach seinem festen und freien Willen gehen lassen.
Summa: Weder theologisch noch philosophisch, noch juristisch (dieser Aspekt wird ja auch in den Niederlanden anders berücksichtigt) kann es hier eine reine Lehre geben. Es ist wohl das zutiefst existentielle Problem, dem wir Menschen ausgesetzt sind. Doch Verbotstafeln helfen am allerwenigsten. Sie sind inhuman.
«Die Welt», 4. 4. 2012
Panoramen
Mein Versagen als Bürger der DDR
Ein Essay der kritischen Selbstbetrachtung
Kürzlich schickte mir ein Freund aus Berlin eine Ansichtskarte; sie zeigt ein Gemäuer mit der Unterschrift «Bunker. Aus der Folge ‹Facade›». Es sollte wohl eines jener «ulkigen» Plaste-und-Elaste-Erinnerungsstücke sein, mittels deren man sich – ob Trabi oder Spreewälder Gurken – die DDR gern zu kommoder Lächerlichkeit zurechtfeixt. Jedoch: Dieser graue Beton-Bunker war alles andere als komisch. Er war – die Fenster mit Brettern vernagelt, schräge, ein Luftloch nach oben – in den 50er Jahren ein Stasi-Gefängnis; da saßen in gräßlichen Zellen unter anderem politische Häftlinge.
In diesen Jahren – 1950 bis 1958 – lebte ich in Ostberlin. Wir alle gingen, abendlich gekleidet, an diesem Bunker vorbei zu den berühmten Brecht-Premieren des Berliner Ensembles, das damals im Deutschen Theater in der Schumannstraße gastierte, zum nicht geringen Mißvergnügen des Intendanten Wolfgang Langhoff; denn das Theater am Schiffbauerdamm wurde Brecht ja erst 1954 zugesprochen. Alle Stephan Hermlins, Hans Mayers, Herbert Iherings flanierten in festlicher Stimmung zur «Mutter Courage» oder zum «Kreidekreis» an dem finsteren Elends-Klotz vorbei, bereit zu Kunstgenuß und Applaus.
Wir? Ich. Hier soll nicht die Rede sein von anderen, sondern von mir. Was geschah da in einem, der sein Wissen – also doch wohl: Gewissen – abgab wie den Mantel an der Theatergarderobe? Ich berichte so gerne und gar nicht unstolz davon, daß ich 1950 aus freien Stücken von Westberlin (wo ich 1949 Abitur gemacht hatte) nach Ostberlin umzog, nach despektierlichen Auftritten mit roter Nelke im Knopfloch am Askanischen Gymnasium in Berlin-Tempelhof und frechen Reden im RIAS-Schülerparlament. Ich attestiere mir das Motiv «Widerwille gegen Adenauer-Deutschland», und es ist ja wahr, daß diese deutsche Hälfte durchsetzt war von Ex-Nazis und geprägt von restaurativer Kulturdumpfheit. Doch das ist ein anderes Thema – nicht das meinige hier. Gut, ich war jung, noch nicht zwanzig – doch Jugend allein ist keine Qualität an sich, und man bleibt auch nicht immer zwanzig. Bald war ich nicht nur älter, Student der Humboldt-Universität und schon Lektor im zweitgrößten belletristischen Verlag der DDR, Volk und Welt, sehr bald war ich sogar dessen stellvertretender Cheflektor. Also durchaus Teil des Apparats, durchaus mit Privilegien – eigene Wohnung, Mitglied des Kulturbund-Clubs wie des Presse-Clubs, wo die Nomenklatura markenfrei recht gut aß.
Und ich wußte. Keineswegs kann ich mich in die angenehme Mär einspinnen, ich hätte immer nur Herder oder Aragon gelesen, Oistrach gehört und den Pergamon-Altar besichtigt. Im Gegensatz nämlich zu meinen späteren Kollegen bei Rowohlt oder in der ZEIT-Redaktion habe ich damals schon Arthur Koestlers «Sonnenfinsternis» gelesen, André Gides «Zurück aus Sowjetrußland» oder Essays von Ignazio Silone. Man konnte damals ungehindert nach Westberlin fahren, Bücher und Zeitschriften kaufen oder leihen, Filme und Theaterstücke sehen. Was ich alles reichlich und häufig tat. Aber in meinem Kopf muß eine Art Filter gewesen sein: ich nahm das alles wahr, wohl auch für wahr; aber ich ließ es nicht in mich ein. «Der Monat», der fraglos wichtige Texte publizierte, war, wenn nicht «der Feind», dann doch «ungültig»; es galten «Les Lettres Françaises», die von Louis Aragon allerdings glänzend inszenierte kommunistische Kulturzeitschrift.
Wie funktionierte das? Hatte jener Filter einen kleinen Schalter, mit dem man einfallendes Licht ausknipste? Die Wahrheit ist kruder. Ich log mir etwas vor. Im Sinne von Margret Boveris «Wir lügen alle» – auf eine andere Diktatur bezogen – lebte und arbeitete ich als «anständiger Lügner». Im hochgemuten Selbstbewußtsein, nicht Mitglied der SED zu sein – ein veritabler «Sonderfall» für die vergleichsweise hohe Position –, tat ich genau das, was ich Jahre später (und bis heute) den großen Furtwänglers und Gründgens’ wie den kleinen Mitarbeitern am «Reich» vorgehalten habe: ich «schmuggelte» Bücher ins schließlich weitgehend von mir bestimmte Verlagsprogramm und stibitzte mir diesen Lorbeer. Auch das, allerdings, ist wahr: Es bedurfte einiger Mogelkünste, jene Autoren «durchzusetzen», mit denen sich später viele westdeutsche Verlage schmückten – Éluard und Majakowski, Tibor Déry und Bulgakow, García Márquez und Amado und Reiner Kunze; von den schwer zu ergatternden (und noch schwerer bei der Polit-Bürokratie durchzusetzenden) «West-Lizenzen» ganz zu schweigen – William Faulkner und Mouloud Feraoun so gut wie Kurt Tucholsky (die Dokumente der Schlacht um diese Edition füllen mehrere Leitz-Ordner). Ja, das war ehrbar wie riskant. Das «Zeugnis», das mir die mich beobachtende Stasi ausstellte, kann sich sehen lassen. Da wird mir attestiert, daß ich ein «netter, ernster und höflicher Mensch» sei, der keine Frauenbekanntschaften hat, nicht trinkt und nicht raucht (was alles drei nicht stimmte); vor allem aber, daß ich aufgrund meines «Intellekts, Auftretens und Arbeitseifers stets das Vorbild der jungen Lektoren» gewesen sei und meine Prinzipien «einer demokratisch-bürgerlich orientierten, künstlerisch hochstehenden Literatur» immer verfolgt habe. Nun ja. Vermerkt wird auch, daß ich es abgelehnt habe, Mitglied der «Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft» zu werden. Und hier wird es prekär. Denn das war eine der sogenannten «gesellschaftlichen Grundorganisationen», in denen Mitglied zu sein so allgemein selbstverständlich war, wie es das Amen in der Kirche ist. Das zu verweigern war freches Sakrileg, und mein recht keckes «Ich liebe keine Einbahnstraßen, ich gehe da erst rein, wenn es umgekehrt auch eine ‹Gesellschaft für sowjetisch-deutsche Freundschaft› gibt» nicht einmal ganz ungefährlich. Diese Weigerung habe ich als «Mut» deklariert. Doch schaukelt der selbstverliehene Mut-Orden nicht doch recht schiefschultrig? Was wäre denn schon die ärgste Konsequenz gewesen? Doch nicht das Lager in Workuta. Die Sache erinnert fatal an eine gespenstische Anekdote, die der Emigrant Alfred Kantorowicz mit gutem Grund oft erzählte, zurückgekehrt aus den USA in die DDR, die er 1956 wieder verließ: Pogrom in Galizien; ein Dorf wird gebrandschatzt; der Rabbiner wird in einen Kreidekreis gestellt; es wird ihm bei Androhung der Todesstrafe verboten, den zu verlassen; Frau und Tochter werden vor seinen Augen vergewaltigt; später findet man ihn lächelnd im Kreidekreis stehen: «Aber Rebbe, sie haben das Dorf abgebrannt, 38 Leute ermordet, deine Frau, deine Tochter vergewaltigt – was stehst du da und lächelst?» – «Ja, und sie haben mich mit dem Tode bedroht, wenn ich aus dem Kreidekreis herausträte; aber sie haben nicht gemerkt, daß ich meine Fußspitze über den Rand geschoben habe.»
Die Fußspitze also. Sie hieß bei mir: ein Buch mehr, eine leicht waghalsige (bald verbotene) Kolumne in der «Berliner Zeitung». Das verbrannte Dorf aber hieß Bautzen oder Workuta. Dorthin, nach Sibirien, hatte man den nicht linientreuen Leo Bauer, Intendant des Ostberliner Deutschlandsenders, verbracht. Ich hatte ihn gut gekannt, mit ihm gegessen, diskutiert. Nun war er «weg» – und gefragt habe ich nicht. Auch nicht, als Joachim Schwelien, der befreundete Chefredakteur des Nachrichtenbüros ADN, abgesetzt wurde. Auch nicht, als der junge Lyriker Horst Bienek verhaftet wurde, er verschwand ebenfalls für lange Jahre in Workuta. Verhaftet wurde er, Assistent am Berliner Ensemble, übrigens in der Theaterkantine; sein Chef,