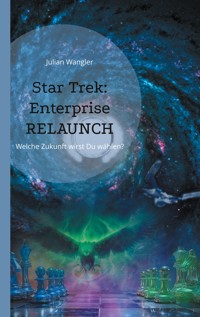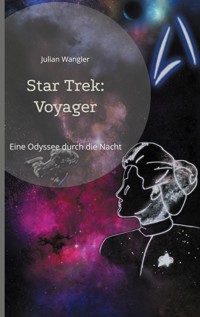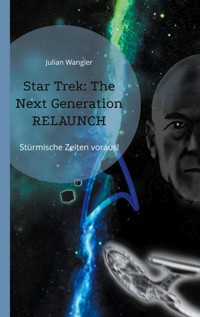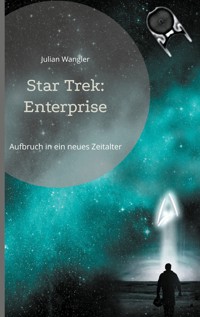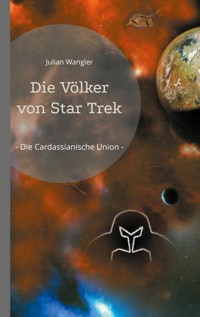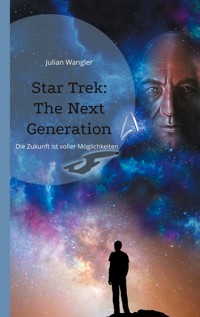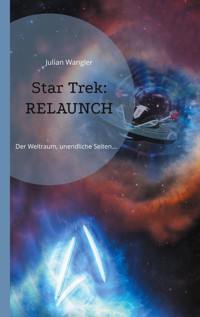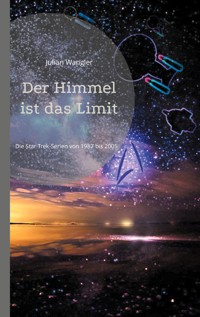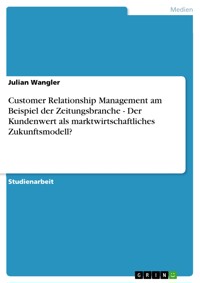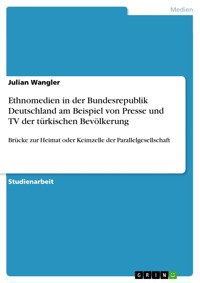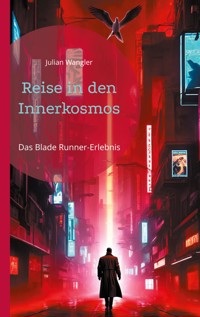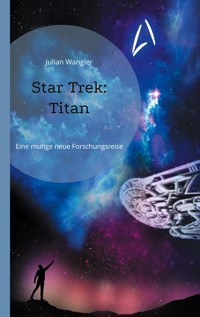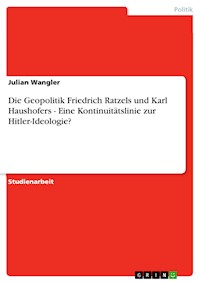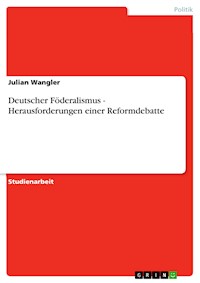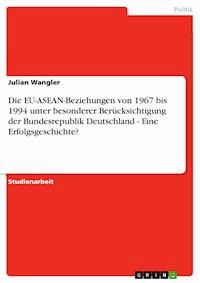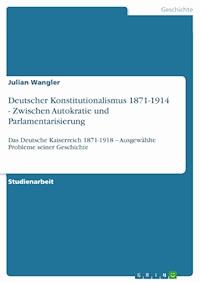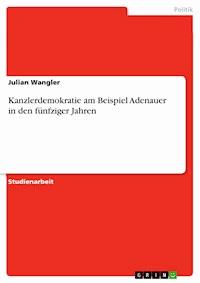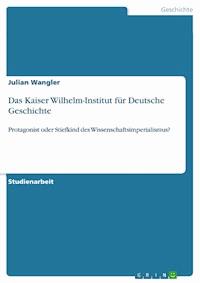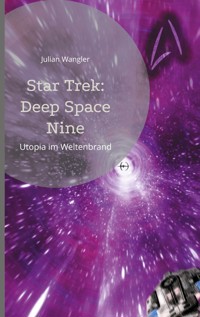
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Star Trek: Deep Space Nine ist der dritte Ableger von Gene Roddenberrys unsterblicher Science-Fiction-Vision. Die Serie rund um Captain Benjamin Sisko und seine multikulturelle Crew brachte es auf 176 Episoden. Bis heute begeistert DS9 Fans mit dramatischem Storytelling, komplexen Charakteren und bestechenden Gegenwartsbezügen - es ist eine Erzählung tiefer Einschnitte. Dieses Buch widmet sich der vielfältigen Welt der Serie. Beleuchtet werden die sieben Staffeln und sämtliche Figuren, aber auch Mächte und Völker sowie zentrale Ereignisse der Seriengeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Es ist leicht, ein Heiliger im Paradies zu sein.“
- Benjamin Sisko inDer Maquis, Teil II
Inhaltsverzeichnis
Vorwort:
Die Welt einer ungewöhnlichen
Star Trek
-Serie erkunden
Brief:
Nichts bleibt, wie es war
– Die Serie –
Neuer Anfang: Geburt und Genese von
Deep Space Nine
Trek with an edge: Das Besondere an
Deep Space Nine
Besprechung: Die sieben Staffeln
Die
Top-15
unter 176 Episoden
Zeitleiste: Wichtige Ereignisse im Überblick
Prominente Schauplätze
– Die Figuren –
Die Hauptfiguren
Wiederkehrende Gastcharaktere
Beziehungskisten
Kommandotandem: Sisko - Kira
Benjamin Sisko: Wanderer zwischen den Welten
Odo: Ein Kind der Ferne
Gul Dukat: Portrait eines vielschichtigen Schurken
Elim Garak: Aus der Finsternis ins Licht
Wandel des Herzens: Liebeslektionen in
Deep Space Nine
– Mächte in
Deep Space Nine
–
Utopia im Existenzkampf: Vereinigte Föderation der Planeten
Machtgier und Machtverfall: Cardassianische Union
Krieg und Ehre: Klingonisches Reich
List und Tücke: Romulanisches Sternenimperium
Anti-Föderation aus der Dunkelheit: Das Dominion
Lang lebe der Kapitalismus: Ferengi-Allianz
Frostige Schimäre: Breen-Konföderation
– Politische Ereignisse in
Deep Space Nine
–
2340-75: Cardassia-Konflikt und Maquis
2371: Pakt der Geheimdienste
2371-73: Demokratie auf Cardassia
2372/73: Klingonischer Krieg
2372: Leyton-Verschwörung
2373-75: Dominion-Krieg
– Station und Raumschiffe in
Deep Space Nine
–
„Hier liegen unsere Hoffnungen“: DS9 im Wandel der Zeit
„Tapferes, kleines Schiff“: Die
U.S.S. Defiant
Schwere Zeiten voraus: Die Sternenflotte im 24. Jahrhundert
„Des Krieges Hund‘ entfesseln“: Klingonische Schiffe
„Alles wird wieder uns gehören“: Cardassianische Schiffe
„Wir werden uns behaupten“: Dominion-Schiffe
„Wir glauben nicht an das Glück“: Romulanische Schiffe
– Essays –
Dunkel, tragisch, glaubwürdig: Die Cardassianer
Fremde Gestade: Der Gamma-Quadrant
Wer ist schuld am Krieg? – Eine alternative Betrachtung
Extensions of Man: Ein futuristisches Tabuthema
Sektion 31: Auf dunklen Pfaden verlieren wir uns
–
Deep Space Nine
-Romanwelten –
Das, was hinter Dir liegt: Von der Okkupation in die Freiheit
Das, was noch vor Dir liegt: Der
Deep Space Nine
-Relaunch
„Das Spiel darf nicht enden“: Einblicke in die 8. Staffel
Alte, neue Crew: Die Hauptfiguren der DS9-Fortsetzung
Nachwort:
DS9s Vermächtnis, ungebrochen kraftvoll und gegenwärtig
Brief:
Die Hoffnung lebt
Vorwort: Die Welt einer ungewöhnlichen Star Trek-Serie erkunden
Star Trek ist viel mehr als ein fiktives Abenteuer zwischen den Sternen. Es ist voll von Parabeln und Metaphern, die auf unsere Gegenwart anspielen. Zugleich weist es in seinen besten Momenten weit darüber hinaus, indem es jene inspirierende Utopie stiftet, in der sich eine vereinte Menschheit dem Universum zugewandt hat. Star Trek begleitet mich nun schon über einen großen Teil meines Lebens. Irgendwie ist es immer dabei gewesen, in allen möglichen Lebenslagen, bewusst wie unbewusst.
Am Anfang dieses Buches steht zunächst ein klares Bekenntnis: Ich bin ein Fan des ‚klassischen‘ Star Trek – wobei ich als Geburtsjahrgang 1985 hierunter weniger Gene Roddenberrys Originalserie (TOS) verstehe als die zwischen 1987 und 2005 entstandenen Nachfolgeserien1. Nachdem ich im Jahr 2021 begonnen habe, meine persönliche Sicht und Interpretation in Bezug auf die Inkarnationen The Next Generation (1987-1994), Voyager (1995-2001)2 und Enterprise (2001-2005)3 in Buchform zu veröffentlichen, soll auch Deep Space Nine (1993-1999) nicht fehlen.
Diese chronologisch gesehen dritte Star Trek-Serie ist die letzte, deren Produktionszeit vollständig im 20. Jahrhundert lag. Und sie ist zweifellos diejenige, die mich unter den verschiedenen Entwürfen des ST-Franchise am meisten geprägt, beschäftigt und mitgerissen hat. Ich sage immer gerne: Mit Star Trek: The Next Generation und Captain Jean-Luc Picard bin ich zum Fan geworden, doch Deep Space Nine hat mich mitten ins Herz getroffen.
Die Serie rund um Commander bzw. Captain Benjamin Sisko und seine gemischte Mannschaft an Bord der etwas bizarr anmutenden cardassianischen Raumstation hat in vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt. So wie mit der Entdeckung des rätselhaften Wurmlochs eine Tür in einen unbekannten Quadranten der Galaxis aufgestoßen wurde, hat DS9 eine Pforte der Gelegenheit geöffnet, um Star Trek mutig zu erweitern und zu modernisieren. Dies ist eine bleibende Leistung, von der die Serie auch heute – Jahrzehnte nach ihrem Produktionsende – mächtig zehrt.
In diesem Buch möchte ich mich nicht in langen Nacherzählungen über das Making-of oder Details der Produktion ergehen, die es anderswo bereits zuhauf zu lesen gibt. Stattdessen möchte ich neben einer Besprechung der einzelnen Staffeln v.a. das meiner Meinung nach einzigartige Setting von DS9 beleuchten, analysieren und interpretieren. Darunter fasse ich in der Serienhandlung stattfindende politische Ereignisse im Ränkespiel der Mächte, prominente Völker und Kulturen, Figuren, deren Persönlichkeiten und Beziehungen untereinander, Raumschiffe und Schauplätze.
In verschiedenen Essays möchte ich mich mit den unterschiedlichen Bestandteilen der komplexen Welt von Star Trek: Deep Space Nine auseinandersetzen, die wie ein sich immer weiter verdichtender und erhitzender Nexus daherkommt. Diese Welt ist von einer solchen Dynamik, dass die ehemals am Rand des erforschten Alls liegende namensgebende Station binnen weniger Jahre zum Knotenpunkt des Star Trek-Kosmos im 24. Jahrhundert wird. Die Veränderungen am Ende der Serie werden schwerwiegend, einschneidend und nachhaltig sein, und doch steckt der Gang der Geschehnisse, den uns DS9 präsentiert, voller Dramatik, moralischem Konflikt und tiefer Menschlichkeit.
Ich möchte darauf verzichten, übertriebene Allegorien und Vergleiche mit der politischen Gegenwart zu ziehen, sondern den narrativen Stoff der Serie möglichst für sich betrachten. Dennoch soll dieses Buch am Ende hoffentlich auch wiedergeben, wie ich die Serie erlebt habe und was mich daran so fasziniert. Hier habe ich meine persönlichen Gedanken, Übersichten und Deutungen zusammengetragen.
- Der Autor, im März 2022
Anmerkung zur 2. Auflage:
In der zweiten Auflage dieses Buches wurden neben einer Überarbeitung und Ergänzung aller bestehenden Kapitel einige neue Kapitel bzw. Abschnitte hinzugefügt. Letzteres bezieht sich v.a. auf die Erweiterung der Sektionen zu Station und Raumschiffen, Essays und DS9-Romanwelten.
- Januar 2024
Anmerkung zur 3. Auflage:
Die dritte Auflage durchlief eine erneute Korrekturrunde einschließlich geringfügiger Überarbeitung aller Texte. Neu hinzugekommen sind Charakterdossiers zu Odo und Elim Garak. Ergänzt wurden von mir zudem einige fiktive Szenen, die jedem Abschnitt vorangestellt sind und sich zentralen Figuren wie Kira, Sisko oder Dukat widmen. Diese sollen helfen, die Atmosphäre des DS9-Kosmos zu unterstreichen. Hinter dem Vorund Nachwort stehen nun zwei imaginierte Briefe eines kürzlich nach Cardassia zurückgekehrten Garak an seinen alten Freund Julian Bashir. Darüber hinaus wurden die Kapitel zu Station und Schiffen bzw. zu den Romanwelten erweitert. Nach meinem Dafürhalten ist dies der finale Stand des Buches.
- September 2024
Anmerkung: Dieses Buch ist nicht im Auftrag oder durch Unterstützung bzw. Veranlassung von Produzenten der Star Trek- Serien oder zusammenhängenden Merchandise-Artikeln entstanden. Es handelt sich ausschließlich um Meinungen und Interpretationen des Autors. Star Trek™ und sämtliche verwandten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen von CBS Studios Inc. und Paramount Pictures.
1„Der Himmel ist das Limit“ – Die Star Trek-Serien von 1987 bis 2005, BoD, 2024, 3. Auflage
2Star Trek: Voyager – Eine Odyssee durch die Nacht, BoD, 2024, 3. Auflage
3Star Trek: Enterprise – Aufbruch in ein neues Zeitalter, BoD, 2024, 3. Auflage
Brief: Nichts bleibt, wie es war
28. Januar 2376, Cardassia Prime
Mein lieber Doktor,
zeigen Sie sich nachsichtig mit mir, dass ich aufgrund zahlreicher Verpflichtungen nicht gleich dazu kam, Ihnen eine Antwort auf Ihr Kommunikee zu schreiben. Wie Sie jedoch wissen, nehme ich unsere Korrespondenz ausgesprochen ernst – sie bedeutet mir viel. Sie ist der unverzichtbare Ersatz dafür, dass wir uns nicht mehr beim Mittagessen unterhalten können. Und da jetzt die ersehnte Gelegenheit da ist, Ihnen meine ganze Aufmerksamkeit zu widmen, wird schließlich alles gut.
Vielen Dank für Ihr aufrichtiges Interesse und die Anteilnahme, die Sie im letzten Brief zum Ausdruck brachten. Tatsächlich habe ich des Öfteren an Sie gedacht, seit sich unsere Wege das letzte Mal gekreuzt haben. Ich war höchst erfreut darüber, von Ihnen zu erfahren, dass das Leben auf Deep Space Nine auch nach den großen Veränderungen, die wir alle erleben durften, anregend bleibt. Und natürlich bin ich nicht im Geringsten erstaunt darüber, dass Ihre Forschung beim medizinischen Corps der Sternenflotte einen fulminanten Resonanzboden gefunden hat. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Commander Bashir. Wenn ich Ihren Werdegang im Rückblick betrachte, wird mir ganz plötzlich bewusst, wie prädestiniert Sie für diesen glanzvollen Aufstieg waren. Ich möchte beinahe sagen – und das ist in keinster Weise beleidigend gemeint –, es war Ihr Schicksal. Bei mir verhält es sich komplizierter. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, die Personen um mich herum haben im Lauf ihres Lebens allesamt – der eine früher, der andere später – ihr Leitmotiv gefunden, wie der Literat sagen würde. Sie haben, wie der Musiker sagen würde, die Melodie ihres individuellen Wegs kultiviert und zu einer Partitur ausgebaut. Doch was ist mit mir?
Manchmal glaube ich, nur ich bin es, dem die Zeit die Möglichkeit verwehrt, einen dieser vielen sprichwörtlichen Fäden des Lebens herauszugreifen und konsequent zu verfolgen, bis zum Schluss. Ich war schon so vieles in meinem Leben, und das ist wahrscheinlich das Problem. Wenn ich zurückblicke, sehe ich so viel Stückwerk, so viele lose Fäden, die im Nichts zu enden drohen. Deshalb trübt sie meine Sicht, die Zeit, heute mehr denn je zuvor. Ich frage mich: Kann dieser Elim Garak überhaupt ein Schicksal haben? Was macht ihn aus, wenn man die vielen Schalen Schicht für Schicht abträgt, was bleibt dann noch von diesem Mann übrig ohne seine zahllosen Masken? Andererseits hat er diese Masken sehr liebgewonnen; sie gehören zu ihm. Vielleicht sind sie alles, was er je hatte.
Sie können unbesorgt sein, mein lieber Doktor: Mein Antrieb, Ihnen zu schreiben, speist sich nicht aus dem Wunsch, mich selbst zu bemitleiden oder Ihnen einen Vortrag über das Schicksal zu halten…obwohl dies vielleicht, ohne dass ich es will, die unbewusste Begleitmelodie dieses Briefs sein könnte; jedenfalls, soweit es mich betrifft. Doch ich greife vor. Ich glaube, das Beste ist es, wenn ich ganz von vorn anfange.
Mein Leben auf Cardassia Prime verläuft recht herausfordernd und produktiv. Es vergeht kein Tag, an dem auch nur der Verdacht aufkommt, ich könnte ihn mit Trübsal verbringen. Stellen Sie sich vor: Ich habe mich doch tatsächlich in der Hauptstadt einer medizinischen Notfalleinheit angeschlossen – an der Seite eines gewissen Arztes namens Parmak. Ein guter Mann, der mich gelegentlich ein wenig an Sie erinnert, Doktor, auch wenn er deutlich älter ist.
Ironisch ist, dass Parmak einst mit der Dissidentenbewegung auf Cardassia im Bunde war, und raten Sie mal, wer für sein Verhör zuständig war, nachdem er verhaftet wurde? Der Mann ist alles andere als ein Feigling, doch er ist so empfindsam, dass ich ihn nur ein paar Stunden anzustarren brauchte, bis er uns alles sagte, was er wusste. Er behauptet, dass es ihm selbst heute noch schwerfällt, mir direkt in die Augen zu sehen. Vielleicht ist hier ein guter Anfang, dachte ich. Ich habe ihn also um Vergebung gebeten, und er war freundlich genug, sie mir zu gewähren. Parmak ist nur der erste in einer langen Reihe, die ich um Entschuldigung bitten muss. Glauben Sie mir, Doktor, da sind noch viele weitere.
Immer, wenn in den Ruinen Überlebende gefunden werden, werden wir herbeigerufen, um Hilfe zu leisten und sicherzustellen, dass sie in eine Versorgungseinrichtung transportiert werden. Es ist ein Wunder, wie manche tagelang, wochenlang, begraben unter Tonnen von eingestürztem Stein, überlebt haben. Erst gestern entdeckte ein Suchtrupp ein schwaches Lebenszeichen inmitten eines mindestens vier Meter hohen Schutthaufens. Als es uns gelang, zu der Stelle, von der die Biosignatur kam, vorzudringen, fanden wir eine tote Mutter mit ihrem Baby – das noch am Leben war. Es war wie ein Wunder. Ich vermag die Blicke der Männer nicht zu beschreiben, als wir das kleine Wesen in den Händen hielten und feststellten, dass es beinahe unversehrt war.
Als ich zum ersten Mal wieder durch Locanda City lief, glaubte ich, ich könnte es nicht ertragen. Doch inzwischen denke ich, dass ich das kann. Ich kann mit dem Geröll leben, mit all den beschädigten Gebäuden, von denen manches unvermittelt in sich zusammenstürzt und Passanten unter sich begräbt. Ich kann mit den Überlebenden leben, die sich wie holographische Phantome bewegen und jede wache Minute damit verbringen, nach allem zu suchen, was sie ernähren und durch den Tag bringen könnte. Ich kann sogar mit dem Gestank der Leichen leben, die die zerstörten Straßen übersäen und in grotesken Posen darauf warten, in Massengräber abtransportiert zu werden.
Doch wissen Sie, woran ich mich wohl nie gewöhnen werde? An diesen Staub. Es ist der Staub, der mich erstickt und meine geistige Gesundheit herausfordert. Er verstopft meine Nase, trübt meine Sicht und brennt in meinen Augen. Mein Mund ist mit einer kalkartigen Paste gefüllt, die Speise und Trank – dieser Tage rare Güter – geschmacklos werden lässt. Wir leben im ewigen Zwielicht, existieren als Schattengestalten in einer halbdunklen Welt, in der jede Form und jedes Geräusch von dieser ruhelosen Staubwolke gedämpft wird, die sich einfach nicht legen will.
Ja, Doktor, mein so lange Jahre gehegter Wunsch ist schließlich in Erfüllung gegangen. Ich bin nachhause zurückgekehrt. Aber anders als ich es mir vorgestellt hatte. Das einzige Heim, das ich je kannte, ist nur noch Schutt. Dank den Gründern, die eine wahrhaft cardassianische Gerechtigkeit walten ließen. Nein, das ist nicht richtig. Dank uns selbst, die wir den ganzen Quadranten hintergangen haben, die wir schuldig im Sinne der Anklage sind. Wir hielten uns für die Herrenrasse, auserwählt zum Herrschen. Das Militär und der Obsidianische Orden hatten Jahrhunderte, um die Union zu lenken und ihre Bürger in ihrem Sinne zu erziehen. Äußerst gekonnt haben sie es verstanden, die explosive Mischung aus Minderwertigkeitsgefühl und Allmachtsfantasie im cardassianischen Herzen anzufachen – mit dem absoluten Höhepunkt an jenem Tag, als sich Cardassia dem Dominion anschloss.
Ich habe es kennengelernt, dieses xenophobe, chauvinistische Denken, das sich wie ein Gift in den Geist eines jeden Cardassianers geschlichen hat. Die Macht dieses Giftes hat Bajor und zahllose andere Welten in die Sklaverei getrieben. Doch nachdem eine Milliarde meines Volkes in einem beispiellosen Krieg verheizt oder wie Vieh abgeschlachtet worden sind, ist er mir endgültig ausgetrieben worden, der Glaube, wir seien ein auserwähltes Volk. Wir haben uns etwas vorgemacht. In Wahrheit waren wir Mörder und Tyrannen – und vor allem waren wir selbst Unterworfene. Geknechtete eines Staates, der uns mit grausamer Entschlossenheit in seine Bahnen lenkte, auf dass wir in seinem Sinne funktionierten. Das Leichentuch dieser Welt ist letztlich gefallen, aber gleichzeitig hat auch alles Wunderbare, Erhabene an Cardassia ein Ende gefunden. Dies ist die Tragik, die dem Ganzen innewohnt.
Wissen Sie, Doktor, ich dachte, im Laufe der Jahre auf Deep Space Nine hätte selbst ich, der unumstößliche Garak, mich geöffnet und eine kritische Sicht auf mein Volk und meine eigene Vergangenheit entwickelt. Abstand gewinnen können. Doch meine Rückkehr droht mich Lügen zu strafen. Jetzt wird mir auf einmal bewusst, dass mir die größte Abrechnung mit allem, was ich mir so lange Zeit zurückwünschte, erst noch bevorstehen könnte. Die Abrechnung mit dem alten Cardassia. Die Abrechnung mit allem, was ich über einen Großteil meines Lebens war. Ich kann mir selbst nicht entkommen.
Wieso kommt es mir gerade jetzt wieder in Erinnerung, ein Gespräch mit einer romulanischen Konkubine, das sich vor langer Zeit im Zuge einiger geheimdienstlicher Verstrickungen ergab. Es war eine sehr intime Unterhaltung. Sie haben ja sicher gehört, dass ich mich eine Zeitlang als Gärtner in Cardassias Botschaft auf Romulus verdingte. Nun, wie dem auch sei, es war keine gerade einfache Zeit damals auf Romulus, doch besagte Konkubine war eine sehr zuneigungsvolle und anmutige Frau, ebenso wie sie voll Weisheit und Melancholie steckte. Ich werde nie den Ausdruck in ihren wunderschönen Augen vergessen, als sie zu mir sagte, was mich auch heute noch berührt: ‚Wir Romulaner führen doch im Grunde ein Leben, das zum größten Teil Fassade ist. Es geht um Verschleierung und Unangreifbarkeit, ewige Schimäre; es geht um Ruhm und Status und Titel… Aber wenn ich hinter die Fassaden meines Lebens blicke, werde ich traurig. Sie nehmen kein Ende, und da ist nichts, was ich ausmachen kann außer Rauch und Schatten.‘ Wissen Sie, Doktor, ich hätte nie gedacht, dass mir eine Romulanerin je derart aus dem Herzen sprechen würde.
Auch ich habe in einer Welt der Fassaden gelebt. Ich habe sie gepflegt wie der Gärtner seine Blumen, aus Pflicht, aus Gewohnheit, aus Furcht, aus Wunsch, mich zu beweisen. Sie sind zu einem Teil von mir geworden. Und dann, eines Tages, stehe ich wieder auf meiner Heimatwelt und muss mir die Frage stellen, wofür das alles gut gewesen sein soll? Wohin hat es mich geführt? Wohin hat es Cardassia geführt?
Und deswegen ist mir klar, dass Enabran Tain, obwohl ich vor mehr als zwei Jahren seinem letzten Atemzug beiwohnte, noch nicht endgültig tot ist. Früher oder später muss ich seinen Spuren folgen und mich ihm stellen. Oder besser gesagt: Ich muss mich mir selbst stellen. Ich muss allem, was ich war und bin, in die Augen sehen. Es ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Frieden zu finden. Wenn es für mich so etwas überhaupt noch geben kann.
Tains Haus auf Cardassia steht nicht mehr. Nichts mehr ist von ihm übrig außer einer rußgeschwärzten Grube, in der ein Trümmerhaufen liegt. Aber vielleicht steht seine Altersresidenz auf der Arawath-Kolonie noch. Ich werde diese Welt für ein paar Tage verlassen müssen, sehr bald schon…
Sie sind zu jeder Zeit willkommen, Doktor.
Ihr Freund
Garak
– Die Serie –
„Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert.“
- Benjamin Sisko in In fahlem Mondlicht
~
2369
Kira wanderte über die von Trümmerhaufen gesäumte Straße. Die Verheerung hatte nur wenige der alten Gebäude verschont.
Sie wusste ganz genau, was die Cardassianer damit bezweckt hatten: Bevor sie verschwanden, wollten sie die Seele des bajoranischen Volkes so stark wie irgend möglich verwunden, indem sie seine ehrwürdigsten Tempel entweihten und deren Insassen peinigten.
Sie trat durch das von Zeit und Feuchtigkeit schwarz gewordene Portal des größten Hauses. Im Innern des Gebäudes erwartete sie kühles Halbdunkel; das einzige Licht stammte von der Sonne, filterte durch Risse und Löcher in den Wänden. In ihrer Umgebung fand sie zertrümmerte Fenster, zerschmetterte Innenwände, enthauptete Statuen.
Trotzdem war es Dukats Schergen nicht gelungen, die ruhige Aura des Sanktuariums zu zerstören. Auch das war ein später Sieg. Kira schritt an einem Mönch vorbei, der leise und auf eine mitleiderweckend schwere Art in einer halb eingestürzten Nische sang. Ein anderer humpelte, von Verletzungen behindert, an der Wand entlang.
„Kann ich etwas für Sie tun, mein Kind?“, fragte eine warme, etwas raue Stimme.
Kira drehte sich um und bemerkte eine schattenhafte Gestalt. Zwischen ihnen glitzerte Sonnenlicht durch eine Öffnung in der Decke, und Staub verlieh dem Glanz die Form eines Balkens.
Sie musterte die an und für sich so unscheinbare Bajoranerin, die vor ihr stand, mit Ehrfurcht. Die kleine Frau stützte sich auf einen Gehstock, und in ihrem Gesicht zeichneten sich mehrere dunkle Striemen ab. Um ein Haar wäre auch sie noch auf den letzten Metern Opfer der Besatzung geworden. Kira hätte nicht gewusst, wie sie ohne Opaka hätten weitermachen sollen.
In Anbetracht ihrer kürzlichen Peinigung war umso verblüffender, dass sich in Opakas Gesicht keine Spur von Leid und Hass zeigte. Da war nur das innere Licht eines unerschütterlichen Friedens, gegen den kein Feind des Universums etwas ausrichten konnte.
Sie kannte Opaka nicht sonderlich gut. Ein gutes Dutzend Begegnungen hatten sie bereits gehabt. Erst seitdem Kira vor einigen Wochen eine Rolle im Militär zu spielen begann, kreuzten sich ihre Wege häufiger.
Merkwürdigerweise beschlich Kira, je öfter sie auf Opaka traf, der Eindruck, sie würde ihr fremder und nicht vertrauter. Eine gütige, aber auch undurchschaubare Aura umgab das spirituelle Oberhaupt Bajors. Ihre Natur stammte wahrhaft von den Propheten ab.
„Eure Eminenz, ich…“ Kira verneigte sich flach. „Ich glaube, ich brauche Euren Rat.“
Schweigend führte sie Kira zu einem Meditationsbereich. Hölzerne Sitzbänke formten dort einen Halbkreis vor dem spiegelnden Wasser eines Teichs. Darüber gewährten Fenster Ausblick zu Bergen, die erhaben am Horizont aufragten. Ihre Abbilder tänzelten im Wasser.
Opaka ließ sich auf eine Bank sinken, und Kira nahm neben ihr Platz. „Was haben Sie auf dem Herzen, mein Kind?“
„Heute Morgen hat mich Verteidigungsminister Erem kontaktiert.“, erzählte Kira. „Wir waren gelegentlich nicht einer Meinung, womit die Gefahr besteht, dass er mich damit kaltstellen will… Jedenfalls: Die Provisorische Regierung bietet mir einen Posten als Verbindungsoffizier an. Stellen Sie sich vor: Auf der Raumstation.“
Ihre Stimme hatte einen Tonfall der Empörung angenommen, einen Tonfall, der ihr Denken und Fühlen verriet. Sie hatte erwartet, dass sich prompt ein Schatten über Opakas Gesicht legte, aber stattdessen lächelte die Kai nur ominös. Eine für Kira schwer deutbare Reaktion.
„Sie kommen zu mir, weil Sie wissen wollen, ob es die richtige Entscheidung ist, dieses Angebot anzunehmen?“
„Ja, Kai.“, erwiderte sie. „Offen gesagt, bezweifle ich, dass ich die Richtige für diesen Posten bin.“
Opaka betrachtete sie aufmerksam. In ihren dunklen, schier unendlich tiefen Augen fand Kira ihr Spiegelbild. „Und wie kommen Sie zu diesem Urteil?“
„Nun, ich denke, ich habe mein ganzes Leben gegen die Cardassianer gekämpft. Diese Station war der Inbegriff ihrer Herrschaft und ihrer Allmachtsfantasien. Sie mag umbenannt werden, aber das kann nicht ungeschehen machen, was sie immer gewesen ist. Hinzu kommt: Sie wird das Instrument sein, um diplomatische Kontakte zur Föderation zu knüpfen…und damit wird auch Dukat eines nicht allzu fernen Tages wieder dort aufkreuzen.“ Sie schüttelte langsam den Kopf. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann.“
Opaka lächelte warm. „Das Leben schien leichter für Sie zu sein, als es nur Gut und Böse gab, nicht wahr? In Ihrer neuen Rolle als Verbindungsoffizier müssten Sie jedenfalls sehr viel mehr Selbstdisziplin beweisen. Ich verstehe Ihr Dilemma, mein Kind. Sie sind nicht allein damit. Viele einstige Widerstandskämpfer, die nun auf Militär- oder Politikerposten berufen werden, tragen denselben inneren Konflikt aus.“
„Und was kann ich dagegen tun? Bringen Sie mir Klarheit, Kai. Bitte.“
Opaka streckte die Hand aus, und ihre langen Finger berührten Kira an der Wange. Sie musterte sie mit der Zärtlichkeit einer Großmutter, die das Gesicht eines geliebten Enkelkindes betrachtet.
Ihre Finger bewegten sich wie eigenständige Wesen, krochen über das Ohr und tasteten darüber hinweg. Für eine halbe Minute schloss sie konzentriert die Augen.
Als sie sie wieder öffnete, umspielte ein sanftes Funkeln ihren Blick. Er ließ sich schwer deuten. Kira fand ihn furchtlos, als habe sie Zugang zu einer sehr viel größeren Wahrheit. „Sie brauchen keine Angst zu haben. Gehen Sie auf diese Station und finden Sie Frieden.“
Irritiert verfolgte Kira, wie die Frau sich erhob und, auf ihren Stock gestützt, langsam davonhumpelte. Was sollte sie davon halten? Opaka hatte ihr keine Begründung gegeben.
„Kai? Warum soll diese Station mir Frieden bringen?“
Für einen Moment verharrte Opaka und wandte den Kopf zur Seite, ohne sich noch einmal umzudrehen. Dann raunte sie: „Weil Sie dort sterben und neu geboren werden. Sie haben den Segen der Propheten, mein Kind.“
Die Serie
>> Neuer Anfang: Geburt und Genese von Deep Space Nine
Alles fing mit einem Anruf an
Im Frühjahr 1993 startete als nunmehr dritter Sprössling des Star Trek-Kosmos die Serie Deep Space Nine, doch eigentlich beginnt die Geschichte bereits zwei Jahre vorher. Ende 1991 erhielt Rick Berman – seinerzeit Produzent von Star Trek: The Next Generation (TNG) und fortan allumfassender Herr über das Franchise bis in die 2000er Jahre –, einen Anruf von Brandon Tartikoff, damals Vorsitzender von Paramount Pictures. Berman wurde gebeten, eine dritte Star Trek-Serie zu entwerfen. Tartikoff ließ ihn wissen, dass er es gerne sehen würde, wenn sich die neue Serie erkennbar von The Next Generation abheben würde. Keine allzu einfache Bitte, wenn man bedenkt, dass das Fandom zu diesem Zeitpunkt bereits auf sehr klar konturierte ST-Abenteuer eingeschworen war und TNG ein im Wesentlichen modernisiertes Remake der Classic-Serie aus den 1960er Jahren darstellte.
Die nächste Generation für Star Trek
Bei Deep Space Nine handelte es sich um die erste ST-Show, die nicht unter Anleitung oder Mitwirkung des ebenso verehrten wie umstrittenen Franchiseschöpfers Gene Roddenberry entstand. Da der Star Trek-Erfinder im Herbst 1991 unerwartet verstorben war, übernahmen dessen Nachfolger Rick Berman sowie der bereits für TNG erfolgreich arbeitende Drehbuchautor Michael Piller die Rolle der ausführenden Produzenten.
Für beide Männer war zu diesem Zeitpunkt klar, dass ihre überaus sorgsam sanierte Fortführung des Roddenberry-Universums funktionierte, und sie waren nun bereit, neue Ufer anzusteuern. Aufgrund des beispiellosen, stilbildenden Erfolgs von TNG und der zurückliegenden TOS-Kinofilme war die Marke Star Trek zu Beginn der 1990er Jahre hoch frequentiert, kommerziell tragfähig und in aller Munde. Was also lag da näher als es nach dem Ende der Abenteuer von Picard und Co. im TV mit einem weiteren Ableger zu probieren?
Harte Konkurrenz war absehbar
Freilich bedeutete dies, dass sich eine neue Inkarnation aus dem ST-Kosmos an den starken Vorbildern würde messen lassen müssen – und tatsächlich sind solche Vergleichssituationen speziell im ST-Fandom wirklich schwierig, weil jede neue Serie Polarisierungspotenzial besitzt. Zudem war das Produktionsumfeld ein anderes geworden.
Star Treks Erfolge in Film und Fernsehen hatten maßgeblich dazu beigetragen, dass andere Science-Fiction-Shows wie Pilze aus dem Boden schossen. Prominente Beispiele hierfür sind Time Trax: Zurück in die Zukunft, seaQuest DSV, Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI und insbesondere J. Michael Straczynskis Babylon 5 (eine Serie, die auffällige Gemeinsamkeiten mit DS9 besitzt und über die manche Gemüter bis heute uneins sind, wer sich an welcher Stelle von wem hat inspirieren lassen). Später würde sich Star Trek die Konkurrenz obendrein ins eigene Haus holen, indem DS9 über weite Strecken parallel zur vierten Serie, Star Trek: Voyager, lief – eine Entscheidung, die man durchaus kritisch hinterfragen kann.
Tartikoff wurde erhört
Konzeptionell entschieden Berman und Piller, einen sichtbaren Alternativweg zu TNG einzuschlagen. Nachdem verschiedene Konzepte diskutiert worden waren (z.B. Captain Sulu-Serie, Klingonen-Serie, Serie auf einer planetaren Kolonie), setzte sich die Idee einer auf einer Raumstation angesiedelten Geschichte durch, die im gleichen Zeitrahmen wie TNG spielen und damit das bestehende Universum des 24. Jahrhunderts erweitern sollte.
Dieses grundlegende Konzept bedeutete einen Bruch mit dem bis dato bei Star Trek üblichen Erzählstil. Es war nämlich kein Setting, in dem ein Raumschiff vom einen zum nächsten Problem flog, dieses (vermeintlich) löste und dann weiter reiste, ohne noch etwas mit den mittel- und längerfristigen Konsequenzen zu tun zu haben. Eine Raumstation blieb hingegen an Ort und Stelle, sodass hier eher gegeben war, dass Probleme permanent vor sich hin brodelten und immer wieder zurückkehrten. Man konnte ihnen so gesehen gar nicht entkommen.
Herausforderungen für das Storywriting
Analog dazu mussten sich die Autoren stärker vom Prinzip der Stand-alone-Episode lösen und stattdessen staffel- bzw. serienübergreifende Handlungsbögen erarbeiten. Abseits der Stammbesetzung, die bewusst gemischter ausfallen sollte, musste diese neue Serie zudem von mehreren wiederkehrenden Nebencharakteren mitgetragen werden. Bei einer an einem stabilen Wurmloch (Passage in einen anderen, fernen Quadranten) gelegenen Raumbasis sollten – wie bei einem intergalaktischen Handels- und Raumhafen – immer wieder neue, aber eben auch alte Gesichter auftauchen, was ein großes Rollenpotenzial bereithielt.
Außerdem sollte die neue Serie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Figuren realistischer – ja, auch deutlich konfliktreicher – darstellen (etwas, das unter Roddenberry explizit abgelehnt worden war). Es sollten Personen mit abweichenden Moralvorstellungen und unterschiedlichen kulturellen und politischen Hintergründen aufeinandertreffen. In Bezug auf Optik und Handlung sollten bewusst dunklere Töne angeschlagen werden. Das ursprünglich erdachte Setting sollte nicht das paradiesgleiche, prosperierende Zentrum der Föderation abbilden, wo es an nichts fehlt, sondern einen Außenposten in einem zerrütteten Stellargebiet am Rand einer ehemals feindseligen Macht, wo es an allem mangelt – ein sprichwörtliches Pulverfass.
Ira Steven Behr kommt zum Zuge
Als Michael Piller 1995 zu Star Trek: Voyager wechselte, wurde er als ausführender Produzent bzw. Leiter des Writers Room durch Ira Steven Behr ersetzt, unter dem DS9 dann so richtig Fahrt aufnahm. Behr war bereits bei TNG dabei gewesen, hatte die Serie aber immer stark dafür kritisiert, dass sie zu starr und im Hinblick auf die Figuren entwicklungs- bzw. konfliktarm gewesen sei. Bei DS9 sollte er etwas Neues vorfinden – und das Ganze ab Staffel drei immer weiter nach seinem eigenen Gusto kultivieren.
In dieser Phase wich das ursprüngliche Konzept vom entlegenen Außenposten immer dezidierter einer Raumstation Deep Space Nine als hochgerüsteter Festung, die angesichts der Bedrohung durch das aggressive, totalitäre Dominion zum gefühlten Mittelpunkt allen Geschehens im Quadranten avancierte – ein radikaler Wandel, der aber glaubwürdig und durchdacht vollzogen wurde. Man könnte auch sagen: Spätestens, als Avery Brooks alias Benjamin Sisko (der erste schwarze Protagonisten-Kommandant in einer ST-Serie) sich einen Bart stehen ließ und ‚oben ohne‘ zu tragen begann, war der kreative Durchbruch von DS9 geschafft. Zusammen mit den Autoren Robert Hewitt Wolfe und Hans Beimler verfasste Behr die Drehbücher für die meisten Dominion-zentrierten Episoden.
Behr bildete die große Kontinuitätslinie bis zum Serienende, die dafür sorgte, dass DS9 sich ‚aus einem Guss‘ entwickelte. Er war es, der elementare Veränderungen in der Dramaturgie forcierte, epische Begebenheiten im Blick hatte, die Charakterentwicklung vorantrieb und demonstrierte, wie viel er von modernem, horizontalem Erzählen verstand. Obgleich DS9 – wie nahezu alle Serien zu dieser Zeit – keinem vorab verfassten Masterplan folgte und wie auch TNG ‚on the fly‘ geschrieben wurde, stellte Behr sicher, dass sich die Show in Richtung einer genuinen Fortsetzungssaga entwickelte anstatt durch ein bestimmtes Setting verbundene Einzelabenteuer zu präsentieren, wie es während der ersten beiden Staffeln noch verbreitet gewesen war. Für eine Zeit, in der durchgehende Handlungsbögen in TV-Serien kaum existierten (von exotischen Ausnahmen wie Babylon 5 oder Twin Peaks einmal abgesehen), kam diese Genese von DS9 einem kleinen produktionstechnischen Revoluzzertum gleich und sichert der Serie, Jahrzehnte nach ihrer Erschaffung, in der Ära der Streaming-Serien die Anschlussfähigkeit an ein neues Publikum.
Wie auch The Next Generation sollte die Serie in Syndication vertrieben, also an regionale Networks weiterverkauft werden. Sie sollte sieben volle Staffeln mit insgesamt 176 Episoden füllen und damit eine weit überdurchschnittliche Produktionsdauer erreichen. In der Gesamtbetrachtung würden es – um auf Tartikoffs ursprünglichen Wunsch zurückzukommen – tatsächlich v.a. die (teils scharfen) Kontraste zur bisherigen Star Trek-Tradition sein, die DS9 hervorstechen und über die Zeit weiter reifen lassen würden.
„Ich glaube fest, dass Gene Roddenberry ein unorthodoxer, kreativer Kerl war, und er kümmerte sich viel mehr um das Franchise als es ihm manche Leute zugestehen wollen. Ich glaube auch, dass er viel kühner mit Star Trek umging als manche Fans das glauben möchten. Wir versuchten mit Deep Space Nine, den loyalen Trekker ein wenig aus der Reserve zu locken und aus der Ruhe zu bringen. […] Wir brachten den Realismus zurück. Die Leute sitzen bei uns weniger herum und reden über Probleme; die Leute selbst sind das Problem. Wir haben versucht, die Charaktere an Konflikten wachsen zu lassen und ihnen eine neue Dimensionalität zu verleihen. Zugleich waren wir immer bestrebt, uns am aktuellen Zeitgeschehen zu orientieren. […] Wir wollten die Fans dazu bringen, die Föderation und was sie bis dahin als gegeben hingenommen hatten, zu überdenken und zu analysieren. […] Trotzdem war uns stets daran gelegen, das Gute und Wünschenswerte, das in Roddenberrys Vision lag, zu bewahren und durch die Auseinandersetzung mit harten Fragen echter und noch wertvoller zu machen.“ (Ira Steven Behr, Executive Producer und Drehbuchautor)
Eine Frage von Erwartung und Aufmerksamkeit
Dennoch würde es der Serie nicht ganz leicht gemacht werden. Die Show hat immer darunter gelitten, dass sie sowohl von Studio- als auch Publikumsseite nie jene Aufmerksamkeit und Würdigung erhielt, die ihr eigentlich gebührt hätte (hierüber geben Showrunner wie Behr selbst ziemlich deutlich Auskunft). Tatsächlich war es so, dass andere Star Trek-Erzeugnisse mehr im Fokus des Augenmerks standen. Insofern ist etwas dran, wenn man behauptet, DS9 sei innerhalb des Star Trek-Universums eine eher unterschätzte Produktion. Dies drückt sich u.a. auch in verschiedenen Emmy-Nominierungen aus, die der Serie letztlich aber durch die Lappen gegangen sind.
Ein Problem war, dass die Erwartungen an DS9, den enormen Quotenerfolg von TNG fortzusetzen, von vorneherein sehr hoch lagen. Als die Crew der U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D, im Mai 1994 ihre siebenjährige Reise auf dem kleinen Fernsehbildschirm beendete und eine Kinokarriere begann, verfolgten erheblich mehr Zuschauer die abschließende siebte Staffel als es bei der ersten Staffel der Fall gewesen war – TNG entpuppte sich als wahres Quotenwunder. Dies ist eine äußerst rare Entwicklung im harten Seriengeschäft und konnte nur von einer Handvoll Titel erreicht werden, darunter auch Emergency Room oder Friends.
Trotz eines sehr erfolgreichen DS9-Pilotfilms – mit 18,8 Quotenpunkten ein Ergebnis, das keine andere ST-Serie vor und nach ihr toppen konnte – ging es über die Jahre der Serie beständig bergab, bis etwa ein Drittel des harten Zuschauerkerns verblieb. Aus heutiger Sicht ist das immer noch ein gutes Ergebnis, erst recht, wenn man bedenkt, dass sich DS9 – anders als Captain Picard und Co. – einer Menge Konkurrenzprodukte auf dem Sci-Fi-Markt stellen musste. Ganz zu schweigen von der Konkurrenz im eigenen Hause, die zuerst mit TNG und dann Voyager erfolgte.
Diese Form von Marktübersättigung blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen: Das Epos rund um die Raumstation musste sich mit einem kleineren Stück vom Kuchen zufriedengeben. Die Quoten waren mit denen der Nachfolgeshow Voyager ziemlich gut vergleichbar, wobei dort niemals ein so hartes Urteil über mangelnden Erfolg gefällt wurde. Wer weiß, vielleicht fiel bei DS9 die Enttäuschung seitens Paramount größer aus, weil es sich um die unmittelbare Nachfolgeserie von TNG handelt. Die Maßstäbe waren vermutlich einfach zu hoch angesetzt worden. Trotzdem ließ man DS9 gewähren, fokussierte sich auf andere ST-Produktionen und ließ das ‚schwarze Entlein‘ im Windschatten der Franchisepioniere weitermachen. Darin lag auch eine Chance für Behr und sein Team, ihr eigenes Ding durchzuziehen.
Zum problematischen Erwartungsmanagement auf der Studioseite hinzu kommt, dass die abweichende inhaltliche Richtung und der neue Stil von DS9 zwar neue Zuschauer ansprachen, jedoch nicht alle der angestammten Star Trek-Fans mitnehmen konnten. Die cardassianische Raumstation bot alleine optisch ein völlig anderes Erscheinungsbild als die geradezu antiseptisch saubere, helle und stets geordnete Enterprise. Die Figuren stritten teils wie die Kesselflicker, wo es unter Jean-Luc Picard im Grunde nur Friede, Freude, Eierkuchen zu besichtigen gegeben hatte. Zudem dominierte gerade in der zweiten Hälfte der Serie die schwere Konfrontation mit dem Dominion, was DS9 dahingehend vertiefte, dass es die Konsequenzen von Krieg, moralischer Makelhaftigkeit und schweren Entscheidungen behandelte.
„Krieg war ein Thema, über das schon seit Beginn der Klassikserie gesprochen wurde. Aber es wurde mit Ausnahme der TOS-Folge Kampf um Organia nie richtig behandelt, nicht explizit jedenfalls. Weit mehr ging es um den Kalten Krieg und das Gleichgewicht des Schreckens, das in dieser Phase so prägend war. Aber echter, schrankenloser Krieg verändert die Dinge fundamental. Wie geht die perfekte, idealistische Föderationsgesellschaft damit um? Deep Space Nine war zum Großteil für uns die Gelegenheit, die Grundzüge von Star Trek auf die Probe zu stellen, die unterschwellige Philosophie unter die Lupe zu nehmen und zu sehen, wo sie vielleicht undichte Stellen hat.“ (Ronald D. Moore, Co-Executive Producer und Drehbuchautor)
„Der Krieg bringt bei Menschen sowohl das Beste als auch das Schlechteste hervor. […] Wir wollten so gut wie möglich versuchen, den Krieg als ernsthaftes Thema darzustellen und ihn nicht herunterspielen. […] Das heißt auch, seine ganz eigene Psychologie zu zeigen; dass er Dich buchstäblich in den Wahnsinn treibt, die Truppen der Föderation tiefgreifend verändert, ganz gleich, ob sie überleben oder nicht. Der Krieg ist ein eigenes Setting.“ (Ira Steven Behr, Executive Producer und Drehbuchautor)
Auch die ehrwürdige Föderation bekam ihr Fett weg. Denkt man an die kritische Darstellung der Sternenflotte (z.B. Putschversuch durch Admiral Leyton) oder die in ihrem Herzen wohnende Sektion 31, wird das Image der Planetenallianz durchaus angekratzt. Dadurch ist die Utopie in DS9 gegenüber dem Vorgänger TNG eindeutig abgeschwächt. Der Umstand, dass DS9 immer dichtere Geschichten in ausgedehnten Handlungssträngen erzählte, machte es für den Gelegenheitszuschauer schwieriger, hier und da mal einzuschalten und der Serie unkompliziert zu folgen.
„Die Originalserie und TNG waren im Großen und Ganzen die Geschichte von Erforschern, die von einem Platz zum nächsten reisten, um eine Art von Güte und Erleuchtung zu bringen, aber natürlich auch Erkenntnisse zu sammeln. Ich glaube, sie benutzten als Hauptthematik, wie Menschen in Frieden zusammenleben. Deep Space Nine handelt in erster Linie davon, wie Menschen mit den Konsequenzen ihres Handelns leben, denn man kann hier nicht einfach davon weg. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich liebe die klassische Serie und ihre Geschichten, und in der Mentalität der 1960er Jahre ergab sie voll und ganz Sinn. Es war so eine Art innere Grundeinstellung, die wir Amerikaner damals hatten: Wir gehen irgendwo hin, lösen ein Problem und ziehen dann weiter. Wie ein guter Roadmovie, und wir sitzen auf unserer schnieken Harley. DS9 war anders. Es war von der Struktur her eine stationäre Show, wo wir jede Woche denselben Schauplatz hatten. Damit war es viel natürlicher, dass wir eine Sendung hatten, in denen es um Konflikte ging. Wir hatten gar nicht den Luxus, irgendwohin zu gehen.“ (Robert Hewitt Wolfe, Drehbuchautor)
Erfolg in einem schwieriger werdenden Umfeld
Entgegen all dieser Widrigkeiten konnte sich DS9 über die Jahre dennoch zu einem insgesamt erfolgreichen Star Trek-Ableger mausern, der v.a. in kreativer Hinsicht seinesgleichen suchte. Aufgrund ihres frischen und mutigen Ansatzes ist die Serie auch Jahrzehnte nach ihrer Produktion weithin aktuell geblieben, vielleicht in mancher Hinsicht sogar an den Zeitgeist herangerückt.
Ganz sicher handelt es sich bei DS9 um eine der besten Science-Fiction-Serien überhaupt. Aus meiner persönlichen Sicht ist es nach TNG die letzte große Star Trek-Serie, die es mit Intelligenz, Einfallsreichtum, Herz und Risikobereitschaft verstand, einem der größten Franchises neue Wege aufzuzeigen. Warum das so ist, wollen wir im folgenden Abschnitt vertiefen.
Die Serie
>> Trek with an edge: Das Besondere an Deep Space Nine
An dieser Stelle möchte ich mir Allgemeinplätze und platte Lobeshymnen sparen, denn natürlich halte auch ich DS9 für eine herausragende, wenn nicht sogar die beste Star Trek-Serie von allen. Stattdessen möchte ich nun zum Wesentlichen vorstoßen und die Frage weiter verfolgen: Was macht DS9 eigentlich so besonders? Was hebt es bis heute so klar von den anderen Franchisevertreterinnen ab?
Zunächst würde ich schlicht festhalten: DS9 hatte den Mut, in vielerlei Hinsicht neue Wege zu gehen. Davon profitierte nicht nur das erzählerische Niveau, wenn es etwa um die moralische Fehlbarkeit einer Hauptfigur oder die Konflikte innerhalb der gemischten Besatzung ging, sondern auch die Vielfalt im Star Trek-Universum. Die Serie wurde so viel mehr zum direkten Spiegel unserer Gegenwart, ohne die moralisch-humanistische Erhabenheit des Kern-Treks aufzugeben. DS9 hat Star Trek in gewisser Weise ‚neu‘ erfunden und dem Franchise dadurch eine Frischzellenkur verpasst. Zugleich hat es aber immer in hohem Maße mit den Vorlagen TOS und TNG gearbeitet und eine organische Anschlussfähigkeit seiner Weiterentwicklungen sicherzustellen versucht.
Meiner Einschätzung nach lässt sich der Alleinstellungswert von DS9 drei groben Kategorien zuordnen, auf die ich mich im Folgenden konzentrieren will: Setting, Erzählung und Figuren.
Das Setting
Fester Schauplatz
DS9 hatte von vorneherein ein klar lokalisierbares Zentrum mit der im bajoranischen Heimatsystem stationierten namensgebenden Raumstation. Es hat zwar nicht darauf verzichtet, neue und wechselnde Handlungsorte einzuführen und fremde Welten zu besuchen, aber trotzdem gab es stets einen Rückbezug auf dieses Zentrum. Mit der festen Verortung der Serie ging die Möglichkeit einher, vertiefte Erzählungen zu schildern (man nehme z.B. die Bajor- und Cardassia-zentrierten Episoden) und sehr konkrete Entwicklungslinien zu verfolgen; alte Probleme kehrten manchmal in neuer Form zurück und beschäftigten Sisko und seine Crew weiter. Das für ST typische, manchmal etwas beliebige Alien-of-the-week-Prinzip wurde nachhaltig durchbrochen – auch nach der Einführung der U.S.S. Defiant als stärker mobiles Serienelement blieb das so.
Verlassen des utopischen Raums
DS9 hatte sich ein Setting gewählt, in dem es die Utopie (die hehre Föderationszivilisation) explizit nicht aufgeben muss, aber zugleich den Raum der Utopie mit dem bajoranischen Sektor als Hauptschauplatz verlässt. Dies gilt nicht nur für die äußeren Verhältnisse (neutraler Raum, Cardassianer und EMZ direkt ‚nebenan‘, Wurmloch als Tor ins buchstäbliche Unbekannte), sondern auch für das Innenleben auf der Station, wo eine ganze Reihe von Figuren vertreten sind, die nicht aus der Föderation kommen und dementsprechend auch nicht deren Prinzipien vertreten und teilen müssen. Zur Umgebung außerhalb von Utopia zählt übrigens auch das Wirtschaftliche. Auf der Erde und den Kernwelten der Föderation gehört Geld bekanntermaßen der Vergangenheit an, aber auf DS9 – jenseits des Föderationsraums – ist das anders. Goldgepresstes Latinum ist hier das Bezahlmittel der Wahl, offenbar die beste und kompatibelste Universalwährung.
Vom Rand der Galaxis zum Zentrum allen Geschehens
Startete DS9 als eine Serie in einem entlegenen, eher verruchten Winkel der Galaxis (man denke an Dr. Bashirs Schwärmerei von der „Wildnis“ im Pilotfilm), mauserte das dynamische Setting sich durch die enorm politischen Konsequenzen (Entdeckung des Wurmlochs, Kontakt und Konflikt mit dem Dominion, DS9 als Vor- und Frontposten) spätestens in der vierten Staffel endgültig zum gefühlten Mittel- und Brennpunkt allen Geschehens. Auf DS9 gibt sich so das halbe Who-is-who des Quadrantengefüges im Laufe der Zeit die Klinke in die Hand. Obwohl diese Entwicklung zu Beginn der Serie nicht zwangsläufig war, erscheint sie doch organisch-konsequent, eröffnete die Möglichkeit für stärker pangalaktische Handlungsstränge und unterstreicht die Bedeutung der titelgebenden Station.
Reflexion der neuen Weltlage
Paradigmatisch und politkulturell stand DS9 für eine neue weltpolitische Ausrichtung des Star Trek-Franchise – und das ist nicht gering zu schätzen. Seit Gene Roddenberrys Originalserie war das ST-Universum bis dahin in den Koordinaten des Kalten Kriegs und damit der Blockkonfrontation beheimatet gewesen. In TNG setzte Captain Picard, analog zu den USA in den 1970er und 1980er Jahren (eine Vielzahl von Abrüstungs- und Verständigungsabkommen mit der Sowjetunion wurden geschlossen), auf bi- und multilaterale Problemlösungen. Gerade Groß- und Supermächte sollten tunlichst nicht in kriegerische Auseinandersetzungen geraten, daher wurde der Diplomatie stets der Vorzug vor aggressiven Interventionen gegeben, wie sie noch in TOS durchaus Gang und Gäbe gewesen waren. Der Kalte Krieg hatte sich somit in friedliche Koexistenz verwandelt. Diplomatie sollte Konflikte entschärfen, lösen und zivilisieren, und sie sollte den Status quo sichern helfen. Das Star Trek-Signum des Völkerrechts war die Oberste Direktive. Mit dem Kollaps des sowjetischen Riesenreichs stand die Welt mit einem Mal vor einer gänzlich neuen Lage, und dies griff DS9 in komprimierter Form auf: Durch Überdehnung und allmählichen Niedergang der Cardassianischen Union ist ein Machtvakuum entstanden, der ehemals okkupierte Planet Bajor hat seine Freiheit zurückerlangt, und während Föderation und Cardassianer sich auf einen neuen, aber fragwürdigen Frieden zu bewegen, muss die allgemeine Lage allem voran stabilisiert werden. Die Föderation – stellvertretend für die Vereinten Nationen – springt in diesem Winkel des Weltraums ein, und tatsächlich ähneln ihre Aufgaben den typischen UN-Missionen der 1990er Jahre: Wiederaufbau, Friedenserhalt und Konfliktbewältigung. Dies ist wohlgemerkt nur der Ausgangspunkt der Serie, die sich zu einer durch und durch globalgalaktischen, vollends multilateralen Angelegenheit weiterentwickelt.
Herausfordernde Gegner
DS9 ist ungemein spannend, weil es nicht zuletzt mit bedrohlichen, dreidimensionalen Gegnern arbeitet. Sind es zunächst v.a. die Cardassianer (die wie die Bajoraner von TNG übernommen wurden), steigt ab der dritten Staffel das Dominion zum großen Kontrahenten auf. Das Dominion ist deshalb so gefährlich, weil es wie eine regelrechte Anti-Föderation erscheint und sich sehr gezielt den Mitteln von Tücke und Furcht bedient. Auch die Klingonen werden zeitweilig als entfesselte Bedrohung inszeniert, die in einer Zeit der Paranoia zu ihren aggressiven Wurzeln zurückkehrt, doch dann werden sie in der Not zu wertvollen Alliierten. Denken wir zudem an den Maquis: Die Rebellenbewegung und ihre Anführer sind im Sinne einer für die Sternenflotte schmerzlichen moralischen Zwickmühle ein interessanter Gegner, weil dieser ein Stück Gerechtigkeit stets auf seiner Seite hat. Lediglich die Romulaner kommen in der Serie zu kurz. Viele der antagonistischen Figuren sind nicht nur gut von den entsprechenden Schauspielern in Szene gesetzt, sondern ihre Motive sind, ob man sie nun richtig oder falsch finden mag, oft nachvollziehbar, sodass sie plastischer und authentischer wirken. Ich denke hier an Charaktere wie Weyoun, Michael Eddington oder auch Gowron (die Liste ließe sich noch erheblich verlängern). Das in meinen Augen aber beste Beispiel für einen herausfordernden Gegner ist und bleibt Gul Dukat, welcher schon im Pilotfilm als Widersacher aufgebaut wird. Der ehemalige Präfekt von Bajor – der den Abzug von seinem alten Posten nie wirklich verwunden hat – ist kein platter rachsüchtiger, gewalttätiger Schurke, wie er selbst bei Star Trek viel zu oft präsentiert wird. Nein, Dukat ist facettenreich, und obwohl er einen sehr dunklen, boshaften Kern hat, tritt er nicht immer als offensichtlicher Feind auf – ganz im Gegenteil. Dukat ist ein hochintelligenter, gewiefter Mann; er ist innerlich zerrissen, und aufgrund der sich rasch wandelnden politischen Umstände schlüpft er in verschiedene Rollen. So glaubt der Zuschauer zeitweilig, bei Dukat könnte eine Entwicklung zum Positiven eingesetzt haben (etwa wenn er vermeintlich selbstlos seine Tochter Ziyal aus einem Breen-Gefängnis befreit oder Siskos Besatzung bei mehreren Gelegenheiten hilft), ehe man mit Entsetzen feststellt, dass dies ein Trugschluss war (z.B. als sich herausstellt, dass Dukat Geheimverhandlungen mit dem Dominion geschlossen und Cardassia an den neuen Feind ‚verkauft‘ hat). Dukats Bösartigkeit entspringt seiner Verletzlichkeit, seinem gekränkten Narzissmus, und mit Donald Trump haben wir auch in der Realität vorgeführt bekommen, wohin solche charakterlichen Grundkonstellationen ein ganzes Land und sogar die Welt führen können. Dukat interpretiert seine Zeit als Bajors Präfekt idealisiert und verklärt, obwohl er gemordet, gefoltert, versklavt hat. Er funktioniert als Kontrahent so gut, weil er Sisko in vielen Dingen gleicht und dennoch völlig anders ist. Wie Sisko ist Dukat einflussreicher Kommandant und Vater, Soldat und (später) religiöse Figur. Aber er deutet diese Rollen völlig im Gegensatz zu Sisko (s. Kapitel Gul Dukat: Portrait eines vielschichtigen Schurken). Eine weitere Figur, deren persönliche Schwächen und innere Korrumpierbarkeit sich als sehr verhängnisvoll erweisen, ist Kai Winn Adami. Hinter der Fassade einer vermeintlichen Heiligkeit schlummert in der Kai eine abgründige, von Missgunst zerfressene Seele.
Religion und Mystik als authentische Elemente
Star Trek war immer sehr skeptisch in Bezug auf metaphysische Erscheinungen und Storyelemente. Entsprechend negativ bis lächerlich wurde Religion in den früheren Serien dargestellt, insbesondere in TOS. TNG zeichnete sich dadurch aus, dass es gänzlich frei von einem karmageladenen Umfeld daherkam. Roddenberry selbst gab zu Protokoll, dass Religion für ihn ein Teil des Problems heutiger Gesellschaften sei, da ihr Vorurteile, Obrigkeitsdenken und antiaufklärerische Einstellungen entsprängen. Der Franchise-Erschaffer betrachtete Religion als archaisches, spalterisches Element, das nicht zu seiner Vision einer rationalen, humanistischen Zukunft passt. DS9 schlug hier eine gänzlich andere Marschroute ein. Als bislang einziger ST-Serie gelang es ihr, spirituelle und mystische Bestandteile zu integrieren, ohne die Nase darüber zu rümpfen und zugleich die dezidiert rationale Star Trek-Perspektive niemals zu verlieren. Diese Anreicherung schafft mehr Nähe zu unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Dass Religion auch eine Quelle positiver Energien sein kann, führen uns die Bajoraner vor Augen, von denen wir gleich zu Beginn lernen, dass es ihr Glaube an die Propheten war, der sie die lange und harte cardassianische Besatzung ihrer Welt ertragen und aufopferungsvoll gegen die Peiniger kämpfen ließ. Und in der Konsolidierungsphase ihres Planeten nach dem Abzug der Cardassianer ist es ebenfalls die Religion, die eine enorme und zentrale Integrationsfunktion unter den zersplitterten und zerstrittenen Bewohnern Bajors einnimmt. Gerade Kai Opaka und Vedek Bareil repräsentieren Werte wie Barmherzigkeit, Altruismus und moralische Festigkeit. Gleichwohl lernen wir auch die Schattenseiten von Religion bzw. Religiosität anhand von Figuren wie Winn oder später sogar Dukat kennen, wenn nämlich Egoismus, Machtgier und Hass im Spiel sind. Ähnliches gilt unter anderen Vorzeichen für die Gründer, die den Vorta und den Jem’Hadar zwecks optimaler Kontrolle eingepflanzt haben, sie als Götter zu verehren. Hier ist Religion ein klares Machtinstrument. Immer wieder gelingt es DS9, eine Doppelperspektive von Wissenschaft und religiöser Weltanschauung bewusst herzustellen, sodass säkulare und glaubensorientierte Weltsichten ihre Berechtigung haben und nebeneinander stehen können. Selbst für Siskos Pfad des Abgesandten, seine Visionen und die Wahrheit über seine Existenz, die er letztendlich herausfindet, gilt dies (s. Kapitel Benjamin Sisko: Wanderer zwischen den Welten). Ob die von den Bajoranern angebeteten Propheten nun tatsächlich Götter oder schlicht außerhalb von Raum und Zeit lebende Wurmlochwesen sein mögen – es liegt am Betrachter, sich ein Urteil zu bilden. Dass mit Kira Nerys eine primäre Hauptfigur der Serie selbst tief im bajoranischen Glauben verwurzelt ist, unterstreicht die tolerante Grundbotschaft der Serie. Wissenschaft und Religion mögen sich immer wieder aneinander reiben, doch es gibt keinen Grund, weshalb sie am langen Ende nicht miteinander vereinbart werden könnten. DS9 ist in diesem Zusammenhang nachdenklich und prinzipiell vorurteilsfrei.
Umarmung des Star Trek-Universums
Es gehört zu den Ironien des Franchise, dass DS9 von einem Teil des Fandoms bis heute vorgeworfen wird, kein ‚richtiges‘ Star Trek zu sein. Dabei hat keine andere Serie Star Trek in seiner Ganzheit je wieder derart umschlossen wie DS9 es getan hat. Verschiedene Versatzstücke sind im Laufe dieses Textes bereits angesprochen worden. DS9 baute in TNG etablierte Völker und Mächte (Cardassianer, Bajoraner, Ferengi, Trill, im weiteren Sinne auch die Klingonen, Maquis etc.) zu vollwertigen Kulturen in einem politischen Geflecht aus, transferierte bekannte Charaktere (O’Brien und seine Familie, Worf, Gowron, Thomas Riker, Lwaxana Troi etc.) in die eigene Serienwelt und entwickelte alles gemeinsam organisch weiter. Insoweit ist etwa das Erscheinen Worfs auf der Station in Der Weg des Kriegers kein Bruch, sondern die ziemlich konsequente Fortsetzung eines Trends, der bereits früh von den Serienmachern verfolgt worden war. Und DS9s Umarmung des ST-Kosmos geht noch darüber hinaus: Man denke beispielsweise an das wiederkehrende Spiegeluniversum oder an eine ikonische Zeitreise-Episode anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums von Roddenberrys Vision (Immer die Last mit den Tribbles). Man denke an die Versuche, der Menschheitsgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert mehr Hintergrund zu verleihen (Gefangen in der Vergangenheit) oder an die mit Julian Bashirs ‚Enttarnung‘ zusammenhängende Thematisierung von genetischer Erweiterung (Dr. Bashirs Geheimnis, Statistische Wahrscheinlichkeiten), die bis zum berüchtigten Despoten Khan Noonien Singh zurückreicht (s. Kapitel Extensions of Man: Ein futuristisches Tabuthema). DS9 war insoweit immer Meta-Trek, und doch ruhte es sich nie auf all diesen Referenzen aus, sondern war klug genug, seinen ganz eigenen Storyweg einzuschlagen. Mehr kann man von einer kunstvollen und großen Franchiseshow nicht erwarten.
Die (epische) Erzählung
Komplexe Storyarcs
Keine andere Serie führte in ihrem Pilotfilm derart viele Handlungsstränge und damit mögliche Entwicklungslinien für die kommenden Seasons ein wie DS9. Umso bemerkenswerter ist, wie viele dieser Stränge im Prinzip bis zum Schluss weiterverfolgt oder zumindest immer wieder aufgegriffen wurden, wiewohl natürlich auch im Laufe der Serie neue Arcs hinzukamen. Die Komplexität der Erzählung ist von vorneherein weit dichter und epischer als bei anderen ST-Serien, weil die Macher in DS9 neben den klassischen Einzelepisoden in regelrechten Storybögen dachten, die schubweise – mal mehr, mal weniger stark – verfolgt werden und die Serie daher in Episodenpaketen betrachtet werden muss. Beispiele sind etwa die Folgen, die sich mit den (politischen) Wandlungsprozessen der bajoranischen Gesellschaft befassen, mit dem sich verstärkenden Maquis-Konflikt oder auch dem in Etappen vorbereiteten bzw. verlaufenden Krieg gegen das Dominion. Besonders herausragend sind in diesem Zusammenhang die in einem Stück erzählten Episoden rund um die Eroberung und Rückeroberung von DS9 zum Ende der fünften bzw. am Beginn der sechsten Staffel sowie die zehn zusammenhängenden Finalfolgen in der siebten Staffel. Man merkt deutlich, dass sich DS9 Zeit nimmt, die Geschichte langsam und sorgfältig zu entfalten; das ‚Pacing‘ ist dadurch von einer gänzlich anderen Sorte und Qualität. Die Macher bewiesen einen langen Atem und Geduld, gerade wenn man an die Entfaltung der Dominion-Bedrohung bis hin zum Kriegsausbruch denkt.
Politische Handlungen
TNG tat es bereits, wenn auch nur in einzelnen und abgeschlossenen Episoden – DS9 nimmt sich daran ein Beispiel und steigert sich enorm. Ein festes, verankertes Setting und die Möglichkeit zu zusammenhängenden Episoden, die Abschied nehmen von der berüchtigten ‚Roddenberry Box‘, eröffnen politische Handlungen, die DS9 von Anfang an weitestgehend gekonnt verfolgt. Zu nennen sind zunächst der Wiederaufbau und die schwierige Übergangszeit auf Bajor, die Konflikte mit Cardassia und dem Maquis (Entmilitarisierte Zone), das Säbelrasseln mit dem Dominion, die überaus dramatischen Umbrüche im Alpha- und Beta-Quadranten vor Ausbruch des Kriegs gegen die Macht von der anderen Seite der Galaxis und schließlich der Kriegsverlauf selbst mit all seinen Irrungen und Wirrungen. Dabei verzichtet DS9 auch nicht darauf, das Innenleben der Föderation stärker zu beleuchten und durchaus ihre Schwachpunkte und zweifelhaften Seiten zu zeigen – etwas, das andere Serien so gut wie vollständig unterließen. So brachte die Infiltration der Föderation durch die formwandelnden Gründer das innerstaatliche Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit auf das Tableau der Serie. Wenn man sich DS9 heute, über zwei Jahrzehnte nach der Ausstrahlung seiner Finalfolge, ansieht, so fällt auf, dass die Autoren einige politische und gesellschaftliche Entwicklungen in fast schon visionärer Voraussicht antizipiert haben. Einige Parallelen zur Gegenwart sind derart frappierend, dass es einem den Atem verschlägt. Nehmen wir nur das Zeitreiseabenteuer Gefangen in der Vergangenheit aus der dritten Staffel. In diesem begeben sich Sisko, Bashir und Dax zurück in das Jahr 2024. DS9 zeigt uns eine sozial und ökonomisch tief gespaltene und segregierte amerikanische Gesellschaft. Während eine reiche Oberschicht in Saus und Braus lebt, muss eine weitgehend unverschuldet arm gewordene oder arm geborene Unterschicht in vom Staat geschaffenen Ghettos ein unwürdiges Leben fristen. Es sind Zonen, aus denen man kaum jemals wieder herauskommt und die einen mit einem bleibenden Stigma versehen.
Dilemmata und der Umgang mit ihnen
An verschiedenen neuralgischen Punkten der Seriengeschichte werden die Helden mit Problemen konfrontiert, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Wenn es hart auf hart kommt, sind es sogar schwerwiegende moralische Dilemmata – die berüchtigte Wahl zwischen zwei Übeln. Für manche der Figuren bedeutet die Auseinandersetzung mit solchen Fragen eine existenzielle Konfrontation: Wie weit ist man bereit, für ein höheres Gut zu gehen? Inwieweit stellt man dafür seine Moral zurück? Wo verlaufen rote Linien? Kann man mit solchen Entscheidungen, in deren Zuge die eigene Ethik kompromittiert werden musste, langfristig leben? Inwiefern wird man davon verfolgt? Die Begegnung mit Dilemmaszenarien, mit moralischen Bürden, die die Charaktere zu tragen haben, ist zu einem echten Markenzeichen der Serie avanciert und verleiht ihr weit mehr Realismus, ja Authentizität. Zudem hält dies große Rückkopplungen für die Figurenentwicklung bereit. Die Drehbuchschreiber waren stets so klug, beides nicht voneinander zu trennen.
Krieg und seine Folgen
DS9 besichtigt allem voran in seiner zweiten Hälfte in der Rolle eines ausgemachten Antikriegsdramas die Bedeutung von Krieg als gesellschaftlicher und individueller Wirklichkeit. Totalitäre und revisionistische Mächte schließen sich zusammen, um die freien Gesellschaften zu vereinnahmen und zu unterwerfen; sie schrecken nicht davor zurück, Zivilisationsbrüche zu begehen. Wie geht man damit um? Versucht man sich im Sinne der Vermeidung von Krieg an Appeasement (also politischem Entgegenkommen) oder bleibt man standhaft-kompromisslos? Als der Krieg dann ausbricht und zu einer schrankenlosen militärischen Auseinandersetzung gerät, sind es andere Fragen, die ins Zentrum rücken. Damit einhergehend, werden v.a. direkte und indirekte Konsequenzen eines umfassenden, ausgedehnten Kriegs auf verschiedensten Ebenen beleuchtet. Hierbei fokussiert die Serie mutig und differenziert, inwiefern Kriege dazu führen, dass Menschen emotional und moralisch abstumpfen, den Feind zusehends entmenschlichen und damit ihre eigene Menschlichkeit zu verlieren drohen. Es geht aber auch, wie bereits angesprochen, um gesellschaftliche Veränderungen innerhalb der Föderation, die ja eigentlich ihrer Grundierung nach dem Krieg als Mittel der Politik abgeschworen hat. Im Angesicht der existenziellen Konfrontation mit dem Dominion und einer drohenden Niederlage sieht sich die Planetenunion gezwungen, ihre humanistisch-rechtschaffenen Grundsätze zu kompromittieren. In den Vordergrund schiebt sich ein kaltes Kosten-Nutzen-Denken, das die Integrität des interstellaren Völkerbundes untergräbt. So beleuchtet DS9, dass selbst eine vermeintlich fortschrittliche, utopische Gesellschaft im Angesicht von Verheerung und Tod zivilisatorisch zurückfallen kann. Zugleich präsentiert es aber auch Helden, die es sich in den Wirren des Kampfes zu keiner Zeit leicht machen und sich bewusst sind, was sie zu verlieren drohen, wenn sie der Verantwortungsethik nachgeben. Im Gegensatz zu prominenten Antikriegserzählungen wie Band of Brothers oder The Pacific setzt DS9 weniger auf die Macht der Bilder als auf die Macht der Erzählung und des Wortes.
Fehlbares Utopia
In DS9 wird das Bild der bislang so unantastbaren Föderation mit einigen erheblichen Makeln und Schrammen versehen. Dies erfolgte zeitgeschichtlich betrachtet ein Stück weit parallel zur zusehends kritischeren Auseinandersetzung und Diskussion über die Rolle der USA als ‚Hüter‘ der neuen Weltordnung nach dem Kalten Krieg. Diese Rolle wird anhand der Föderation, die in TNG noch eine Art gesegnetes Idyll war, durchaus erwachsen reflektiert. In der gesamten Serie zeigt sich die Planetenallianz fehlbar. Selten offen belehrend, konfrontiert uns DS9 mit kritischen Fragen, denen wir nachhängen können: Stolpert die Föderation durch eigenes Mitverschulden in den Krieg gegen das Dominion hinein, weil sie die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannte? Oder man denke an ihren Umgang mit den Cardassianern und dem Maquis. Um tunlichst Frieden mit einer ehemals verfeindeten Macht zu schaffen, war sie bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen – und ihre eigenen Bürger im Grenzgebiet aufzugeben. Dadurch schuf sie sich neue Probleme, die wiederum den Frieden mit Cardassia bedrohen und dessen Hunger auf Revision des Status quo weiter anfachen. Die Art und Weise, wie die Sternenflotte den Maquis kriminalisiert und verfolgt wie Schwerverbrecher, kann ebenfalls hinterfragt werden. Und wie selbstverständlich und unumstößlich ist eigentlich die innere Verfasstheit der Föderation? Zeigte uns der Putschversuch von Admiral Leyton nicht, dass eine gehörige Portion Angst und Paranoia dazu führen können, dass die Demokratie plötzlich als schwach und reversibel betrachtet wird, weil der Ruf nach dem vermeintlich ‚starken Mann‘ laut wird? Und mehr noch: Was im Herzen der Planetenallianz rund um die Machenschaften von Sektion 31 geschieht, zieht einem zum Ende der Serie sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Wie wir sehen, ist Sektion 31 nicht isoliert, nein, sie infiltriert Denken und Handeln der Sternenflotte und Föderationspolitik (s. Kapitel Sektion 31: Auf dunklen Pfaden verlieren wir uns). An verschiedenen Punkten der Serie wird also hart mit der Planetenallianz ins Gericht gegangen. Zwar wird DS9 keinen echten Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Föderation im Kern ihres Wesens für eine normativ gute, gerechte Ordnung steht, doch ist die Serie gespickt mit markanten Ambivalenzen, die der in TNG noch verklärten Zukunftsgesellschaft Grautöne und sogar Schattenseiten andichten. Dadurch wird deutlich: Nichts ist gottgegeben und selbstverständlich, und auch Demokratie und Werte müssen tagtäglich neu erkämpft und geschützt werden, gerade in Krisenzeiten. Auch im Hinblick auf diese Botschaft war DS9 in bemerkenswerter Weise seiner Zeit voraus.
World Building
Star Trek entdeckte seit seiner Entstehung unzählige fremde Welten, aber nicht immer war es gut, wenn es um die glaubwürdige Darstellung von Kulturen ging. DS9 ragt gerade hier heraus. Das fest verortete Setting brachte die große Chance, bestimmte Völker bzw. Weltenbündnisse wie die Bajoraner, Cardassianer und das Dominion vertieft und facettenreich zu betrachten. Mit dem Einstieg des von TNG importierten Worf in der vierten Staffel wandte sich DS9 auch der konsequenten Weiterverfolgung der klingonischen Gesellschaft zu. Zudem ist es ausschließlich das Verdienst dieser Serie, dass die Ferengi von einer Ansammlung von Witzfiguren und Halunken zu einer spannenden, alternativen und trotzdem unterhaltsamen Kultur ausgebaut wurden, die eine Menge ironischer Anspielungen auf die Auswüchse des US-amerikanischen Kapitalismus bietet.
Überwinden von Tabus
DS9 segelte produktionsmäßig eher im Windschatten von TNG und VOY. Vielleicht ist das einer der wesentlichen Gründe, weshalb die Macher freier waren als bei anderen ST-Serien, die üblichen Restriktionen innerhalb des Franchise zu überwinden. Teilweise wurden kreative Lösungen gefunden, ohne in direkter Weise mit den seit Roddenberry geltenden Vorgaben zu brechen, die auch dem neuen Franchiseoberhaupt Rick Berman am Herzen lagen. So wurden immer wieder neue Dinge ausprobiert, ohne die Grundprinzipien der Funktionsweise einer modernen Star Trek-Serie auszuhebeln. Beispielsweise galt es seit Roddenberry-Zeiten als ungeschriebenes Gesetz, dass es innerhalb des Hauptcasts keinerlei Konflikte geben durfte, weil eine moralisch geläuterte Menschheit präsentiert werden sollte – ein Umstand, unter dem die TNG-Autoren seinerzeit sehr gelitten hatten. Dieses Problem umgingen die Macher von DS9, indem sie besonders viele nicht-menschliche Vertreter in die Führungscrew einführten, die nicht der Sternenflotte angehörten und entsprechend auch nicht ihren Regeln und ihrer Ethik unterworfen waren. Auf ganz ähnliche Weise wurde auch eine Ökonomie an Bord der multikulturellen Station außerhalb des Föderationsraums eingeführt. Das Ergebnis war ein wirklichkeitsnäheres Setting, das dennoch problemlos Teil von ST bleiben konnte.
Die Figuren
Konsequente Charakterentwicklung