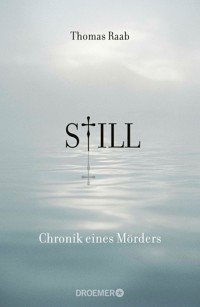
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nur eines verschafft Karl Heidemann Erlösung von der unendlichen Qual des allgegenwärtigen Lärms: die Stille des Todes. Blutig ist die Spur, die er in seinem Heimatdorf hinterlässt. Er zieht hinaus in die Welt, jenseits der Gesellschaft, schläft in verlassenen Ställen, bleibt im Verborgenen, lauschend, und ist doch mitten unter den Menschen. Durch sein unfassbar sensibles Gehör hat er gelernt, sich lautlos wie ein Raubtier seinen Opfern zu nähern, nach Belieben das Geschenk des Todes zu bringen, und doch findet er nie, wonach er sich sehnt: Liebe. Bis er auf einen Schatz stößt. Ein Schatz aus Fleisch und Blut. Lebendig. Ein Schatz, der alles ändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Raab
Still
Chronik eines Mörders
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nur eines verschafft Karl Heidemann Erlösung von der unendlichen Qual des allgegenwärtigen Lärms: die Stille des Todes. Blutig ist die Spur, die er in seinem Heimatdorf hinterlässt. Halbwüchsig zieht er hinaus in die Welt, jenseits der Gesellschaft, schläft in verlassenen Ställen, bleibt im Verborgenen, lauschend, und ist doch mitten unter den Menschen.
Durch sein unfassbar sensibles Gehör hat er gelernt, sich lautlos wie ein Raubtier seinen Opfern zu nähern, nach Belieben das Geschenk des Todes zubringen, und doch findet er nie, wonach er sich sehnt: Liebe. Verzweifelt ist seine Suche – bis er auf einen Schatz stößt. Ein Schatz aus Fleisch und Blut. Lebendig. Ein Schatz, der alles ändert.
Inhaltsübersicht
Widmung
Einmal ausgesprochen und gehört [...]
Teil 1 GLAUBE
1 Der Anfang
2 Die Herkunft
3 Die Geburt
4 Die Lösung
5 Der Untergang
6 Die Erkenntnis
7 Das Verschwinden
8 Charlottes Augen
9 Die Besucher
10 Die Behandlung
11 Der Ausflug
12 Die Erlösung
13 Der Friedhof
14 Erde zu Erde
15 Die Nacht
16 Der Aufstieg
17 Die Betrachtung
18 Menschenhand
19 Der Vollzug
Entscheidungssituationen, in denen der [...]
Teil 2 LIEBE
20 Der Tatort
21 Das Verhör
22 Die Anwesenheit
23 Die Suche
24 Das Herz
25 Fünf
26 Der Liebesakt
27 Der Schrei
28 Das Fieber
29 Der Blick
30 Der Schmerz
31 Die Trennung
32 Garten Eden
33 Die Finsternis
34 Aubruck
35 Die Berührung
36 Die Begegnung
37 Gewalt
38 Die Geduld
39 Die Hinrichtung
40 Die Flucht
41 Das Geben
42 Das Bekommen
Flucht ist ein Weg [...]
Teil 3 HOFFNUNG
43 Das Verschwinden
44 Die Suche
45 Das Vergessen
46 Das Erwachen
47 Das Buch
48 Neubeginn
49 Katharina
50 Das Sterben
51 Das Scheitern
52 Die Fürsorge des Paolo M.
53 Die Fürsorge des Horst S.
54 Q
55 Die Erlösung
56 Die Fürsorge des Karl H.
57 Tod und Auferstehung
58 Aubruck
59 Die Stadt
60 Der Freispruch
61 Der Wegweiser
62 Das Gemälde
63 Die Münze
64 Das Zeugnis
65 Loslassen
66 Der Lebensklang
67 Das Ende
Für Anna
Weil Du bist wie ich.
In Liebe, Dein Vater
Teil 1 GLAUBE
Einmal ausgesprochen und gehört lässt nichts mehr sich zurücknehmen, nie wieder, kein Wunsch, kein Fluch, kein Gebet.
1 Der Anfang
Der Tag, an dem Karl starb, war ein guter Tag.
Weißer Rauch stieg aus dem Backsteinschlot jenseits der Hügel und schob sich wie ein Brautschleier über den wolkenlosen Himmel. Darunter das Grün der Wiesen und Wälder. Saftig. Üppig. Ausgedehnt. In großer Ferne erst die sanfte Erhebung des Kalvarienberges, dahinter der immerfort qualmende Rauchfangzipfel der Stahlfabrik, und diese Stille. Nur der Vogelgesang, das Summen der Insekten, das Knistern der Stromleitungen, das Rauschen der Bäume, der Wind. Ein Ort des Friedens – für einen flüchtigen Moment.
Irgendwann nämlich ragt der erste Wegweiser aus dem Erdreich empor, deutet in nur eine Richtung, beschriftet mit Jettenbrunn. Vielleicht mag die Sonne scheinen, es klar sein und warm, dennoch wird sich von nun an über jeden Kieselstein, jeden Grashalm, über alles und jeden ein Schatten schieben, eine Wolke voll Erinnerung, düster, unheilschwanger. Denn inmitten dieses Friedens kam einst ein Kind zur Welt: Karl Heidemann.
Und dies ist seine Geschichte.
Es war der 6. Dezember des Jahres 1982, da durchschnitt ein Schrei die Stille der kleinen Siedlung. Schrill, andauernd, als wollte er sichergehen, wahrgenommen zu werden. Unüberhörbar drang er in die beheizten Stuben und brachte den Menschen Freude. Nichtsahnende Freude. Neues Leben bedeutete neue Hoffnung. Zu wenige Junge blieben, zu viele Alte starben, zu viele Häuser standen bereits leer.
Diesmal aber leerten sich die Jettenbrunner Häuser nicht aus Gründen der Landflucht, sondern aus Gründen der Dankbarkeit. Es galt, als wäre der Heiland geboren, an den Ort der Niederkunft zu pilgern. Denn dort im Hause Heidemann lag der mit Käseschmiere und Blut überzogene Karl in den noch feuchten Laken seiner glückerfüllten Mutter und brüllte um sein junges Leben.
Man kam der schneidenden Kälte wegen warm umhüllt aus allen Richtungen, mit Körben voll Brot und Wein, mit kleinen Gaben, gehäkelten Häubchen, bunten Strickwesten, das neue Leben willkommen zu heißen.
Man scharte sich dampfend um die Mutter, wärmte die Hände über dem glühenden Holzofen, wärmte den Körper mit dem ausgiebig zur Begrüßung gereichten Selbstgebrannten, betrachtete das lauthals, mit grässlichem Ton schreiende Kind und wusste auf Anhieb: Der Junge wolle die Brust, den Jungen dürste es nach Fencheltee, der Junge brauche den Schnuller, Daumen, Kissenzipf, der Junge benötige Frischluft, und nicht zu vergessen, der Junge müsse erst die zurückgelegte Reise namens Geburt verdauen: Bestürzung, Enge, Gewalt, Schmerzen, dann gleißendes Licht, klirrende Kälte, Todesangst, Entrissenheit, Erstickungsgefahr. Nur ganz wenigen wäre bei solch einem fundamentalen Ereignis auf Anhieb nach Lachen zumute, es gäbe also mit Sicherheit keinen Grund zur Sorge. Und Karl schrie immer noch.
Charlotte Heidemann hörte zu, aber sie verstand nicht, hielt nur behutsam ihr sich immerfort verkrampfendes Fleisch und Blut in Händen.
Ohrenbetäubend war der Lärm, den dieses kleine Wesen schon in den ersten Stunden seiner Existenz hervorzubringen imstande war. Ohrenbetäubend und von einer derartigen Klugheit. Jedem der Jettenbrunner dämmerte es schließlich, den wohlig warmen Gemächern der Jungmutter möglichst zügig den Rücken kehren zu sollen.
Und so geschah es.
Wie ein Liebkosen strich der eisige Wind über die pulvrig beschneiten Felder, während die Jettenbrunner unterwegs in ihre Häuser kleine, mit Tratsch gefüllte Atemwölkchen hin und her schickten.
Zwar liefen, wie stets um diese Jahreszeit mit Einbruch der Dunkelheit, die Rädchen der Stromzähler auf Hochtouren, denn erhellt waren die mit Lichterketten geschmückten Häuser, Adventsfriede aber wollte sich keiner einstellen. An diesem sechsten Dezemberabend kam in Jettenbrunn der heilige Nikolaus, begleitet von einem durch Mark und Bein gehenden, bis weit hinein in die Wälder, ja bis hinauf an die Spitze des Kalvarienhügels vernehmbaren Geplärre.
Karl schrie. Und schrie. Und schrie. Keine mütterliche Liebkosung, kein inniger Gesang, kein Anlegen an die Brust vermochten ihn zu trösten. Alles von ihm zum Ausdruck Gebrachte war Verschmähung. Während Charlotte Heidemann zärtlich auf ihn einredete, leise summend sein Köpfchen streichelte, verweigerte er aus seiner Mutter zu trinken, verweigerte er sich seiner Mutter zuzuwenden, verweigerte er sich von ihr beruhigen zu lassen. Er schrie und strampelte ohne Unterlass, bis er nicht mehr konnte, bis er weit nach Mitternacht schweißnass und eng mit Stoffwindeln umwickelt aus Erschöpfung in seinen ersten abgenabelten Schlaf fiel.
Behutsam wurde das ermattete Kind in sein Bettchen gelegt, friedvoll von Johann Heidemann geschaukelt.
Friedvoll und still.
Eine für alle erlösende Stille, für ganz Jettenbrunn, für Karls Eltern und für Karl selbst. Nur das Ticken der Uhr, das leise Reiben der sich über den Dielenboden bewegenden Wiege, der tiefe väterliche Atem.
Ein Schlaf nur von kurzer Dauer.
2 Die Herkunft
Karls Vater Johann Heidemann war ein kräftiger Mann, klein zwar, aber von der körperlichen Widerspenstigkeit eines Baumstumpfes. Stamm und Krone zu fällen ist keine Kunst, ein Wurzelstock jedoch krallt sich unnachgiebig in sein Erdreich und bleibt, als Sitzgelegenheit, als Basis neuen Lebens, als Stolperstein. Und über die Schattenseiten des Lebens wusste Johann Heidemann von Kindesbeinen an zu berichten.
Sechs Jahre war er alt, da kam eines Abends anstelle seiner Eltern ein Polizeibeamter nach Hause. Viel gab es nicht zu berichten, außer eben das für diese Gegend Übliche:
Die sanfte, hügelige Weite.
Die sich in zarten Bögen darüberschlängelnde Bundesstraße. Die darauf grob das Geschwindigkeitslimit ausreizenden Lastkraftwagen.
Das Überholmanöver eines solchen.
Die als unbefahren vermutete Gegenspur.
Das dennoch vorhandene Fahrzeug seiner Eltern.
Das nächste eiserne, zwischen staubigen Begrenzungspflöcken errichtete Gedenkkreuz.
Von da an wuchs Johann bei seinem Großvater und seiner schwerkranken Großmutter auf, mütterlicherseits, denn auch Johanns Vater hatte in jungen Jahren seine Eltern verloren. Kein Jahr später wurde aus seiner neuen Heimat ein reiner Männerhaushalt, mit neunzehn schließlich der Haushalt eines Alleinstehenden. Nur sein Nachbar, der ebenfalls auf sich gestellte Dorflehrer Alois Daxberger, war ihm als Bezugsperson geblieben. Zu diesem Zeitpunkt erledigte Johann Heidemann, wie viele Stammhalter dieser Region, bereits sein Tagewerk in der Siegensharter Stahlfabrik.
Den Rest seiner Zeit aber verbrachte er bevorzugt allein. Der Postwirt wurde ebenso gemieden wie jede dörfliche Festivität, jede Zusammenkunft, denn Reden war seine Sache nicht. Johann Heidemann sprach nur das Nötigste und ertrug den daraus resultierenden Ruf, geistesarm zu sein, ebenfalls mit Schweigen. Was sollte er den Jettenbrunnern schon entgegenhalten. Vergeudete Liebesmüh, wenn es den Menschen, um sich ein Bild von etwas oder jemandem zu machen, meist schon genügt, allein die Karikatur zu sehen.
Karls Mutter Charlotte, geborene Auböck, hingegen sprach zusätzlich das, was Johann Heidemann nicht sprach. Und sie sprach es mit einer Ausdauer, Schnelligkeit, Lautstärke, sägend, schrill, schmerzvoll oft, als liefen ihr gleichermaßen Zeit und Zuhörer davon. Dass Letztere blieben, lag allein an der kultivierten Heuchelei des Menschen namens Höflichkeit, denn Charlotte war die Frau des Johann Heidemann, und Johann Heidemann war trotz seiner ihm attestierten Zurückgebliebenheit der Mann für alle Fälle. Ein Hilfsarbeiter, der selbstlos anzupacken wusste, ob Baumschlag, Hausbau, Senkgrubenaushub. Ein Nutztier allerhöchster Güte, geschickt, unbezahlbar, und das für den aus Restanstand aufgedrängten Lohn eines Abendessens, eines Fläschchens Wein, einer Packung Pralinen.
Mit ihm galt es sich gut zu stehen, nichts zu erwähnen von der durch seine Partnerwahl über das Dorf gekommenen akustischen Plage. Einer Plage, der kaum zu entkommen war. Wochentags nämlich stand Charlotte an der Wurstschneidemaschine der betagten Lebensmittelhändlerin Adele Konrad, brachte wie auch die Tageszeitung den neuesten Tratsch in Umlauf, ließ zu der gewünschten Menge Schinken gerne noch ein paar Scheiben mehr auf das Papier gleiten, ergänzte zuweilen jedes vierte Stück Gebäck kostenfrei auf ein fünftes. All das, während um ihren Hals an einem Lederbändchen ein fünfzackiger Stern hin und her baumelte. »Den haben mir meine Eltern geschenkt! Er soll Böses von mir abhalten. Fünf ist meine Glückszahl!«, wusste bald jeder der Dorfbewohner. »Und? Hilft es?«, kam es oft verächtlich zurück.
»Uns jedenfalls nicht!«, war man sich im Kreise des Stammtisches einig. Belustigt. Grölend. Niederträchtig. Denn Charlotte war ein guter Mensch und inmitten der Obst- und Gemüsekisten, Mehl- und Gewürzsäcke, Wein- und Sauerkrautfässer zu Hause. Damit kannte sie sich aus. In ähnlichem Umfeld nämlich wuchs sie heran, weit im Norden des Landes, als Kind eines städtischen Kleinkrämer-Ehepaares, spezialisiert auf Zubehör und Reparaturen. Als das einzige Kind. Mutter und Vater mit grauen Arbeitsmänteln um den Leib, die Mutter Gertraud mit Perlen an den Ohren, der Vater Heinrich mit Pomade im Haar, das Geschäftslokal durchwegs aus polierten, nach Honig und Wachs duftenden Hartholzmöbeln, darin unzählige Schubladen verschiedenster Größe, wiederum darin unzählige Gegenstände. Stets hatten ihre Eltern alle Hände voll zu tun, und doch war ihnen das wichtigste Teilchen unter all den abertausenden die eigene Tochter. Der Stubenwagen, das Krabbelgitter, der Hochstuhl standen hinter dem Verkaufstisch, irgendwann auch Charlotte höchstpersönlich. Und niemals gab es ein: »Lass das, du kannst das nicht!«, ein: »Pfoten weg, du machst hier noch alles kaputt!«, sondern nur ein: »Du schaffst das schon.«
Und weil Mama und Papa Auböck eben kaum eine Hand frei hatten, schon gar nicht die erhobene, wurde Charlotte ein im Grunde ihres Herzens fleißiges, liebenswertes Wesen. Nur was nützt die größte innere Strahlkraft, wenn allein auf den äußeren Makel geachtet wird. So also war sie ihres Organes wegen seit Kindesbeinen an dazu verdammt, inmitten der Nägel- und Schraubenschachteln, Katzenstreu- und Rasendüngersäcken, Knopf- und Reißverschlussladen einsam aufzuwachsen, ohne Klarheit über die Ursache ihrer Verstoßung. Sie wusste nur: Da lag anders als bei ihren Mitschülern keine Einladung zu Kindergeburtstagsfeiern auf ihrer Schulbank, da stand bei Faschingsbällen niemand auf, um sie zum Tanz zu fordern, da trat kein junger Mann in den Laden, um sie auszuführen. Nichts.
Je größer die Zurückweisung, desto lauter, ungefragter ihr Ton. Und niemand da, der in Charlottes Schrillheit das darin verborgene Notrufsignal erkannte, dieses stumme, aber dennoch immer eindringlicher werdende: »Wer sagt mir endlich, was nicht stimmen soll mit mir? Wer, außer meine Eltern, nimmt mich an? Wer nimmt mich an der Hand?«
Und dann, ja dann kam Johann Heidemann.
Er von links des Weges, wortlos und allein.
Sie von rechts des Weges, wortlos und allein.
Beide entlang der rot-weißen Markierung.
Es war Charlottes erster Urlaub ohne Eltern. Sie wollte weg, weit weg, allem Trübsinn den Rücken kehren, woandershin, wer andrer sein, nur für zwei Wochen. Irgendwo im Grü- nen, weniger Menschen, weniger Zurückweisung, weniger Schmerz, so ihre Hoffnung. Eine kleine Pension am Fuße eines Kalvarienhügels, lange schlafen, viel spazieren, ein wenig den Stationsberg erklimmen, dem Kreuzweg folgen bis hinauf zum Gipfel, das Leiden Jesu abschreiten, das eigene vergessen, auf der anderen Seite wieder hinunter, dann durchs Gehölz, die Füße im Wasser baumeln lassen. Einen Weiher soll es geben.
Dann dieser laue Frühlingstag. Der Wald, der Duft des Bärlauchs, das Blühen, Sprießen überall, darin zwei Menschen. Charlotte und Johann. Fremde, die sich einen flüchtigen Gruß zunicken, aneinander vorbeigehen. Keine zwei Meter danach ein Anhalten. Von ihr. Von ihm.
»Verzeihung, wissen Sie, wo es zum Weiher geht?«
»Weiß ich.« »Das ist gut, ich bin nämlich nicht aus der Gegend.«
»Sondern?« »Sondern hier auf Urlaub.« »Hier! Auf Urlaub?«
Worauf der Weg gemeinsam fortgesetzt wurde. Johann hörte zu, Charlotte sprach, die ganze Strecke, hin und retour, sah immer wieder die Augen dieses fremden Mannes und erkannte erstmals mehr darin als in den Augen all der anderen. Sie sah das wortlose Interesse, die ungebrochene Aufmerksamkeit, nie die Langeweile, nie den Spott, nie den Verriss, an keinem ihrer weiteren Urlaubstage, und an jedem davon waren sie einander erneut begegnet, absichtlich, gemeinsam durch den Wald spaziert. Auch für Johann Heidemann schlüpfte diese Welt aus ihrem grauen Kokon, bekam die Sehnsucht nach Zweisamkeit plötzlich ein wahrhaftiges Gesicht. Ein Gesicht, das geduldig an seiner Seite blieb, bis zu dem Umkehrpunkt des täglichen Spazierganges: der Marienkapelle am Ufer des Jettenbrunner Weihers.
Ein Weiher, der schon viel zu Gesicht bekommen hatte: Menschen, die vergnügt aus dem Wasser kamen, Menschen, die verzweifelt ins Wasser gingen, Menschen, die im Sommer eine Abkühlung suchten, Menschen, die im winterlichen Eis einbrachen, Menschen, die an seinem Ufer die Unschuld verloren, Menschen, die in der Kapelle um die Vergebung ihrer Schuld baten, Menschen, die ihre Sehnsüchte der darin stehenden Marienstatue zuflüsterten, hier die Worte fanden für all das, worüber sie ansonsten mit niemand anderen sprechen konnten. Keine sechs Monate später sprach Johann Heidemann genau an selbiger Stelle vor aller Ohren ein bisschen mehr als sonst und nahm Charlotte Auböck mittels eines dermaßen schallenden »Ja« zur Frau; so laut hatte man ihn nie zuvor das Wort erheben gehört.
3 Die Geburt
Nie zuvor durfte man Zeuge solche einer Eintracht, einer wie füreinander geschaffenen Liebe werden. Man sah Johann und Charlotte spazieren gehen, täglich, sah sie auf offenen Futterwiesen Picknickdecken ausbreiten, sah Johann dies voll Liebe dokumentieren, bewegte Bilder, sah Charlotte auf der Wiese stehen, eine Schnur in der Hand, den Blick konzentriert emporgerichtet, ein kurzes Lächeln in die Kamera, ein Deuten gen Himmel, ein Papiervogel, weit oben, schwebend, Drachen steigen lassen wie Kinder, hörte ihr Lachen und etwas davon schummelte sich auf die Jettenbrunner Gesichter. Und selbst wenn gelegentlich ein aus Spott verstohlenes dabei war, es hatte doch seinen bewundernden Ursprung: Wie machen die beiden das? Kann ein gemeinsames Leben wirklich so harmonisch sein? Warum geht es nicht mir so?
Und bald suchte sich die Liebe ihren Weg zur bleibenden Zeugenschaft, ihren Weg zur Fleischwerdung. Es stellte sich Nachwuchs ein. Karl Heidemann. Und er kam bereits unüberhörbar, da konnte von Geburt noch gar keine Rede sein.
Groß war die Glückseligkeit der werdenden Mutter, überbordend ihr Frohsinn. Voll des Beifalls sah sie das Treiben des Gemahls, die Instandsetzung des alten Bauernhofes zu einer Oase des Wohlgefühls mit Weinkeller, Sauna, Ruhe- und Freizeitraum.
Dankbar ihr Erdulden des sich wochenlang Übergebenmüssens. Selig war sie, wenn das in ihr heranwachsende Leben sich streckte, seine Fäustchen, Beinchen gegen die mütterlichen Grenzen stemmte. Überbordend ihr Frohsinn, zum Ausdruck gebracht durch das unermüdliche Geträller ganzer Litaneien an Kinderliedern. Geträller mit gellendem Ton. Endlosschleifen oft derselben Zeilen:
Leise, Kindelein, leise! Der Mond geht auf die Reise.
Er hat sein weißes Pferd gesäumt.
Das geht so still, als ob es träumt.Leise, Kindelein, leise!
Stille, Kindelein, stille!Der Mond hat eine Brille.Ein graues Wölkchen schob sich vor,das sitzt ihm grad auf Nas und Ohr. Stille, Kindelein, stille!1
Und der noch ungeborene Karl tat es Charlotte mit seinen Möglichkeiten gleich: Tobte die Mutter, tobte auch das Kind, erhob die Mutter ihre Stimme, reagierte auch das Kind, boxte, trat, im Laufe der Schwangerschaft immer lebhafter, immer schmerzhafter. Erst wenn es Zeit war, zu Bett zu gehen, erst wenn Charlotte endlich schlief, wurde es endlich auch ruhig in ihr. Als wären Mutter und Kind eine Einheit, verbunden wie Herz und Seele, so erschien es ihr.
Und sie lag falsch. Völlig falsch.
Karl durchbrach diese Einheit mehr als einen Monat vor dem vorausgesagten Termin, verursachte eines Vormittags den befreienden Blasensprung. Dann ging es schnell, sehr schnell. Keine Endloswehen, keine Marter, als wollte Karl seiner Mutter nicht nur sich, sondern auch das Heroentum einer langen, schweren Niederkunft rauben. Ein Wunschkind, innig erwartet, und doch war dieses Zur-Welt-Kommen nichts anderes als der erste von Karl gesetzte Schritt einer nicht enden wollenden Flucht und Welle der Zerstörung. Ein verheerender, unüberhörbarer Schritt. Laut und unbarmherzig drang sein fortwährendes Gebrüll bis in den verborgensten Winkel des Dorfes.
Nach kurzer Zeit hatte die körperliche Konstitution des Neugeborenen einen besorgniserregenden Zustand erreicht. Unterernährt, entkräftet und heiser wand er sich in den Armen seiner über alle Maßen verzweifelten Mutter. Und immer wieder und wieder:
Leise, Kindelein, leise! …
Stille, Kindelein, stille! …
Doch kein leise, keine Stille. Jede Müh vergeblich. Auch gaben weder die täglichen Visiten des Dorfarztes Dr. Albrecht Hofstätter noch der Besuch des nächstgelegenen Spitals Aufschluss. Keiner vermochte eine sichtbare Erkrankung des Säuglings festzustellen. Bis auf das zu geringe Gewicht entsprach alles der Norm. Charlotte Heidemann hätte also, so wurde ihr erklärt, ein Schreikind zur Welt gebracht, so etwas käme vor, und so leid es allen täte, dafür gäbe es oft keinerlei medizinischen Befund, keinerlei Erklärung, schon gar nicht, wenn Schwangerschaft und Geburt so reibungslos verlaufen wären wie in ihrem Fall. Den Eltern wurde also angeraten, dem Kind viel Ruhe und eine Großzucht mit der Flasche angedeihen zu lassen.
Von da an trank Karl. Und er trank mit der Geschwindigkeit eines Eilboten, eines Flüchtigen, gierig, hektisch, als müsste er unmittelbar nach Einnahme der Wegzehrung weiter. Nur wo soll ein in Windeln und Stubenwagen steckender, allem und jedem ausgelieferter Säugling schon hin? Während Charlotte anfangs ihr tobendes Kind nicht aus der Hand zu geben bereit war, es verbissen an sich drückte, bis es völlig ermattet an ihrer Seite einschlief, wurde auch sie mit der Zeit immer schwächer.
»Überlass ihn doch kurz mir, damit du dich ausruhen kannst«, forderte Johann besorgt.
»Ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin«, war die Antwort, als hätte sie eine Ahnung, was kommen würde.
Zuerst aber kam Dr. Hofstätter, denn lange dauerte es nicht und Charlotte Heidemann war für alles zu schwach. Die unbändige Angst, die Ratlosigkeit in Anbetracht des eigenen hilflos wirkenden Kindes, der Kummer der Zurückweisung, der Schmerz der sich entzündenden Brust, das einsetzende Fieber brachen ihren Willen. Dr. Hofstätter setzte ihr Infusionen, verordnete strenge Ruhe, übergab Karl den kräftigen Armen seines Vaters, schickte die beiden hinaus. Da wurde Karl ruhig.
Und er blieb es, auch als sein Vater ihm eine Mütze überzog, ihn in Winterbekleidung steckte und mit Decken umwickelt ins Freie trat.
Finsternis und Stille. Spät war es geworden. Erstmals umgaben Karl Heidemann die frische, eisige Luft, der klare Sternenhimmel, das Treiben der Nacht. Groß wurden seine Augen, weit spreizten sich seine Nasenflügel, leicht neigte er sein Köpfchen, roch, lauschte, fühlte, neugierig und gierig zugleich, ein wenig wie ein Entdecker in fremdem Land, ein wenig wie ein Raubtier auf Jagd.
Für einen Moment blieb Johann im Mondlicht stehen, betrachtete seinen Sohn, atmete tief. Dann sah er es, und nichts Schöneres hatte er jemals zuvor zu Gesicht bekommen: Das Lächeln seines Kindes, kurz, reflexartig zwar, und doch von einer alles erwerbenden Eindringlichkeit. Schwarz funkelnde Augen hefteten sich suchend an den Blick des Vaters. Um dort zu bleiben.
In diesem Moment wurde Karl Heidemann ein zweites Mal geboren, erneut von seiner Mutter getrennt, abgenabelt in einem Sinn, den Mütter erst dann in dieser Endgültigkeit empfinden, wenn in Kinderzimmern nur noch die Kinderfotos an die einstige Anwesenheit der Abgebildeten erinnern.
Karl war zu diesem Zeitpunkt keine drei Wochen alt.
4 Die Lösung
Es kam der Tag, dem Charlotte Heidemann mit großer Angst entgegenblickte: Der Ruf der Stahlfabrik, das Ende der ständigen Anwesenheit ihres Mannes, das Auf-sich-allein-gestellt-Sein: Ihre eigene Familie zwecks Hilfe zu weit entfernt. Die Eltern ihres Gatten tot. Zu den Verwandten in der Umgebung nie ein Kontakt. Freunde, die man hätte fragen können, gab es keine.
Erstmals bekamen die Worte »Du schaffst das schon allein« eine völlig andere Dimension. Sitzengelassen, so fühlte sie sich, sitzengelassen mit sich und ihrem möglicherweise schweren Schicksal.
Und tatsächlich, der an die Wand gemalte Teufel kam, sprang aus seinem geistigen Schaubild heraus in die Realität, von wegen also, angekündigte Revolutionen fänden nicht statt. Diese fand statt, mächtiger, unnachgiebiger noch als befürchtet. Kein Bewegen der Wippe, keine Kindermelodien, kein Spaziergang mit dem Kinderwagen halfen. Undenkbar, Karl in ein Auto zu setzen und loszufahren, hoffend, das Vibrieren, das Rumpeln, die Fahrzeuggeräusche könnten als letztes Wundermittel dienen.
Erst abends, wenn Johann nach Hause kam, gab es Erleichterung. Noch in der Tür nahm er, verschwitzt von der schweren körperlichen Arbeit, seinen brüllenden Sohn in Empfang, band ihn sich fest eingepackt vor die Brust und marschierte los.
Wo anfangs erst nach ein paar Kilometern Ruhe eingekehrt war in den müden, kleinen, verkrampften Körper, reichten mit der Zeit bald wenige Schritte, reichte bald allein der strenge väterliche Körpergeruch. Dennoch folgte Johann stets derselben Route. Weit hinaus aus dem Örtchen bis an das Ufer des Weihers stapfte er durch den in diesem Jahr sich zäh haltenden Schnee, eins mit seinem schlafenden Sohn, eins mit sich. Es war seine Zeit, sein Tagesausklang, als wollte er all den Sorgen davonlaufen. Es war sein schneller Herzschlag, der dem Kind zur Zuflucht wurde.
Untertags und ab etwa zwei Uhr nachts aber gab es kein Entkommen, nicht für Karl, nicht für seine Mutter, nicht für ein ganzes Dorf. Immer mehr fand Charlotte schließlich in jenem einzigen Mittel Zuflucht, mit dem ihr Kind zumindest kurz zu besänftigen war: das Fläschchen.
Und weil Karl, als wüsste er keinen Ausweg, auch stets trank, wurde sein Geschrei als unstillbarer Hunger und immerwährende Aufforderung, gefüttert zu werden, gedeutet. Der immerwährenden Aufforderung folgte die stetig anwachsende Frequenz an Hauptmahlzeiten, der hohen Frequenz folgte der wachsende Körperumfang, dem wachsenden Körperumfang der tatsächlich wachsende Hunger, ein Teufelskreis. Karl Heidemann also bekam in mehrerlei Hinsicht das Maul gestopft, so lange, bis er randvoll abgefüllt nichts anderes mehr konnte, als wie betäubt in einen kurzen Schlaf zu fallen.
Dieses »gestopft« sah man dem Jungen recht schnell an. Schweigen dazu von Karls Vater Johann, was hätte er auch sagen sollen, Charlotte den einzigen kurzen Rettungsanker rauben?
Belustigung im Kreise des Stammtisches: »Wie es aussieht, geht das bei dem Heidemann-Brocken mit dem Auswachsen gewaltig in die falsche Richtung. Wenn der Bengel laufen kann, müssen wir unsere Speisekammern zusperren.«
So lange lustig hatte es die Stammtischrunde, bis diesem humorigen Reihum eine weitere Vermutung hinzugefügt wurde: »Vielleicht ist Karls Geschrei die Strafe für euer jahrelanges Schandmaul Charlotte gegenüber!«
Das saß, verbreitete sich wie ein hoch infektiöses Virus und nistete sich als Vorbote des Bösen in den Köpfen der Jettenbrunner ein.
Und auch Charlotte nistete sich ein: in ihrem Schicksal. Verkroch sich, erfüllt von dem Glauben, die Einheimischen gäben ihr die Verantwortung für das Gebrüll ihres Sohnes. Gebrüll, offenbar begründbar mit weiblicher Unfähigkeit, ja sogar einer schlechten Mutterschaft. Nur ist eben jeder Glaube aus Sicht der Andersgläubigen ein Irrglaube. Folglich lag Charlotte falsch, denn die Jettenbrunner mieden das Haus der Heidemanns aus anderen Gründen. »Krank ist der Bub, und zwar im Kopf! Und vom Teufel besessen ist er womöglich auch.«
So also trat auf beiden Seiten genau das ein, was für jeden Glauben gilt, der für sich selbst die Möglichkeit außer Acht lässt, in Frage gestellt zu werden: Er wurde zur Wahnvorstellung.
Bald mied Charlotte die Straße und Jettenbrunn Charlotte, mehr noch als sonst. Und obwohl jeder die Hilfsbedürftigkeit der jungen Mutter registrierte, obwohl so etwas wie Mitleid die Runde machte, so etwas wie Scham vor der Tatsache, mit einem Säugling nichts zu tun haben zu wollen, es änderte nichts. Gebückt, fluchtartig ging man Charlotte und Karl aus dem Weg, suchte bereits in großer Distanz eine geeignete Abzweigung, den erstbesten Gesprächspartner. Da wurden nur aus Angst, mit ihr ins Wort kommen zu müssen, jahrzehntelange Konflikte beendet, was dem Jettenbrunner Frieden in gewisser Weise wieder einträglich war.
Überhaupt setzten sich in den Köpfen seltsame Gedanken fest. Gedanken, die selbst denjenigen, die sie dachten, befremdend, ja unzulässig erschienen. Nur welche Kraft ist mächtiger, ansteckender, aufbauender oder zerstörender als die in den Köpfen der Menschen? So also gab man Karl an allem die Schuld, enthob den Jungen aller Rechte eines Säuglings, sprach ihm die Absichtslosigkeit ab und die Zurechnungsfähigkeit zu, ja den Mutwillen, die Gemeinheit. Etwas Beängstigendes, Schauriges läge in seiner Stimme, seinem Blick. Nichts also an Bösem hatte dieser lächerliche, an Charlottes Hals baumelnde fünfzackige Stern abhalten können, ganz im Gegenteil. Wie würde ein Kind, das beschlossen hatte, vom Anbeginn seiner Existenz dieser Welt vorwiegend ins Gesicht zu brüllen, handeln, wenn es erst des Handelns fähig wäre?
Vorerst aber handelte Charlotte Heidemann.
Zu zäh vergingen ihr die einsamen Stunden, zu unerträglich war ihr der permanente Lärmpegel, die allerorts spürbare Zurückweisung, zu verspannt, zu schmerzend der Körper von der täglichen Mühe des Herumtragens, Versorgens ihres Sohnes. Schier unmöglich wurde es bald, Windeln zu wechseln, ihr wie eine Larve immer fetter werdendes Kind hochzunehmen, es überhaupt zu berühren. Immer stärker wuchs Karls Widerstand, und bald wuchs auch ihr eigener, durchbrach dieses Bollwerk an mütterlicher Liebe und legte den ersten Funken an von Herzen kommender Abscheu.
Abscheu gegen diese stets grässlich verzogene, aufgeblähte Fratze. Sie stand am Ende ihrer Kräfte. Nur noch eines übrig an Sehnsucht: Flucht. Alles liegen, alles stehen lassen.
Eines Nachmittags vollzog sie diesen Wunsch, anders als gedacht.
Vom Sträuben ihres Kindes war sie mit blank liegenden Nerven zur Badewanne gelaufen, wollte den mit Kot verschmierten Rücken des Jungen säubern, wollte Karl behutsam in das warme Wasser legen. Nur daraus wurde nichts, und nichts daran war ein Versehen.
Vor ihr das wild mit seinen kleinen Fäustchen um sich schlagende Kind, in ihr der Zorn, die Verzweiflung.
Vor ihr das immer höher steigende Wasser, in ihr das Verlangen nach Befreiung, der Gedanke, die Tat.
Ein kurzer Blick ins Leere, dann ein Stoppen des Wassereinlaufes, ein Betrachten dieses Bündels Verachtung in ihren Armen, ein Vorbeugen, ein Aus-den-Händen-gleiten-Lassen.
5 Der Untergang
Karl erstarrte, spreizte seinen Körper gleich einem Fallschirmspringer und verschwand unter der Wasseroberfläche, wehrlos, mit aufgerissenem Mund, aufgerissenen Augen. Dumpf der Aufschlag seines Köpfchens gegen den Emailleboden.
Dann wurde es still.
Vom Grund der Wanne aus starrte Karl Heidemann zur Decke empor. Nur kurz der Schrecken in seinem Gesicht, dann Entspannung, als hätte er etwas begriffen. Keine Angst war es, die Charlotte an ihm erkennen konnte, auch nicht, als ihre Blicke sich trafen.
Ein einziges Luftschnappen entfernt von seinem Ende lag Karl regungslos vor seiner Mutter, ohne das Verlangen nach Rettung zu äußern, ohne seine Augen von ihr zu lösen.
Augen voll Stolz, als würde er wissentlich dieses noch so junge Leben aufs Spiel setzen wollen, nur um seiner Peinigerin den Hilferuf zu verwehren.
Ein Frösteln im Nacken, den kalten Schweiß auf der Stirn riss Charlotte Heidemann, wie aus den Klauen des Teufels befreit, ihr Kind zu sich empor, presste es an ihr Herz, lief unter Tränen ins Schlafzimmer, trocknete es ab, zog es an, steckte es ins Bettchen, unentwegt flüsternd: »Verzeih mir, bitte verzeih mir!«, und stürmte ins Freie, hinaus in die Kälte.
An ihrem Körper nur ein dünnes Kleid, an ihren Füßen nur Strümpfe, darüber die Pantoffeln, lief sie wie eine Getriebene den schneebedeckten Weg entlang. Nur, was nützt schon die Flucht, wenn vor sich selbst davongelaufen wird.
Dass Flucht allerdings helfen kann, wenn vor anderen davongelaufen wird, wusste der neben seinem knisternden Kachelofen aus seinem Fenster blickende Nachbar der Heidemanns, Alois Daxberger. Fahnenflucht in seinem Fall. Umgeben von Toten und Kindern saß er im Jahr 1944 fern der Heimat in einem Schützengraben, sein Maschinengewehr im Anschlag, und befahl jenen paar Knaben neben sich, die man ihren Eltern entzogen hatte, um mit stolzgeschwellter Brust an dem teilnehmen zu lassen, was als siegreicher Endkampf propagiert wurde, ihre Waffen, ihre Uniformen abzulegen und, so schnell ihre Beine sie tragen mögen, davonzulaufen. Vierzehn-, fünfzehnjährige Buben, die mit halben Leibern auf den Feldern lagen und nach ihren Müttern schrien, hatte er bereits genug gesehen. Höchste Zeit, dieser gottlosen Welt den Rücken zu kehren, denn egal wohin der Tod ihn führen würde, so seine Gewissheit, schlimmer könne es nicht kommen. Keine Stunde nachdem die Kinder zu laufen begonnen hatten, schlug eine Granate ein, neben ihm, und für Alois Daxberger war es nicht wie gewünscht mit dem Leben vorbei, sondern mit der vollen Funktionstüchtigkeit seines Hörvermögens und dem Vorhandensein seiner Beine.
Heimgekehrt war er in Jettenbrunn als einer der wenigen männlichen Überlebenden seiner Generation, ein Dorfsterben der anderen Art, und lange benötigte er nicht, um feststellen zu müssen: Sosehr ihm einst der Krieg Bitterkeit gegeben und im Gegenzug dazu alles genommen hatte, seine Angehörigen, seine Beine, sein Gehör, manchmal war es absurderweise genau dieser Mangel, der ihm hier das Leben etwas weniger beschwerlich erscheinen ließ. Eines nämlich wusste er seit seiner Zeit als Soldat: Gut ist es, nicht überall dabei sein zu müssen. Denn so wie überall galt auch hier: Viel leichter, als ein freiwilliger, akzeptierter Außenseiter zu sein, ist es, ein unfreiwilliger, inakzeptierter zu werden.
Besorgt legte Alois Daxberger also an diesem Nachmittag seine Lektüre aus der Hand. Vor seinem Fenster war Charlotte vorbeigelaufen, kaum bekleidet, hinein in die Nacht, hinaus aus dem Ort. Unmöglich, ihr hinterherzueilen. Zurückgeblieben das schreiende Kind.
Charlotte Heidemann lief und lief und lief, verlor ihre Pantoffeln, verlor die Kräfte, stürzte und blieb liegen, in dem Wissen, so viel von sich gar nicht abstreifen zu können, um das eine verlieren zu können: die Erinnerung an das eben Geschehene, den an ihre Fersen gehefteten eigenen Schatten.
»Karl!«, flüsterte sie, zusammengekauert, die Hände vor ihrem Gesicht, die Nässe auf ihrer Haut. Dann begann sie zu beten, immer wieder dieselbe Stelle: »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.«
Und je länger sie sprach, desto sinnloser erschien ihr dieses Bitten. Keine Selbstvergebung mehr möglich, für den Rest des Lebens.
Wie ein schauriges Bett, weich und endgültig, empfing sie die Schneedecke. Einfach hierbleiben, einschlafen, ein allerletztes Mal, bis nichts mehr zu fühlen, zu hören sei.
Und genau dieses Hören ließ Charlotte Heidemann still werden, denn tatsächlich: Es war still. Zu still. Selbst hier, mit Blick auf die klein gewordenen Umrisse ihres Hauses müssten sie zu vernehmen sein: Karls Schreie. Doch nichts. Kein Ton.
Panisch nahm Charlotte Heidemann den Weg zurück in Angriff, stolpernd, hellwach, das Schlimmste vor Augen: Ihr starres Kind, sie die Täterin, das Leben verwirkt. Und tatsächlich, Karl lag in seinem Bettchen, die leicht gebeugten Arme wie ein Gekreuzigter mit den Handflächen nach oben weggestreckt, das Gesicht entspannt, der Kopf zur Seite geneigt, die Augen zu. »Ich hab dich umgebracht, ich …!«, fiel sie flüsternd auf die Knie und weinte. Bitterlich.
»Er schläft.« Brüchig, sanft die aus dem Hintergrund den Raum erfüllende Stimme. Alois Daxberger.
»Er schläft«, wiederholte Charlotte wie in Trance, ihre Hand auf Karls Körper. Kaum spürbar die Bewegung des wattierten Schlafsacks. Auf und ab, auf und ab.
»Alois«, kam Charlotte langsam zu Sinnen, flüsternd, »wie bist du herübergekommen, ohne Rollstuhl?«
»Von mir zu euch geht es bergab. Eine Rutschpartie, wenn Schnee liegt. Und für das Stück herein in die Stube sind meine Arme noch kräftig genug! Alles in Ordnung mit dir?« Ohne Vorwurf sein Blick.
»Ich musste mal an die Luft!«
»Das ist zu verstehen. Karl war jedenfalls ruhig, als ich zur Tür herein bin, und ist dann eingeschlafen, vor meinen Augen. Ganz friedlich.«
»Wie? Eingeschlafen?«
»Wie und warum, das weiß ich nicht, Charlotte. Hauptsache, er ist, oder?«
»Ja, Hauptsache, er ist.« Leise Charlottes Stimme. Erstmals also war Karl in ihrer Gegenwart nicht völlig geschwächt von seinem ständigen Gebrüll, seinem Überfüttertwerden ruhig geworden, sondern aus anderem Grund. War es der Schock des Untertauchens, das Wasser?
»Sei so gut, holst du den Rollstuhl und bringst mich bitte zurück.« Müde die Augen des Alois Daxberger. Und als die Stube allein wieder gefüllt war mit Mutter und Kind, begriff Charlotte Heidemann, erkannte sie ihren Denkfehler. Und erst jetzt wurde ihr kalt, unbeschreiblich kalt.
»Ich!«, flüsterte sie, sank auf die Knie, klammerte sich an die Gitterstäbe, als wären es ihre eigenen: »Bin ich der Grund deiner Schmerzen?« Karl war eingeschlafen, nicht nur ohne Gebrüll, sondern auch ohne ihre Gegenwart.
6 Die Erkenntnis
Als Johann Heidemann an diesem Tag nach Hause kam, fand er seine Frau in einem besorgniserregenden Zustand vor: Eine leere Likörflasche in der Hand, den Inhalt teils über den Boden verschüttet, saß sie in nasser Kleidung an Karls Bettchen gelehnt auf dem Teppich, den Kopf vorgeneigt, hinter ihr in tiefem Schlummer das um diese Zeit ansonsten niemals schlafende Kind.
Die Innentüren alle offen, auch die ins Badezimmer, darin die mit Wasser und Kot gefüllte Wanne. Johann wusste nicht: Wurde Karl Alkohol verabreicht? Schläft er deshalb? Schläft er einfach so? Was war hier geschehen? Johann wusste nur: Zeit zu handeln.
Vorerst aber handelte Karl. Noch am selben Abend.
Fürsorglich hatte Johann Heidemann seine Frau ins Bett getragen, versucht, ihrem Lallen, ihrem Dahinphantasieren Sinn zu entnehmen, da ließ auch wie gewohnt wieder sein Sohn von sich hören, und höchst Sonderbares war zu beobachten.
Noch lange bevor ein Mensch seine Existenz begreifen kann, greift er nach ihr. Bisher aber hatte Karl nie den Eindruck erweckt, irgendwelche ihm entgegengestreckten Finger oder die neben seinem Köpfchen liegenden Stofftiere berühren zu wollen, hatte sich anfangs nur gestreckt, suchend, tastend, immer präziser in Richtung seiner Stirn, seiner Schläfen. An diesem Abend schien es, als wären ihm durch das Abtauchen, durch das Eindringen des Wassers, endlich die Koordinaten bewusst geworden. Karl Heidemann fand sein Ziel, fand Halt: an seinen Ohren.
Und er griff ab diesem Zeitpunkt nach nichts anderem mehr, brüllend wie eh und je. Was anfangs noch einem belanglosen Fingerspiel glich, entpuppte sich schon tags darauf als Akt der Gewalt. Als wollte er sie ausreißen, so zog er daran, als wollte er sie abschaben, so grub er seine Nägel in sein noch weiches Fleisch. Blutig bald sein Bettchen, seine Matratze.
Charlotte blieb in Gegenwart des vor ihren Augen ausbrechenden Wahnsinns gar nicht die Gelegenheit, in ihren eigenen zu verfallen. Denn verklebte sie Karl die Blessuren oder verband ihm den Kopf, zerrte er so lange daran, bis seine wunde, rote Haut wieder frei lag, um noch wunder zu werden.
»Vielleicht das Wasser!«, brach Charlotte schließlich unter dem Druck der ständigen Fragen ihres Mannes das Schweigen und gestand, Karl wäre ihr tags zuvor in die Wanne gerutscht, untergetaucht. Darum ihre Verstörung. Vielleicht wäre etwas über den Gehörgang in sein Ohr geraten, verursache Schmerzen. Und keine Vorstellung hatte Charlotte über das Ausmaß dieser Schmerzen.
So also kam Karl auf dringendes Anraten des jungen, ortsansässigen Allgemeinmediziners Dr. Albrecht Hofstätter erneut in ein Krankenhaus, und diesmal wurde ihm geholfen. Anders als vorgesehen.
Keine Diagnose zu stellen. Nicht auf Anhieb, nicht nach genauerem Hinsehen. Ein Rätsel war es den Ärzten, dieses gewaltsame, selbstzerstörerische Handanlegen. Folglich wurde keine Bemühung ausgelassen, wurde Johann mit seinem brüllenden Sohn durch ein Gebäude ungeahnten Ausmaßes geschickt, von einer Untersuchung zur nächsten. All das, während Charlotte zu Hause den ersten Tag seit Karls Geburt für sich allein verbringen konnte.
Endlose Gänge, Stockwerke über Stockwerke, Fahrstühle neben Fahrstühlen, metallische Kästen, die Menschen auf und ab schoben. Und genau in einem dieser geschlossenen Räume passierte es. Nur Vater und Sohn darin. Surrend, vibrierend die Fahrt abwärts in eine der Kellerebenen.
Plötzlich ein außerplanmäßiger Halt. Ein kräftiger Ruck. Ein Knarren. Ein Flackern des Lichts. Dann Stillstand. Kein Mucks mehr. Finsternis.
Johann Heidemann griff um sich, erfüllt von Angst. Stecken geblieben mit seinem schreienden Kind. Doch Karl schrie nicht mehr, lag ruhig in den Armen seines Vaters. So ruhig, als wäre er weit hinausgetragen worden, immer tiefer hinein in den Wald.
Johann aber war nicht gelaufen, nur einen einzigen Schritt hatte er getan, aus dem Lärmen des Krankenhauses hinein in die Isolation einer abgeschlossenen Zelle.
Wieder ein Flackern, ein Ruckeln, dann Licht, Bewegung, Weiterfahrt. Ein kurzes Stück nur. Denn Johann betätigte, ohne zu überlegen, die Stopptaste, zwang, noch bevor Karl erneut zu weinen beginnen konnte, dem Gefährt die nächste Pause auf. Keine Erklärung wusste er für die Ursache dieser schlagartigen Zufriedenheit seines Sohnes, der plötzlich die Hand nicht zu den Ohren, sondern den Daumen in den Mund führte. Was war hier anders?
Johann Heidemann sah sich um, irgendwo zwischen Untergeschoss zwei und Untergeschoss drei, dachte nach, ließ die letzten Wochen an sich vorüberziehen, verglich die Lebenssituation seines Kindes mit den gegenwärtigen Umständen.
Warum diese plötzliche Ruhe? Und er stand lange, sehr lange.
Dann verstand er.
Dann verstand er alles, dann wurde ihm klar: Keinem der Ärzte, deren letzte Strategie es nur sein könne, seinem Sohn Schmerz- und Beruhigungsmittel zu verabreichen, ohne zu wissen, wogegen, wäre es möglich zu helfen.
Mit dieser Einsicht beendete Johann den erzwungenen Halt, kehrte ins Erdgeschoss zurück, trug sein mit Öffnen der Tür wieder brüllendes Kind zum Wagen. »Gleich, mein Junge, gleich hast du ihn wieder, deinen Frieden! Nur noch den Heimweg musst du überstehen!«
Voll Hoffnung nun die Fahrt hinaus aus der Stadt, durch das immer spärlicher besiedelte Land, eilig, ohne Rücksicht auf Geschwindigkeitsbeschränkungen, ohne Zweifel an seiner Theorie. Kaum zu Hause angelangt, stürmte er mit dem Bündel Verzweiflung in seinem Arm durch das Wohnzimmer, nahm Charlotte an der Hand, den Kellerschlüssel an sich, stieg hinunter, betrat die kleine Sauna, schloss die Tür.
»Johann, was sollen wir hier?« »Bleib einfach ruhig und warte.« Und tatsächlich, wie zuvor dieselbe Reaktion: Karl wurde mit offenen Augen still, so still, wie ihn Charlotte im Zustand völligen Wachseins noch nie erlebt hatte, tief unter der Erde, in einem abgeschlossenen, fensterlosen Raum, seinen Blick an das Gesicht des Vaters geheftet, dankbar fast. Dann schlief er ein.
»Er braucht Ruhe. Wahrscheinlich brüllt er aus Verzweiflung über all den Wirbel, der um ihn ist.« Flüsternd der Ton, und wenngleich Johann in diesem Augenblick mit seiner Vermutung richtiglag, hatte er doch nicht die geringste Vorstellung von dem Ausmaß seiner Theorie, von der für Karl vorhandenen Wirklichkeit und den sich daraus ergebenden Folgen.
Denn von solch feiner, unausnehmbarer Empfindlichkeit war Karl Heidemanns Gehör, wie es in keinem Buch der Rekorde zu finden, keinem medizinischen Sammelsurium menschlicher Mutationen nachzuschlagen ist. Er hörte den Flügelschlag eines Schmetterlings, hörte das Rauschen der Wipfel des weit entfernt gelegenen Waldes, hörte eine Blindschleiche durchs Gras gleiten, er hörte zwar keinen fremden Gedanken, aber er hörte den Atem und das Pulsieren des Blutes, deren Zusammenspiel oft mehr verrät als jedes Wort. Wie jedes ungeborene Kind hörte auch Karl im Fruchtwasser das Gurgeln, Gluckern der mütterlichen Magen- und Darmgeräusche, den mütterlichen Herzschlag, die mütterliche Stimme, nur für ihn war diese Stimme ein messerscharfes, schneidendes Eindringen, dieser Herzschlag ein nicht enden wollendes Donnern, das Strömen des mütterlichen Blutes ein reißender Sturzbach, jedes Aufsetzen ihrer festen Schritte ein dröhnendes Hämmern.
Nichts anderes wollte er, als dieser immer enger werdenden Folterkammer zu entfliehen, und wäre es ihm möglich gewesen, er hätte den Schöpfer verflucht für die Marter der frühen vorgeburtlichen Entwicklung des Gehörsinns. Er hätte den Schöpfer verflucht für die ihm dadurch geraubte Liebe. Vielleicht nämlich hätte er ihn ertragen, für ein paar Tage, all diesen Lärm im Inneren seiner Mutter, nicht aber für so elend lange Wochen. Vielleicht hätte er unter anderen Umständen ein Zuhause finden können in den mütterlichen Armen, einen Rückzugsort. Stattdessen aber fand er auch, auf die Welt gekommen, keinen Frieden vor, sondern nichts als ein Wüten, ein ununterbrochenes Wüten. Und nun stand Johann Heidemann, seinen Sohn im Arm, inmitten der Abgeschiedenheit des Kellers, und war voll Hoffnung. Mit der freien Hand zog er seine Frau zu sich und hauchte ihr nichtsahnend ins Ohr: »Alles wird gut.«
Ein Lächeln rang sie sich ab, ein Nicken, von dem sie bereits ahnte: Es ist ein Irrtum.
Von diesem Tag an wurde es still in Jettenbrunn.
7 Das Verschwinden
Karl Heidemann war von heute auf morgen aus dem Ortsbild verschwunden, sowohl optisch als auch akustisch.
Selbiges galt für seine Mutter.
Anfangs fragte man nicht, nahm die Abwesenheit erleichtert zur Kenntnis, genoss die Ruhe. Krankheit vielleicht?
Doch nach einigen Tagen immer noch dasselbe Bild: Dunkelheit im Kinderzimmer, kaum noch Licht im Haus, Dauerbeleuchtung im Stiegenabgang, abends ein eilig heimkehrender Johann, Tür auf, Tür zu, kein Spaziergang mehr so wie sonst.
Irgendwann stellte man ihn zur Rede, durchaus mit Besorgnis, vernahm ein: »Alles in bester Ordnung, dem Kleinen geht es endlich gut, er hat es nur eben gern ein wenig ruhiger!«, vermutete aber tatsächlich den ausgebrochenen Wahnsinn der Eltern. Wem auch sei es zu verübeln, gebrandmarkt von den so schweren letzten Monaten, der Wirklichkeit nicht ins Auge blicken zu können, zu wollen? Denn höchstwahrscheinlich, so fraß sich das Gerücht durch die Reihen wie die Miniermotte durch Rosenblätter, läge irgendwo im Hause Heidemann der Leib des so ruhig gewordenen, leblosen kleinen Karl herum, vielleicht sogar einbalsamiert und aufgebahrt in den Tiefen des Kellers.
Und Karl lag tatsächlich dort, inmitten des Saunabereiches, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Er stemmte sich in seinem Bettchen, seinem Laufstall hoch, saß bald, stand bald, gewann an Ichbewusstsein, gewann an Neugierde, Fertigkeiten, gewann die Erkenntnis, den größten Lärm und zugleich Schmerz selbst verursacht zu haben: durch sein eigenes Geschrei. Nur eines verlor er mit einem Schlag, und er verlor es trotz des ständig ihn umgebenden Rauschens der Heizungsrohre, Wasserleitungen, trotz des Surrens der Neonlampen, Tiefkühltruhe: Die Notwendigkeit, seine Stimme erheben zu müssen.
Von nun an also brüllte er nicht mehr. Schwieg. Kein Ton, kein Wort mehr aus seinem Mund, schon gar nicht jenes, das Eltern, kaum bringt ein Kind erste Laute über die Lippen, mit täglicher Sehnsucht erwarten: Wird aus dem Dada und Baba irgendwann das erhoffte Mama, Papa? Es wurde nicht.
Was keineswegs bedeutete, dass Karl nicht sprach.
Seine Augen, die Stellung seines Kopfes, die Haltung seines Körpers, die stets langsamen Bewegungen seiner Arme, seines vom fehlenden Tageslicht erblassten, vollen Gesichts: Immer verständlicher wurde sein Kommunizieren, immer leichter fiel es ihm bald, sich mitzuteilen, minimalistisch zu verdeutlichen, allein sein, in Ruhe gelassen werden zu wollen. Nur ein Wegdrehen, eine kleine Mimik, wenn seine Mutter die Stimme erhob, im schlimmsten Fall ein langsames An-die-Ohren-Pressen seiner Handflächen.
Stille Ablehnung, das war es, was Charlotte entgegenschlug. Unentwegt. Und das traf. Es traf sie mehr als all das bisher Geschehene. Bald wurde ihr die im Haus eingekehrte Ruhe mehr Fluch als Segen. Denn vorbei der im Lärm verborgene Mangel an Direktheit, an klarer Botschaft, vorbei der Trugschluss: »Er brüllt deshalb oder deshalb, oder deshalb. Ich jedenfalls bin es nicht!« Erst das Schweigen, die wortlose Abkehr, erklärte alles, brachte Klarheit. Unmissverständlich.
Kein Blick, kein Lächeln, kein Zeichen der Zuwendung, nichts. Nicht beim Wickeln, nicht beim Füttern, nicht bei all den Dingen, die zwangsweise so lange der mütterlichen Nähe bedürfen, bis ein Kind sauber ist, vieles alleine kann.
Und Karl lernte schnell, sehr schnell.
Noch bevor er laufen konnte, krabbelte er zu seinem Töpfchen, zog sich Hose, Leibchen an und aus, schlug seiner Mutter den Löffel aus der Hand, ergriff ihn selbst, um sein eigener Herr zu sein, um Distanz zu schaffen, immer größere Distanz. Nur eine Möglichkeit blieb Charlotte, Karls Nähe zu spüren, so absurd sie ihr auch schien, so schaurig und unverständlich: »Badezeit, mein Schatz!«
Aufmerksamkeit in seinem Gesicht, ein Strahlen fast, ein Emporstrecken der Arme.
»Willst du zu mir? Na, dann komm.« Das Glück der Mutter, für einen Moment. Ihr Kind in den Armen ging Charlotte ins Bad, verschloss ihm mit knetbarer Masse die Ohren, während plätschernd die Wanne einlief, strich ihm über den Kopf, drückte ihn an sich: »Willst du hinein, ja, willst du? Na, dann ab mit dir ins Wasser.«
Dort saß er ein Weilchen, aufrecht, stolz wie inmitten einer selbstgebauten Seifenkiste, seine kleine, aufgeblasen wirkende Hand an den Rand gelegt. Irgendwann ein langsames Zurücksinken, ein Betten des Kopfes auf die Oberfläche, als wäre sie ein Kissen. Das Wasser stieg ihm über die Ohren, bis hinauf an den Augenrand. Ein kurzes, gestrecktes Schweben, ein tiefes Luftholen, das Lösen der Hand, dann ein Abwärtsgleiten, die Lider offen.
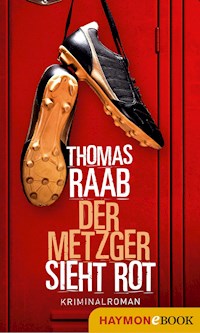


![Walter muss weg [Frau Huber ermittelt, Band 1] - Thomas Raab - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6449af66891644fec5c3bf512e0e7e71/w200_u90.jpg)
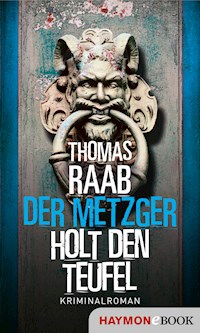

![Peter kommt später [Frau Huber ermittelt, Band 3] - Thomas Raab - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/37fbc55a2c46e56db5bce63bb86b09ca/w200_u90.jpg)






















