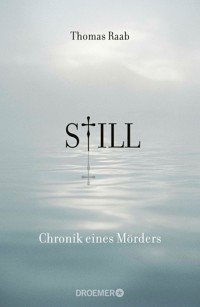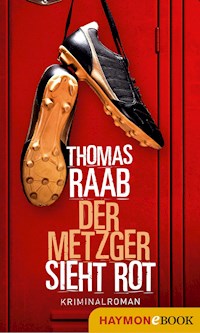
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Metzger
- Sprache: Deutsch
SPORT IST MORD. DER METZGER HAT ES JA SCHON IMMER GEWUSST … Der Metzger – ein Original Der Metzger, das ist einer, der alte Dinge liebt. Als Restaurator kennt er die Schönheit eines Gegenstands, wenn dessen abgenutzte Oberfläche eine Geschichte erzählt. Er ist einer, der gerne allein ist, manchmal allerdings ist er auch einsam. Er ist einer, der in der Schule gemobbt wurde, weil er zu klug und zu weich war für die wilden Bubenspiele am Pausenhof. Einer, der gerne Rotwein trinkt, mitunter viel zu viel, und dann fantasiert von den üppigen Rundungen seiner ehemaligen Schulwartin. Denn auch, wenn mit dem Wein manchmal die Melancholie kommt, weiß er um die schönen Seiten des Lebens. Und um die lustigen. Vor allem aber ist der Metzger einer, dem das Verbrechen immer wieder vor die Füße fällt - und ihn zu seinem Leidwesen, aber zur Freude einer großen Leserschaft, zwingt, die gemütliche Werkstatt zu verlassen und Nachforschungen anzustellen. Der Raab – ein Kultautor Der Raab, das ist einer, der einen unverwechselbaren Stil hat. Schräger Humor, authentische Charaktere, Wortwitz, feine Gesellschaftskritik; vor allem eine extrem gute Beobachtungsgabe und zugleich die Fähigkeit, die Beobachtungen treffend-komisch aufs Papier zu bannen, das ist die Mischung, die ihn so erfolgreich gemacht hat. Beim Lesen ist es zuweilen schwer zu entscheiden, ob man gespannt der Auflösung entgegenfiebern oder sich lieber doch möglichst viel Zeit lassen möchte, um das Lesevergnügen voll auszukosten. Und vielseitig ist er, der Raab - er schreibt nicht nur sehr verschiedene Kriminalromane, sondern auch Drehbücher. Man munkelt außerdem, dass er seine Lesungen zuweilen selbst musikalisch untermalt. Und gerne auch eine Kostprobe von seinem kabarettistischen Potential gibt … Der zweite Metzger-Krimi – eine finale rote Karte Menschenmassen sind des Metzgers Sache nicht. Aber für seine geliebte Danjela tut er fast alles - mit ihr geht er sogar zu einem Heimspiel des Fußballspitzenclubs "Kicker Saurias". Leider spielt diesmal auch der Sensenmann mit - und verübt ein grobes Foul: Für den nigerianischen Tormann endet das Spiel bereits vor dem Schlusspfiff, er bricht plötzlich tot zusammen. Und als sei dies noch nicht genug, gerät Danjela, die ihre Neugier nicht bezähmen kann, am nächsten Tag vor dem Stadion in Lebensgefahr. Das wird ein Nachspiel haben! Der sonst friedliebende Metzger schäumt vor Wut, macht sich auf die Suche nach dem Täter und findet Ungeheuerliches! **************************************************************************** "Ich bin ja absolut nicht fußballinteressiert, aber dieser Metzger-Fall hat mich trotzdem begeistert und bestens unterhalten." "Thomas Raab ist für mich der beste Figurenzeichner der deutschsprachigen Krimilandschaft. Der Metzger und seine Danjela sind fast schon alte Freunde!" *****************************************************************************
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Raab
Der Metzger sieht rot
Kriminalroman
Die Wirklichkeit ist eine Frage der Perspektive.
Prolog
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!
Da gehört schon eine ordentliche Portion Durchhaltevermögen dazu, damit eine gerahmte Urkunde samt Pokal, Meisterteller oder sonstigen schmucken Unbrauchbarkeiten in der Vitrine landet – ganz egal, ob man jetzt Tischler, Konditor, Kanalräumer, Buddhist oder Fußballer ist. Und weil, was nun den Himmel betrifft, die Hilfe aus dem Jenseits eher spontan erfolgt, spricht wohl nichts dagegen, wenn ein irdisches Händchen gelegentlich etwas nachhilft! So ein kleiner Schubser in die richtige Richtung hat im Grunde noch keinem geschadet. Ist nur ein Pech, wenn der Schubser nicht aus dem Jenseits kommt, sondern ausgerechnet dazu dient, jemanden genau dorthin zu befördern.
Dieser Umstand kann ihn allerdings nicht mehr erschüttern, als wäre eine Gelse knisternd im bläulichen Schimmer einer für genau diese Spezies vorgesehenen finalen Beleuchtung verschmort. Wo gehobelt wird, fallen Späne, und gehobelt wird ja schließlich mit durchaus schöpferischem Antrieb, um beispielsweise aus einem Stück Holz einen Stuhl herauszubekommen. Am Ende zählt nur das Ergebnis, nicht der Span. Kein Mensch interessiert sich für den Verschnitt, wenn er auf dem Sessel hockt und sein Mittagessen hinunterschlingt, die Tageszeitung durchblättert oder gegen die dreijährige Tochter in Folge die vierte Runde „Memory“ verliert.
In Anbetracht des gigantischen Mischwaldes „Menschheit“ ist die Bedeutung eines kleinen Menschenlebens gerade von der Größe eines Streichholzes, und wen bitte kümmert die Einzahl, wenn es um die Mehrzahl geht.
Im Jänner 2008 umfasste die Weltbevölkerung 6,646 Milliarden Menschen bei einem momentanen Wachstum von etwa zwei bis drei Menschen pro Sekunde. Gar nicht auszurechnen, wie sich das noch beschleunigt, wie beinah alles sich beschleunigt. Früher dauerte es einige Generationen lang, um eine Kathedrale zu errichten, heute steht in wenigen Monaten ein Wolkenkratzer, dagegen wirkt eine Kathedrale größenmäßig wie eine Hundehütte.
Seit er diese traumhafte Etage im vorletzten Stock eines neu gebauten gläsernen Bürogebäudes bezogen hat, fühlt er sich ohnedies, was wieder den Himmel betrifft, diesem näher als zuvor. Hier ist der perfekte Platz. Da kann so ein kleiner inszenierter Wink des Schicksals, so ein bedeutsames Dahinscheidenlassen, durchaus auch als ein wenig göttlich bezeichnet werden. Und weil es die wie Pilze aus dem Boden schießenden, gläsernen Neubauten so an sich haben, dass sie von allen Seiten sichtbar aus den städtischen Silhouetten herausragen, wie eben einst die Kathedralen, fällt es den Bewohnern der oberen Etagen gar nicht sonderlich schwer, an ihren polierten Fensterscheiben stehend über die Welt hinwegzusehen.
Der Mensch als einzelnes Subjekt nimmt sich verdammt noch mal viel zu wichtig, gibt ohnedies genug davon, geht es ihm durch den Kopf. Einem gepflegten Kopf natürlich, der sich nun erhobenen Hauptes dem Spiegel zuwendet, einem Spiegel von solch gigantischem Ausmaß, da könnte sich eine komplette apulische Großfamilie geschlossen selbst begutachten, samt Opa im Krankenbett.
Er aber steht allein davor, und das Wort allein bekommt eine neue Dimension in Gegenwart eines solchen Spiegels.
Gekonnt bindet er seine Krawatte, ein Teil der täglichen Routine, schließt bedächtig die auf dem Schreibtisch liegende große schwarze Aktenmappe, dreht sich um und blickt lächelnd über die Dächer hinaus zum Rand der Stadt. Hell beleuchtet erstrahlt dort das Zentrum, der Lebensinhalt und die Droge manch menschlicher Sinnsuche. Kein Wunder also, dass sich an diesem penibel gestutzten Rasenfleckchen auch jene Personen einfinden, die mit all ihren Sinnen, vor allem dem Geschäftssinn, genau diese Sinnsuchenden suchen.
1
Unaufhaltsam bewegt sie sich auf ihn zu. Es gibt Situationen, da ist die Chance zu entkommen so realistisch wie ein Lottogewinn. Ob er nun will oder nicht, sie wird ihn erfassen. Und während sie mit unausweichlicher Vehemenz heranrollt, beobachtet der Metzger seine Umgebung genauso verwundert wie ein Eremit die erste Karnevalssitzung. Wozu Menschen imstande sind, muss man erst erleben.
Da hilft es auch gar nichts, dass er in den letzten Monaten mehr Personen näher kennengelernt hat als in den vergangenen Jahren und dass aus diesen unangenehmen erzwungenen Konfrontationen durchaus angenehme Bekanntschaften hervorgegangen sind. So viel nette Personen kann Willibald Adrian Metzger nämlich gar nicht kennenlernen, dass sich bei ihm diesbezüglich ein Effekt der Gewöhnung oder gar der Sucht einstellt. Ganz im Gegenteil, das Auftreten des Menschen im Plural, als Anhäufung auf engstem Raum, löst bei ihm kein anderes Verlangen aus, als schleunigst den Rückzug in seine Werkstatt antreten zu können – was momentan rein beziehungstechnisch völlig ausgeschlossen ist.
Und während er sich ein wenig fröstelnd nach seinem stillen Kellergewölbe sehnt, kommt ihm aus heiterem Himmel der Gedanke an das friedliche Bild des Menschen in seiner ursprünglichen Singularität: ein Fötus im rötlich warmen Schimmer des Inneren seiner Mutter.
Den Metzger schaudert es bei der Vorstellung, so ein kleines Menschenleben müsste hier das Licht der Welt erblicken. Doch gerade die aktuelle Farbgestaltung dieses Umfelds trägt wesentlich für die ungewöhnlichen, pränatalen Gedankengänge des Willibald Adrian Verantwortung.
Eine gigantische Heerschar an Gestricktem, Bedrucktem, um den Hals Gewickeltem, durch die Luft Geschwenktem, auf Wangen und Körperteile Geschmiertem knallt dem Metzger ein Rot vor die Augen, dagegen wäre die mütterliche Plazenta ein lahmer Farbtupfer, eine optische Belanglosigkeit.
Dermaßen von Rot dominiert ist Willibalds augenblickliche Umgebung, dass es einem unkonzentrierten Beobachter gar nicht auffallen würde, wie sehr sich da neben dem Metzger die Backen von Danjela Djurkovic ebenso gänzlich diesem Farbton angepasst haben. Der Metzger ist nun aber alles andere als ein unkonzentrierter Beobachter, und gerade hier, inmitten dieses Malkastens, interessiert es ihn ohnedies viel mehr, sich den Backenrötungen, die die Menschen inklusive seiner durchaus angenehmen Bekanntschaft Danjela Djurkovic da an den Tag oder besser gesagt an die flutbelichtete Nacht legen, zu widmen als jener Angelegenheit, für die das Flutlicht eigentlich vorgesehen wäre.
Angespannt sitzt sie da, die Djurkovic, und wenn sich beim Metzger in den letzten Wochen ein zarter Hauch von „sich kennen“ eingeschlichen hat, dann ist in diesem Moment von dem Lüftchen nicht mehr viel vorhanden. Um nicht zu sagen: Flaute.
Von der Djurkovic-Ausgeglichenheit, die der Willibald Adrian so zu schätzen gelernt hat, ist nur noch eine Form von physischer Balance über, die die leicht in Hockstellung befindliche Danjela vor dem Umkippen bewahrt. Wie eine Vollblutstute kurz vor dem Rennstart verharrt sie in dieser eigentümlichen Stellung, aus der sie unter gewöhnlichen Umständen schon längst hoffnungslos auf ihrem von Willibald Adrian Metzger so gern gesehenen mächtigen Hinterteil gelandet wäre. Jede Faser ihres Körpers ist auf den Sprung vorbereitet, auf diesen einen Moment der Entladung, und sie wartet angespannt auf das Heranrollen. Langsam und schwerfällig nähert es sich, begleitet von einem gewaltigen Gegröle, das selbst auf mittelalterlichen Schlachtfeldern hätte mithalten können. Im Grunde ist das hier auch nichts anderes – genauso martialisch, genauso Furcht einflößend. Nur fehlt halt im Spiel, wenn es martialisch wird, beim Großteil der Mitwirkenden jegliche Furcht, und jene, bei denen dann doch aus reinem Selbstschutz die Angst auftaucht, nennt man zumeist Verlierer!
Die Gesichter sind wie von Sinnen, bestialisch aufgerissene Mäuler, erhobene Fäuste und brachiale Schreie. Für gewöhnlich würde Willibald Adrian Metzger entsetzt das Weite suchen. Aber eben nur für gewöhnlich. Hier ist alles anders. Es hat die Djurkovic eine Menge an Überredungskünsten gekostet, den Metzger hierher mitzuschleppen, aber was macht man nicht alles aus Liebe, und vor allem aus Neugier an der geliebten Person. „Der Mensch ist mir für gewöhnlich schon als Einzelner zu gefährlich. Ich muss mich nicht auch noch freiwillig der weitaus gefährlicheren Zusammenrottung dieses Säugers zu hirnlosen Rudeln ausliefern!“, hat der Metzger noch trotzig gemeint. Und jetzt ist genau dieser Umstand der Zusammenrottung die Faszination – der Metzger fühlt sich wie ein einsamer, im Busch lauernder Verhaltensforscher inmitten einer Horde hysterischer Affen.
Fasziniert starrt er auf Danjela, deren Lungen, bis zum äußersten mit Sauerstoff gefüllt, auf den herannahenden Schrei warten, ihr Gesicht starr vor Erregung und ihre Augen – sie hätte in Anbetracht des eigenen Spiegelbildes Reißaus genommen.
Dann ist sie da.
Die Djurkovic springt katapultartig aus ihrem ausgebleichten Plastiksessel, genauso wie alle anderen Besucher, vorwiegend Männer, streckt ihren voluminösen Körper bis zu den Fingerspitzen in die Höhe und schickt einen ansteigenden Ton ins Oval, ähnlich der lebensrettenden Sirene für den Feueralarm an ihrer Dienststelle, Willibalds ehemaligem Gymnasium, und Willibald kann ein Lied davon singen. Nach diesem Brüller, der selbst den eingefleischtesten Dauerabonnenten vor Neid verstummen lässt, ertönt ein „Applaus für die Welle in Sektor C!“ aus den Lautsprechern. Bis zu den Ohren strahlt die Djurkovic, wie ein gerade fürs fulminante Vorsingen vor familiärer Versammlung gelobtes kleines Mäderl.
Wie sehr doch die durch Massenhysterie reduzierte menschliche Vernunft zum leichtesten Opfer und zum dankbarsten Konsumenten jeglicher emotionalen Zuwendung wird, denkt sich der Metzger.
Schulwartin Danjela Djurkovic wirft ihrem Willibald einen stolzen Blick zu, wohl in Erwartung eines wohlwollenden Nickens. Den Kopf bewegt er zwar schon, der Metzger, aber in die andere Richtung. Deutlicher kann ein verwundertes Kopfschütteln nicht ausfallen.
Richtig erschrocken ist er, der Metzger. Nicht nur durch das dröhnende Hupkonzert aus den hinteren Reihen. Seine Danjela, der Inbegriff an Weiblichkeit, verehrt inmitten männlicher Fanatiker ein kugeliges Götzenbild. Dem Metzger wird jetzt richtig eng um seinen Hals, so als wäre der knallrote Fanschal, den ihm die Djurkovic beim Betreten des Stadions verpasst hat, mit einem Würgereflex beim Auftreten schlechter Gedanken und einer gewissen Mieselsüchtigkeit des Trägers ausgestattet. Man stelle sich vor, Schals wären grundsätzlich zu solchen Kunststücken fähig, beinah die ganze Stadt würde sich im Winter nach Luft ringend auf dem Boden winden. Willibald Adrian Metzger, schon allein wegen seines körperlichen Erscheinungsbildes als offenkundiger Sportverweigerer deklariert, sitzt verloren in seinem Jackett im Niemandsland, emotional leicht eingefroren, und trotz frühlingshafter Temperaturen ist er jetzt froh über den wärmenden Fanschal – obwohl, er weiß ja nicht einmal mehr, welche beiden Mannschaften hier verbissen versuchen, der anderen einen unbedeutenden Ball, übrigens längst nicht mehr aus Leder, tretend hinter einer Linie in einem weitmaschigen Netz kurzfristig zwischenzulagern.
Fußball also. Gelingt nun diese im Grunde höchst banale Aufgabe, wird diesem Ereignis oft staatstragende Bedeutung beigemessen, von einer Hälfte des Publikums frenetisch gefeiert, während die andere Hälfte sich bereits gedanklich ganz der Begegnungsgestaltung mit der gerade jubelnden, gegenübersitzenden Zuschauermasse nach dem Schlusspfiff außerhalb des Stadions widmet.
Tausende Augen starren hypnotisch auf den Ball, und im Metzger keimt die Frage auf: „Ist diese Kunststoffkugel ein letzter verbitterter überirdischer Versuch, die Menschen grenzüberschreitend zu verbinden, sozusagen der vergegenständlichte Messias?“
Mit leuchtenden Augen, aufgeregt wie ein kleines Polarwölfchen in der sibirischen Tundra während der ersten Jagd, steht eine vergnügte Danjela immer noch vor ihrem Plastiksessel. Sie hat vor lauter Begeisterung vergessen, sich wieder hinzusetzen.
Wahrscheinlich genau die gleiche Begeisterung wie anno dazumal, als im Mittelalter die Einwohner zweier benachbarter Gemeinden in der Region Derbyshire das alljährliche Ziel verfolgten, mit einem Ball und wahrscheinlich genauso roten Backen und leuchtenden Augen wie die der Danjela Djurkovic, den gegnerischen Mühlstein zu berühren.
Die Entfernung zwischen diesen Mühlsteinen, die im Lauf der Jahrhunderte zu den heutigen Toren heranwuchsen, betrug etwa drei Meilen. Logisch, dass da keine Regeln definiert waren, das gilt übrigens auch für die Anzahl der Spieler. So schoben sich teilweise bis zu tausend Teilnehmer in der Gegend herum. Muss eine friedliche Angelegenheit gewesen sein. Und weil der Unfriede ja ein Phänomen ist, das aufgrund seines häufigen Auftretens den Menschen offensichtlich sehr viel Vergnügen bereiten muss, gibt es bis heute diese Form der „spielerischen“ Auseinandersetzung, meistens mit Ball, in den verschiedensten Variationen – genannt nach dieser Region, nämlich Derby. Wenn sich also zwei Parteien regional nahe liegen und es durch diese Nähe wegen der menschlichen Liebe zum Unfrieden naheliegend ist, sich aus diversen Gründen in die Haare zu geraten, nennt man das Derby. Wenn einem der beste Freund die Frau ausspannt, ist das im entferntesten Sinn auch ein Derby, oder wenn zwei benachbarte Schrebergärtner um ein Stückchen Rasen streiten. Sozusagen ein Konflikt im eigenen Revier – und der ist ohnedies wie ein Virus ohne Heilmittel. Nun ist Fußball ja im Grunde kein Konflikt, sondern eher ein Spiel, zumindest für die aktiv am Spiel beteiligten Personen – solange diese sich an die Regeln halten. Nicht jedoch für die Zuschauer, und schon gar nicht, wenn die alle aus derselben Stadt kommen.
So wie in diesem Fall.
Genauer gesagt im Fall: Kicker Saurias Regis gegen SK Athletik Süd, der eine Klub aus dem Osten der Stadt, der andere aus dem Süden. So klein können Städte gar nicht sein, dass nicht die Kluft zweier Vereine aus derselben Metropole, derselben Liga und folglich derselben Absicht, nämlich auf einem Tabellenplatz vor dem anderen Klub zu landen, von dermaßen unüberwindlichen Ausmaßen ist, eher würde sich der Papst beschneiden lassen.
Die Stimmung im Stadion ist schwer explosiv, nur die Djurkovic registriert in ihrer Begeisterung nicht, welche Sprengkraft das Fass in sich birgt, an dem sie sich gerade ekstatisch besäuft. Dem Metzger ist aber schon längst nicht mehr so wohl in seiner Haut, sein rechter Mundwinkel zuckt nervös und verpasst ihm beinah im Dreisekundentakt einen dezenten einseitigen Grinser, unfreiwilliger und vor allem unehrlicher kann so ein Grinser kaum sein – dem Willibald Adrian ist nämlich alles andere als nach Lächeln zumute.
Fest drückt er sich schutzsuchend in den Schalensitz, während um ihn herum die Sprüche der benachbarten Fans immer rüder werden, weit entfernt von jugendfrei. Die Väter klopfen stolz ihren minderjährigen Söhnen auf die Schulter, weil den Kleinen Worte über die Lippen kommen, für die es zuhause gewöhnlich eine Tracht Prügel setzt. So lernt der Sprössling frühzeitig, dass dem gegnerischen Sektor weit mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden muss als den paar Hanseln, die da unten verzweifelt einem Ball hinterherlaufen. Eine Lektion fürs Leben, kann man da nur sagen.
Dann kommt der Angriff! Die Fangemeinde, in die der Metzger eingetaucht ist, ohne zu wissen, wem er da eigentlich angehört, stimmt ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert an. Der Stürmer nähert sich bedrohlich dem Strafraum, überspielt gekonnt die Abwehr, und innerhalb des Bruchteils einer Sekunde wird dieser Sturmlauf beendet – mit einem Schuss.
2
Was folgt, ist eine sportliche Meisterleistung, eng verbunden mit der Demonstration „menschlicher“ Grausamkeit. Denn die gewaltige artistische Parade des Torhüters, der eben eine 100-prozentige Torchance aus dem rechten Kreuzeck, also der rechten oberen Ecke des Kastens, herausfischt, ist den Zuschauern nicht einmal ein Raunen wert. Jetzt wundert sich der Metzger natürlich schon ein wenig, warum trotz dieser unglaublich grandiosen Einlage des Tormanns, dieser Rettung in höchster Not, der Jubel der eigenen Fangemeinde und der Mitspieler bedrückend mäßig ausfällt.
Und während in Willibalds Hirn das Unverständnis dieser Verhaltensabnormität richtiggehend für Aufruhr sorgt, gesellt sich zu dieser geistigen Verwirrung auch noch eine akustische Luftverpestung der anderen Art.
„Schleich di ham, Bimbo!“, ertönt es aus den eigenen Reihen, also dem rot getünchten Kicker-Saurias-Fanblock, gefolgt von:
„Spü di mit aner Kokosnuss, oba ned mit an Fuaßball!“ und „Schickt’s den Bimbo dorthin, wo’s dunkel ist, weu da fühlt er sich z’haus!“
Spätestens jetzt erwacht auch die Djurkovic aus ihrer spielbedingten Euphorie.
Wenn die eigenen Wurzeln keine einheimischen sind, ist das Gehör für verbale Umweltverschmutzung besonders sensibel, obwohl, für die Identifizierung der Disharmonie derartiger Meldungen braucht man für gewöhnlich gar kein sensibles Gehör, außer man trifft sich in ausgemusterten Militäruniformen mit seinen kahl geschorenen Freunden zum Paintballschießen im Gebüsch.
Wird ja auch höchste Zeit, denkt sich der Metzger, nachdem ihm die Danjela einen erstaunten Blick zuwirft. Er stellt verwundert ihrem wieder erwachten Geist die Frage: „Was passiert hier, bitte?“
„Na, schätz ich mal, neue Tormann nicht gerade Liebling von Fangemeinde. Heißt Kwabena Owuso, Import aus Ghana, Ersatz für Nummer-Eins-Goali Stefan Kreuzberger, hat Pause wegen Leistenbruch!“
„Ich bin zwar ein Unwissender“, meint der Metzger, „aber gilt nicht für gewöhnlich: je exotischer der Kicker, desto begehrter, bewunderter und gelegentlich auch besser?“
„Willibald, hast du heimlich studiert Fußball, wegen mir, brauchst du nicht. Ich nehm Metzger auch mit keine Ahnung. Ist ein Problem, weißt du, wenn begehrte Ausländer schickt beliebte Inländer auf Bank. Das ist so, wie wenn Mann aus Reklame, den Frau und Gatte im Fernsehn bewundern wegen gute Figur, plötzlich läutet an Wohnungstür, Frau guckt bei Spalt raus, erkennt und reißt sofort Tür auf, wegen Begehren. Da ist bei Gatten schnell vorbei mit Bewundern.
So ist auch in Fußball, da ist Fangemeinde egal, ob wegen Leistenbruch oder sonst was einheimischer Spieler geht auf Zwangspause. Noch dazu, wo Kreuzberger zusammen mit Adi Schuster inzwischen ist einziger Stammspieler mit inländischem Reisepass bei Kicker Saurias. Fans große Patrioten, mehr als Liga. Weil momentan in Fußball gibt nur ein Gesetz: Einwanderungsbehörde bekommt von Liga Freikarten für Spiele und Liga von Einwanderungsbehörde Freikarten für Spieler.“
Willibald Adrian Metzger ist schockiert, und er wird gleich noch viel schockierter sein.
Sprechchöre werden angestimmt und dann inbrünstig gesungen: „Zehn kleine Negerlein!“
Anfangs nur von ein paar halbtrunkenen Halbstarken.
Bei „Da waren’s nur noch sieben!“ dann schon vom ganzen Sektor, bei „Da waren’s nur noch sechs!“ auch schon von einigen gegnerischen Fans, weil, was spricht dagegen, die besungene Person gehört ja zur anderen Mannschaft.
Bei „Da waren’s nur noch vier!“ ist dann bereits zum Kicker-Saurias-Sektor das gesamte gegenüberliegende gegnerische SK-Athletik-Süd-Grätzel zu hören.
Dass kurzfristige Verbrüderungen ausgewachsener Feinde zum Zwecke unisoner Verabreichung handfester Gemeinheiten gegenüber Dritten durchaus üblich sind, weiß der Metzger, da hätte er sich den Fußballplatzbesuch ersparen können.
Eine durchaus neue Erfahrung wird ihm allerdings durch die Reaktion des in diesem Fall grausam Betroffenen zuteil. Kwabena Owuso nämlich bleibt so was von gelassen, als stünde er verträumt in seiner Heimat an einem einsamen Strand des Atlantiks. Und er hält stand, den Gesängen und jedem spielerischen Ansturm, mit bewundernswerter Präzision. Wäre das Spielfeld die Hölle und der Ball eine verzweifelte Seele, die aus dieser Unterwelt zu fliehen versucht, Kwabena wäre der Cerberos, der Höllenhund, der es keiner Wuchtel gestattet, aus dem Hades zu entkommen.
So hält er einen Ball nach dem anderen, und zum Lachen ist ihm auch nicht.
In den Homer’schen Gesängen, die vielleicht eine etwas gehobenere Alternative zu den eher primitiven Schlachtchören darstellen könnten, wird Cerberos vom in die Unterwelt gelangenden Odysseus folgendermaßen beschrieben:
Auch den Kerberos sah ich,
mit bissigen Zähnen bewaffnet.
Böse rollt er die Augen,
den Schlund des Hades bewachend.
Wagt es einer der Toten
an ihm vorbei sich zuschleichen,
so schlägt er die Zähne
tief und schmerzhaft ins Fleisch der Entfliehenden und schleppt sie zurück unter Qualen,
der böse, der bissige Wächter.
Dass Kwabena Owuso ziemlich bald, in vielfacher Hinsicht, dem Viecherl näher kommen wird, als ihm lieb ist, hat zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht einmal Zeus geahnt.
Jetzt ist das so mit der Masse: Wenn ein Gefäß ihrem Ansturm standhält, beruhigt sie sich im Lauf der Zeit – da wird der brühend heiße Kaffee nach der Erschütterung des Einschenkens im Bollwerk des Häferls zu einem friedlichen Brackwasser. Und irgendwie erscheint es dem Metzger, als wäre der Tormann der Behälter, in dem der brodelnde Haufen zur Ruhe kommt.
Ist ihnen eigentlich auch gar nichts anderes übrig geblieben, den Zuschauern. Spätestens als Kwabena Owuso, begleitet von der Hintergrundkulisse „Da waren’s nur noch zwei!“, einen 100-prozentigen Torschuss grandios, wie mit Zauberhand, aus dem langen Eck herausfischt, verändert sich der Gesang. Dem ganzen Stadion entkommt ein „Uhhhhhhh“, gefolgt von einem anschwellenden Applaus, sogar einige Gegenspieler gratulieren zu dieser Parade – das ist wahre Sportlichkeit.
So geht es in die Pause.
Während sich der Metzger mit der Djurkovic um ein Bier und ein Paar Würstel anstellt, tummeln sich aufgeregt die Leute herum, als gäbe es etwas gratis, und wie dann richtiggehend Volksfeststimmung aufkommt, ist von nichts anderem mehr die Rede als von Kwabena Owuso. Von der tollen Leistung, und dass er überhaupt schon so lange so grandios hält und dass er im Grunde locker mit dem Kreuzberger mithalten kann und dass sie froh sein können, so einen guten Ersatztorhüter zu haben, und dass sie ohnedies schon alle im Vorhinein gewusst haben, welch unbändige Kraft eines Löwen und reaktionsschnelle Wendigkeit einer Gazelle in dem Schwarzafrikaner stecken. Er, der Held, Kwabena, was für ein toller Name – kurz zuvor haben sie ihm noch verbal die Würde geraubt, ihn akustisch gegeißelt und singend beerdigt, und jetzt, Minuten später, feiern sie ihn mit einem Bier in der einen und einem Würstel in der anderen Hand. Kwabena Owuso hat bis zu seiner Auferstehung nicht drei Tage gebraucht.
Zum Glück hat der Metzger sein Würstel noch nicht gegessen, denn so zum Speiben wie in Anbetracht dieses erbärmlichen Geschwätzes, dieser Falschheit, dieser lautstarken Definition des Begriffs „Menschlichkeit“ war ihm schon lang nicht mehr! Der Mensch, die Krone der Schöpfung, denkt er sich angewidert, wobei ihm da weniger das Juwel auf königlichen Häuptern als vielmehr der Zahnersatz auf angefaulten Gebissresten durch den Kopf geht. Beim Übertünchen der eigenen Grauslichkeit ist der Mensch ja wahrlich Weltklasse, nur bei Massenaufläufen kennt der Primärinstinkt keine Gnade, und die ganze Verderbtheit und Unaufrichtigkeit dunsten unter dem Zahnersatz hervor, dass es einem den Magen umdreht.
Logisch, dass Kwabena Owuso beim Beginn der zweiten Hälfte einen Begrüßungsapplaus abbekommt, den er sein Lebtag nicht mehr vergessen wird – lang braucht er sich den aber gar nicht zu merken.
Zuerst ist dem Metzger aufgefallen, dass er so blass aussieht. Sogar aus den hinteren Reihen hört er ein verwundertes „Schau, wie der Owuso ausschaut, hätt i ma nicht gedacht, dass ma siecht, wann a Neger blass wird!“
Und schon wieder ist der Metzger froh über das Würstel, nur diesmal, weil er es dann gar nicht mehr gegessen hat. Für die Menschheit braucht man einfach einen leeren Magen.
Den Eindruck macht auch Kwabena Owuso, als täte ihm ein leerer Magen jetzt recht gut. Verwundernd, dass jemand, der so schlecht aussieht, doch noch fähig ist, sportliche Höchstleistungen zu bringen. Denn trotz Blässe wirkt er höchst motiviert, geradezu überdreht. Dann kommt die erste Parade, etwas langsam reagiert der Ghanaer, trotzdem umfängt er sicher den Ball und lässt sich in typischer Tormannmanier hinfallen. Großer Beifall der eigenen Fans. Nur wie lange soll nun so ein Applaus für gewöhnlich dauern? Bis der Tormann wieder aufsteht? Langsam und irgendwie hilflos verebbt der Beifall. Statt des Balls rollen die Augen des Torhüters wie die des Cerberos, nach einigen Muskelzuckungen bewegt sich nur noch der Speichel, der langsam aus dem offenen Mund der Schwerkraft folgt, dann verstummt auch das letzte Klatschen.
Kwabena Owuso wird nicht mehr aufstehen.
3
Serginho, Fußballprofi des Fußballvereins São Caetano, brach während eines Spitzenspiels gegen den FC São Paulo in der 59. Spielminute zusammen und starb. Er war 30 Jahre alt. Cristiano de Lima Junior, brasilianischer Profi-Fußballspieler, brach während des Finales um den indischen Föderationen-Cup, nachdem er Sekunden zuvor das 2:0 für seinen Verein erzielt hatte, am Spielfeld zusammen und starb. Er war 25 Jahre alt.
Miklós Fehér, Stürmer der ungarischen Fußballnationalmannschaft, erlitt kurz vor Spielende im Meisterschaftsspiel Vitoria Guimarães gegen Benfica Lissabon einen Herzinfarkt. Versuche, ihn auf dem Spielfeld wiederzubeleben, blieben erfolglos. Er war 24 Jahre alt.
Der schottische FC-Motherwell-Profi Phil O’Donnell brach in einer Ligapartie zusammen. Er verstarb 35-jährig im Krankenwagen.
Kwabena Owuso wäre in drei Wochen 27 Jahre alt geworden. Der Tod hat eine nicht zu verachtende Reihe berühmter Namen schon direkt vom Spielfeld zu sich gerufen. Owuso wird sich spektakulär in diese Reihe einordnen – auch wenn er sich zu Lebzeiten nicht unbedingt einordnen wollte – und seinen Gedenkstein bekommen. So ein plötzliches Herzversagen inmitten erlebnisdurstiger Zuschauermassen, live, unzensiert, das wünscht sich eigentlich keiner, wenn die Eintrittskarte entwertet wird. Aber eben nur eigentlich.
Zufrieden lächelt sie in sich hinein, als die Sanitäter den leblosen Kwabena auf die Bahre legen. Die Stille im Stadion ist erdrückend, nur vereinzelt ist knisternd das Zerbeißen von Popcorn zu hören, die Gesichter der Menschen sind so blass wie das des Ghanaers. Jede Hilfe zu spät, und selbst wenn sie nicht zu spät gekommen wäre, sie hätte nicht helfen können. Wenn so ein Herz nicht mehr schlagen will, kann so ein kleiner Elektroschock gelegentlich schon den Willen dieses Organs vom Gegenteil überzeugen, aber wenn es nicht mehr schlagen soll, dann kann so ein Defibrillator heiß laufen ohne die geringste Herzmuskelzuckung.
Mit Kwabena Owuso ist es vorbei, und nach diesem Auftritt wird als Todesursache der plötzliche Herztod in die Akten eingetragen. Im Grunde stimmt das ja auch! Und es ist gut so.
Was bitte ist daran auch verwerflich an so einer dezenten Beglückung, wenn man das Schreckliche an diesem Szenario ausblendet und den Betroffenen selbst betrachtet. Da jedem ja irgendwann diese letzte Eintrittskarte gelöst wird, das steht außer Frage, und so manchem die Angst der ungewissen Gestaltung dieses gezwungenen Abganges gelegentlich schlaflose Nächte bereitet, klingt so eine überraschende Direktüberweisung, so eine schmerzlose Spontantransformation, ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Das ist, als stürbe ein Priester während der Wandlung, der Meisterkoch beim Flambieren, der Turniertänzer während einer Hebefigur und der Liebhaber beim Koitus. Für die Zurückgebliebenen ein Horror, für den Toten aber ein Segen.
Und warum sollen sich immer nur die so billig aus dem Leben Geschiedenen über diesen raschen Abgang freuen? Die meiste Trauer ist Heuchelei, davon ist sie überzeugt, genauso wie davon, dem Kwabena im Grunde eine Freude gemacht zu haben – und sich und langfristig dem ganzen Verein. Und deshalb, verdammt noch mal, darf sie auch zufrieden lächeln, immerhin haben ja alle was davon.
Die Frage ist nur, ob sich Kwabena Owuso nun auch wirklich freut, wenn er im Angesicht des Herrgottes erfährt, dass der Himmelvater selbst mit der kurzfristigen Abholung genauso viel zu tun hat wie mit der Wahl seiner irdischen Vertretung.
Ihr ist das egal, genauso egal wie das Dahinscheiden des Tormanns. Nicht, dass ihr grundsätzlich ein Menschenleben nichts bedeutet, nur wenn sie der Mensch eher an ein Tier erinnert, was soll’s – in China sterben auch Hunde und keinen schert’s, sie werden sogar kross angebraten! Aufgewachsen ist sie in der Vorstadt, dort, wo das Faustrecht entscheidet, ob man den Überblick bewahren kann oder nicht. Wer sich diesbezüglich nicht durchsetzen konnte, war mit verschwollenen Augen gesegnet, weil eines war klar: Wenn zugeschlagen wurde, dann garantiert aufs Auge, und dann war es vorbei mit dem Überblick. Logisch, dass es ihr dank der Verknüpfung Frau und Vorstadt anfangs unmöglich war, ihren „Mann“ zu stehen, und logisch, dass weiblich zu sein, gerade da, wo sie aufwachsen durfte, gleichzeitig bedeutete, gelegentlich mit verschwollenen Augen durchs Leben navigieren zu müssen. Es gehörte in der Männerwelt ihrer Siedlung zum guten Ton, dass jeder seiner Geliebten nach einigen Monaten zusätzlich zum Spitznamen „Schlampe“ dann und wann ein blaues Auge verpasste, sozusagen als wandelnde Reviermarkierung. Da war dann allen klar: Diese Braut ist vergeben. Nicht dran zu denken, dass jemals irgendein Streifenwagen deswegen angehalten hätte, da musste schon was Gröberes passieren.
Nichts beschäftigt die Menschen so sehr wie die gründliche Pflege eingeschworener Feindschaften, und nichts kann ihnen so viel Mut eintrichtern bis zur Selbstvernichtung wie Hass. Kein Wunder also, dass dieses Muster dort, wo Gottes vergessene Kinder am Rand der Großstädte dieser Welt vom modernen Zeitgeist gerade mal die Arbeitslosigkeit verpasst bekommen, prächtig funktioniert. Und genau dorthin, in die leer gewordenen Wohnungen schickt die „Stadtplanung“ die eben erst zum gar nicht zugesicherten Verbleib zugereisten Gäste aus den benachbarten bis weit entlegenen Ländern niedrigeren Standards! Wobei mit Standards Begriffe wie Recht auf Bildung, auf Nahrung, auf Sicherheit, auf soziale Grundversorgung, auf Freiheit gemeint sind – also jene Kleinigkeiten, die oft nur ein paar Kilometer weiter, um nicht zu sagen auf der anderen Straßenseite, so zwischendurch konsumiert werden als soziales Fastfood, ohne die Klarheit, wie gut sie eigentlich schmecken.
Klug, diese politisch gesteuerte Besiedelungspolitik! Da entstehen Gettos am Stadtrand, in manchen Städten sogar schon in zentralen Bezirken, wo eine Schule drei Gassen weiter den Eindruck vermittelt, sie befinde sich in einem anderen Land. Äußerst klug, denn warum bitte sollen sich diese Gettos nicht genauso nach außen verbarrikadieren, wie sich das Außen gegenüber den Gettos verbarrikadiert.
Was tun, wenn also die leer stehenden Nachbarwohnungen der Vorstadtsiedlungen mit Flüchtlingen, Asylanten, Arbeitssuchenden besiedelt werden, wenn einem also schlagartig das bewusst wird, was man ohnedies schon die ganze Zeit geahnt hat. Abgeschobensein im eigenen Land! Der Staat ist unsichtbar, auf den kann man nicht hindreschen. Naheliegend, sich genau jene zu suchen, die nichts für die ganze Misere können, aber wenigstens sichtbar sind, nicht Deutsch können und von vornherein die Hosen voll haben!
Das ist aber jetzt noch nicht das Gröbere, sondern der sozialpolitische Alltag dieses Landes. Grob ist, wenn die Gedroschenen zurückdreschen, das bitte ist nicht vorgesehen.
Nachdem also ihr Bruder mit seiner Bande der Reihe nach, anfangs nächtens, später tagsüber im Gebüsch, schließlich auch tagsüber mitten auf dem Spielplatz, vorwiegend Schwarzafrikaner bis zur Unkenntlichkeit einem gesichtschirurgischen Eingriff der anderen Art unterzogen hatte, waren die dunkelhäutigen Burschen irgendwann so weit, wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
4
Das Stadion schien wie ein Konzertsaal während einer Vorstellung. Jedes Hüsteln wäre zu hören gewesen. Das hektische Getümmel auf dem Spielfeld, der Zustrom aller Betreuer, die Verzweiflung der Spieler, das Hantieren des Ärzteteams und die vergeblichen Wiederbelebungsversuche, all das konnte die Zuschauer aus ihrer Erstarrung nicht befreien. Erst als der leblose Körper von Kwabena Owuso auf die Bahre gehoben wurde, ging ein Raunen durch die Menge. Jetzt war es offiziell, auch der Tod hat diesmal seine Eintrittskarte ins Stadion gelöst, und neben jedem in diesem Oval hätte er Platz nehmen können.
Langsam leeren sich die Bänke. Und während eine Kolonne, ähnlich wie bei einem Staatsbegräbnis, gesittet und flüsternd die Zuschauerränge verlässt, bleiben der Metzger und die Djurkovic noch ein Weilchen sitzen. Beide den Blick starr Richtung Rasen gerichtet.
Jetzt betreiben die Danjela und der Willibald ihre Zweisamkeit grundsätzlich nicht auf besonders redselige Art und Weise, Worte sind eher dazu gedacht, das Schweigen zu überbrücken, diese wohlige Stille, die sich zwischen ihnen derart zufrieden und selbstlos auszubreiten vermag.
Nur so viel Stille, wie es im Augenblick braucht, das braucht auch seine Zeit. Und so sitzen sie beieinander, gelegentlich ein langes Seufzen über die Unglaublichkeit des eben Erlebten, ein Über-den-Oberschenkel-des-Partners-Streichen – eine Umarmung wäre da schon zu viel gewesen – und hin und wieder ein Übergeben des Bechers mit abgestandenem Bier zwecks Mundbefeuchtung. Mehr nicht. Keine Worte.
Den Metzger fröstelt, er nimmt eine der zahlreich auf dem Boden herumliegenden Zeitungen und steckt sie unter sein Hemd zwischen Rücken und Hosenbund, ohne den Blick von der Rasenfläche zu lösen, deutet mit einem weiteren Exemplar Richtung Danjela, die dann seinem Beispiel folgt und, nun ebenfalls am Rücken durch eine Zeitung gewärmt, dem Metzger ein zartes Lächeln, kombiniert mit dem so vertrauten Über-den-Oberschenkel-Streichen, zuteilwerden lässt.
Der Rasen übt direkt hypnotische Wirkung aus, und langsam drängen sich vereinzelte Bilder aus Willibalds Zwangserfahrungen rund um das Thema Fußball ins Gedächtnis, wie Promis vor laufende Kameras – vorwiegend Abziehbilder. Denn noch gut erinnert sich der Metzger an die Pickerlsammelwut seiner Mitschüler während diverser Welt- oder Europameisterschaften, an die Tauschorgien in den Pausen, an die Bestechungsversuche auf den Toiletten, an die Plünderungen diverser Schultaschen sich gerade auf der Toilette befindender Sammelkonkurrenten, an die durch Unterdrückung des folgenschweren Harndranges hervorgerufene reizbare Stimmung im Klassenraum, an den Geruch, der durch das Öffnen einer neuen Packung unweigerlich den gesamten Klassenraum in Beschlag genommen hat, an die stolze Präsentation beinah gefüllter Alben, an die friedliche Stille nach gekürten Welt- und Europameistern. Das Einzige, was der Metzger zur Schulzeit gesammelt hat, waren schlechte Erfahrungen. Aber Pickerl? Da hat man ja längerfristig von schlechten Erfahrungen mehr.
Die Annahme, Willibalds Berufswahl Restaurator hätte ihn vor weiteren Abziehbildern befreit, unterliegt einem groben Irrtum. Weil heute noch picken wie das Amen im Gebet dann, wenn Fußballgroßveranstaltungen die Welt lahmlegen wie eine geistige Eiszeit, auf der Fensterscheibe seiner Werkstatt all jene Fußballergesichter, die keiner mehr tauschen muss. Und die kleben gut.
Wenn der Kwabena Owuso bei diversen Klubs auch so gut picken geblieben wäre wie die Bilder auf Willibalds Auslage, hätte er sich den Wechsel zu seiner letzten Mannschaft vielleicht erspart, und der Metzger eine weitere schlechte Erfahrung.
Kwabena Owuso wird nicht mehr erleben, dass ein 14-Jähriger ein Abziehbildchen mit seiner Visage in ein Album klebt, dafür wird der Metzger erleben, wie sehr ein bisher unbedeutender Sportler durch seinen Spontanabgang dermaßen die Schlagzeilen in Beschlag nimmt, dass alle 14-Jährigen von selber sein Foto aus den Zeitungen ausschneiden und auf ihre Schreibtische, Schulübungshefte, über ihre Betten und auf ihre Kinderzimmereingangstüren kleben, dass es die reinste Freude ist. Vom Niemand zum Helden braucht es nur ein kleines öffentliches Dahinscheiden.
Mittlerweile hat sich das Stadion beinah bis auf den letzten Platz geleert, und während sich draußen die Leute friedlich wie sonst nie in ihre Autos zwängen und diszipliniert in einer elendslangen Kolonne, das Schritttempo beinah meditativ zelebrierend, zur Hauptstraße pilgern, beginnen im Stadion Ausländer, die bisher weder von der Liga noch vom Staat als würdig erachtet wurden, zumindest mit einer Arbeitsgenehmigung ausgestattet zu werden, den Dreck einzusammeln, den die Besucher verursacht haben, als wären sie eine ganze Woche hier gewesen.
Erst durch das behutsame Deuten eines älteren Mist sammelnden Herrn wird dem Metzger und der Djurkovic klar, dass es Zeit wäre zu gehen.
Und da eröffnet sich nun immer der Pferdefuß einer frischen Bekanntschaft, dieser allerersten eigentlich richtigen Beziehung des Willibald Adrian mit genau diesem Thema: dem Gehen.
Behutsam gehen die beiden miteinander um, aber je behutsamer die Djurkovic den Metzger in die Richtung bearbeitet, das Gehen als ständigen gemeinsamen Prozess zu veranstalten, desto mehr ist dem Metzger immer nach gehen zumute. Kein Thema für die Djurkovic, der Willibald könnte umgehend zu ihr in die Dienstwohnung ziehen, könnte augenblicklich einen Wohnungsschlüssel ausgehändigt bekommen, könnte ohne Zögern eine ganze Kastenseite abbekommen, samt halbem Waschtisch und dazugehörigen Barthaaren im Waschbecken, nur für den Willibald ist das alles eben auch kein Thema, und hier beginnt das Problem.
Nicht, dass der Metzger nicht erfüllt wäre von der Gewissheit: Die Djurkovic ist es, die Richtige, das Nonplusultra seiner Vorstellung von Weiblichkeit und Bleibenwollen, nur ist das noch lang kein ausreichender Grund, aus zwei Leben eines zu kreieren. Das geht auch nicht, zumindest in Willibald Adrians naivem Verständnis von Beziehungsführung, die immer wieder bei der Frage ankommt: Müssen verschiedene Geschmäcker, Gewohnheiten und Lebensstile zusammengeworfen in einem großen gusseisernen Kochtopf mit gleichmäßigen Alltagsrührbewegungen zu einem Einheitsbrei namens Partnerschaft vermantscht werden, bis darin eine abgestandene geschmacklose Brühe vor sich hinköchelt, für die gilt, jede Würze von außen wird die Suppe kräftig versalzen?
Dass es aber nur sehr wenige Frauen gibt, die sich einen Lebenspartner suchen, sei er auch noch so eigenbrötlerisch, damit sie aus der Ferne seinen egomanischen Habitus bewundern können, damit sie gelegentlich in seine Welt eintauchen dürfen wie ein Astronaut in eine ferne Galaxie, wird der Metzger bald zu spüren bekommen. Die Mannsbilder sind nicht die Jäger, die Mannsbilder sind vielleicht kurz die Jäger, aber dann die Gejagten von der weiblichen Sehnsucht nach Einklang, Zusammengehörigkeit und Beständigkeit. Und wenn dann die hurtigen Männerherzen am Ende ihrer Flucht, und die kann sehr lange dauern, erschöpft in ihrer undekorierten Einsamkeit landen, wäre so eine Madame mit ihrem Einklang-, Zusammengehörigkeits- und Konstanzbedürfnis doch allemal die bessere Lösung. So lange wird die Hetzjagd beim Willibald aber gar nicht dauern.
Das Problem also beginnt damit, dass die Djurkovic neben dem Metzger das Schweigen liebt, und umgekehrt, solange es sich nicht um das Schweigen in Anbetracht der unausweichlich bevorstehenden Frage handelt: „Gehen wir zu dir oder zu mir, oder geht jeder nachhause oder wie geht’s jetzt weiter?“ Eine Lähmung tritt hier ein, und jede Leichtigkeit ist dahin wie bald der Tschadsee, die Pasterze, der Eisbär und die Bienen. Grundsätzlich will der Willibald immer nachhause, außer er spürt eine Schwere in sich, die aufgefangen werden muss, bevor er in sich selber durchbricht; oder er wird von einer Djurkovic-Sehnsucht durchströmt, was ja laut seiner individuellen Zeitrechnung gar nicht so selten vorkommt. Viel zu selten natürlich für Danjela Djurkovic, und nachdem in der Beziehung zweier schon sehr erwachsener Einzelgänger die Phase des schonungslosen „Wir sagen, was wir uns denken!“ vor lauter Respekt und Achtung spät bis nie eintritt, bleibt den beiden also ein Gespräch über die bevorstehende Frage „Gehen wir zu dir oder zu mir, oder geht jeder nachhause oder wie geht’s jetzt weiter?“ verwehrt.
Diesmal kündigt der Metzger an, dass er sich nicht wohl fühlt, und das ist durchaus ehrlich gemeint. Somit ist der Djurkovic klar, der Metzger wird nachhause gehen, allein, das braucht er gar nicht mehr dazusagen. Und da die beiden noch einander glauben, was sie sich sagen, erspart sich die Danjela den Gedanken, der Willibald könnte sie indirekt nur loswerden wollen, und meint: „Na, arme Junge, bist du gewesen zu lange in Freien und alte Knochen rebellieren!“ Sie erspart sich aber nicht den kleinen Schmerz des nun immer noch offenen Rätsels: Wie geht es weiter? Der Metzger weiß ja längst, weiter geht’s nur noch mit der Djurkovic, die kommt ihm nicht mehr aus, die Djurkovic sieht aber immer noch keinen Metzger-Wohnungsschlüssel an ihrem Schlüsselbund und umgekehrt, und genau das wäre in ihrer Vorstellung der nächste Schritt im Bezug auf alles Weitere.
Heute allerdings, da würde sich der Metzger eine ziemliche Abfuhr einfangen, wäre ihm nach einem Abend in trauter Zweisamkeit zumute, denn heute will auch ausnahmsweise die Djurkovic nachhause, und zwar ebenso allein. Wenn der Willibald allerdings wüsste, warum, so groß könnte sein Einsamkeitsbedürfnis gar nicht sein, keinen Schritt würde er von der gewichtigen Seite seiner Danjela weichen.
5
Müde, seelisch angeschlagen stapft der Metzger die Stiegen hinauf in seine Altbaumansardenwohnung. Das war keine Kleinigkeit, der erste Fußballplatzbesuch nach hartnäckigen Überredungsversuchen und dann gleich so was. Auf diese krasse Verdeutlichung seiner Gewissheit „Sport ist Mord“, alle körperlichen Fitnesszuckungen betreffend, hätte er gerne verzichtet, genauso wie auf diesen leichten wiederkehrenden Schmerz in Danjelas Augen, immer wenn er sich für einen Soloabgang in Richtung seiner eigenen vier Wände entscheidet. Als wäre es ein Abschied auf ewig!
Trotz aller unabstreitbaren Liebe ist seine gelegentliche Sehnsucht nach Zurückgezogenheit drängender als der Pseudoabschiedsschmerz im Djurkovic-Blick, den er sich diesmal allerdings nur eingebildet hat. Mag rücksichtslos klingen, nur für den Willibald beginnt Treue mit der Treue zu sich selbst, das hat er gelernt im Lauf seiner menschenscheuen Restauratorenisolation, und wenn er verlernt, auf seine innere Stimme zu hören, wird es ihm bald genauso gehen wie auf dem Fußballplatz in Anbetracht der maskulinen Fremdwortungetüme – er wird trotz germanistischer Ahnenreihe die eigene Sprache nicht mehr verstehen. Und für den zentralen Ruf kein Ohr mehr zu haben, ist ganz schlecht.
So sperrt er also seine Wohnung auf, der Metzger, sein Reich, seinen Hort der Aufgeräumtheit, in den sich dank Danjela erfreulicherweise einige weibliche Utensilien eingeschlichen haben, von denen der Willibald keines mehr missen möchte.
Sein Abend folgt für gewöhnlich, bei einer Soloheimkehr, immer dem gleichen Muster. Jackett in die Garderobe hängen, Schweinslederschuhe fein säuberlich in der Plastikschuhschale parken zwecks Austausch mit den ausgefransten Lederhausschlapfen, erste kurze Grundreinigung im Bad, die offene Flasche Blaufränkischen vom Vorzimmer-Biedermeiertischchen holen und gemütlich lesen, ins Leere starren, Wein schlürfen und Halbschlaf absolvieren auf seinem Chesterfieldsofa. Fernseher gibt es hier keinen, ins Leere starren ist dem Willibald Adrian fernsehen genug.
Diesmal fällt die übliche Routine bereits im Vorzimmer einer leichten Irritation zum Opfer, denn beim Aufschnüren der Schweinsledernen erschreckt den Metzger ein leichtes Rascheln aus seiner hinteren Körperhälfte. Ein dezenter innerer Ruck und der ängstliche Gedanke, ob der menschliche Zerfallsprozess bereits zu Lebzeiten von einem krematorischen Knistern begleitet wird, erübrigen sich, nachdem der Willibald seinem Hosenbund die wärmende und inzwischen körperwarme Zeitung entnommen hat. Zerknittert, aber durchaus noch als Nachtlektüre verwendbar, obwohl dem Metzger freiwillig zu Lesezwecken höchst selten eine Zeitung in die Finger kommt.
Heute wird sich diese Nachtlektüre allerdings nicht mehr ausgehen, müde sucht er nur mehr den schnellsten Weg in sein antikes Bettgestell, und der kann ja bei Männern durchaus eine Gerade sein, ohne Umweg ins Bad oder sonst wo hin. Es geht ihm ja wirklich nicht gut, dem Metzger.
Der neue Tag kommt mit einer Schwere daher, dagegen sind Wahlsonntage ein Lapperl, so schwer steht der Metzger auf, als hätte er die gesamten Stimmzettel für diverse rechtsradikale Parteien höchstpersönlich in einem Rucksack zur Entsorgung zu transportieren, da kommt ja einiges zusammen. Mit derartigen Gliederschmerzen steigt er aus dem Bett, als hätte er diesen richtungsweisenden Weg zur Mülldeponie bereits mehrmals zurückgelegt. Kein guter Tag also, allein sitzt er beim Frühstück, natürlich mit Djurkovic-Sehnsucht, aber er hat das so gewollt, zumindest gestern. Nach einem mühseligen Fußmarsch erreicht er in einer sehr matten Verfassung seine Werkstatt, die ihn mit der üblichen Aufgeräumtheit begrüßt, einzig ein Tabernakelschrank aus dem 18. Jahrhundert sorgt optisch für Chaos. Auf sein hölzernes Gerippe entblößt, nimmt er einen Großteil des Gewölbekellers ein. Sorgfältig gestapelt liegen die herausgenommenen noch renovierungsbedürftigen 26 Schubladen verschiedenster Größen an der Wand, alle feuervergoldeten und gänzlich im Original erhaltenen Bronzebeschläge sind behutsam abmontiert und schreien förmlich nach frischem Glanz. Eine Auftragsarbeit, grundsätzlich lebt der Metzger ja von solchen Stücken, nur kosten ihm genau diese die meiste Substanz. Denn er wäre nicht Restaurator geworden, wenn sich nicht zwischen seinen Werkstücken und ihm jedes Mal eine Form der Liebe einstellen würde, die über die Zeit erhaben sein möchte. Nur geht das schlecht, denn jedes dieser Stücke, bis auf jene, die in seiner Wohnung untergetaucht sind, muss wieder fort, er muss ja schließlich von etwas leben, der Metzger. Gut, Willibald Adrian archiviert sie zwar optisch fein säuberlich in seinen Fotoalben, um den Arbeitserfolg zu dokumentieren, man will sich ja nichts nachsagen lassen, nur weg ist in den meisten Fällen auch wirklich weg. Besonders bei Auftragsarbeiten, da wollen die Kunden zumeist bereits bei Auftragserteilung einen Fertigstellungstermin und den genauen Preis, und obwohl sich der Metzger zwingt, für solche mit bereits formuliertem Ablaufdatum versehene Liebesbeziehungen keinen emotionalen Speicherplatz zur Verfügung zu stellen, endet dann doch immer alles in einer menschlich-hölzernen Tragödie. Es beginnt eigentlich schon tragisch, denn der gewissenhafte Willibald Adrian schiebt die Beschäftigung mit diesen Gegenständen ab dem Zeitpunkt ihres Eintrudelns künstlich in weite Ferne, als würde er sich selbst vorgaukeln wollen, sie blieben ihm doch erhalten, auch über den Abgabetermin hinaus, das Wiederweg-Müssen hängt ja schließlich von ihm ab. Möbelzwangsenteignung könnte man das nennen, nur kommt es dann nie so weit, denn sein Pflichtgefühl holt ihn immer in der Zielgeraden ein, und den Metzger überkommt ein Stress, dagegen hat der Urlauberrückreiseverkehr Erholungswert.
Dieser Tabernakelschrank hat es ihm nun besonders angetan, was man von seiner Besitzerin nicht gerade behaupten kann. Ingeborg Joachim. Da sprießen schon die ersten Knospen, schleppt sie noch ihren Chinchilla, ihren Nerz oder ihren Waschbären durch die Gegend, aber ohne ein Tröpfchen Schweiß auf ihrer Stirn, versteht sich. Ingeborg Joachim ist eher von der Machart, dass da schon gefälligst andere vor ihr schwitzen müssen, und zwar einzig aus Angst vor ihrer Launenhaftigkeit. Das hat der Metzger bereits bemerkt, wie sie ihn in ihre Wohnung kommandiert hat, um das teure Stück erstens zu begutachten und zweitens auch gefälligst gleich mitzunehmen, als wäre das so mir nichts dir nichts durchführbar. Da muss man einmal freundlich bleiben, denn was bleibt dem Metzger schon anders übrig, einzig sein guter Ruf bringt ihm Kunden, und da seine Kundschaft eher zu einer aussterbenden Spezies zählt, braucht er diplomatisches Geschick wie ein Amnesty-International-Abgesandter in Guantánamo. Was braucht auch so eine Person einen Tabernakelschrank, denkt sich der Metzger in Gegenwart dieses Prunkstücks: Um die Pokale ihres rasierten Pudels im Tabernakel aufzupflanzen? Wo Geld keine Rolle spielt, wird die Welt entweiht.
Geld hat für Otto Weinstadler allerdings schon eine Rolle gespielt, wie der eines Tages mit seinem Spieltisch aus dem früheren 19. Jahrhundert im Stil Ludwigs XV. in Willibald Adrians Werkstatt hereinspaziert ist. Die Eingangsglocke hat geläutet, der Metzger hat den Weinstadler gesehen und gewusst, wie der Hase läuft. Das sind arme Schweine, die ihre Heiligtümer verschachern müssen, nur um zu Geld zu kommen. Otto Weinstadler ist seiner Pensionierung freudvoll in die Arme gelaufen, nur die Pensionierung nicht ihm.
Was der Staat einem Hackler im Ruhestand in die Hände drückt, lässt den Ruhestand dieser Berufsgruppe gar nicht zu. Nur hat halt der Weinstadler schon zu viel gehackelt, und das zu schwer, um auch noch in der Pension pfuschen gehen zu können.


![Walter muss weg [Frau Huber ermittelt, Band 1] - Thomas Raab - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6449af66891644fec5c3bf512e0e7e71/w200_u90.jpg)
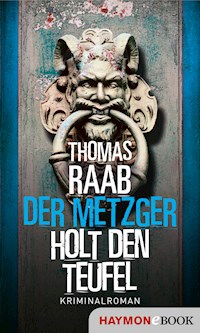

![Peter kommt später [Frau Huber ermittelt, Band 3] - Thomas Raab - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/37fbc55a2c46e56db5bce63bb86b09ca/w200_u90.jpg)