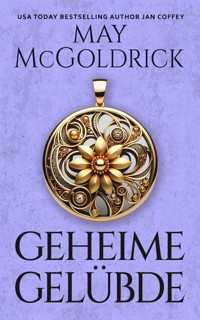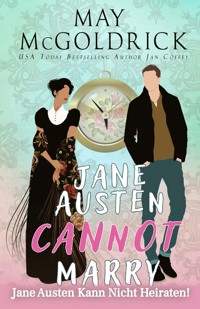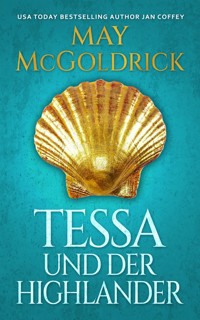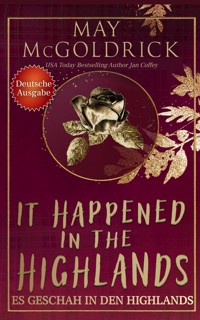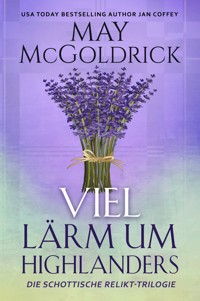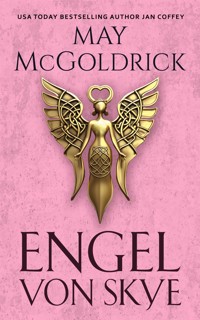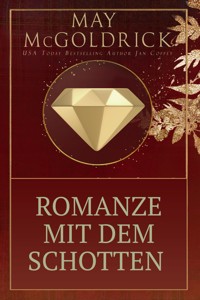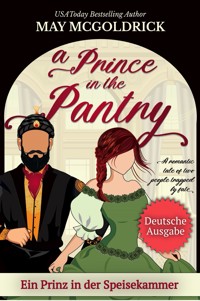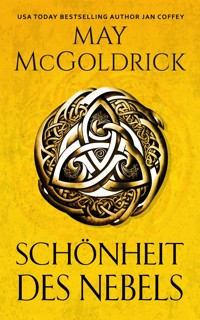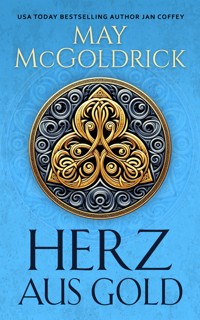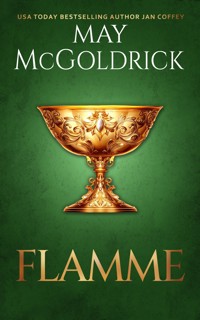Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die schottische Relikt-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die schottische Reliquien-Trilogie: Buch Drei Sturm in den Schottischen Highlands Die Schottische Reliquien-Trilogie: Buch Drei Miranda MacDonnell ist auf der Flucht. Als sie von ihrer Mutter ein mysteriöses Relikt erbte, ahnte sie nicht, welche Gefahren es mit sich bringen würde. Nun wird sie von einem unerbittlichen Feind gejagt, der vor nichts zurückschreckt, um sie zu finden. Sie hat nur eine Wahl: Sie muss sich auf dem Schiff des berüchtigten Freibeuters Black Hawk verstecken. Rob Hawkins, der als Black Hawk bekannte Freibeuter, hat den Auftrag des Tudor-Königs, den abtrünnigen Kommandanten Sir Ralph Evers zu finden und zu töten. Um seinen Auftrag zu erfüllen, muss Hawk Miranda finden, eine junge Frau, die von Evers verfolgt wird. Als er in einen Sturm gerät, erleidet er Schiffbruch mit einem Jungen, der eine unheimliche Fähigkeit zu seiner Rettung zeigt. Auf der geheimnisvollen Insel der Toten auf den Äußeren Hebriden gestrandet, erkennt Hawk, dass der "Junge", der mit ihm reist, in Wirklichkeit Miranda MacDonnell ist … und wenn er sie hat, würde auch Evers bald zu ihm kommen. Was als List beginnt - sie als Köder zu benutzen - ändert sich jedoch bald, als Gefühle zwischen den beiden aufkommen. Uralte Mächte sind am Werk, die alle vier Besitzer der Reliquie auf die Insel der Toten ziehen, um dort eine letzte Schlacht zu schlagen, in der das Gute die Mächte des Bösen besiegen muss - ein spektakulärer Höhepunkt der schottischen Reliquien-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sturm in den Schottischen Highlands
Tempest in the Highlands
2nd German Edition - DIE SCHOTTISCHE RELIKT-TRILOGIE
Buch 3
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Urheberrecht
Danke, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Falls es Ihnen gefallen hat, bitten wir Sie, es weiterzuempfehlen, indem Sie eine Rezension hinterlassen.
Sturm in den Schottischen Highlands (Tempest in the Highlands). Urheberrecht © 2022 von Nikoo und James McGoldrick
Deutsche Übersetzung ©2024 von Nikoo und James McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt: Book Duo Creative.
KEIN KI-TRAINING: Ohne die ausschließlichen Rechte des Autors [und des Herausgebers] aus dem Urheberrecht in irgendeiner Weise einzuschränken, ist jede Verwendung dieser Publikation zum „Trainieren“ generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) zur Erzeugung von Text ausdrücklich verboten. Der Autor behält sich alle Rechte zur Lizenzierung der Nutzung dieses Werks für generatives KI-Training und die Entwicklung von Sprachmodellen für maschinelles Lernen vor.
Umschlag von Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Anmerkung zu dieser Ausgabe
Anmerkung des Autors
Über den Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
KapitelEins
Heiligtum des Umhangs
Monyabroch, Schottland
Mai 1544
„Feuer.“
Miranda setzte sich auf und fragte sich, ob sie das Wort geträumt hatte.
Auf dem Feldbett neben ihr schaukelte Mirandas Mutter mit steifem Körper, ihre Augen starrten in die rauchige Dunkelheit des Raumes. Das Wort kam von Muirne MacDonnells Lippen, aber sie war in einem starren, tranceartigen Zustand gefangen.
„Feuer … brennt“, flüsterte Muirne, ohne die Dutzenden anderer Pilger zu bemerken, die um sie herum schliefen.
Miranda berührte das Gesicht ihrer Mutter. Es war heiß. Fieberhaft heiß. Einen Moment lang fragte sie sich, ob dies mehr von der Krankheit war, die sie hierhergebracht hatte. Seit Monaten waren sie zu einem heiligen Schrein nach dem anderen gereist, während die Krankheit, die Muirne befallen hatte, immer schlimmer wurde und die Heilungsfähigkeit der Ärzte, die sie aufsuchten, weit überstieg. Sie alle behaupteten, man könne nichts mehr tun. Sie lag im Sterben.
„Häuser brennen. Kirchen. Smoke. Edinburgh steht in Flammen.“
Miranda wurde klar, dass dies nicht die Worte eines Fiebers waren. Dies war eine Vision, wie so viele, die sie im Laufe der Jahre gesehen hatte.
Nur eine Handvoll der Reisenden in diesem Raum waren MacDonnells. Unabhängig von ihrer Verwandtschaft konnte sie sich auf keinen von ihnen verlassen. Keiner wusste von Muirnes Visionen. Und wie sie wahr geworden waren.
Eine einzelne Linie Mondlicht strömte durch den Rand eines verschlossenen Fensters und schnitt eine Schneise über die schlafenden Frauen. Bis auf die gelegentliche Unruhe und das leise Schnarchen war es still in der Kammer. Hinter den weiß getünchten Steinmauern auf beiden Seiten füllte sich ein Raum nach dem anderen mit Pilgern.
Jedes Frühjahr kamen sie zum Heiligtum des Mantels. Der Boden zwischen den schlafenden Reisenden war mit Krücken übersät. Viele legten weite Strecken zurück. Die Lahmen, die Blinden, die Kranken, die Verzweifelten, die Gläubigen. Sie alle kamen zum Schrein und baten um Hilfe, weil sie glaubten, eine Berührung des Umhangs des Heiligen würde sie heilen.
Miranda streichelte Muirnes Gesicht und zog ihre Mutter an sich, in der Hoffnung, sie sanft aus dem Bann zu lösen. Die Zeit war ein undeutliches Element in diesen Visionen. Vielleicht würden sie mehr darüber wissen, was sie gesehen hatte, wenn sie erwachte.
Ihr Blick fiel auf eine alte Frau, die an der Wand saß. Dunkle Augen beobachteten sie. Die Lippen bewegten sich, als sie ihren Rosenkranz betete.
Mit ihren achtzehn Jahren wusste Miranda, wie gefährlich es war, ihre Mutter dem Verdacht auszusetzen, besessen zu sein, oder, schlimmer noch, sie der Hexerei zu bezichtigen. Das alles war erklärbar. Sie hatte nur einen Albtraum, das war alles.
Muirne klammerte sich an ihren Arm, ihre Augen waren weit geöffnet. Die nächste Welle des Alptraums, der sie umhüllte, war bereit, sie zu verschlingen. „Sie sind hier.“
Jeder weitere Gedanke an Erklärungen verflog. Miranda sprang von der Pritsche auf und eilte zwischen den Betten hindurch zum verschlossenen Fenster. Sie stieß es auf und blickte über das Tor am Ende des Gasthofs hinaus.
Muirne hatte Recht, wie immer. Selbst von diesem Aussichtspunkt aus sah sie sie in der Ferne, wie sie über einen Hügel auf der Flussstraße kamen. Eine scheinbar endlose Reihe von Fackeln, eine glitzernde Schlange, die sich durch die Nacht zum Schrein schlängelte.
Die Reisenden im Raum bewegten sich. Eine Frau hob ihren Kopf in der Dunkelheit ein paar Meter entfernt.
„Packt eure Sachen zusammen“, rief Miranda. „Alle. Wir müssen gehen. Wir müssen jetzt alle von hier weg.“
Sie bewegte sich zwischen den Betten hindurch, stieß erst gegen die Schulter des einen, dann des anderen und schüttelte sie.
„Wach auf“, rief sie, ging zur Tür und riss sie auf. „Schnell. Nehmt eure Sachen und lauft in den Norden. Wir werden angegriffen.“
Miranda half einer alten Frau auf die Beine.
„Geh und wecke die Männer“, sagte sie zu einem Mädchen. „Soldaten. Die englischen Soldaten sind fast bei uns. Sie werden das Heiligtum niederbrennen und die Stadt plündern. Sie werden uns alle töten.“
Eine Frau rief aus dem Fenster: „Sie hat recht. Ich sehe sie!“
Der Raum brach in Panik aus.
Die Frauen strömten durch die Tür und die Treppe hinunter in den Hof. Aus den Zimmern der Männer drangen Schreie, als die Nachricht sie erreichte.
Ein Kleinkind wimmerte, während die Leute um sie herumstürmten. Miranda hob das Kind in ihre Arme. Eine blinde Nonne stolperte und wurde von hinten gestoßen. Miranda stürzte vorwärts und stellte sich dem Chaos in den Weg, damit sie wieder auf die Beine kommen konnte. Die Mutter des Kindes fand sie, und das Kleinkind stürzte sich in ihre Umarmung.
Miranda drehte sich um. Der Raum war leer. Sie schnappte sich ihre Tasche und ihre Umhänge und hielt sich an Muirnes Arm fest. „Komm schon, Mutter. Wir müssen jetzt gehen.“
Umgeben von anderen Pilgern, eilten sie durch das Dorf. Während sie weitergingen, sprach sich die Nachricht schnell in anderen Gasthäusern und Herbergen herum. Noch bevor sie den nördlichen Rand der Stadt erreichten, strömten die Menschenmassen auf die schlammigen Straßen.
Miranda und ihre Mutter erreichten die Felder und begannen den Aufstieg in die Hügel. Das Volk breitete sich über das ansteigende Wiesenland aus, und im Mondlicht erkannte sie, dass Hunderte von ihnen geflohen sein mussten.Als sie den Kamm des Bergrückens erreichten, der das Flusstal bildete, blieb Miranda stehen und blickte zurück.
Andere Pilger um sie herum blieben stehen und schauten ebenfalls zurück. Die Reihe der Soldaten war bereits im Dorf. Die Fackelträger verteilten sich in kleineren Strömen und rannten zwischen den Gebäuden hindurch. Fast sofort begannen die Feuer zu brennen.
„Bei der Jungfrau, sie verbrennen das Heiligtum!“, rief eine Stimme. „Die Teufel verbrennen das Heiligtum.“
„Wer hat den Alarm ausgelöst?“, fragte jemand. „Wer hat sie kommen sehen?“
Die Menge wurde still, und dann durchbrach eine dünne Stimme die Stille.
„Sie.“
Miranda erkannte sie. Die alte Frau, die in der Herberge ihren Rosenkranz betete.
„Das da.“ Sie hob ihren knochigen Finger. „Muirne von Tarbert Castle. Die Frau des Gutsherrn der MacDonnells, Angus. Sie hat es in ihrem Traum gesehen.“
Im Schein des untergehenden Mondes drehten sich die Gesichter zu ihnen um.
Miranda zog sich der Magen zusammen. Ein ganzes Leben voller Geheimnisse war ruiniert.
Miranda wickelte ihren Mantel um ihre Mutter und zog ihn ihr über den Kopf, sagte aber nichts und drehte Muirne in Richtung Westen. Gemeinsam machten sie sich in der Dunkelheit auf den langen Heimweg.
* * *
Die englische Armee brannte und plünderte nach Belieben. Edinburgh, die Abtei in Holyroodhouse und der Palast des Königs. Leith, Cragmiller, die Abtei von Newbattle, die Kapelle Unserer Lieben Frau, die Stadt und die Burg von Preston, Hatintown mit dem Kloster und dem Nonnenkloster und viele andere. Die Eindringlinge verschonten keine Burg, keine Stadt, keinen Haufen und kein Dorf, bis sie sie umgestürzt und zerstört hatten ... und das unter großen Verlusten.
Ein Ort stach bei dem Amoklauf besonders hervor. Jeder Pilger im Heiligtum des Mantels entkam. Das Wunder wurde einer sehenden Frau zugeschrieben. Einer Frau, die in die Zukunft gesehen hatte.
Muirne MacDonnell.
KapitelZwei
Burg Tarbert
Kintyre, Westschottland
Vier Monate später
Obwohl die Feuer im Turm fast erloschen waren, hing der beißende Geruch von Rauch in der Luft und brannte in den Lungen des englischen Schiffskapitäns. Rob Hawkins warf einen Blick den Hügel hinunter auf das Dorf und den Hafen. Tarbert Castle würde überleben, dachte er, aber zu viele seiner Bewohner hatten es nicht geschafft.
Stirnrunzelnd wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Kleriker zu.
„Ja, sein Name war Evers.“ Der alte Priester war aufgebracht und wurde mit jeder Frage aufgeregter.
Irgendetwas stimmte da nicht, dachte Rob. Warum sollte Evers seine Armee in den Highlands zurücklassen, nur um an der Westküste Schottlands entlangzusegeln? Verglichen mit all den prall gefüllten Gewölben und Truhen der Abtei, die er bereits geleert hatte, schien diese Burg nichts zu bieten. Warum also hierherkommen? Warum den Gutsherrn töten?
Aber nichts an dieser Mission ergab einen Sinn.
Als der Bote aus Frankreich eintraf, wo Henry Tudor in Boulogne kämpfte, waren die Befehle des Königs eindeutig gewesen. Rob sollte Sir Ralph Evers finden – Gouverneur von Berwick-upon-Tweed, Kommandant im Norden, Aufseher der East March, High Sheriff von Durham. Und dann sollte er den Mann töten. Nicht um ihn zu tadeln. Ihn nicht wegen eines Verbrechens anklagen. Ihn nicht zurückbringen, um ihn vor Gericht zu stellen.
Seine Aufgabe war es, ihn zu finden … und zu töten.
Und im Gegenzug würde Rob mit dem ultimativen Preis für einen Freibeuter belohnt: einem vom König ausgestellten Kaperbrief, der ihm freie Hand gab, die Schiffe feindlicher Nationen anzugreifen und zu plündern. Und im Moment befand sich König Heinrich mit fast allen Nationen im Krieg. Und das bedeutete das Potenzial für enormen Reichtum.
Sinn oder Unsinn, Rob hatte sofort den Anker gelichtet und segelte nach Norden.
„Du bist sicher, dass es Sir Ralph Evers war?“ betonte er.
„Er war es, sage ich dir. Der Teufel persönlich. Die Geißel der Grenzen.“
Rob drehte sich um und betrachtete die Rauchschwaden, die noch immer vom Turm aufstiegen. Seine Männer arbeiteten Seite an Seite mit den Einheimischen, um die letzten Brände zu löschen und die Verwundeten zu versorgen. Die Leichen der Toten waren entlang der Burgmauer aufgereiht worden. Er warf einen Blick auf sein Schiff, die Peregrine, das im Hafen vor Anker lag.
Er hatte erwartet, dass er auf der Suche nach seiner Beute weiter nach Norden segeln würde. Als er in Whitehaven anlegte, um Nachschub zu holen, erzählte ihm der dortige Kommandant, dass Evers und seine Mischlingsarmee zuletzt auf der Suche nach „dem verdammten Heiligen Gral oder so etwas“ durch die Highlands gezogen seien. Doch als sie kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen ein kleines Handelsschiff abfingen, erfuhr er, dass ein Engländer nicht einmal einen Tag zuvor die Burg Tarbert in Brand gesteckt hatte. Die Brutalität des Angriffs entsprach Evers' Stil, und die MacDonnell-Hochburg lag auf seinem Weg. Rob hatte beschlossen, aufzuhören. Seine Entscheidung hatte sich ausgezahlt.
„Und das“, sagte er zu dem Priester und deutete auf den Turm und die Leichen, „das Töten, das Plündern, das Feuer. Du sagst, all das geschah, nachdem er entdeckt hatte, dass die Frau des Gutsherrn tot war?“
„Ja. Niemand hier wird lange um Angus MacDonnell trauern. Der Mann war ein harter Kerl und so zäh und knauserig wie eine alte Auster. Aber seine Frau Muirne … das ist eine Frau, die man vermissen wird. Starb vor nicht einmal zwei Wochen.“ Der drahtige Kleriker rang die Hände. „Och, nichts als Kummer für uns jetzt. Als der MacDonnell als Gutsherr kam, dachten wir, unser Leben würde besser werden. Das war es nie. Aber jetzt ist es so weit gekommen. Es wird noch schlimmer werden, ganz sicher. Es ist fast zu viel für mein Herz, um es zu ertragen.“
Rob schüttelte den Kopf. „Kannte Evers die Frau des Gutsherrn? Gab es eine Absprache, die schiefgelaufen ist? Das alles ergibt für mich keinen Sinn.“
„Für mich auch nicht“, stimmte der Priester zu und umklammerte das Holzkreuz an seinem Gürtel. „Aber ich weiß, was ich weiß.“
Und Rob glaubte nur, was er mit eigenen Augen sehen konnte. Sir Ralph Evers war ein wertvoller Kommandeur im Dienste des Königs gewesen, aber irgendetwas war mit dem Mann schiefgelaufen. Er schien übergelaufen zu sein, aber nicht, um mit Schottland oder Frankreich oder Suleiman vom Osmanischen Reich zu kämpfen. Soweit Rob es beurteilen konnte, kämpfte Evers auf seiner eigenen Seite. Aber er glaubte nicht, dass ein so erfahrener und angesehener Mann wie er alles aufgeben würde, um auf eine mythische Suche zu gehen. Warum also hat er es getan?
Um den Mann zu finden und zu töten, brauchte Rob mehr Antworten.
„Erzähl mir, was passiert ist.“
„Warum sollte ich dir etwas sagen?“, brummte der Pfarrer. „Du sagst, du seist Schotte, und deine Mannschaft scheint aus Schotten und Portugiesen zu bestehen, aber ich weiß, dass du ein Engländer bist, und versuch nicht, das zu leugnen. Du bist der Pirat, den man Black Hawk nennt.“
„Pirat? Nein.“ Rob starrte den alten Mann an. „Mein Vater ist Engländer. Das will ich nicht leugnen. Aber meine Mutter war eine Kennedy, geboren und aufgewachsen in Moray. Ich habe also schottisches Blut in meinen Adern, das so gut ist wie deines oder das von jedem anderen. Und du sollst verdammt sein, wenn du sagst, ich hätte deinem Volk etwas angetan.“
Der Kleriker wandte seinen Blick von ihm ab und starrte auf die Männer, die auf der anderen Seite des Hofes zusammenarbeiteten. Er nickte.
„Für dein Kennedy-Blut werde ich es dir erzählen. Der Engländer kam nach Tarbert, eingeladen vom Gutsherrn. Er wurde wie ein Gast in die große Halle geführt.“
Rob versuchte sich vorzustellen, was für ein Geschäft Angus MacDonnell mit einem abtrünnigen Kommandanten wie Evers gemacht hätte.
Der Mann zeigte auf den Turm. „Der Gutsherr war kein Narr. Und das macht das Ganze noch schwerer zu verstehen.“
Rob versuchte sich vorzustellen, was für ein Geschäft Angus MacDonnell mit einem abtrünnigen Kommandanten wie Evers gemacht hätte.
Der Mann zeigte auf den Turm. „Der Gutsherr war kein Narr. Und das macht das Ganze noch schwerer zu verstehen.“
Rob wartete, denn er sah, dass der Geistliche noch mehr sagen wollte.
„Als seine Männer mich aus dem Dorf holten, dachte ich, ich würde gehängt werden. Meine.“ Er runzelte die Stirn bei der Erinnerung. „Die große Halle war voller Leichen. Der Gutsherr selbst saß noch in seinem Stuhl, tot wie dieser Stein. Sie haben mich zu Evers geschleppt, und da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Das Gesicht des Satans.“
„Was wollte er von dir?“
Der alte Mann schwankte leicht. „Er wollte, dass ich ihn in die Familiengruft bringe.“
Robs Blick schweifte über die von Evers zurückgelassenen Trümmer. „Die Krypta?“
Der Priester zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf. „Er wollte, dass ich ihm zeige, wo die Frau des Gutsherrn begraben wurde.“
„Warum?“
„Ich weiß es nicht.“ Der Kleriker wurde blass. „Ich habe ihm gesagt, dass sie nicht da war. Ich habe ihm erzählt, wie sie gestorben ist und dass es keine Leiche zu begraben gibt. Aber er hat mir nicht geglaubt. Als ich schwor, dass es die Wahrheit war, habe ich noch nie eine solche Wut in den Augen eines Mannes gesehen. Ich dachte, ich würde sterben. Er verfolgte mich weiter. Stellte so viele Fragen. Ich weiß nicht, was ich geantwortet habe, aber dann habe ich zufällig die Tochter erwähnt. Ich glaube, das hat mir den Hals gerettet.“
„Keine Leiche? Wartet.“ Das Rätsel wurde immer komplizierter. „Welche Tochter?“
„Miranda.“ Er zögerte. „Es gab nie eine treuere Tochter als dieses Mädchen. Und jetzt ist auch sie von uns gegangen.“
Der Versuch, den Kleriker zu verstehen, war wie das Lösen eines nassen Knotens. „Was ist mit der Tochter passiert?“
„Muirne MacDonnell war schon seit einiger Zeit krank. Sterbend. Alle wussten es. Miranda hat sich immer um sie gekümmert. Nahm sie sogar auf Pilgerfahrten mit. Dann, vor drei Wochen, ist das Mädchen verschwunden. Einfach verschwunden.“
„Und niemand weiß, wohin diese Tochter gegangen ist?“
„Keine Menschenseele, soviel ich weiß“, antwortete der Priester. „Und den haben wir alle vermisst, sage ich euch.“
„Warum?“
„Das Mädchen hat so eine Art an sich. Immer wenn es in einer Hütte brannte, war sie zur Stelle. Wenn ein Hund verrückt wurde, war sie zur Stelle. Wenn die Kinder zu nahe am Brunnen spielten, war sie zur Stelle. Eines Tages kam sie ins Dorf gerannt und sagte, dass Schwärme von Meeräschen in den See kämen. Bevor man ‚Ave Maria‘ sagen konnte, war der Hafen voll mit springenden Fischen. Ihretwegen hatten die Leute den ganzen Winter über gut zu essen.“
Rob schüttelte den Kopf. Er wollte sich nicht ablenken lassen. „Aber die Tochter ist einfach verschwunden, und dann ist die Frau des Gutsherrn gestorben?“
Der Priester umklammerte wieder das Kreuz. „Eines Abends, einige Tage nach Mirandas Abreise, nahm Muirne das Boot eines Fischers und ruderte hinaus auf die Förde. Am nächsten Morgen fand man das Boot, aber Muirne war unauffindbar.“
„Vielleicht hat die Tochter sie geholt – oder jemand anderes. Woher wussten Sie, dass sie tot war?“
„Das kann ich nicht beantworten. Aber der Gutsherr behauptete, sie sei hineingefallen. Ihre Krankheit war für sie immer schwerer zu ertragen gewesen. Jeder wusste, dass sie immer schwächer wurde. Wenn sie aus Versehen aus dem Boot gefallen wäre, wäre sie mit Sicherheit ertrunken.“
Der alte Priester schwankte unsicher. Aus Angst, er könnte zusammenbrechen, half Rob dem Mann auf eine Bank an der Küchenwand.
„Und das hast du Evers erzählt. Du hast ihm gesagt, dass Muirne MacDonnell dort nicht begraben ist.“
„Das ist so.“
„Aber er ist trotzdem in die Krypta gegangen?“
„Aye.“ Der Priester runzelte die Stirn. „Und da drin ist etwas passiert.“
„Was meinen Sie?“ Rob kämpfte gegen die aufsteigende Frustration an, aber er musste herausfinden, wohin Evers von hier aus reiste.
„Ich weiß nur, dass das Letzte, was er fragte, bevor er reinging, war, wohin Miranda gegangen sein könnte. Sie war diejenige, die er als Nächstes wollte. Niemand hatte die Antwort. Aber als er rauskam, rief er seine Kommandanten zusammen. Ich habe ihn selbst gehört. Sie setzten die Segel in Richtung Mull. Sie wollten nach Duart Castle. Man könnte meinen, er hätte seine Antwort von den Toten bekommen.“
KapitelDrei
Der große schwarze Vogel schwebte herab und glitt über das blaugrüne Wasser. Der Falke drehte sich und stieg auf, ritt auf der unsichtbaren Brise. Als er aufwärts kreiste, merkte Miranda, dass ihre Füße an einen hohen Felssockel gefesselt waren, umgeben von einem glitzernden Meer. Sie wehrte sich gegen die Falle, aber es gab keine Erleichterung.
Der Wind begann, sie zu umhauen und peitschte ihren Mantel. Plötzlich tauchte der schwarze Falke ab, zog im letzten Moment hoch und landete anmutig auf der glatten Steinoberfläche. Die Flügel verschwanden und er verwandelte sich vor ihren Augen in einen Mann. Sie starrte auf das Gewirr aus schwarzem Haar, das ihm bis zu den Schultern hing. Die große, kräftige Gestalt ragte auf dem Felsen empor. Seine haselnussbraunen Augen richteten sich auf sie.
Sie spürte keine Angst. Er war gekommen und sie hatte ihn erwartet. Es musste Rob Hawkins sein, wie ihre Mutter es vorausgesagt hatte. Muirne sagte, dass ihre Schicksale miteinander verwoben seien. Er war der Einzige, der sie von diesen Fesseln befreien konnte.
Als er auf sie zukam, schwoll das Meer an und bespritzte sie beide mit Salzgischt. Er streckte die Hand nach ihr aus.
Bevor sich ihre Finger berührten, wechselte die Farbe des Himmels hinter ihm zu einem stürmischen Grau. In der Ferne zuckten die Blitze in der Luft.
Plötzlich wogte das Meer an den Seiten ihres felsigen Sitzplatzes hoch, und eine Welle, so hoch wie Ben Nevis, erhob sich, blieb einen Moment stehen und stürzte dann hinab, um ihn in die aufgewühlten Fluten zu reißen.
Sie schrie verzweifelt auf und suchte mit ihren Augen nach ihm. Aber er war weg.
Er wird ertrinken.
Miranda MacDonnell erwachte in Panik und starrte durch das schummrige Licht auf geschwärzte Balken. Das Holz schien zu weinen. Sie war nass und lag in einer Netzhängematte. Die Vision wich nur langsam zurück. Sie konnte ihre Füße nicht bewegen.
Sie atmete tief durch und kämpfte gegen die starren Krämpfe an, die den Körper ihrer Mutter in der Vergangenheit schon tausendmal gepackt hatten. Sie ließen nur langsam von ihr ab.
Ein gewaltiger Knall drang an ihre Ohren, und ein Schauer durchlief sie. Die rollende Bewegung erinnerte Miranda daran, dass sie sich an Bord eines Schiffes befand.
Rob Hawkins. Die Black Hawk. Sein Schiff. Sie war in Tarbert an Bord gegangen. Sie hatte sich die Haare abgeschnitten, Jungenkleidung angezogen und sich als Küchenhilfe ausgegeben.
Sie versteifte sich. Die Vision schwebte über ihr und erinnerte sie an die Gabe, die sie nun besaß. Der Kummer über den Tod ihrer Mutter war noch nicht verflogen. Aber sie musste aufpassen. Er war dabei zu ertrinken. Sie musste zu ihm gelangen.
Als sie sich aus der Hängematte rollte, kippte das Schiff nach vorne und schüttelte sich erneut, als ob es gegen eine Steinwand stieß. Der Geruch von Bilgenwasser, aufgewirbelt von der aufgewühlten See, stieg von unten auf und drehte ihr den Magen um. Miranda landete auf allen Vieren auf dem rauen Holzdeck und berührte den Stein in der Tasche an ihrem Gürtel. Als sie stand und sich an den Hängematten auf beiden Seiten festhielt, neigte sich der Bug des Schiffes nach oben, und Meerwasser strömte durch die Lücken in den Planken über ihr.
In der Ferne ertönte eine Glocke, und aus anderen Hängematten drangen Flüche durch die Dunkelheit.
Seit sie vor zwei Tagen an Bord der Peregrine gegangen war, hatte Miranda sich so weit wie möglich von der Öffentlichkeit ferngehalten. All das war jetzt vergessen.
Die Schotttür schwang auf, und der Kopf des Maats erschien. Eine heulende Böe aus Regen und Wind fegte herein.
„Aufstehen, Hunde!“, rief er. „Alle werden gebraucht!“
Miranda war bereits an der Tür und drängte sich an ihm vorbei. Erleichtert, aus der engen Umzäunung herauszukommen, in der die Besatzung schlief, stürzte sie ins Freie, nur um von der stechenden Salzgischt getroffen zu werden.
Draußen an Deck herrschte das Chaos. Von überall her kamen Rufe, die im Tosen der Wellen und im schrillen Wind halb untergingen. Männer kämpften, hielten sich an den Leinen fest und schauten zu den Masten und Takelagen hinauf, wo andere um ihr Leben rangen.
Vor ihr löste sich ein Fass vom Fuß des Großmastes, kippte um und schlug mit tödlicher Wucht über das Deck. Als es das Dollbord erreichte und dort einschlug, sprangen zwei Matrosen herbei, um es zu sichern. Aber sie konnten es nicht halten, da das Schiff rollte, und das Fass schleuderte zurück, prallte über Bord – nicht, bevor es einen Teil der Seile, die den Mast hielten, mitgerissen hatte.
Miranda konnte ihn nicht sehen. Sie stemmte sich gegen die Panik, die sie ergriff. Ihre Mutter hatte ihr mit dem strengen Befehl aufgetragen, sich in der Nähe des Dorfes zu verstecken und auf ihn zu warten. Black Hawk war der Schlüssel, um ihren Zwilling zu finden – den Bruder, bei dem Miranda nun Unterschlupf zu finden hoffte, sobald das Schiff Schloss Duart erreichte. Der Bruder, der bei ihrer Geburt von ihr getrennt worden war, wegen des abscheulichen Mannes, den sie „Vater“ nannte. Aber jetzt, in ihrer eigenen Vision, hatte sie gesehen, wie Black Hawk über Bord gespült wurde.
Die vom Wind getriebene Gischt stach ihr ins Gesicht. Eine Welle erhob sich und brach über das Deck. Sie fragte sich, ob das Meer das Schiff ganz verschlingen würde, und kämpfte gegen eine Angst an, die kälter war als der Ozean selbst.
Sie war schon oft an Bord von Schiffen gewesen, aber noch nie in so wilder See wie hier. Und immer als Passagier, als Tochter des Gutsherrn.
Sie sprang auf und klammerte sich an die Rattenleinen, als eine weitere Welle sie überspülte, und spähte durch den strömenden Regen. Wo war Black Hawk?
Miranda kämpfte sich nach achtern vor. Bei jedem Rollen des Schiffes ergoss sich das Wasser über die Seite und zwang sie, sich festzuhalten, bis es so weit zurückging, dass sie weitergehen konnte.
Plötzlich sah sie ihn, wie er die Matrosen auf dem Achterdeck überragte und einer Mannschaft Befehle zurief, die um ihr Schiff und sich selbst rang. Er strahlte rohe Kraft und die Trittsicherheit eines Mannes aus, der an Bord von Schiffen aufgewachsen war. Für eine kurze Sekunde wanderte Mirandas Blick hinunter zu dem vom Regen dunkel gefärbten Lederwams, das weiße Hemd klebte an den sehnigen Muskeln seiner Arme. Mit seinem schwarzen Haar, das ihm ins Gesicht wehte, unterstrich Rob Hawkins seine Befehle mit explosiven Flüchen.
Bis auf eines waren alle Segel an den vorderen Masten aufgerafft und gesichert worden. Nur das oberste Segel am Großmast musste noch eingerollt werden. Er deutete darauf und schrie. Eine Leine hatte sich verheddert, und zwei Matrosen hingen daran und versuchten, sie zu befreien.
Der Maat schrie Miranda von hinten an: „Aufstehen, Junge! Schneid die Laken durch, wenn es sein muss, aber bring die Plane rein!“
Sie blickte nach oben, das Salzwasser brannte in ihren Augen. Der Mast war hoch und die Spitze verschwand in einem Nebelschleier. Sie war noch nie auf etwas so Hohes geklettert. Aber ihr Leben war auch noch nie in Gefahr gewesen. Wieder eine der Visionen ihrer Mutter. Wenn Miranda in Tarbert geblieben wäre, würde sie sterben.
So viele Premieren.
„Guter heiliger Brendan“, betete sie und kletterte auf die Reling. „Bewahre mich vor einem nassen Grab. Und noch wichtiger, bewahre ihn vor …“
Das Knacken des Mastes über ihr ließ das Gebet in ihrer Kehle erstarren. Die Leinen lösten sich in ihrem Griff, und sie wäre beinahe über Bord gegangen, als das obere Drittel des Mastes abbrach und nach unten krachte. Gesplittertes Holz von den Rahen und Leinen, die ihn in der Luft hielten, prallte auf das Deck.
In diesem Moment schlug eine Welle gegen das Schiff und riss zwei Matrosen mit sich. Zu ihrem Entsetzen ging einer von ihnen auf der schäumenden Dünung über Bord. Das Bein des anderen verfing sich in den Leinen, sodass der schreiende Mann mit dem Kopf nach unten über die Bordwand baumelte.
Miranda packte sein anderes Bein, aber sie wusste, dass sie ihn nicht lange halten konnte.
Sie wusste nicht, woher er kam, aber Black Hawk landete auf der wogenden Leinwand und war im Nu neben ihr.
Der Kapitän konnte nicht verhindern, dass er umkippte, und zog den Mann zurück an Bord, als ob er nicht mehr als eine Feder wöge.
Als er ihn an Deck absetzte, klopfte er ihm auf die Brust und rief: „Du bist jetzt in Sicherheit, Mann.“
„Aye, Hawk“, keuchte der Seemann und versuchte, zu Atem zu kommen. „Sicher.“
Rob Hawkins schnitt ihn von den Leinen los, die ihn gerettet hatten, und packte Miranda an der Tunika an der Schulter. Er zeigte nach oben.
„Klettere jetzt, Junge. Schneide die Schoten durch. Der ganze Mast geht kaputt, wenn wir das Segel nicht frei schneiden, und Gott helfe uns, wenn das passiert.“
Seine Hand berührte ihre, und sie sah vor ihrem geistigen Auge, dass ihre Vision der Wahrheit entsprach. Er ging hinunter in diese stürmische See. Hawk war weg, bevor sie ein Wort sagen konnte.
Sie konnte nichts anderes tun, als seine Befehle zu befolgen. Wenn sie das Schiff rettete, so beschloss sie, konnte sie vielleicht auch ihn retten.
So war ihr Leben, sie reagierte auf eine Krise nach der anderen. Vorher war es immer Muirnes Vision gewesen, die sie leitete; jetzt war es ihre eigene. Sie konnte die Zukunft verändern und Leben retten. Aber dazu musste sie die Gefahren ignorieren, denen sie ausgesetzt war. Das war schon immer so gewesen.
Miranda sah ihm zu, wie er sich über das wogende Deck zum Heck bewegte, holte tief Luft, streckte die Hand aus und fröstelte. Als sie zum wild schwankenden Mast hinaufblickte, bezweifelte sie, dass sie die Rah erreichen konnte, auf die Black Hawk zeigte, geschweige denn die dicken Leinen durchschneiden. Sie würde mit Sicherheit auf das Deck stürzen und sich das Genick brechen.
Gefahren. Miranda hatte aufgehört zu zählen, wie oft sie im Laufe der Jahre dem Tod entgangen war, als sie versuchte, jemandem das Leben zu retten. Und doch blieb ihre eigene Zukunft ein Rätsel. Ihr eigenes Ende, wann immer es kommen sollte, lag jenseits ihrer Visionen. Sie schluckte den Knoten der Angst hinunter, der sie zu ersticken drohte. Was sie wusste, war, dass sie jetzt klettern musste. Ihr Überleben hing davon ab.
Die Leinen peitschten im Wind, und der Mast ächzte unter dem Druck des Segels. Es gab keine Zeit zu verlieren. Bevor sie sich hochziehen konnte, erhob sich eine weitere Welle und krachte über das Deck. Eine Wand aus schäumendem grünem Wasser schlug sie gegen das Dollbord, aber irgendwie hielt sie sich fest und versuchte, wieder zu Atem zu kommen.
Als sie sich aufrichtete und sich das Wasser aus den Augen wischte, war das Hauptdeck mit Wrackteilen übersät. Das Schiff rollte erneut, und ein weiteres Krachen schnitt durch den heulenden Wind.
Miranda blickte rechtzeitig auf, um zu sehen, wie sich ein Baum losriss und auf das Heck hämmerte. Black Hawk sprang darüber, als die Welle über das Deck fegte, aber die Takelage blieb an ihm hängen. Während er versuchte, sich zu befreien, erhob sich eine weitere Welle, blieb einen Moment stehen, spülte dann das Achterdeck frei und trug den Kapitän über Bord.
Ihr Herz blieb stehen. Sie hing über den Rand hinaus, klammerte sich an die Rattenleinen, während ihre Augen verzweifelt das aufgewühlte Wasser absuchten. So konnte es nicht sein. Er konnte nicht ertrinken.
„Bitte, Gott“, murmelte sie. Sie konnte nicht alles überleben, was sie durchgemacht hatte, nur um es so enden zu lassen. Teile des Schiffes verteilten sich über das grüne Wasser. Reling, Masten und Fässer dümpelten inmitten von herunterhängenden Leinen und zerrissenem Segeltuch.
Dort, nicht weit achtern, entdeckte sie eine weiße Wolke. Es war Black Hawk. Sie konnte ihn nicht sterben lassen. Sie brauchte ihn.
Sie kletterte auf die Reling, holte tief Luft und stürzte sich in den Wassertaumel. Das Meer war eiskalt, aber sie schwamm in Richtung des weißen Tuchs. Mit jeder Dünung stieg sie hoch in die Luft und blickte einmal auf das Deck des verunglückten Schiffes hinunter, bevor sie in eine Mulde hinabstieg, von der sie glaubte, dass sie sie verschlingen würde.
Einen Moment später ritt sie auf einer ansteigenden Dünung wieder nach oben, und die Peregrine zog vorbei und ließ Miranda in ihrem Kielwasser zurück.
Sie sah ihn. Sein Gesicht drehte sich nach oben, bevor es in den graugrünen Fluten verschwand.
Kräftig schwimmend tauchte sie ab, als eine Welle über ihr zusammenschlug. Die Wucht trieb sie tief in die salzige See. Hawk schwebte direkt über ihr, seine Arme kraftlos ausgebreitet.
Mirandas brennende Lungen waren kurz davor zu platzen, als sie ihn erreichte. Sie packte ihn am Kragen, trat so fest sie konnte und schaffte es, stotternd und nach Luft schnappend, die Oberfläche zu erreichen.
Das Holz, das einst zum Schiff gehört hatte, trieb in der Nähe, und sie hatte Mühe, den Mann dorthin zu ziehen. Als sie es erreichten, war sie fast am Ende ihrer Kräfte, aber sie schob ihn auf den Balken.
Miranda erlaubte sich einen Hoffnungsschimmer, als sie ihn Meerwasser aushusten hörte. Seine Augen öffneten sich für einen Moment und er sah ihr ins Gesicht, bevor sie sich wieder schlossen.
Sie waren von Wrackteilen umgeben, aber das Schiff selbst war hinter den Wasserbergen nicht mehr zu sehen.
Sie hielt sich an einer Ecke des Balkens fest und kämpfte gegen die Verzweiflung an, die in Panik umzuschlagen drohte. Wo waren sie? Wer sollte sie finden? Wie lange konnte sie sich noch festhalten, bevor das kalte, aufgewühlte Meer sie in seine Tiefen hinabsaugte? Sie berührte Hawks Hand, aber das Einzige, was sie sehen konnte, war Wasser, dunkel und endlos.
Tränen stiegen ihr in die Augen und vermischten sich mit der Salzigkeit des Meeres auf ihren Lippen. Die Bilder ihrer kurzen Geschichte liefen vor ihr ab. Worin hatte ihr Leben bestanden? Dienen. Stets auf der Hut vor dem Unerwarteten zu sein. Andere zu retten und Katastrophen abzuwenden. Sich um ihre Mutter zu sorgen. Miranda hatte sich nie erlaubt zu träumen, zu planen, an eine Zukunft zu denken; ihr Leben war nicht das ihre, das sie nach Belieben gestalten konnte. Ihre Aufgabe war es, zu reagieren, wenn sie gebraucht wurde.
Das Meer war ein Grab, und die betäubende Kälte des Todes kroch ihre Beine hinauf.
Ein Stöhnen entrang sich ihrer Brust und kam über ihre Lippen. Sie blinzelte weitere Tränen zurück, als sie sich an Muirnes Worte an ihrem letzten gemeinsamen Tag erinnerte. Miranda wollte nicht gehen. Sie wollte ihre Mutter nicht verlassen.
„Du hast keine Wahl, Miranda. Der Tod wartet auf dich, wenn du bleibst. Aber es gibt noch mehr.“
Sie hatte sich alles genau angehört, was Muirne ihr über Hawk erzählt hatte. Aber es gab noch mehr, über das sie nachdenken musste.
„Dies ist eine Reise, die du antreten musst. Du wirst lernen, dich zu verändern und wiedergeboren zu werden, um herauszufinden, wer du bist. Die Reliquie ist ein Geschenk, aber sie kann auch ein Fluch sein. Das wisst ihr sicher schon. Aber du musst lernen, mit ihr umzugehen, damit sie dir dient, anstatt dich zu zwingen, ihr dein Leben zu opfern.“
Ihr Leben opfern. Sterben im Dienste eines zerbrochenen Steinsplitters. Miranda wurden die Glieder schwer. Ihr Kinn sank in das kalte Meer. Sie berührte wieder Hawks Hand. Dunkle, stürmische See erfüllte ihre Vision.
Ihr Kopf sank in das Wasser, Erschöpfung machte sich breit. Sie dachte, wie leicht es wäre, loszulassen. Muirne hatte Miranda gesagt, dass ihr Leben untrennbar mit dem dieses Mannes verbunden sein würde, aber jetzt wurde ihr klar, dass ihre Mutter nie gesagt hatte, wie kurz dieses Leben sein würde.
Wie als Reaktion darauf rutschte Hawk vom Balken ins Meer. Miranda wusste nicht, woher sie die Kraft nahm, aber sie griff nach oben und fing ihn auf. Mühsam drückte sie die beiden wieder an die Oberfläche. In diesem Moment sah sie eine Leine, die von einem Holz in der Nähe herabhing.
Miranda zog ihr Messer, schnitt ein Stück davon ab und band sich und Hawk zusammen über das Holz.
KapitelVier
Rob Hawkins rollte sich auf die Seite und sein Magen hob sich. Er hustete etwa ein Fass Meerwasser in den Sand und zwang sich auf Hände und Knie.
Er war am Leben. Irgendwie hatte er es ans Ufer geschafft. Er sank zurück auf den harten Sand. Aber wie? Und welches Ufer? Wo war er? Was war mit seinem Schiff passiert? Mit seiner Mannschaft?
Ein stechender Regen prasselte auf ihn ein, und der Wind heulte immer noch. Er versuchte, tief einzuatmen, doch es gelang ihm nicht. Sein ganzer Körper schmerzte und sein Mund schmeckte wie Bilge.
Er erinnerte sich daran, wie er nach Norden segelte, als sich das Wetter verschlechterte. So einen Sturm hatte er noch nie erlebt, und er war schließlich auf Schiffen groß geworden. Er war der älteste Sohn von William Hawkins, einem Segelhändler aus Plymouth, der auch eine Freibeuterflotte für die englische Krone befehligte.
Er versuchte, sich aufzusetzen, doch seine Arme fühlten sich schwer wie Mühlsteine an. Sein Gesicht lag in einem kalten, sandigen Bett aus Seegras. Er machte sich Sorgen um seine Mannschaft, die sich wahrscheinlich im Sturm ums Überleben kämpfte.
Und was war mit seinem Schiff? Die Peregrine gehörte ihm und nur ihm. Wenn das Schiff nun auf dem Meeresgrund lag, wie viele von seiner Besatzung waren dann auch untergegangen? Er hatte fast alle diese Männer persönlich ausgesucht – Engländer, Portugiesen und Schotten – und er war verdammt stolz auf sie.
Rob war von Geburt an ein halber Schotte, und das brachte ihn in der englischen Gesellschaft oft an den Rand, besonders nach der zweiten Ehe seines Vaters mit einer hochgeborenen Engländerin. Als sie zwei weitere Söhne bekamen, hatte sich seine Position nicht verbessert. Aber das war ihm egal.
Er roch den Sand und verdrängte den bitteren Geschmack der Salzlake in seiner Kehle.
Rob war stolz darauf, seinen eigenen Weg zu gehen. Er wollte nichts mit dem Leben am Hof zu tun haben. Er wollte nie vom Namen oder Vermögen seines Vaters abhängig sein. Und in seiner Karriere als „Feind des Königs“, die ihn als Attentäter für die Krone in den gefährlichsten Gefilden führte, hatte er sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet.
Er war gut in dem, was er tat, und er war glücklich dabei. Aber dieser Sturm war der schlimmste, den er je erlebt hatte. Sie hatten versucht, nach Westen zu laufen, um ihn zu umgehen, aber vergeblich. Sie hätten ihn vielleicht überstehen können, aber dann hatte die Takelage um sie herum zu fallen begonnen.
Er erinnerte sich, wie er versuchte, dem Ausleger auszuweichen, der sich losriss. Das nächste, was er wusste, war, dass er im Meer trieb und alles schwarz wurde.
Wie hatte er überlebt? Ach, der Junge!
Robs letzte Erinnerung war die an einen Jungen, der nicht halb so groß war wie er, der ihn an die Oberfläche zog und ihn rettete.
Mit aller Kraft zwang er sich, sich aufzusetzen. Er blinzelte den Sand und das Salz aus den Augen. Ein kalter Windstoß blies ihn um. Der Sturm hatte überhaupt nicht nachgelassen. Der Regen prasselte immer noch in Strömen. Er war durchnässt und fror bis auf die Knochen. Er griff nach dem Messer, das er an seinem Gürtel trug. Zum Glück war es nicht verloren gegangen.
Er blickte um sich. Das Meer brach über eine zerklüftete Felsenreihe, bevor es einen kurzen Strandabschnitt hinaufglitt. Die Flut kam näher. Hinter ihm tauchten Klippen auf und verschwanden im Nebel und dem dunkler werdenden Himmel.
Nicht weit von ihm lag die Leiche eines Jungen im Sand, ausgestreckt. Rob schleppte sich hinüber.
Junge war bewusstlos, aber er atmete wenigstens noch. Sein blondes Haar klebte ihm im Gesicht. Er war jung, seine Gesichtszüge noch jungenhaft, ohne Bart, ohne die harten Linien der Männlichkeit. Woher hatte dieser Kerl die Kraft, sie beide zu retten?
Rob stand auf und sah sich erneut um. Er hatte keine Ahnung, wo sie waren. Sie könnten an der Küste einer beliebigen Insel der Äußeren Hebriden oder noch weiter draußen liegen. Eine Welle schwappte an den Strand und spülte bis zu seinen Stiefeln. Er hatte keinen Zweifel, dass dieser Abschnitt bei Flut unter Wasser stehen würde. Er musste ihnen einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Felsvorsprünge mit steilen, unüberwindbaren Klippen sperrten den Strand an beiden Enden ein, aber Felsvorsprünge am Fuße der Steilküste, die entlang des Strandes verliefen, könnten einen trockenen Platz bieten. In dem trüben Licht sah es so aus, als gäbe es Höhlen in der Felswand. Das wäre sogar noch besser, dachte er.
Er hob den Jungen an seinen Armen hoch und warf ihn über seine Schulter, was ihm ein Husten entlockte. Er hatte schon Säcke mit Futter getragen, die mehr wogen.
Als er den Strand hinaufkletterte, kehrten Robs Gedanken zu seinem Schiff zurück. Die Masten und die Takelage stürzten um ihn herum ein, bevor er über Bord gefegt wurde. Er runzelte die Stirn und betete, dass das Schiff den Sturm überlebt hatte. Vielleicht waren noch andere Überlebende an Land gespült worden. Bei Tagesanbruch würde er versuchen, die Klippe über dem Strand zu erklimmen, sich zu orientieren und nach seiner Mannschaft zu suchen.
Der Eingang einer Höhle unter einem Überhang war ein willkommener Anblick. Der Junge wälzte sich auf Robs Schulter.
„Lass mich runter“, sagte er schwach und kämpfte. „Lass mich jetzt runter.“
Das dünne Gestell zitterte, und die Zähne klapperten so laut, dass Rob es durch den Sturm hindurch hören konnte. Er kletterte auf den Felsvorsprung und duckte sich unter den überhängenden Felsen. Auf beiden Seiten des Höhlenmundes sah er Treibholz und trockenes Seegras. Das war ein gutes Zeichen, dachte er. Sie würden ein Feuer haben.
Er versuchte, den Jungen herunterzulassen, aber der dürre Kerl rutschte ab und fiel auf die harten Felsen. Sofort krabbelte der Junge auf die Knie, würgte und hustete.
Rob ging so weit in die Höhle hinein, wie es das schwache Licht, das von draußen hereinkam, zuließ. Der Ort war hoch genug und trocken genug, um Schutz vor der Flut und dem Sturm zu bieten. Er drehte sich um. Der Junge saß zusammengekauert an einer Wand neben dem Höhleneingang, umarmte seine dünnen Beine und zitterte.
„Hier gibt's genug Treibholz, um ein Feuer zu machen. Wie heißt du?“
Rob konnte die Antwort nicht hören. Er sammelte getrocknete Stöcke und Seetang auf, stapelte sie in der Nähe des Jungen und nahm seinen Feuerstein und Dolch heraus.
„Wie heißt du?“
„Gavin.“ Er zitterte weiter.
„Du bist ein ganz schön mutiger Kerl, Gavin. Das muss ich dir lassen.“