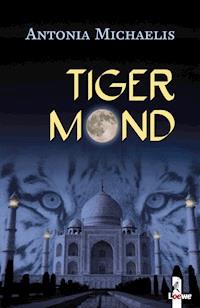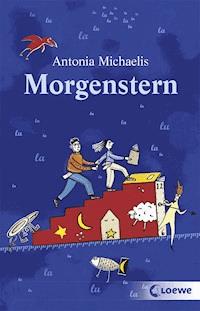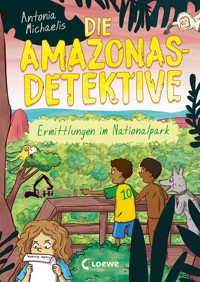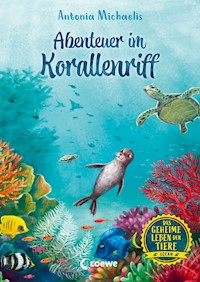13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Road Novel von Antonia Michaelis über zwei ungleiche Helden und sehr viele Kühe. In einer Sommernacht lernen sie sich kennen: Sean, Student aus dem Iran, seit zwei Monaten in Deutschland, und Davy, aus dem Heim abgehauen, auf der Suche nach einem Freund. Beide werden Zeugen eines Überfalls. Von nun an verfolgt von Verbrechern und Polizei türmen sie zusammen quer durch Deutschland: über Erdbeerfelder, unter dunklen Gewitterwolken, durch Biergärten, im Heißluftballon, mit der Bahn und auf dem Moped. Immer wieder werden sie dabei von Kühen umzingelt, das scheint ihr Schicksal zu sein. Warum sonst sollte der Wagen mit Sean und dem Abschiebebescheid ausgerechnet auf dem Weg zum Flughafen in einer Kuhherde stecken bleiben? Klug, skurril und komisch nimmt Antonia Michaelis ihre Leser mit auf eine Deutschlandreise aus Sicht eines Flüchtlings und erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
In einer Sommernacht lernen sie sich kennen:
Sean – Student aus dem Iran, seit ein paar Monaten in Deutschland, und Davy – aus dem Heim abgehauen, auf der Suche nach einem Freund. Beide werden Zeugen eines Überfalls. Und dann beginnt eine Verfolgungsjagd quer durch Deutschland: über Erdbeerfelder, durch Biergärten, im Heißluftballon, mit der Bahn und auf dem Moped. Immer wieder werden sie dabei von Kühen umzingelt, das scheint ihr Schicksal zu sein. Warum sonst sollte der Wagen mit Sean und dem Abschiebebescheid ausgerechnet auf dem Weg zum Flughafen in einer Kuhherde stecken bleiben?
Eine Roadnovel über zwei ungleiche Helden, Feuer und Sternenlicht, Musik und Kühe und einen Sommer auf deutschen Straßen.
Für Stevy und Bob,
alias Babak Bazrafshan aus Teheran
(dem einige dieser Dinge wirklich passiert sind),
die grenzenlose Freiheit,
das Kaninchen,
die Wölfe – UND den Hut.
0
Der Anfang vom Ende beginnt damit, dass ich auf einem Autodach stehe.
Ich, achtzehn Jahre alt, der Held dieser Geschichte.
Strohhut, Dreitagebart, kurzes schwarzes Haar, ein wenig zerzaust vom Wind.
Ich stelle es mir gerne als Szene in einem Kinofilm vor.
Wie ich da stehe, charismatisch, gut aussehend, ein Abenteurer. Wie ich auf die Landschaft hinabsehe: Sie ist so grün, hügelig, lieblich.
Neben der gewundenen Straße stehen ordentliche Leitpfosten. Und unten im Tal eine Kirche, weiß und adrett, ein Dorf, eine Tankstelle.
Unter mir: eine Menge herandrängender, warmer, brauner Leiber. Nein, es sind keine Mädchen.
Und, na ja, wenn da eine Kamera wäre, würde sie wahrscheinlich die Panik in meinen Augen zeigen. Und meine verschorfte rechte Wange, die ein wenig wirkt, als hätte ich beim Radfahren mit dem Gesicht gebremst.
Möglicherweise, vielleicht, eventuell … würde ich im Film weniger charismatisch wirken als lächerlich.
Aber, seien wir ehrlich: Keiner macht eine besonders gute Figur, wenn er auf dem Dach eines alten und zudem noch beigefarbenen Fiats steht, der in einer Kuhherde feststeckt.
Es wird nicht besser davon, dass sich weiter unten auf der Straße ein Polizeiauto nähert, das ein eindeutiges Ziel hat. Den Fiat und mich.
Und den kleinen Jungen, der neben mir auf dem Dach steht und wie ich mit den Armen wedelt, um die Kühe zu vertreiben.
Der Fiat ist leider nicht ganz legal ausgeliehen, aber das ist, wie die Deutschen sagen, nur die Spitze des Eisbärs. Da sind mehr und andere Vergehen auf der Liste, die sie über uns haben.
»Haut ab, ihr blöden Viecher!«, schreie ich die Kühe an. »Wenn die Polizei uns kriegt, ist es aus mit uns, aus und vorbei!«
Doch die deutschen Kühe verstehen mich nicht.
Denn ich schreie auf Persisch.
Persien. Iran.
Ein wunderbares Land. Weit weg.
Irgendwo dort sitzt meine Mutter und wartet auf Nachricht von mir. Irgendwo dort sitzen meine Onkel und Tanten und Cousinen und Cousins und Neffen und Nichten und warten darauf, dass ich Fotos schicke von meiner Arbeitsstelle in Deutschland. Meinen Freunden. Dem Beginn meiner glänzenden Zukunft.
Irgendwo dort sitzt mein Vater und will endlich stolz sein auf seinen Sohn.
Den Vagabunden. Den Herumtreiber. Den Typen, der Kameraeinstellungen erfindet, weil er gerne ein Held wäre.
Wenn sie den Film sehen könnten, den ich im Moment – nur im Kopf – drehe!
Ich male es mir aus: Sie sitzen alle auf dem rot gemusterten Teppich vor dem großen Flachbildschirm, essen Pistazien, trinken süßen Tee und starren gebannt auf die grüne deutsche Hügellandschaft.
Und mein Vater sagt: Bei Gott, was hat er da wieder angestellt? Er ist und bleibt ein Versager.
Okay, wir hatten das schon, dass ich auf dem Dach des Fiats keine besonders gute Figur mache.
Der kleine Junge neben mir macht aber keine wesentlich bessere.
Er sieht aus, als würde er eine Windmühle imitieren, wie er so mit den Armen wedelt, und jetzt hüpft er auch noch, was für das Autodach gar nicht gut ist. Aber es kracht und scheppert, und die Kühe weichen ein wenig.
»Siehste!«, ruft der kleine Junge triumphierend. »Geht doch!«
Wobei, was er sagt, nur höchstwahrscheinlich »siehste-geht-doch« bedeutet, genau verstehe ich ihn nie. Das liegt zum Teil an meinem Deutsch. Es liegt jedoch auch daran, dass der kleine Junge nuschelt und lispelt und noch etwas Seltsames mit den Wörtern anstellt, sodass immer Teile von ihnen fehlen.
Dieser verdammte kleine Junge.
Wie er da auf und ab hopst, wedelnd, grinsend.
Er ist ein Versager. Wie ich. Und er möchte wie ich anders sein: charismatisch und gut aussehend, ein Filmheld, ein unwiderstehlicher Mr Charming. Was er ist. Manchmal, in goldenen Augenblicken. Aber lieben tue ich ihn für die Augenblicke, in denen er sich vergeblich bemüht.
Weißt du noch, will ich zu ihm sagen. Weißt du noch, wie unsere Reise begann? Damals, an der Küste, in jener windigen Nacht?
Ich hatte nicht damit gerechnet, einen kleinen Jungen mit Sprachfehler zu treffen.
Und du hattest wahrscheinlich nicht damit gerechnet, einen Iraner mit Strohhut zu treffen.
Wenn wir uns nicht getroffen hätten, wäre die Polizei jetzt nicht hinter mir her, mein Gesicht wäre noch heil, meine Kleidung nicht blutverschmiert.
Aber was auch immer jetzt geschieht – ganz ehrlich? Ich würde nichts anders machen.
1Ketchup
Nacht und irgendwo das Rauschen von Wellen und im Sand ein verlorener Schlüssel.
So fing es an.
Es war natürlich eine blöde Idee, nachts im Sand einen Schlüssel zu suchen. Aber als ich entdeckt hatte, dass der Schlüssel nicht da war, war es schon Nacht gewesen, und ich hatte nicht bis zum Morgen warten können, denn zwischen sechs und sieben Uhr durchkämmen sie den Strand mit Spezialfahrzeugen, um den Müll zu entfernen. Dieses Land ist sehr gründlich. Und es würde auch sehr gründlich sein in der Entfernung und Vernichtung meines Schlüssels.
Der Schlüssel schloss den grauen metallenen Spind auf, der in der Ecke meines Zimmers im Heim stand. Dieser Schrank enthielt die wichtigsten Dinge in meinem Leben: einen Laptop, eine Klarsichthülle voller Dokumente, elf Unterhosen, zwei Hemden, eine Flasche Rasierschaum, dreiundzwanzig Dosen Deo (ein Sonderangebot), eine halbe Stange polnischer Zigaretten und ein zerfleddertes Buch mit deutschen Grammatikübungen.
Sowie einen ungeöffneten Brief.
Ich hatte bisher nicht den Mut gehabt, ihn zu öffnen. Ich hatte ihn in den Schrank gelegt und eingeschlossen und war auf die Insel gefahren, ans Meer, um dort genau diesen Mut zu sammeln. Man fährt über eine Brücke hin, und eigentlich ist es keine Insel, aber die Leute sind beleidigt, wenn man ihnen das sagt.
Wenn ich »Insel« denke, denke ich an die einzige Insel meines Landes, die ich je besucht habe. Kisch: Touristenstrandgebiet, Einkaufsurlaubsziel, Freihandelszone.
Und ich denke Worte wie Hotelkette und Shopping Mall und Freiheit. Auf Kisch ist nicht nur der Handel frei und daher alles billiger. Auf Kisch ist auch die Freiheit freier als irgendwo sonst im Iran. Dort kann man Frauen sehen, deren Kopftücher eine Menge Haar zeigen und deren Kleider enger sind als irgendwo sonst, Frauen, die Beachvolleyball spielen und rauchen, starke Frauen, wunderschöne Frauen.
Sollte ich jemals zurückkehren, werde ich es vielleicht endlich wagen, eine von ihnen anzusprechen.
Und ich würde ihr nicht erzählen, dass ich in Deutschland meine Nächte damit zugebracht hatte, Schlüssel im Sand zu suchen.
Im Licht meines Handydisplays fand ich hölzerne Eisstäbchen, Einwickelpapier und Muscheln, aber keinen Schlüssel. Ich wanderte von dem großen Steg weg, den sie Seebrücke nennen, obwohl er sinnlos im Nichts endet, wanderte an den Hotels vorbei, die aussahen wie schnörkelverzierte Sahnetorten, und ließ auch sie schließlich hinter mir.
Der kalte Nachtwind riss mir zweimal den Strohhut vom Kopf, und ich musste am Strand entlangrennen wie ein Deutscher Leinenhund und meinen eigenen Hut apportieren.
Hinter dem Strand lag ein Wald aus frierenden deutschen Kiefern. Ich habe gelernt, dass es extra Orthopäden für sie gibt, vermutlich, weil sie so krumm stehen. Na, wenn die Deutschen Hundefriseure haben, warum dann keine Kieferorthopäden?
Hinter den Bäumen standen nur noch vereinzelte kleine Ferienhäuser, und darüber hingen die Sterne am schwarzen Himmel, klar und wunderschön. In Teheran ertrinken die Sterne jede Nacht im Lichtsmog der Stadt. Der große Hafis hat über die Sterne geschrieben, und ich wollte gerade eines seiner Gedichte zitieren, da bemerkte ich das Licht hinter den frierenden Kiefern: ein huschendes, heimliches Licht, begleitet von leisem, verhaltenem Lärm, den jemand sich bemühte nicht zu machen. Schritte. Ein Klirren wie von brechendem Glas. Flüsternde Stimmen.
Ich steckte das Handy weg und stand ganz still.
Und dann trugen mich meine Füße den Strand hinauf, obwohl ich wusste, dass ich hätte umkehren sollen. Das Licht kam aus einem der Ferienhäuser, einem modernen Quader mit einer großen Schiebetür aus Glas. Die Schiebetür stand offen, und von dem Glas fehlte ein Stück – ein genau kreisrund ausgesägtes, handtellergroßes Stück neben dem Griff.
Die Deutschen machen eben alles sehr ordentlich. Selbst das Einbrechen.
Im Haus waren drei Männer im Licht einer Taschenlampe dabei, etwas wegzutragen. Eine Stereoanlage. Nach einem Moment kehrten sie zurück und trugen andere Dinge fort: einen Tisch, einen Plattenspieler, einen Computer … Als ich um das Haus herumschlich, fand ich dort einen Umzugswagen.
Ich fragte mich, ob ich die Polizei rufen sollte.
Ich meine, die deutsche Polizei ist dein Freund und Helfer, ich weiß das. Aber möglicherweise hat die Polizei etwas gegen charismatische junge Männer aus Persien, die sie nachts im Wald findet. Ich meine, die Polizisten könnten ja eifersüchtig werden auf einen so charismatischen Typen, der da unter den Sternen steht und poetische Gedanken denkt und viel cooler ist als sie.
Oder, falls es ein eher unsicherer Junge mit Strohhut sein sollte, den die Polizisten finden, könnte er sich beim Erklären in ein komisches Gestottere verirren …
Ehe ich zu einem Entschluss kam, flog mit einem Knall eine Tür im Haus auf, und dann flutete grelles Licht das Wohnzimmer. Ich kniff die Augen zusammen. Jemand fluchte auf Deutsch. Jemand sagte: »Was, zum Teufel, ist hier los?«
Und dann sah ich wieder etwas.
Hinter der Glastür standen die Einbrecher: drei Männer in dunkler Kleidung, mit schwarzen Mützen und schwarzen Handschuhen.
In der Tür zum nächsten Zimmer jedoch stand jetzt noch jemand.
Ein vierter Mann in einem hellblauen Pyjama mit kleinen gelben Mustern. Und ich begriff: Diesem Mann gehörte das Ferienhaus. Die Einbrecher hatten nicht damit gerechnet, dass er zu Hause war.
Der Mann war groß, breitschultrig und sehr selbstsicher. Er hielt ein Handy in der einen Hand, und in der anderen – ich schluckte – eine Pistole.
Er schien keine Angst zu haben. Ich hatte Angst. Ich stand draußen im Wind und hatte an seiner Stelle Angst und wusste, dass es manchmal besser ist, Angst zu haben. Wenn es drei gegen einen sind, Pistole hin oder her.
Er sagte noch mehr, und gleichzeitig tippten seine Finger jetzt etwas auf dem Handy.
Da löste sich die Starre der Männer. Einer machte einen Satz auf den Pyjamamann zu, um ihm das Handy zu entreißen, der zweite griff nach der Pistole, der dritte gesellte sich dazu, und es wurde sehr unübersichtlich. Sie rangen miteinander, stumm und keuchend.
Und dann knallte etwas. Wahnsinnig laut. Und der große, starke, breitschultrige Mann sackte in sich zusammen. Das Handy fiel aus seiner Hand.
Jemand löschte das Licht.
Alles lag wieder im Dunkeln, und es war einen Augenblick lang unheimlich still. Ich hörte meinen eigenen raschen Atem.
Bis einer der Männer etwas flüsterte, noch nervöser als zuvor.
Sie beeilten sich jetzt, rafften ihre Ausrüstung zusammen und verließen kurz darauf das Haus.
Das Geräusch eines Motors zerhackte die Nacht und wurde dann leiser.
Ich stand und starrte ins Dunkel.
Nein, ich stand nicht mehr.
Denn ich bin vielleicht ein Versager, und ich bin vielleicht der einzige Schüler im Deutschkurs A2, der nach Monaten immer noch nicht versteht, warum es der Büstenhalter heißt, aber die Männerunterhose.
Aber ich bin keiner, der zusieht, wie jemand stirbt.
Ich kniete neben dem gefällten Riesen im hellblauen Pyjama und suchte den Puls an seinem Handgelenk. Und fand nichts. Was allerdings an meiner Unsicherheit mit Pulsen liegen konnte.
»Verzeiherung«, sagte ich. »Excuse me, do you hear me? Are you alive? Lebt Sie?«
Der Riese im Pyjama gab ein Knurren von sich, das von tief unten in seinem massigen Körper kam, es war wie ein Erdbeben.
Da war Blut an seinem Pyjama, viel und sehr feuchtes Blut. Es sah unecht aus, wie Ketchup.
Ich dachte an den Freund meines Onkels, den wir einmal besuchen wollten, als ich noch klein war. Der lag auch in so viel Blut auf dem Teppich. Der Teppich war im Eimer. Irgendwer sagte, ein Krankenwagen müsste kommen, aber keiner rief einen.
Der Mann auf dem Teppich damals war Schriftsteller, das ist ein sehr gefährlicher Beruf im Iran. Es wurde nie jemand für den Mord verhaftet, die Polizei sagte, die Spur verliefe sich im Dunkeln.
Aber ich dachte damals, dass ich einen Arzt rufen würde, wenn ich noch mal jemanden in so viel Blut fände.
»A doctor«, sagte ich zu dem Mann im Pyjama. »I will call a doctor. Bitte zu warten mit Sterben, until ich habe gefunden.«
Meine Hand zitterte, als ich das Handy bediente. Der Netzempfang war schlecht, ich wartete ewig. Im Licht des Displays sah ich das schmerzverzerrte Gesicht des Riesen. Es rasselte, wenn er Luft holte.
»This is an emergency«, sagte ich schließlich zu der Frau im Wolgaster Krankenhaus. »Do you speak English, please?«
»Was ist los?«, fragte sie.
Und ich sagte »Blut« und »Zinnowitz, beach, holiday house« und »schnell« – und dann sah ich neben mir eine Bewegung. Eine Bewegung, die nicht von dem röchelnden Mann herrührte.
Ich steckte das Handy blitzschnell weg und griff nach der Pistole, die noch auf dem Boden lag.
Sie war unerwartet schwer in meinen Händen.
»Wer ist da?«, fragte ich in die Dunkelheit. »I have weapon. Kommen Sie nicht naher.«
»Was?«, fragte eine Stimme, und dann ging das Licht an.
In der Tür zum Flur stand ein kleiner Junge.
Vielleicht acht Jahre alt.
Er war sehr dünn, trug eine viel zu große blaue Windjacke, dreckige Turnschuhe und eine löcherige Jeans. Seine Augen waren blaugrau und weit aufgerissen, was daran liegen konnte, dass ich die Pistole auf ihn gerichtet hielt. Ich senkte sie.
Der Junge starrte mich nur weiter an.
Schließlich öffnete er den Mund und sagte einen langen Satz in einer mir vollkommen unbekannten Sprache. Erst, als er den Satz zum dritten Mal wiederholt hatte, verstand ich etwas, nämlich, dass er die Männer gesehen hatte und dass er doch deutsch sprach. Nur klangen die einzelnen Wörter alle so, als hätten sie zu lange in einem Fluss gelegen, der ihre Kante abgeschliffen hatte.
»Ich hab die gesehn, die Männer. Die mit den Auto. Du gehörs nich zu denen, oder?«
»Nein«, sagte ich. »Was do you do here? Was … du machst? Hier? Nachts?«
»Ich hab geschlafn«, meinte der kleine Junge schulterzuckend. »Inna Garage. Weil da kein Wind is. Und denn war Lärm. Wem hast du angerufm? Mit den Handy?«
»Klinik«, sagte ich.
»Gut. Aber wenn die komm, kommt auch die Polizei. Wenn die sehn, was passiert is … auweia.« Er deutete auf den Mann im Pyjama, der ab und zu leise stöhnte.
»Die glaubm für Garantie, dass du das wars«, sagte der kleine Junge. »Deine Fingaabdrücke sin auf der Pistole. Die Einbrecha ham Handschuh angehabt.«
»Shit«, sagte ich und ließ die Pistole fallen.
»Komm«, sagte der Junge. »Wir müssen weg.«
»Du auch?«, fragte ich.
»Klar, die dürfen mir doch nich finden«, meinte er, als wäre ich ein bisschen doof.
»Warum?«
»Na, weil ich abgehaun bin«, sagte der Junge. »Von das Heim.«
»Hm«, sagte ich. »Komisch. Ich wohne auch in Heim. Fluchtlingsheim.«
»Nee, da wohns du nich mehr«, meinte der Kleine. »Du muss richtich weg. Weg aus die Stadt.«
Er klang sehr entschlossen.
»Aha«, sagte ich. »Vielleicht ich muss nach Köln. Es kommt drauf an wegen die Brief in das Schrank.«
»Köln is super«, sagte er. »Kann ich denn mit?«
»Let’s see«, sagte ich.
In der Terrassentür blieb ich stehen und warf einen letzten Blick auf die Pistole, die jetzt wieder neben dem Riesen im Pyjama lag. Dann ging ich zurück und wischte mit dem Ärmel darüber, wegen der Fingerabdrücke, das musste reichen. Ich erwog kurz, die Pistole mitzunehmen, aber wenn sie die später bei mir finden würden, wäre das eher ungünstig.
Der Junge zog ungeduldig an meiner Hand, zog mich weg.
»Ich heiß Davy«, sagte er. »Und du?«
»Shayan«, sagte ich.
»Sean«, sagte er. »Kenn ich. Vom Fernsehen.«
Sean Connery, dachte ich. James Bond. Der perfekte Gentleman, dem die Frauen zu Füßen lagen. Erstaunlich, dass dieser kleine Junge einen so uralten Helden wie Sean Connery kannte. Aber cool.
»Sean«, sagte ich. »Okay. Komm.«
Dann traten wir hinaus in die windige deutsche Nacht und rannten.
2Wurstgulasch
Es war natürlich Irrsinn.
Irrsinn, mit diesem kleinen Jungen irgendwohin zu wollen.
Es wurde mir klar, als wir nach unserem nächtlichen Marsch bei meinem Fahrrad ankamen, das ich an der Seebrücke abgestellt hatte, in einem der Fahrradständer. Du kannst am abgewracktesten Provinzbahnhof sein oder vor einer alten Militärkaserne im Wald, wo sie Flüchtlinge durchimpfen (und ich weiß das): Es gibt immer Fahrradständer. Dabei ist es nicht so, dass die Deutschen überall Fahrräder bei sich haben, sie fahren gerne Auto, aber die Anwesenheit einer hübschen, ordentlichen Reihe von Fahrradständern scheint sie zu beruhigen. Das liegt am ökologischen Gewissen der Menschen hier. Wenn die Deutschen Fahrradständer sehen, haben sie das Gefühl, sie könnten theoretisch mit dem Fahrrad gekommen sein und so den weltweiten CO2-Ausstoß verringert haben, und dann sind sie glücklich.
Ich zog also mein Fahrrad aus dem Radständer, und Davy kletterte ganz selbstverständlich auf den Gepäckträger. Das Fahrrad war nicht viel mehr als ein Skelett. Ein Ukrainer, der aus dem Heim hatte ausziehen dürfen oder müssen, hatte es mir günstig überlassen. Der Gepäckträger war mit Draht geflickt.
»I don’t think this will hold you«, sagte ich zu Davy, und Davy sagte: »Ja, ja, los«, und dann sagte keiner von uns mehr etwas, denn in dem Augenblick erfasste uns das Licht von Autoscheinwerfern.
Die Polizei. Verdammt. Wir waren die einzig wachen Menschen in einem Ort, in dem gerade jemand niedergeschossen worden war. Natürlich glaubten die Polizisten, dass wir die flüchtigen Mörder waren.
Das Polizeiauto fuhr jetzt auf den Platz vor der Zinnowitzer Seebrücke.
Scheiße, dachte ich, das geht gar nicht, da ist ein Poller. Ein Poller, der Autos von der Seebrücke fern hält. Aber die Polizei hatte ihn überwunden, sie war auf eine unheimliche Art allmächtig.
Und als ich das begriff, bekam ich Angst.
Vermutlich war es nicht wahr, was die Deutschen über ihre Polizei sagten, von wegen Freund-und-Helfer und der ganze Quatsch, vermutlich waren sie genau wie die Polizei im Iran, und für etwas verhaftet zu werden, was man nicht getan hat, ist eine Sache, die einem dort allzu leicht passieren kann.
Ich sprang in die Pedale, und das Rad schoss los, auf die heckengesäumte Promenade zu.
Dort kann man nur als Fußgänger gehen, am Meer entlang, aber man sieht es nicht, wegen der Hecken. Vermutlich mögen die deutschen ihr kaltes, windiges Meer nicht und gehen lieber an ihm spazieren, ohne es angucken zu müssen.
Ich drehte mich um, um zu sehen, ob die Polizei uns auf den Promenadenweg folgte. Sie hätten dazu mehrere Hecken und Bänke umfahren müssen, aber man wusste ja nie.
Das Auto war stehen geblieben, mitten auf dem runden Platz. Eine Polizistin sprang jetzt heraus und rief etwas, vielleicht, dass ich anhalten sollte. Für den Bruchteil einer Sekunde sahen wir uns an, sie und ich.
Und ich dachte: Das ist nur eine Frau, die hat zu Hause vielleicht Kinder, und wenn sie mich verhaften, werde ich mich an sie halten, vielleicht hilft das.
Ich fragte mich, was sie sah. Einen charismatischen jungen Mann, der Sean Connery glich? Oder eher einen panischen, dünnen Jungen mit einem zerknickten Strohhut? Ich erinnerte mich schlagartig an eine ganze Handvoll ähnlicher Situationen aus meinem Heimatland, in denen ich der Polizei begegnet war. Sie hatten nie den charismatischen Helden gesehen, immer nur den Jungen mit dem Hut, der gerade wieder irgendein Verbot übertreten hatte und der nie politikkonform genug war. Allein die Tatsache, achtzehn zu sein, macht einen ja des verbotenen Revoluzzertums verdächtig, und die Tatsache, nachts auf einer Straße unterwegs zu sein, sowieso.
Einmal hatten sie mich verprügelt und vierundzwanzig Stunden lang eingesperrt, weil sie mich dabei erwischt hatten, wie ich meine Freundin auf einer Parkbank in der Öffentlichkeit küsste, obwohl es ja Nacht und gar keine Öffentlichkeit da war.
Ich hatte wenig Lust, mit gebrochenen Knochen in einer Zelle zu landen.
Und deshalb sah ich wieder nach vorn, trat noch kräftiger in die Pedale und schoss zwischen den Hecken entlang. Um sie zu verwirren, bog ich ab, holperte einen schmalen Durchgang zwischen zwei Hotels hindurch auf eine andere Straße und hetzte weiter, an Pensionen und Restaurants vorbei, und dann, irgendwo in einer Art Park, rutschte das Fahrrad in einer Schlammpfütze aus, und wir stiegen auf unelegante Art und Weise ab.
»Da rein!«, keuchte Davy, er krabbelte voraus, über Schlamm und Gras und Sand in ein Holzhaus. Ich begriff verspätet, dass wir auf einem Kinderspielplatz waren, und krabbelte ihm nach. Das Haus war recht geräumig, und ich zog das Fahrradwrack zu uns herein. So kauerten wir in der Dunkelheit und warteten auf ein Motorengeräusch. Auf suchende Taschenlampen. Gebellte Befehle. Schritte.
Doch nichts von alledem kam.
Nach einer sehr langen Zeit kroch fern ein Auto vorüber. Dann war um uns nur noch die dunkle deutsche Nacht.
»Wie krass«, sagte Davy.
»Krass«, wiederholte ich. »Krass – ist was?«
»Krass ist …« Davy überlegte. »Krass ist krass«, erklärte er dann.
»Okay«, sagte ich. »Ich lern. Der, die oder das Krass?«
»Gar nix«, sagte Davy. »Nur krass-krass.«
Und ich dachte, dass mir dieses Wort sympathisch war, wenn es nicht einmal einen Artikel brauchte.
Als der Morgen heraufzog, saßen wir nicht mehr in dem Spielplatzhäuschen in Zinnowitz. Die ersten Farben malten sich an den Himmel, und ich lenkte das Fahrradwrack über die Brücke mit dem blauen Mechanismus, der die ganze Straße anhebt, wenn die Schiffe durchfahren. Vor uns lag Wolgast.
Ich fragte Davy, wo er wohnte.
»Ich bin doch abgehaun«, sagte er. »Aus das Heim. Schon vergessen? Ich hab ein Onkel hier, aba der säuft. Du hast gesagt, wir fahn nach Köln.«
Ich wollte ihm sagen, dass ich das nicht gesagt hatte. Dass in Köln jemand war, den ich überzeugen musste, mir zu helfen, wegen des Briefs in meinem Spind. Und dass ich dabei ganz bestimmt keinen kleinen Jungen brauchen konnte und dass ich …
»Ich zeig dich den Truckerstop«, sagte Davy. »Das is nach den Mac noch ein Stück weiter und denn rechts, da nehmt uns einer mit, das hab ich schon mal gemacht. Da ham die mir aber wieder zurückgebracht. Diesmal nicht, ich geh nich zurück in den Heim. Lieba sterb ich.«
Und er lehnte seinen Kopf an meinen Rücken, eine warme Kinderwange an meiner Jacke.
Ich dachte an meinen Bruder zu Hause. Amin. Er war neun. Ich dachte daran, wie er mich zum letzten Mal umarmt hatte, ehe ich gegangen war. Er hatte nicht gewusst, dass es das letzte Mal war. Ich spürte die Wärme seiner Umarmung in der Wärme von Davys Wange.
Und vielleicht lag es daran, dass ich ihn nicht einfach irgendwo absetzen konnte.
Es wäre das Vernünftigste gewesen: ihn irgendwo abzusetzen.
Aber ich habe sowieso noch nie das Vernünftigste getan.
Truckerstop. Rechts nach McDonald’s. Ich trat in die Pedale.
Und dann schlingerten wir über die Straße, um abzubiegen, weil der Truckerstop natürlich links war statt rechts, und kamen hinter einem Schild zum Stehen, das verkündete:
ROCKYS’FELDKÜCHE – HEUTEWURS’TGULASCH.
Auf dem Feld parkten schon zwei LKWs. Die Fahrer, bullige Typen, standen an dem Wagen, wo ein Mann mit Bauch, Schürze und Kelle aus einem großen Topf eine rosabraune Masse in weiße Plastikschüsseln füllte: Rocky, wahrscheinlich. Er rückte das Rippstrickunterhemd unter der Schürze zurecht und steckte sich eine Zigarette an.
Und ich stellte mir vor, wie ich jetzt gleich auf ihn zugehe, mit sicheren Schritten, wie ein Held, wie Sean Connery.
Wie meine Familie zu Hause vor dem Flachbildschirm im Wohnzimmer sitzt, auf dem roten Teppich, und die ganze Szene sieht.
Sie trinken Tee und kauen Sonnenblumenkerne, die Vorhänge sind vorgezogen, schließen die Hitze und den Smog und die neugierigen Augen des Staates aus, schließen Teheran aus. Mein kleiner Bruder, Amin, sitzt ganz vorne und ruft: »Da ist er! Mein Bruder! Er ist sooo cool! Und jetzt zeigt er es dem Dicken im Unterhemd!«
Und ich, der Held, gehe in der Szene auf die Trucker und den Dicken zu, die Hände in den Schlaufen meiner Jeans – Moment, die Schlaufen sind seit Serbien ausgerissen. Also mit den Händen in den Taschen. Ich lüfte den Strohhut, wie ein echter Gentleman, lehne mich an die Theke des Gulaschwagens, und sage: »Excuse me, would you be so kind as to tell me how to get to Cologne?«
»Häh?«, fragte der Dicke.
Mit einem Schlag fiel ich aus der Kopfkino-Szene zurück in die Realität.
Davy zog an meinem Ärmel. »Der kann kein Englisch«, sagte er. »Lass mich ma.«
Und er schob sich an mir vorbei und stellte sich auf die Zehenspitzen, er reichte gerade so über die Theke. Der Dicke rauchte in aller Seelenruhe weiter, ehrlich gesagt, blies er mir den Rauch ins Gesicht, und dabei musterte er Davy wie ein Insekt, während die Trucker ihr Wurstgulasch in die breiten Grinsegesichter schaufelten.
»Prima Hut«, sagte der eine, aber er meinte das vielleicht nicht ernst. »Versteh? Hut? Prima?«
»Danke«, sagte ich steif und setzte den Strohhut wieder auf. Ich war mir unsicher, ob sie den Hut wirklich gut oder ob sie ihn scheiße fanden und sich über mich lustig machten, und ich spürte ein leichtes Zittern in meinen Händen, denn falls die Trucker beschlossen, mich beispielsweise zusammenzuschlagen, rechnete ich mir nicht besonders viele Chancen aus.
»Wir müssn nach Köln«, erklärte Davy nach oben zu dem Dicken im Unterhemd. »Wir brauchen ein, der nach Köln fährt. Am bestn schnell.«
»Da fragst du den Falschen«, sagte der Dicke. »Ich fahr mit meiner Gulaschkanone nich nach Köln, nee, sieht nicht so aus.« Und er klopfte liebevoll auf die Wand des Wagens. »Schwerin ist das Weiteste, wo wir mal waren.«
Warum die Deutschen übrigens zerkleinertes Abfallfleisch aus Kanonen auf Feldwegen verkaufen, war mir nicht ganz klar. Vielleicht ist es eine überlieferte Sitte, und sie haben auf diese Art mal einen Krieg gewonnen? Ich kenne mich nicht aus mit deutschen Kriegen außer mit dem Zweiten Weltkrieg und Hitler, den die Iraner mögen, die Deutschen aber nicht. Außer die Deutschen, die wiederum keine Iraner mögen. Hitler war bisher der einzige Ausländer, der nicht unser Öl wollte und trotzdem versprochen hat, uns zu helfen. Dafür wollte er aber offenbar eine Menge Dinge, die ich noch nicht ganz begriffen habe, unter anderem hatte er eine effektive Methode erfunden, sehr viele Leute mit Giftgas umzubringen, noch effizienter als Assad.
An jenem Tag neben der Gulaschkanone kam mir der Gedanke, dass er die Leute danach vielleicht zu Wurstgulasch gemacht hat und dass Wurstgulasch eine gute Art ist, etwas zu verbergen, weil man nicht sieht, was es vorher war …
»Keiner hier fährt nach Köln«, sagte einer der Trucker. »Köln ist arschweit weg.«
»Was wollt ihr denn da?«, fragte der andere.
»Nix, war’n Witz«, sagte Davy schnell. »Wir wolln nur nach …« Er zögerte, und ich sah, dass er den Pullover des Truckers anstarrte. »Anklam«, sagte er dann. Das stand auf dem Pullover, weiß auf schwarz: UNSERANKLAMBLEIBTUNSER. KEINEÜBERFREMDUNG!
»Ich will nach meine Oma«, erklärte Davy. »Die wohnt da.«
»Ach, und deinem Freund seine Oma, die wohnt da auch?«, fragte der erste Trucker. Sie brachen wieder in schallendes Lachen aus.
»Na, okay, Kleiner. Ich liefer dich bei der Oma ab. Wenn ich die denn mal sehen kann.«
Davy nickte. »Klar.«
Und ich fragte mich, ob er wirklich eine Oma in Anklam hatte und ob es eine gute Idee war, dorthin mitzufahren. Andererseits besaß Anklam einen Bahnhof, da war ich schon gewesen, es waren Ausländer-raus-Aufkleber an den Laternen, und es roch immer penetrant nach verbranntem Popcorn von der Zuckerfabrik. Ich könnte mich dort in einen Zug setzen, dachte ich. Richtung Köln.
Zehn Minuten später hob ich Davy auf den Beifahrersitz eines grünen LKWs.
Dann kletterte ich ihm nach. Der Fahrer zog die Augenbrauen zusammen.
»Der nicht«, sagte er entschlossen.
»Doch«, sagte Davy genauso entschlossen. »Das is Sean. Der hilft mich!«
Der Fahrer startete den Motor. »Ach ja?«
»Klar«, sagte Davy und legte eine kleine, schmierige Hand auf meine. »Sean is mein Freund.«
Und dann bogen wir auf die Schnellstraße ab, und die Sonne legte sich hellgelb auf die Sitzpolster, und Davy schlief ein, den Kopf an meiner Schulter.
Ja, und da schlief er also friedlich, dieser kleine Junge, den ich eigentlich überhaupt nicht kannte, und ich merkte, dass ich auf die Oma hoffte. Ich konnte doch schlecht ein Kind mit nach Köln nehmen.
»Also? Wo kommst du her?«, fragte der LKW-Fahrer. »Du versteh? Dein Land?«
»Ich verstehe«, sagte ich, denn das konnte ich schon von Anfang an korrekt sagen, weil es mich von Anfang an genervt hat, dass Leute wie dieser LKW-Fahrer zu glauben schienen, man wäre erstens bekloppt, wenn man nicht aus Deutschland stammte, und zweitens schwerhörig. Sie sprachen nie langsamer, wenn man etwas nicht verstand, sondern immer nur lauter.
»Ich komme aus Teheran«, sagte ich möglichst würdevoll und wusste, dass der Trucker jetzt überlegte, wo Teheran war.
»Teheran ist die Hauptstadt von Iran«, erklärte ich. Auch so ein schöner auswendig gelernter Satz. Er nickte.
»Und? Willst du wieder zurück, irgendwann?«, fragte der Trucker.
Komisch, alle stellten ständig diese Frage. Da bist du fünf Minuten irgendwo zu Gast, und schon fragen sie, wann du wieder gehst.
»Ich geh zurück zwei Wochen«, sagte ich. »Tourist. Sie verstehen? Ich bin Tourist. Besucherin.«
»Besucher«, sagte der Trucker.
»Was?«
»Besucherin ist eine Frau«, sagte der Trucker und steckte sich eine Zigarette an, ohne mir eine anzubieten, was sehr schade war. »Deutsch, in ist für Frau.«
»Ja, aber die Gleichberechterung«, sagte ich, denn das hatte ich mir gemerkt, es war etwas typisch Deutsches. »Deutschland, jede Wort muss in am Ende haben, ist Gleichberechterung, nein? Also ich sage: Bin ich Besucherin. Ist gerecht.«
Der Trucker nickte langsam.
»Schön, du bist Tourist«, sagte er schließlich. »Dann ist ja gut.«
Danach erklärte er mir in etwa, dass er nichts gegen Leute aus anderen Ländern hätte, solange sie in ihren anderen Ländern blieben, aber Touristen waren eine Ausnahme.
Und da stellten wir fest, dass wir ziemlich viele Gemeinsamkeiten hatten, und wir redeten eine halbe Stunde über Fußball. Ich sagte den Namen eines deutschen Fußballers, und er sagte »Ja, ja« und erzählte etwas über den Fußballer, was ich nicht verstand, und ich sagte »Ja, ja«, und dann nannte ich den Namen eines iranischen Fußballers und erzählte etwas über den, was der Trucker nicht verstand, und dann kam wieder ein deutscher dran.
Wir machten das Gleiche auch eine Weile mit Titeln von Rammstein, und am Ende sagte ich noch einmal, dass ich bald zurückgehen würde.
Denn warum, sagte ich, würde jemand aus dem Iran weggehen wollen?
»Land viel modern«, sagte ich. »Viel Kultur. Iran hat erfinden Trickfilm, Sie wissen? Erste Trickfilm von Welt. Heute in Museum. Ein Becher, von Ton. Mit Ziege und Baum. Ziege, sie frisst Baum, hüpft, hüpft, hüpft. Vier Bilder. Sie dreht Tonbecher schnell, es ist wie Film.«
Und falls der Trucker jetzt traurig war, dass die Iraner das Kino erfunden hatten, während sie selbst noch in Höhlen lebten, fügte ich rasch hinzu: »Deutschland auch ist sehr Kultur. Goethe, Schiller, Wurstgulasch.«
Da lachte der Trucker laut und dröhnend, klopfte mir mit seiner Pranke auf die Schulter und wiederholte begeistert: »Goethe, Schiller, Wurstgulasch!«
Er fuhr die Fenster herunter, um die warme Sommerluft hereinzulassen, und eine Weile riefen wir immer abwechselnd »Goethe, Schiller, Wurstgulasch!« und lachten. Vielleicht lachten wir nur, weil es sich gut anfühlte, zusammen zu lachen.
So kamen wir nach Anklam hinein.
Und ich dachte, dass ich meinen Mitbewohner anrufen sollte, in Wolgast. Wegen des Briefs und weil er ja den Schrank irgendwie aufkriegen und nachsehen könnte. Aber ich verschob das auf später. Unangenehme Dinge auf später zu verschieben – darin war ich immer schon gut.
SMS nach Köln, auf Persisch:
Hey. Ich bin auf dem Weg. Wirst du mir helfen? Du hast es versprochen.
Und dann tankten wir, komischerweise auf einem Flugplatz, weil da das Benzin billiger war und weil der Trucker sowieso in der Nähe abbiegen musste. Der Flugplatz war klein und nur für Sportflieger. Davy schlief noch immer. Der Trucker unterhielt sich draußen mit einem winzigen alten Tankwart in einer schwarzen Jacke. Er erinnerte mich irgendwie an meine Großmutter, wie sie klein und faltig aus ihrem schwarzen Tschador heraussah, wenn sie zum Markt ging, um Kräuter zu kaufen.
Es tat ein bisschen weh, an meine Großmutter zu denken. An sie und ihre Küche und den Duft darin: Kerbel, Pfefferminze, Basilikum, Schnittlauch, Zwiebel, all diese Gerüche, die es in Deutschland nicht gibt, oder wenn, dann nur in winzigen Dosen, als wären Kräuter gefährliche Medikamente. Aber ich konnte dem Trucker nicht sagen, dass ich meine Großmutter vermisste, denn ich hatte ihm ja erzählt, ich könne jederzeit zurückkehren, weil der Iran ein modernes Land ohne Probleme sei. Ich meine, das ist er. Solange man den Mund nicht aufmacht.
»Warum seufz du?«, fragte Davy, gähnte und streckte sich.
»Meine Oma ist wie das Mann«, sagte ich.
»Deine Oma is Tankwart aufm Flugpatz? Cool«, meinte Davy. »Aba wir müssen jetzt weg.«
Damit öffnete er die Tür und glitt zu Boden wie eine kleine, entschlossene Schlange. Er legte den Finger an die Lippen, und ich folgte ihm gehorsam über die asphaltierte Fläche bis hinter ein kleines Häuschen, wo wir uns duckten und kurz Atem holten.
»Wir müssen zur Straße«, sagte Davy. »Denn halten wir wieder’n Daumen raus.«
»Warte. Was ist mit dein Oma in Anklam?«
Davy schüttelte den Kopf und grinste breit, und jetzt sah ich, dass er vorne eine riesige Zahnlücke hatte, so breit wie eineinhalb Zähne, sodass man sich fragte, wie er es geschafft hatte, einen halben Zahn zu verlieren. »Ich hab drei Omas«, sagte er. »Eine in Wolgast, eine in Lassan und eine aufm Friedhof, und die wollen mir alle nich. Nich mal als Besuch.«
»Du hast gelügt zu den Trucker«, stellte ich fest. »Kinder nicht dürf lügen.«
Davy sah mich aufmerksam an und legte den Kopf schief.
»Dürfen Awachsene?«, fragte er.
Doch ehe ich darüber nachdenken konnte, packte er meine Hand und zog mich mit sich über eine Wiese, in Richtung Straße.
Als ich mich umsah, startete auf der Rollbahn gerade ein kleines rotes Flugzeug, das aussah wie Spielzeug. Es flog hoch ins Himmelblau hinein, und ich dachte, wie wunderbar es sein musste, so hoch oben zu fliegen, wo man machen konnte, was man wollte. Keine Straßen, keine Verkehrsschilder, keine Grenzen. Eines Tages, dachte ich, kaufe ich mir so ein Flugzeug. Genau so eins, ein kleines rotes. Und ich sah den Film wieder vor mir, sah, wie ich samt Strohhut durch den Himmel glitt, wie ich einen Looping machte, während die Verwandten zu Hause das Ganze auf dem Flachbildschirm verfolgten. Hörte Amin sagen: »Das ist die Freiheit, guckt euch das an! Die ganz große Freiheit, er hat sie gefunden.«
»Er hat genug Geld verdient, um sich eine eigene Maschine zu kaufen«, sagte mein Vater stolz.
»So, so«, murmelte meine Mutter, »und wie hält der Strohhut bei dieser wahnwitzigen Fliegerei?«
»Sean!«, sagte Davy und zog an meinem Ärmel. »Träumst du? Da nehmt uns einer mit.«
Gut, wenigstens ein schönes neues deutsches Auto, dachte ich. Wenn schon kein Flugzeug.
Ich blinzelte.
Der am Straßenrand gehalten hatte, war ein älterer dicker Mann im Trainingsanzug, der uns mit einem Kopfnicken bedeutete, Platz auf der Ladefläche seines Anhängers zu nehmen. Auf der Ladefläche waren bereits eine Waschmaschine und ein Stapel Holzbretter festgezurrt.
Und das, was den Anhänger zog, war kein schönes neues deutsches Auto.
Es war ein Pferdewagen.
Eine halbe Stunde später saß ich also auf einer Waschmaschine, die von zwei alten braunen Ponys gezogen wurde, und ließ die saftig grünen Felder und Wiesen an mir vorüberziehen.
Davy lehnte neben mir an dem Stapel Bretter. Er hatte die zu große blaue Windjacke aufgemacht, aber nicht ausgezogen, und einen Grashalm im Mund wie eine Zigarette.
»Köln, ja?«, fragte ich zweifelnd.
»Ich hab ihm gefragt«, sagte Davy mit einem Achselzucken. »Er hat gesagt, det is die Richtung.«
Autos überholten uns unaufhörlich, schöne, schnelle deutsche Autos, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Ford … alle mit Touristenkennzeichen. Ab und zu ein schwarzes Auto mit einheimischem Kennzeichen und Achten im Nummernschild und getönten Scheiben. Wenn ich die sah, duckte ich mich unwillkürlich. Solche Autos sollte man meiden, das hatten mir die Afrikaner im Heim eingebläut. In denen saßen Leute, die vielleicht für Katzen bremsten, aber für Iraner bestimmt nicht. Einem von denen waren die Drogenpreise der Afrikaner im Heim zu hoch gewesen, da hatte er »Heil Hitler!« gerufen und dem Afrikaner beide Arme gebrochen.
Der Pferdewagen bog jetzt in eine noch kleinere Straße. Hoch am Himmel kreiste ein Bussard – frei wie das rote Sportflugzeug. Vielleicht sind immer nur die Raubtiere frei.
Da fügte ich mich meinem Schicksal, mit einer Waschmaschine und acht Meilen pro Stunde zu reisen.
Es war schön, die Bäume anzusehen mit ihren ausgestreckten uralten Armen voller Grün, schön, die einzelnen Blumen am Straßenrand zu betrachten, kleine weiße und gelbe und violette Blumen ohne Namen. Dieses Deutschland ist ein sehr schönes Land, wenn man es schafft, der allgemeinen deutschen Eile und Effektivität zu entrinnen. Diesem Prinzip, überall so rasch wie möglich anzukommen.
Wenn man sich immer beeilt, ist man früher am Ziel, doch das Ziel wird dadurch nicht schöner. Man kann weiterhetzen, zum nächsten Ziel. Und am Ende? Am Ende ist man früher tot.
Es machte nichts aus, wann ich nach Köln kam.
Und es hatte etwas durchaus Königliches, so hoch oben auf dieser Waschmaschine zu thronen und die Landschaft zu betrachten. Wir fuhren jetzt durch einen Wald voller hoher Bäume. Ich sah Vögel zwischen den Ästen, ich sah ein Reh durch die Schatten springen, und ich stellte mir vor, wie ich mit meinem kleinen Bruder durch diesen Wald wanderte. »Schau, Amin«, würde ich sagen. »Das ist auch Deutschland. Nicht nur die Autobahnen.« Und wir würden uns ins Moos setzen und ein Picknick machen wie in den Parks von Teheran, und es wäre genauso schön.
»Ich hab Hunger«, sagte Davy, als könnte er Gedanken lesen. »Hast du was zu essen?«
Ich gab ihm meinen letzten Kaugummi.
Dann sah ich ihm beim Kauen zu, sein Gesicht mit der Zahnlücke und den fragenden blauen Augen, und auf einmal wurde mir bewusst, dass ich dabei war, ihn tatsächlich mit nach Köln zu nehmen.
Dies war nicht mein kleiner Bruder, es war ein fremder Junge.
»Hör zu«, sagte ich. »Du kannst nicht bleiben mit mir. Was ist mit Schule?«
»Jetzt is keine«, sagte Davy. »Wir ham doch Sommaferien.«
»Aber«, begann ich.
Und ich wollte ihm erklären, dass ich ihn auf keinen Fall weiter mitnehmen würde. Dass man sich um Kinder kümmern muss, darum, dass sie sich waschen und sich die Zähne putzen und gesunde Dinge essen. Und dass ich der Letzte war, der sich dafür eignete. Ich bin niemand, der Verantwortung übernehmen kann, wollte ich zu ihm sagen, ich bin ein Vagabund, ein Versager, der verrückte Junge mit dem Strohhut, der schon in Teheran sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat.
Aber da legte er mir eine Hand auf den Arm, eine kleine, dreckige warme Hand, und sagte: »Ich muss aber mit dir mit. Ich kann nich zurück zu die anderen.«
Ich sah ihn nur an, und er sah mich an, und die Zahnlücke sah mich auch an. Und ich dachte daran, dass Kinder solche Zahnlücken dann haben, wenn sie in die Schule kommen. Und dass Davy sicher schon in der dritten Klasse war. Er hatte Ärger gehabt mit den anderen im Heim, genug, um Zähne einzubüßen. Und ich sah in seinen Augen die Angst vor noch mehr Ärger und eine kleine Traurigkeit und eine große Sehnsucht nach der Straße. Den Feldern. Der Freiheit.
Er sehnte sich nach Freiheit so wie ich.
»Nur bis Köln«, sagte er. »Denn geh ich nach mein Vater. Der wohnt in die Nähe.«
»Ach so«, sagte ich. Und beinahe war ich enttäuscht.
Er hatte einen Vater.
Ich war niemand für ihn. Und ich war niemand mehr für Amin, weil ich Amin verlassen hatte.
Ich gehörte nicht in dieses Deutschland mit seinem grünen Wald, und ich gehörte nicht mehr in den Iran mit seinen warmen, quirligen, bunten Straßen.
Ich zog den Strohhut tiefer in die Stirn und schloss die Augen.
SMS nach Köln, auf Persisch:
Alles in Ordnung? Ich habe dir geschrieben. Warum antwortest du nicht?
Irgendwann machte der Pferdewagenkutscher eine Pinkelpause, und dann setzte er sich auf einen Stein und fing an, ein Sandwich zu essen. Sandwiches heißen in Deutschland Stulle und sind aus dunklem Brot voller Körner. Wenn man es kaut, ist es, als würde man in einen Kiesweg beißen.
Dennoch knurrte mein Magen bei dem Anblick. Davys Augen waren groß wie Murmeln.
»Mahlzeit«, sagte er und schluckte.
Ich fragte mich, wann wir zu einem Laden kommen würden, wo man etwas zu essen kaufen konnte. Beim Tempo des Pferdewagens konnte das noch Tage dauern.
»Warum«, fragte ich, »Sie haben keine Auto?«
Er wiegte den Kopf und bedachte die Frage gründlich.
»Na, vor der Wende war nix mit Auto«, sagte er schließlich. »Mussteste ja ewig warten druff. Und denn kam die Wende, und alle ham sich drüben Autos gekauft. Aber teuer, na! Für meine Gäuler, da brauch ich kein Benzin, kein Öl, nix. Keine Fahrerlaubnis, keinen TÜV. Kostet ja alles ein Geld, mein lieber Scholli!« Er lachte kurz und rau.
»Sean«, sagte ich. »Mein Name. Sean, nicht Scholli.«
Der Mann sah mich verständnislos an, dabei war er es doch, der mich mit Scholli angesprochen hatte, und zufällig wusste ich aus dem A2-Kurs, dass Scholli ein Fisch ist, in Mehl und gebraten (und natürlich ohne Gewürze).
Mein Magen knurrte wieder, lauter. Da seufzte der alte Mann, pulte ein Alufolienpäckchen aus seiner Tasche und hielt es uns entgegen. »Kuchen«, sagte er. »Hab ich gebacken.«
Wir nahmen jeder ein Stück Kuchen, der rot-grün-gelb gefleckt war und die Konsistenz eines Schwamms hatte. Deutsche Küche ist gewöhnungsbedürftig.
»Papageienkuchen!«, sagte Davy begeistert. »Is mein Lieblings!«
Und ich nickte dankbar. Ich sage jetzt nicht, wie er schmeckte, weil das unhöflich wäre. Aber ich fand es beeindruckend, dass der Mann Kuchen backte. Mein Vater hätte das nie hinbekommen.
»Wenn ein Tag Sie kommen zu Iran«, sagte ich, »Sie kommen zu uns. Sie kann probieren Iran Essen.« Es war natürlich vollkommen klar, dass dieser alte Mann in seinem Leben nicht mehr in den Iran kommen würde. Und ich vermutlich genauso wenig.
Aber Höflichkeit ist wichtig, Höflichkeit ist das Letzte, was bleibt, wenn man nichts mehr hat.
»Klar, ich komm nach Teheran«, sagte der Alte grinsend. »Ich stell einen Antrag auf Kur bei der Krankenkasse und schreib rein, ich muss da zwei Brüder besuchen, vielleicht zahlen die dann den Flug, was.«
Und dann holperten wir weiter die kleine Straße entlang.
Brüder. Der Alte musste ziemlich kurzsichtig sein.
Der Asphalt der Straße hatte sich in uraltes Kopfsteinpflaster verwandelt, als die Pferde stehen blieben. Kurz vor einem Dorf.
»So«, sagte der alte Mann. »Hier is Ende. Köln is da.« Er zeigte die Straße entlang. »Nach dem Dorf noch ne Stunde, wenn ihr zügig lauft.«
»Fahren Sie nicht weiter bis zu das Dorf da?«, fragte Davy.
»Doch, da wohn ich«, sagte der Mann. »Aber muss ja nicht gleich jeder wissen, dass ich so’ne wie euch mitgenommen hab. Ihr versteht schon. Ausländer. Denn haut rein.«
Ich wusste nicht, in was wir hauen sollten, es war wohl nur wieder eine Redensart.
Als wir an dem Hof vorbeikamen, in dem der Wagen jetzt stand, luden zwei jüngere muskulöse Männer gerade die Waschmaschine ab. Sie warfen uns Blicke zu wie Hunde, die ein Grundstück verteidigen. Und wir machten, dass wir weiterkamen.
Nach drei Stunden waren wir immer noch nirgends angekommen. Und es war warm. Und wir waren sehr, sehr durstig. Alles, was ich bei mir hatte, waren mein Portemonnaie und mein Handy, und noch hatte niemand eine App erfunden, mit der man Trinkwasser runterladen konnte.
»Du, Sean«, sagte Davy und blieb stehen. »Ich kann nicht mehr.«
Und er setzte sich einfach auf die Straße.
»Können wir nicht warten, bis ein Auto kommt und uns mitnimmt?«
»Hier nicht kommt Auto«, sagte ich, denn da war ich ziemlich sicher. »Wenn ich Reise gemacht zu Deutschland, ich musste auch laufen. Viel laufen. In Berge. Sehr kalt. Schnee. Ich hatte viele Abenteuer.«
»Was für Ahmteuer denn?«, fragte Davy.
»Ich erzähle, wenn wir sind nächste Dorf«, sagte ich.
»Das ist fies!«
»Nein«, sagte ich. »Das ist vernunftlich.«
Aber er stand trotzdem nicht auf.
»Okay«, sagte ich. »Shit. I’ll carry you. Just ten minutes. Then you’ll walk.«
Und ich nahm ihn auf meinen Rücken und trottete weiter, die Straße entlang, leise vor mich hin fluchend, in allen Sprachen, die mir einfielen.
Es war später Nachmittag, als wir das Schild sahen.
Da stand es, zwischen weiten Wiesen und Maulwurfshügeln, stand stolz gelb-schwarz neben dem Fahrweg, der eigentlich nur aus Schlaglöchern bestand, als hätte man es eben erst geputzt, das Schild. Hinter dem Schild lag ein Ort aus vielleicht zwanzig Häusern und einer alten Backsteinruine, aus der Birken sprossen. Hühner gackerten irgendwo, Radiomusik lief, eine fette Frau mit Zigarette im Mund und hautengem pinkfarbenem Oberteil jätete Unkraut. Ein paar Glatzköpfe schraubten an einem Traktor herum und tranken Bier aus Flaschen.
Ich sah den Film wieder vor mir.
Den Film, in dem ich, der Held mit dem leicht zerknickten Strohhut, vor dem Schild stehe: mit einem dreckigen, verschwitzten kleinen Jungen auf dem Rücken, der eingeschlafen ist. Ich sehe sehr heldenhaft aus, wirklich, wie ich mich da aufopfere und das Kind trage. Dank dieser Opferbereitschaft, dank meiner Klugheit und meiner Landeskenntnis haben wir, die Filmfiguren, unser Ziel erreicht.
Die Zuschauer dürfen aufatmen. Denn jetzt liest der Held, also ich, das Schild:
Und darauf, schwarz auf gelb, sehr ordentlich, steht der Name des Dorfes, dort im nordostdeutschen Nirgendwo:
CÖLLN.
3Erdbeeren
Ich vergaß das Kopfkino und alle Helden.
Verdammt, wie konnten sie ein Dorf hier ins Nichts bauen, dass Cölln hieß?
In meinem Land sind wir ehrlicher, wir haben genau ein Teheran und ein Schiras und Isfahan, und nicht plötzlich irgendwo in den Bergen an der türkischen Grenze ein zweites.
Ich dachte daran, was mir die Leute über den Osten erzählt hatten, den Osten von Deutschland.
Natürlich wusste ich von der Teilung Deutschlands, dem Mauerbau, dem Mauerfall. Die Revolutionäre im Iran sind immer noch Kommunisten, Freunde von mir waren Kommunisten, und ich fand es seltsam, dass sie hier den Kommunismus wieder abgeschafft hatten, weil er nicht so funktioniert hatte.
Die Leute hatten mir erzählt, dass es viele Dinge im Osten lange nicht gegeben hat, angefangen mit der Freiheit, ganz ähnlich wie in meinem Land – bis hin zu Marzipan und Reiseerlaubnissen. Und dass es daran liegt, dass so viele Kinder amerikanische oder französische Namen haben, Davy oder Kevin oder Justin. Ein Volk, das nicht nach Amerika ausreisen darf, möchte eben wenigstens so tun, als hätte es ein amerikanisches Baby. Und womöglich, dachte ich, war es mit den Orten genauso. Wenn man nicht nach Köln fahren kann, baut man sich eben sein eigenes Cölln. Der Iran hätte eigentlich voll sein müssen von New York.
In Cölln gab es nichts.
Keinen Laden, keinen Dorfplatz, keine Leute, die vor ihren Türen saßen und sich unterhielten – bis auf die Männer, die den Traktor reparierten, und die Frau im Gemüsebeet, und die starrten uns nur wortlos an. Ich ließ sie starren, ich ging einfach weiter mit meiner Last aus Kind und Regenjacke und Durst.
Ich ging zu der Ruine, trat das hohe Gras platt und legte Davy in den Schatten.
Er wachte nicht auf.
So erforschte ich die Ruine allein. Die Natur hatte das alte Gebäude fast komplett verschlungen, Brombeerranken wuchsen durch die Fenster, doch die Brombeeren daran waren leider noch hart und grün. Das Holz der Treppe zum ersten Stock war herausgerissen, vielleicht hatte es jemand verheizt, genau wie die Türen. Es lag eine Menge Müll herum, leere Bierflaschen, zerfetzte Plastiktüten, eine Matratze.
Und dann fand ich etwas Wunderbares. Ich fand eine Pumpe.
Eine alte, eiserne Wasserpumpe, eingerostet, aber funktionstüchtig. Es war kein Eimer da, und so holte ich zwei leere Bierflaschen aus dem Haus, wusch sie aus und pumpte das Wasser hinein, um damit zu Davy zurückzukehren.
»Aufwach!«, sagte ich.
Davy schlug die Augen auf und starrte mich und die Flasche an, die ich ihm hinhielt.
»Bier?«, fragte er beeindruckt.
Ich nickte und grinste.
Und Davy rappelte sich hoch, sagte »Cool!« und trank einen Schluck.
»Is ja Wasser«, meinte er dann, irgendwie erleichtert.
Wir stießen unsere Bier-Wasser-Flaschen aneinander, und ich sagte: »Nush«, und Davy sagte: »Prost«, und wir tranken eine Weile schweigend und gierig.
»Was is Nush?«, fragte Davy dann.
»Prost. In Persisch.«