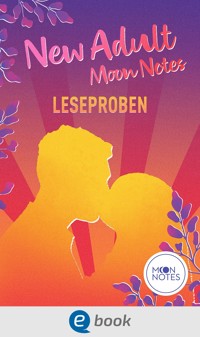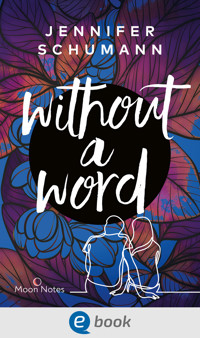9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Was, wenn du die große Liebe im schlimmsten Chaos triffst? Eine Amerikanerin in Paris: Ihr Studium an einer berühmten Modeschule führt die 19-jährige Emma nach Paris. Gemeinsam mit einer Studienfreundin ist sie in einer Bar im 10. Arrondissement, als plötzlich bewaffnete Männer das Lokal stürmen und in die Menge feuern. Emma und der 23-jährige Lucien sind gerade zufällig im hinteren Teil der Bar, gemeinsam können sie sich in einem Lagerraum verschanzen. Stundenlang lenken sie sich dort mit Gesprächen von der Panik ab. Doch als das Leben weitergeht, erweist es sich ein ums andere Mal als hart für die beiden, die mit sich und ihren Gefühlen ringen. Zwei Survivor, die sich finden und wieder zu verlieren drohen. - Eine "Liebe gegen alle Widerstände"-Romanze vor dem Hintergrund der Terroranschläge in Paris. - Dein Lieblings-Topic "Forbidden Love" mit True Crime-Elementen und Tiefgang. - Emma in Paris: Mode im angesagten Uni-Setting.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch
Ihr Studium an einer berühmten Modeschule führt die 19-jährige Amerikanerin Emma nach Paris. Um die erste absolvierte Prüfung des neuen Semesters zu feiern, trifft sie sich eines Abends mit Freundinnen in einer Bar, als plötzlich bewaffnete Männer das Lokal stürmen und in die Menge feuern. Emma und der 23-jährige Lucien sind gerade zufällig im hinteren Teil der Bar, und gemeinsam können sie sich in einem Lagerraum verschanzen. Stundenlang lenken sie sich dort mit Gesprächen von der Panik ab. Doch als das Leben weitergeht, erweist es sich ein ums andere Mal hart zu den beiden, die mit sich und ihren Gefühlen ringen.
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast,
können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken.
Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person
deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden:
www.nummergegenkummer.de
Schau gern hinten im Buch, dort findest du eine Auflistung
der potenziell triggernden Themen in diesem Buch.
(Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern,
steht der Hinweis hinten im Buch.)
Kapitel 1Emma
»Wollt ihr drinnen oder draußen sitzen?« Um sich vor der Kälte zu schützen, zog Sharon ihren grauen Wollmantel am Kragen enger.
»Ich bin für drinnen«, gab Vera ihre Stimme ab.
»Drinnen«, lautete auch Momokas Entscheidung.
Hastig schickte ich die Nachricht an meine Mom ab, die ich gerade getippt hatte, und sah mich auf der Terrasse des Cafés prüfend um. »Mir wäre drinnen auch lieber.«
Sharon verdrehte die Augen, schob dann aber die Eingangstür des Ladens auf. »Okay, dann mal los, mein erster Drink ruft nach mir. Wisst ihr, was uns von den Franzosen am allermeisten unterscheidet?« Sie wartete unsere Argumente gar nicht ab, was typisch für sie war. Sharon war die geborene Anführerin. Herrisch, aber liebevoll. Unterstützend, aber bereit, dir in den Arsch zu treten. »Uns unterscheidet, dass wir im Inneren von muffigen Bistros vergammeln, weil wir uns den Allerwertesten nicht abfrieren wollen, was zur Folge hat, dass ich nicht rauchen kann und mir wie eine Aussätzige vorkomme.«
Wir drei lachten, wobei ich Sharons Arm mitfühlend tätschelte.
Auch im Inneren unseres Lieblingslokals war es voll, was für einen Freitagabend mitten in einer Großstadt wie Paris natürlich nicht unüblich war. Doch ich hegte eine heimliche Liebe zu einem Tisch an der Fensterfront, von wo aus man den Blumenladen gegenüber sehen konnte. Mit all den Pflanzen, die tagsüber vor dem Geschäft standen, kam es einem vor, als wäre August und nicht November. Aber wir bezogen einen der Tische im hinteren Bereich. Dort, wo unter der Woche öfter ein älterer Herr saß, Tee trank und seine Nase im Grunde ständig in ein Buch gesteckt hatte. Er war für mich zu einer meiner ersten Konstanten in dieser noch ziemlich fremden Stadt geworden.
Für mein Studium an einer der renommiertesten Modeschulen der Welt war ich erst vor drei Monaten von einem ruhigen Vorort in Boston ins pulsierende Paris gezogen. Das zu tun, beinhaltete so viel mehr als nur den Wechsel meines Wohnortes. Es war eine monumentale Veränderung, die meinen Eltern das Herz gebrochen und mir einen massiven Schuldenberg aufgehalst hatte. Eine Entscheidung fürs Leben, hatte es mein Dad genannt. Seine Stimme dabei mahnend, sein Blick traurig. Er hatte versucht, mir diese lebensverändernde Entscheidung auszureden, doch ich war stur geblieben, hatte meine Bewerbung abgeschickt und die Zusage der ESMOD erhalten. Ich hatte ihm versprechen müssen, nach meiner Ausbildung zurück in die USA zu kommen, und ich hatte es getan, wohl wissend, dass ich mir im Stillen die Wahl, in Europa zu bleiben, offenlassen würde. Es war eine winzige Option, eher sogar unwahrscheinlich, weil ich Boston liebte. Aber ich wollte ungebunden und frei sein.
Paris und ich – es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, kitschig. Hey, die Stadt der Liebe machte auch vor mir nicht halt.
Meine Liebe zu der Stadt war groß, mein Heimweh manchmal aber noch größer. So ehrlich musste ich sein, zumindest zu mir selbst. Meinen Eltern gegenüber erwähnte ich dahingehend keine Silbe. Irgendwann aber war dieses Gefühl, ich wäre bloß im Urlaub, verschwunden und einer mir bis dato völlig unbekannten Sehnsucht nach meiner Familie gewichen. Doch diese Tiefpunkte gingen zum Glück vorbei und machten der Leidenschaft in mir für alles, was mit Mode zu tun hatte, Platz. Eine Leidenschaft, von der ich nun nicht mehr in meinem Kinderzimmer träumen, sondern sie tatsächlich verwirklichen durfte. Und jeder Idiot wusste, dass der Weg in die Freiheit übersät war mit Tränen, Schweiß und Schmerz.
Schmerz war auch das Thema des Abends. Meine Freundinnen hatten die schwierige Aufgabe, meine geknickte Seele zusammenzuflicken. Sharons ideale Mischung dafür – Freundinnen, der ein oder andere Drink, Musik und männliche Ablenkung. Letzteres hatte den höchsten Stellenwert.
»Also … was flößen wir uns zuerst ein?«, fragte Sharon, nachdem wir uns aus unseren Jacken geschält hatten.
»Ich glaube, ich trinke erst einmal einen Tee oder so etwas«, meinte Momoka, die eigentlich alle Momo nannten und die, obwohl sie ursprünglich aus Japan kam, manchmal wortgewandteres Englisch sprach als Sharon. Was Momo darauf schob, dass ihre Familie laut ihren Angaben in Geld schwamm und sie mehrsprachig aufgewachsen war. Was genau genommen hieß, dass sie perfektes Französisch (sehr hilfreich, wenn man in Paris lebte), Englisch, Deutsch und Spanisch beherrschte.
»Piep – falsche Antwort«, vermeldete Sharon und winkte dem Kellner. Dieser trabte relativ schnell an, was zum einen wohl Sharons zauberhaftem Lächeln und zum anderen ihrem kompromisslosen Winken zu verdanken war. »Vier Mimosa und eine große Schüssel Erdnüsse, bitte.«
Ich warf einen skeptischen Blick in die Getränkekarte. »Zwölf Euro kostet so ein Mimosa. Zwölf Euro für etwas Orangensaft und Sekt.«
»Genau genommen ist es kein Sekt, sondern Champagner«, erwiderte Vera, die mir gegenüber auf einem der hellbraunen Ledersessel saß und einige verhedderte blonde Strähnen aus ihrer goldenen Halskette befreite.
»Na, das ändert natürlich alles«, meinte ich sarkastisch und schob die Karte mitsamt all meinen momentanen finanziellen Sorgen beiseite. Na ja, eigentlich war mein Finanzchaos omnipräsent, aber ich redete mir ein, dass es jeder neunzehnjährigen Studentin, die nicht zufällig Momo hieß und aus irgendwelchen elitären japanischen Kreisen stammte, so ging. Manchmal musste man sich zwischen Essen und Mimosa entscheiden. Und heute war ein Tag, an dem mir Alkohol sympathischer war als ein vor Fett triefender Burger.
Unsere Mimosa kamen unverzüglich, als hätte das Personal hinter der Bar irgendwo bereits fertig gemixte Getränke gebunkert. Der Inhalt des bauchigen Glases war unterdurchschnittlich gering. Locker würde mich jeder Schluck einen Euro kosten, wenn ich besonders kleine nahm, waren es vielleicht fünfzig Cent.
Meine Berechnungen wurden jedoch von Momo unterbrochen. Diese lehnte sich ihrerseits zurück und schenkte ihrem Getränk keinerlei Beachtung, dafür mir, wofür ich sie wirklich, wirklich liebte. »Sharon hat kurz angerissen, dass die Bluthündin auf dich losgegangen ist?«
»Ja«, meinte ich zerknirscht.
»Erzähl, was ist passiert?«
Ich blickte in die Runde – von Veras hochgezogenen Augenbrauen, die Neugier offenbarten, zu Momos grüblerischem Blick, hin zu Sharon, die dreinschaute, als würde sie gleich selbst die Story erzählen, wenn ich nicht endlich damit anfing.
Ich lächelte und überspielte damit das unbändige Verlangen, in Tränen auszubrechen. Zu heulen ist so viel einfacher, als tapfer zu sein. Das war die erste Lehre, die ich in meiner kurzen Laufbahn als Studentin an der ESMOD hatte ziehen müssen. »Ihr kennt ja das Verfahren. Um unseren kreativen Ist-Zustand einschätzen zu können, wollen sie von uns verschiedene Schnittmuster zu einem besonderen Motto gefertigt bekommen. Möglicherweise habe ich mich da in etwas verrannt, aber ich war überzeugt. Anfangs zumindest.«
»Deine Arbeit ist gut«, gab Sharon eine kurze Zwischenmeldung.
Ich zuckte mit den Schultern, was angesichts der Tatsache, dass ich mich vor den Ruinen meines einzig wahren Traumes befand, ein wirklich bescheidenes Mittel war. Wären nicht Trauerchöre oder weinende Jungfrauen, die hinter mir standen, treffender?
»Lieb von dir, Sharon, aber Prof. Bernard ist da anderer Ansicht. Sie sagte, dass mein Entwurf, sollte er sich nicht monumental verbessern, eine unbefriedigende Note für mich bedeuten würde. Außerdem hat sie mich als uninspiriert, dem Mainstream folgend und als ernüchterndes Ergebnis der langjährigen Angriffe auf das, was Mode einmal war, bezeichnet. Sie hasst mich.«
»Sie hasst jeden. Und außerdem staucht sie alle Studierenden mindestens einmal im Semester zusammen.« Ihrer Rede folgend hob Momo das Glas in die Mitte des Tisches.
Wir stießen an, und ich nahm einen Ein-Euro-Schluck. Doch weder der noch Momos Aufmunterungsversuche waren mir ein allzu großer Trost. Denn dummerweise glaubte ich Prof. Bernards Worten mehr als denen meiner neuen Freundinnen. Und dass, obwohl es Momo besser wissen musste. Sie war im zweiten Jahr, ebenso wie Vera. Einzig Sharon und ich waren naive Erstis, die nun aber mal so richtig unsanft auf dem Boden der Tatsachen aufschlugen.
»Diese Frau ist mir so was von unsympathisch, und ihr wisst, Leute, dass ich Menschen liebe.« Große Worte, denen Sharon eine ebensolche Geste in Richtung der restlichen Besucher des Bistros widmete.
»Schon klar, wir sind alle bloß Darstellende im Film, der sich dein Leben nennt«, erwiderte ich schmunzelnd.
»Schön wär’s, wenn ich mir die Besetzung darin aussuchen könnte. Die Rolle meines zukünftigen Ehemanns würde ich dann nämlich an Jake Gyllenhaal vergeben.«
»Jake Gyllenhaal? Wie alt ist der? Fünfzig?«, fragte Vera, und offenbar schien Sharons gyllenhaal’sche Obsession bis zu diesem Zeitpunkt an ihr vorübergezogen zu sein. Was verwunderlich war, da Sharon ihn ständig als ihre Muse bezeichnete und sogar eine Tasse mit seinem Gesicht darauf besaß.
»Fünfzig?!«, stieß Sharon daraufhin erschüttert aus.
»O Mann, jetzt hast du etwas losgetreten«, jammerte ich und gönnte mir einen Ein-Euro-Fünfzig-Schluck.
Sharon richtete sich auf. Sie war bereit, für ihre fiktive Romanze mit Jake Gyllenhaal zu kämpfen. »Jacob Benjamin Gyllenhaal, geboren am 19. Dezember 1980 in Los Angeles, Kalifornien.«
Ich griff nach einer Erdnuss und steckte sie mir in den Mund. »Noch nicht fünfzig.«
»Er könnte trotzdem fast dein Dad sein«, vermeldete Momo.
Sharon seufzte. »Liebe kennt kein Alter.«
»Amen.« Ich hob mein Glas, doch bis auf Vera stieß niemand an. Momo und Sharon waren damit beschäftigt, sich gegenseitig kontrollierend zu mustern. »Können wir uns wieder mit realen Problemen befassen? Genauer gesagt meinem Totalversagen und der Tatsache, dass ich diese Stoffmuster neu zusammenstellen muss?«
»Er entstammt einer wahrhaftigen Schauspielerfamilie, was ich richtig cool finde«, fuhr Sharon unbeirrt fort. »Vater, Mutter, Schwester – alle in Hollywood unterwegs.«
»Klingt nach strengen Regeln und viel Drill. Ich weiß, wovon ich spreche, und das ist kein Märchen, auf das man irgendwie neidisch sein sollte.« Momos Gesichtsausdruck wurde finster, wann immer sie von ihrer Familie erzählte. Jeder hatte seine Kämpfe auszutragen, dies war Momos Kampf.
Sharon ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen. »Es war bestimmt schwierig. Aber er hat trotzdem seinen eigenen Weg gemacht.«
Ich beugte mich vor und klopfte mit einem Finger auf die Tischplatte. »Und denkt ihr, auch ich werde meinen eigenen Weg gehen bezüglich der mittelschweren Krise, in der ich mich befinde? Nicht zu vergessen, dass ich sehr, sehr wenig Zeit übrig habe, um sehr, sehr viele Änderungen vorzunehmen.«
»Er stand am Anfang seiner Karriere, und was hat er getan? Im konservativen Amerika der 2000er hat er die Rolle als Jack Twist in Brokeback Mountain angenommen. Er hat sich den Kritiken, der Herausforderung und dem Risiko gestellt, weil er an den Film und seine Botschaft geglaubt hat. Ich bewundere nicht nur seine Hülle, sondern auch das, was in ihm steckt, Momo.« Wir waren allesamt sprachlos. An mich gewandt sagte sie: »Niemand auf dieser Welt sollte dir sagen, wer du zu sein hast, Emma. Niemand darf dir vorschreiben, was du fühlen oder denken sollst. Wenn die Kreativität keine Freiräume mehr zulässt, dann stehen uns wirklich dunkle Zeiten bevor. Also, mein Rat ist, kämpfe für das, was du entwickelt hast, und erst recht für das, was du willst. Es ist dein Projekt.«
Meine Hände zitterten, so sehr wollte ich diese Person sein, die Sharon war und die ich möglicherweise auch in mir sah. Doch ich war keine Revolutionärin. Ich glaubte nicht, dass ich den nötigen Mut hatte, mich mit jemandem wie Prof. Bernard anzulegen. Vor allem auch deshalb, weil der Einsatz verdammt hoch war und meine Zukunft auf dem Spiel stand.
Momo aber nickte zustimmend. »Ja, Emma, genau richtig. Die Bluthündin sollte mal ihren Horizont erweitern.«
Vera lächelte gerührt. »Gut gesagt, Sharon.«
Nun lag es an mir, aber ich konnte hier und heute keine Entscheidung treffen. Ich bezweifelte sogar, dass ich in der Lage wäre, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, die mich direkt ins Auge von Prof. Bernards Wutsturm bringen würde. Insgeheim wusste ich allerdings, dass ich die Muster abändern und den Wünschen Bernards entsprechend gestalten würde. Ich würde die drei Mädels enttäuschen, und das setzte mir zu.
»Ich bin … wohlerzogen … zu wohlerzogen für so etwas«, murmelte ich und hoffte gleichzeitig, meinem Verstand wäre etwas weniger Unterwürfiges entsprungen.
Sharon stöhnte. »Neeein, knick jetzt nicht ein.«
Vera und Momo kniffen die Augen zusammen, enthielten sich aber einer Stimme.
Während um uns herum das Nachtleben von Paris pulsierte, wurde es mir inmitten all der Ausgelassenheit zu eng. Ich stand auf, entschuldigte mich und durchquerte das Lokal in Richtung Toiletten. Diese befanden sich ganz am anderen Ende der Bar. Man musste zuerst einen schmalen, fensterlosen Flur entlanggehen, dem man seinen Schrecken durch die Beschallung mit lauter Musik zu nehmen versuchte.
Unter Frank Sinatras Fly Me To The Moon betrat ich die Damentoilette. Ich war zum Glück allein, stemmte meine Hände an den Rand des Waschbeckens und betrachtete mich im Wandspiegel. Ich sah müde und abgeschlagen aus und fragte mich, ob ich mir selbst nicht zu viel zugemutet hatte. Oder vielleicht hatte ich meine eigenen Fähigkeiten auch gehörig überschätzt. Von zu Hause wegziehen, ein neues Land, eine fremde Sprache und eine der härtesten Schulen des Landes – das waren enorme Kräfte, die da auf mich einwirkten.
Ich wollte erwachsen sein, aber hier in diesem Klo mitten in Paris kam ich mir wie ein Kind vor, das unglaublich gerne mit Mommy und Daddy zu Abend essen würde, anstatt gegen den Rest der Welt zu kämpfen.
Bevor auch nur eine einzige Träne fließen konnte, atmete ich tief durch und verließ die Toilette. Während Sinatra davon sang, was er anbetete und wonach er sich sehnte, hörte ich im Flur einen Kerl über den Lärm der Lautsprecher hinweg mit jemandem auf Französisch am Telefon sprechen. Ich bog um die Ecke und sah ihn. Er hatte mir den Rücken zugewandt. Breite Schultern, braune Haare.
Nachdem er sich umgedreht hatte und unsere Blicke sich trafen, kam ich zu dem Schluss, dass nicht nur seine Hinter-, sondern auch seine Vorderseite überaus ansehnlich war. Dunkle Augen, leichter Bartschatten und etwas an seiner Ausstrahlung, das ihn geradewegs auf die Liste der Männer brachte, auf die ich stand.
Doch im nächsten Moment veränderte sich dieses freundliche Funkeln in seinen Augen zu etwas Bedrohlichem. Er sah sich mehrmals in Richtung des Gastraumes um, steckte das Handy eilig weg, hastete dann auf mich zu und packte mich am Arm. Entsetzt stieß ich einen grellen Schrei aus, der ihn aber kaltließ. Immer weiter zog er mich den Flur entlang. Ich stolperte, doch er zerrte fester.
Meine Gedanken rasten. Ich dachte an Entführung, wollte schreien, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich krallte meine Nägel in seine Haut. Auch das ließ ihn kalt.
Der Typ drehte sich um, redete auf mich ein. Ich verstand allerdings kein Wort. Ich sah, wie sich seine Lippen bewegten, war aber wie taub.
Dass ich verloren war, wusste ich spätestens dann, als er die Tür zu einem Lagerraum öffnete und mich hineinschob. Dicht gefolgt von ihm selbst.
Sein Körper war nun eine Trennwand zwischen mir und der Tür.
Und ich … ich war gefangen in der Hölle, wie ich sofort erkannte.
Kapitel 2Lucien
Einige Stunden zuvor
Nach meinem letzten Kurs des Tages hatte ich jetzt eigentlich endlich frei. Ich wollte nach Hause fahren, duschen und den Abend halb pennend, halb wach bei irgendeinem Film auf der Couch verbringen. Doch meine Pläne wurden durchkreuzt, als ich im Wagen in Richtung Innenstadt saß.
Nachdem er geschlagene zehn Minuten um den heißen Brei herumzureden versucht hatte, kam mein Kumpel Mathis doch noch zum Punkt. »Es geht darum, dass ich ihr gesagt habe, wir wären heute Abend ohnehin dort in der Gegend.«
Ich knurrte leise, damit Mathis es nicht hörte. »Wir sind aber nicht ohnehin dort in der Gegend. Warum sollten wir auch? Soll sie doch nach Passy kommen.«
»So funktioniert das nicht, Mann, und das weißt du.«
»Was willst du eigentlich von dem Mädchen? Ich dachte, sie wäre längst Geschichte.«
Bei Mathis war das so ein Auf und Ab mit den Frauen. Er verknallte sich in jede hübsche Frau, und das war so lange kein Problem, bis er die nächste hübsche Frau traf. Im Fall dieser Amelie schlug er aber einen völlig anderen Kurs ein, womit ich kein Problem hätte, würde er mich nicht dauernd mit reinziehen.
Als wäre ich seine verdammte Gouvernante, sollte ich ihn nun in irgendeine Bar begleiten, wo er Amelie treffen wollte, weil es näher bei ihr wäre, und weil er vorgegeben hatte, wir wären ohnehin öfter dort in der Gegend.
»Ich will alles von ihr, Luc. Liebe, Vertrauen, Babys – das ganze verdammte Paket.« Ich hörte es poltern und stellte mir vor, wie er mit der Faust demonstrativ auf den Tisch schlug, um den Irrsinn, den er da von sich gab, noch zu bekräftigen.
Es war verrückt, dennoch fragte ich nach: »Babys? Du redest von echten, menschlichen Babys? Nicht Hundebabys oder so etwas?«
»Nein, echte, niedliche Babys. Ein Stück von ihr und ein Stück von mir.«
»Okay, Kumpel, schalt mal einen Gang runter. Im Augenblick befindest du dich ja noch ganz am Anfang eurer Lovestory – sollte es diesmal eine werden. Die Voraussetzungen sind übel, wenn du schon jetzt anfängst, sie zu belügen.«
Ich überquerte die Pont de Sèvres und hielt an einer roten Ampel. Durch den offenen Spalt des Fensters hörte ich die Fahrerin im Wagen neben mir lauthals lachen, was ich selbst äußerst erheiternd fand.
»Ich habe alles unter Kontrolle«, versicherte mir Mathis. »Du musst da nur mitspielen, damit diese winzige Notlüge nicht umsonst gewesen ist.«
Die Kolonne bewegte sich langsam ostwärts. Es herrschte nervenaufreibendes Stop-and-go, und dazu hatte ich auch noch meinen besten Freund an der Backe, der sämtliche Geschütze auffuhr, um Amelie für sich zu gewinnen. »Das Letzte, was ich will, ist ein bescheuertes Doppeldate mit irgendeiner ihrer Freundinnen«, warf ich ein.
»Ich weiß, ich weiß. Keine Panik, es werden nur wir drei dort sein. Und du kannst, sobald es gut läuft, auch gerne mithilfe einer Ausrede abdampfen.«
Das Gute für Mathis und das Schlimme für mich war, dass ich so ziemlich jedem Menschen auf diesem Planeten eine Abfuhr bezüglich dieser Bitte erteilen würde, nur nicht ihm. Er war mehr für mich als bloß ein Freund. Er war derjenige, den ich tiefer als alle anderen in mich blicken ließ. Er kannte meine Ängste, meine Träume und all die Abgründe, aus denen ich mich nur schwer freikämpfen konnte. Er kannte als Einziger die erschütternden Storys aus meiner Kindheit. Ihn rief ich an, wenn ich am Boden lag.
Also sagte ich zu. Natürlich würde ich ihn nicht hängen lassen, so wenig erfolgversprechend diese Mission in meinen Augen auch war. Wir vereinbarten, dass Mathis mich abholen und wir dann mit der Metro rüber ins elfte Arrondissement fahren würden.
»Dort ist es«, verkündete Mathis, der aufgeregt einen halben Schritt vor mir ging.
Ich trottete hinter ihm her, den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Kinn hochgezogen. Da es arschkalt war, konnte ich seine gute Laune noch weniger teilen. Ich knurrte bloß anerkennend, als wir über den Zebrastreifen gingen.
Die Terrasse war brechend voll. Unter der blattlosen Krone einer Erle drängten sich die Menschen um runde Tische. Die einzige Wärmequelle waren die Heizstrahler an der Decke. Doch ich war froh, dass Mathis ins Innere des Ladens ging und dort Ausschau nach Amelie hielt. Ich hatte sie erst einmal flüchtig gesehen und erinnerte mich kaum noch, wie sie aussah. Spontan würde ich auf blond, langbeinig und sportlich tippen – das war immerhin das präferierte Beuteschema meines Kumpels.
Und tatsächlich winkte uns eine Blondine von einem der Tische direkt an der Fensterfront.
»Denk dran: Wir lieben den Laden«, meinte Mathis an mich gewandt, während wir einen Slalom um Tische und Stühle absolvierten.
»Jaja.«
Das Lokal war auf den ersten Blick nicht übel – gemütlich, atmosphärisch, dennoch fehlte ihm eine Noblesse, auf die ich viel Wert legte. Im realen Leben wäre das hier niemals unser Lieblingslokal des Viertels. Ein Viertel, in dem ich zuvor überhaupt nichts zu suchen gehabt hatte.
Mathis und ich waren Passys – Jungs aus dem Nobelviertel der Stadt.
Wir setzten uns, bestellten uns Bier, und ab da verwandelte ich mich in eine Art stiller Zuhörer, der nur ab und an nach seiner Meinung gefragt wurde. Damit ich vor Langeweile nicht einschlief, versuchte ich Amelie zu ergründen.
Warum war dieses Mädchen derart vorsichtig in Bezug auf Mathis?
Sie hatte gewollt, dass sie sich hier trafen und ich mitkam. Aber weshalb? War sie ein Kontrollfreak? Litt sie unter Verfolgungswahn?
Während ich mehr von ihr erfuhr – sie studierte Kunstwissenschaften und redete meinem Geschmack nach auch viel zu häufig darüber und generell über sich selbst –, wurde mir klar, dass sie zutiefst unsicher war. Sie wusste, dass Mathis nichts für sie war, dass er ihr Herz brechen würde und so weiter und so fort. Ihr war bewusst, dass sie einen Tanz auf dem Drahtseil absolvierte, und ich sollte hier sein, um den Friedensrichter zu spielen. Ich sollte ihr mehr Zeit mit Mathis verschaffen, bevor er sie fallen ließ. Aber ich würde nicht den Fehler machen, mich auf irgendeine Seite zu schlagen.
Das war mir echt zu blöd.
Wie groß die Gefahr war, dass ich in diese Zwickmühle kommen würde, blieb aufgrund Mathis’ verliebtem Getue ohnehin schwer vorauszusagen. Ich hatte ihn selten derart engagiert erlebt. Er interessierte sich wirklich für jedes einzelne Wort, das den Mund von Amelie verließ. Er hing an ihren Lippen, und das nicht im knutschenden Sinne.
Ich würde definitiv allein nach Hause fahren müssen.
Um kurz vor halb zehn, also nachdem ich es bereits über eine Stunde in der Gesellschaft der beiden Turteltauben ausgehalten hatte, ging auf meinem Handy eine Nachricht ein. Sie war von Isabelle.
Kannst du reden? Jetzt?
Weil ich Mathis und Amelie etwas Zeit allein geben wollte, damit sie testen konnten, ob sie auch ohne mich klarkamen, stand ich auf und wählte Isabelles Nummer. Während es klingelte, steuerte ich zuerst die Tür zur Terrasse an. Doch da mir von dort ein frostiger Wind entgegenblies, machte ich kehrt und hielt im Flur vor den Toiletten.
Ich lehnte seitlich an der Wand, als Isabelle ranging.
»Hallo«, sagte sie matt.
»Hallo, du wolltest mit mir reden?«
»Ja, das wollte ich. Bist du unterwegs?« Ihre Frage klang für meinen Geschmack eine Spur zu kontrollierend. Zu stark nach dem, was wir eigentlich hinter uns lassen wollten.
Als ich antwortete, bemühte ich mich aber um einen ruhigen Ton. »Ich bin mit Mathis in einer Bar. Also … was gibt es?«
»Deine Mutter hat mich heute angerufen und mir eine Einladung für euer Weihnachtsessen übermittelt. Ich habe sie gebeten, vorher mit dir Rücksprache zu halten, bevor ich ihr meine Zu- oder Absage gebe.« Frank Sinatra mit Fly Me To The Moon in dem einen und Isabelles Stimme im anderen Ohr, überlegte ich, wann wir das letzte Mal telefoniert hatten.
Wir waren seit über einem Dreivierteljahr getrennt. Genauer gesagt hatte mich Isabelle für ihr Studium in London verlassen. Das war die halb offizielle Version der Story. Die offiziellere war, dass wir eine Beziehungspause eingelegt hatten, bis jeder von uns mit seiner Ausbildung fertig war. Die tatsächliche Version aber war, dass das, was auch immer einmal zwischen mir und Isabelle existiert hatte, nicht mehr länger vorhanden war. Da war keine Liebe, kein Herzschmerz, lediglich bloße Ernüchterung.
Kein Mensch war fehlerlos, weder Isabelle noch ich. Doch unsere Fehler hatten sich zu sehr aneinandergerieben, und schlussendlich waren wir daran gescheitert. Ich hatte die Realität längst eingesehen. Anders als Isabelle, die, bequatscht von meiner und ihrer eigenen Mutter, immer noch davon überzeugt war, dass uns ein wenig Abstand guttun würde. Dass wir wieder zusammenkommen würden, wenn sie mit der Uni fertig war, und dass wir dann genau dort weitermachten, wo wir im Frühling aufgehört hatten.
Und diese Einladung meiner Mutter zum Weihnachtsessen verdeutlichte mir das einmal mehr.
»Besser wäre es gewesen, meine Eltern hätten vorher mich gefragt.« Ich war stinksauer und machte mir nicht mehr länger die Mühe, mich irgendwie diplomatisch zu verhalten.
»Du kennst sie ja«, warf Isabelle ein, was meine Wut aber nur noch verstärkte. »Deine Mutter meint es nur gut und will irgendwie zwischen uns vermitteln.«
Ich schnaubte und stieß mich von der Wand ab. »Und wie stellst du dir das vor? Wir sitzen brav am Tisch und tun so, als hättest du nicht einen anderen Typen gevögelt?«
Bevor sie mit diesem Kerl ins Bett gegangen war, hatte ich tatsächlich in Erwägung gezogen, zu ihr nach London zu ziehen. Zumindest für die Zeit ihres Studiums.
Wir wären weit weg von unseren Familien gewesen. Nur wir beide. Möglicherweise hätten wir einige Probleme damit beheben und neu anfangen können. Doch daraus war nichts geworden.
»Lucien … bitte«, meinte sie.
»Nein«, erwiderte ich. Sofort kroch die Erinnerung an den Schmerz, den ich empfunden hatte, als sie mir ihr Geständnis abgeliefert hatte, erneut in mir hoch.
Mein ganzes Vertrauen in Isabelle, in unsere verdammte Beziehung und in einfach alles, was uns je verbunden hatte, war in diesem Augenblick vernichtet worden. Gegen Ende war es nicht mehr wirklich kultiviert zwischen uns zugegangen. Wir hatten viel gestritten, uns oft tagelang angeschwiegen und uns wüst beschimpft, wenn wir miteinander sprachen.
Sie sagte damals, dass sie einen Fehler gemacht hatte und dass sie nur herausfinden wollte, ob sie mich wirklich noch liebte. Dass man dafür mit einem anderen Mann schlafen musste, war mir neu.
»Meine Eltern werden auch dort sein. Es wäre … wie früher.«
Nichts war wie früher, dachte ich. Doch da war diese Schlinge um meinen Brustkorb, die sich stetig enger zog. Meine Eltern würden es meine gute Erziehung nennen, Mathis eine Erinnerung daran, dass ich in einem goldenen Käfig lebte.
In Wahrheit hatte ich keine andere Wahl, als Isabelles Anwesenheit zu akzeptieren. Und um ehrlich zu sein, war sie im Rennen mit meinen und ihren Eltern sogar auf der Pole Position, wenn es darum ging, wer das freundlichere Arschloch war.
»Ich möchte dich so gerne sehen«, gestand Isabelle, während ein Mädchen, das sofort meine volle Aufmerksamkeit hatte, die Damentoilette verließ.
Sie musterte mich, also musterte ich sie auch, was nur fair war. Ihre ganze Erscheinung und ihr vorsichtiges Lächeln waren das Beste, was ich an diesem Abend zu Gesicht bekommen hatte. Ihre Augen waren dunkelblau, und irgendetwas an ihr erinnerte mich an Sonne, Urlaub und Strand. Vielleicht war das ihrem gelben Pullover oder ihren dunkelblonden Haaren zuzuschreiben. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich sie nicht einfach so an mir vorbeispazieren lassen durfte. Ich wollte mit ihr reden, und das nicht aus Gründen, um mich an Isabelle zu rächen.
Nein, ich hatte persönliche Gründe dafür. Es ging nur um mich und darum, den Namen dieser Frau herauszufinden.
War sie die ganze Zeit schon da gewesen, während ich an Mathis’ und Amelies Tisch gefangen gewesen war? Irgendwo in der Nähe, nur hatte ich sie nicht bemerkt?
Im nächsten Moment hörte ich einen dumpfen Knall.
Einmal. Zweimal.
Zuerst dachte ich an Feuerwerkskörper. Ein paar Jugendliche vielleicht, die draußen auf der Straße Böller zündeten. Doch dann drehte ich mich zum Innenraum und sah durch das Glas der Eingangstür, die ich vor wenigen Minuten erst selbst geöffnet und dann wieder geschlossen hatte. Leute liefen draußen panisch über die Straße, duckten sich oder fielen zu Boden. Ich hörte noch einmal den gleichen Knall und wusste instinktiv, dass da draußen irgendetwas Schreckliches vor sich ging.
Ich reagierte innerhalb von Sekundenbruchteilen, aber meine Bewegungen wirkten für mich selbst wie im Zeitlupentempo. Als würde ich neben mir selbst stehen und zusehen, wie ich nach dem Arm dieser Frau griff. Ihr Blick veränderte sich, ihr Kopf schnellte in Richtung Vorderseite des Lokals, aus der man weiterhin dieses Geräusch hörte. Schüsse … das waren Schüsse.
Ich zog sie den Flur entlang, auf der Suche nach einem Ort, an dem wir sicher waren. Sie wehrte sich und schrie. Den Ernst der Lage hatte sie überhaupt nicht begriffen. Um sie von dort wegzubekommen, musste ich mehr Kraft aufwenden. Schließlich öffnete ich eine Tür mit der Aufschrift »Privat« und schob das Mädchen hinein. Ich folgte ihr, schloss die Tür und tastete verzweifelt nach dem Lichtschalter.
Als das Licht anging, begegnete ich ihrem tränenfeuchten, entsetzten Blick.
»Alles wird gut«, sagte ich, wusste aber nicht, wem von uns ich damit Mut machen wollte.
Kapitel 3Emma
Völlig erstarrt stand ich vor ihm, während sich die Puzzleteile in meinem Kopf zusammensetzten. Jemand hatte da draußen auf Menschen geschossen. Inmitten der vor dieser Tür stattfindenden Katastrophe hatte ich anscheinend auch meine Fähigkeit, Französisch zu verstehen, verloren. Anstatt zu überlegen, was mit meinen Freundinnen war oder wie ich mich in Sicherheit bringen konnte, grübelte ich darüber, was sein »Tout ira bien« bedeutete.
Er wiederholte es mehrmals, fuhr sich durch sein an den Spitzen gelocktes Haar und blickte sich suchend in diesem Lagerraum, in dem wir uns befanden, um. Immer mehr Tränen strömten über mein Gesicht. Ich konnte sie nicht aufhalten, ebenso wie das Zittern, das von meinem ganzen Körper Besitz ergriffen hatte. Mein Verstand ertrank währenddessen in der Flut aus ungeordneten, beängstigenden Gedanken.
»Il nous faut un meilleur endroit«, fuhr er fort und schob mich in den hintersten Winkel des Lagers.
Zwischen Weinkartons und Schnapsflaschen drückte er mich auf eine umgedrehte Holzkiste. Entgeistert sah ich ihm dabei zu, wie er schwere Kartons vor die Tür schliff, um diese zu verbarrikadieren. So ganz schien er seinem Werk aber nicht zu trauen, da er stehen blieb und den Ausgang im Auge behielt.
Keiner von uns beiden sagte etwas, was dem Chaos draußen große akustische Macht verlieh. Ich hörte, wie Menschen schreiend den Flur entlangliefen. Ich versuchte, nicht zu atmen, mich nicht zu bewegen, nicht aufzufallen. Ich wollte mich wegträumen. Weg von diesem Chaos. Weg von der Gefahr. Weg von dem Leid, das mich diese Schreie erahnen ließen.
Während ich mich panisch im Raum umsah, blickte der Typ auf sein Handy. Achselzuckend und mit gerunzelter Stirn steckte er es aber wenig später zurück in seine Hosentasche. Entweder hatte er keinen Empfang oder die Dinge, die er über das, was dort draußen passierte, gelesen hatte, waren zu schrecklich, um sie mit mir zu teilen.
Mein Handy steckte in der Tasche, die ich am Platz gelassen hatte, und ich konnte nur noch an meine Eltern denken und daran, dass ich sie vielleicht nie wiedersehen würde. Dass die Nachricht, die ich meiner Mom vorhin geschrieben hatte, meine letzte an sie gewesen sein könnte. Ich stellte mir vor, dass jemand hereinkam und auf uns schoss. Genauso, wie sie es mit den anderen auf der Terrasse gemacht hatten.
Vor lauter Panik beschleunigte sich meine Atmung. Ich begann zu hyperventilieren, und mir wurde schlagartig schwindelig. Ich wollte einfach nur noch weg von hier. Ich kam mir so ausgeliefert und hilflos vor. So allein.
Dass ich zumindest nicht allein war, zeigte mir dieser fremde Mann, als er sich vor mich kniete und nach meiner Hand griff. »Respire plus lentement.«
»Ich … Ich verstehe es nicht«, meinte ich jammernd.
Er runzelte zuerst die Stirn, dann nickte er. »Engländerin?«, fragte er, und unter normalen Bedingungen hätte ich seinen Akzent vermutlich unglaublich süß gefunden.
»Amerikanerin.« Meine Antwort zerrann in einem noch tieferen Atemzug.
Ich schloss die Augen, riss sie aber wieder auf, als jemand von außen mehrmals heftig die Türklinke betätigte. Die Barrikade, die er errichtet hatte, zeigte allerdings Wirkung. Die Tür blieb zu und das Schicksal jener Person, die zu uns hereinkommen wollte, ungeklärt.
Dieser Vorfall ließ uns beide zusammenzucken. Ich stieß ein Wimmern aus, und der Typ vor mir rückte noch weiter von der Tür ab.
Wie ein wildes Tier wollte ich flüchten. Doch ich war eingesperrt, und das machte mich fertig.
Irgendwo ganz tief in meinem Gedächtnis vergraben, tauchten einige Fetzen dieses Anti-Terror-Trainings auf, das ich erst vor zwei Jahren an der Highschool absolviert hatte. Doch wie so häufig konnte man sich in einer echten Notsituation nicht an das Gelernte erinnern.
Selbst wenn, da draußen waren Menschen mit Gewehren. Menschen, die auf andere geschossen hatten.
Augenblicklich verkrampfte ich mich nur noch heftiger. Ich fing zu zittern an und schwitzte gleichzeitig unter dem dicken Stoff meines Pullovers.
»Okay … du musst langsamer atmen.« Der Fremde sprach ganz ruhig, als würde es nur uns beide geben. Nicht die drohende Gefahr, nicht all das Leid, nur uns. Schließlich hob er meine Hand an seine Brust. Flach breitete er meine Handfläche darauf aus und bedeckte meinen Handrücken mit seinen Fingern. »Mach es genau wie ich. Konzentriere dich auf mich. Ein und aus. Ein. Aus.«
Unter dem Stoff seines schwarzen Shirts spürte ich die Wärme seiner Haut. Ich fühlte seinen Herzschlag an meiner Handfläche. Ein stetes Pochen, das so gar nicht zu meinem wild rasenden Herzen passte.
Er machte es mir verdammt einfach, mich sicher zu fühlen. Aber diese Tür … sie … sie wirkte so bedrohlich, weil sie das buchstäbliche Tor zur Hölle war. Und wenn sie sich öffnete, dann wäre ich verloren. Genau wie er.
Schluchzend wollte ich ihm meine Hand entziehen, doch er hielt mich sanft, aber bestimmt fest. »Ich will nicht sterben. Sie werden hier reinkommen und sie … sie …«
Als ich abbrach und noch heftiger zu zittern anfing, rückte er näher, bis sich unsere Knie berührten. »Du wirst nicht sterben.«
»Woher willst du das wissen?«, erwiderte ich schroff und verzweifelt zugleich.
»Ich weiß es nicht. Aber an die Alternative zu denken, würde ja nichts bringen.«
Ich lauschte den Geräuschen von außerhalb. Es war ruhiger. Keine Schüsse mehr.
Trotzdem schien mir die Gefahr noch lange nicht gebannt. Vielleicht war es nur die Ruhe vor dem Sturm. Möglicherweise hatte man Geiseln genommen – falls sie überhaupt in den Laden gekommen waren. Wenn dem so war, dann würden sie früher oder später das gesamte Gebäude absuchen. Vorerst aber waren wir sicher. Daran klammerte ich mich.
»Sie werden Polizisten schicken«, meinte der Unbekannte vor mir, als hätte er meine Gedanken gelesen.
»Es kann dauern, bis sie hier reinkommen, ohne ein enormes Blutbad zu verursachen.« Ich hörte mich nicht nur verzweifelt an, ich war es auch. Ich war am Ende. Meine Kräfte hatten mich im Stich gelassen, und mein Körper sackte immer tiefer in sich zusammen.
Der Typ seufzte, schüttelte aber überzeugt den Kopf. »Es … Es gibt keinen Schlüssel, aber ich glaube, die Tür ist sicher. Wir sind sicher.«
»Was ist mit den Menschen dort draußen?«
Auf meine Frage hin verzog er schmerzlich das Gesicht. »Ich weiß es nicht. Wirklich.«
»Ich auch nicht«, erwiderte ich müde.
Stumm beobachteten wir beide die Tür. Noch nie zuvor war mein Leben derart abhängig von einem Gegenstand gewesen.
Eine gefühlte Ewigkeit verharrten wir so – ich auf der Kiste kauernd und er neben mir hockend. Von der anderen Seite der Tür war nun nichts mehr zu hören, was ehrlich gesagt beinahe so gruselig war wie das Chaos zuvor.
»Wie heißt du?«, fragte der Unbekannte irgendwann in die Stille und bemühte sich dabei um ein Lächeln.
»Emma.«
»Emma aus Amerika«, wiederholte er. »Warum bist du in Paris?«
Es klang wundervoll, wie er Paris Französisch aussprach, und ich erinnerte mich daran, wie ich mich in alles hier auf Anhieb verliebt hatte. Die Menschen, die Gebäude, die Geschichte, das Essen. Das alles schien jetzt so weit weg. Unerreichbar und verloren. »Ich habe gerade erst mit meinem Studium angefangen. Ich … Ich … Tut mir leid, ich kann gerade nicht richtig denken oder reden oder irgendetwas.«
»Okay«, sagte er und brachte wieder etwas Abstand zwischen unsere Knie, ließ seine Hand aber weiterhin über meiner.
Ich lehnte meinen Hinterkopf an die unverputzte Backsteinmauer, schloss die Augen und versuchte, mich einzig auf meine Atmung zu konzentrieren und den Rest zu vergessen. Das war vielleicht die beste Idee.
Ich fragte mich, wo Momo, Vera und Sharon in diesem Moment waren. Ob sie sich in Sicherheit bringen hatten können oder ob sie verletzt oder sogar tot waren. Ich wollte zu ihnen und gleichzeitig für immer hierbleiben, um mich vor der Welt zu verstecken, die so fürchterlich grausam war.
Mit wem war er hier? Es war doch schrecklich egoistisch von mir, mich einzig um mich selbst zu kümmern und zu verdrängen, dass auch dieser Mann, dessen Namen ich noch nicht einmal kannte, die gleichen Ängste und Sorgen durchstand.
Als ich die Augen öffnete, hatte er seine Aufmerksamkeit zur Tür gerichtet. Ich betrachtete sein Profil mit der geraden Nase und dem Bart, der mindestens ein Fünf-Tage-Bart sein musste. Vielleicht auch ein Sieben-Tage-Bart. Aber ich musste zugeben, dass ich mich mit Bärten nicht allzu gut auskannte.
Sein Blick traf auf meinen und leise fragte ich: »Comment tu t’appelles?« Wie ist dein Name?
»Lucien.«
»Lucien«, versuchte ich mich an seinem Namen, aber bei mir klang es holpriger und nicht ganz so melodisch wie bei ihm. »Danke, dass du mich gerettet und hierhergebracht hast.«
Mit zusammengepressten Lippen lächelte er. Ob er mich tatsächlich gerettet hatte, würde sich wohl erst noch zeigen.
»Was sollen wir tun? Noch länger hierbleiben? Rausgehen?«, zählte ich alle unsere Optionen auf.
»Wir bleiben.« Lucien klang entschlossen, und ich entschied, mich auf ihn zu verlassen. Schließlich hatte er auch vorhin blitzschnell die richtige Wahl getroffen.
»Lebst du hier in Paris?«
Er nickte und nahm meine Hand von seiner Brust. Doch er ließ mich nicht los, sondern hielt mich weiterhin fest. »Ist das okay?«, fragte er leise.
»Ja«, erwiderte ich flüsternd und betrachtete seine viel größere Hand, die mit meiner sehr viel kleineren Hand verschränkt war.
»Ich lebe hier, ja. Eigentlich ist Paris auch viel … freundlicher.«
»Ich weiß. Es tut mir leid«, sagte ich und leckte mir über die Lippen. »Ich meine, dass so etwas hier in deiner Heimat passiert. Absolut schrecklich.«
Lucien kniff die Augen zusammen und zog sein Handy hervor. Ich wollte fremden Leuten zwar nicht hinterherspionieren, aber ich sah ihm wie selbstverständlich dabei zu, wie er eine Nachricht an einen gewissen Mathis schrieb.
»Bist du mit ihm hier?«, fragte ich.
Lucien nickte, und als er mich ansah, schwappte all seine Verzweiflung über mich hinweg. »Je ne peux pas le perdre.« Ich darf ihn nicht verlieren.
So viel Schmerz lag in seiner Stimme, und ich war damit völlig überfordert. Ich war eine schlechte Stütze und rang verzweifelt um Worte. Aber was sollte ich sagen? Ich wollte Lucien keine falschen Versprechungen machen. Also schwieg ich und zog unsere verknoteten Hände auf meinen Schoß.
»Ich bin mit drei Freundinnen hier – Momo, Vera und Sharon. Sie studieren mit mir und sind so ziemlich die einzigen Leute, die ich in dieser Stadt, genauer genommen in diesem Land, wirklich kenne. Ich weiß auch nicht, was mit ihnen passiert ist, und mein Handy ist da draußen.« Okay, die Idee, mit ihm zu reden, um ihn von seinen Sorgen abzulenken, war nicht allzu klug. Denn nun war ich selbst wieder unglaublich verzweifelt. Einzelne, dicke Tränen flossen über meine Wangen. Ich wischte sie mit meiner linken Hand beiseite und schniefte ziemlich freimütig.
»Jetzt kennst du auch mich«, bekräftigte er und zeichnete mit seinem Daumen kleine Kreise auf meinen Handrücken.
»Stimmt.« Mir wäre es allerdings lieber gewesen, wir hätten uns auf andere Weise getroffen.
Er war mir sofort aufgefallen, als ich aus der Toilette kam. Nun war er aufgewühlt und gestresst, aber als er dort an der Wand gestanden und mir dieses winzige Lächeln zugeworfen hatte, da war in meinem Bauch eine Art Superschmetterling geschlüpft.
»Wo habt ihr ungefähr gesessen?«
»Weiter hinten. Nicht bei der Terrasse. Und ihr?«
Sein Kiefer verspannte sich, als er deprimiert nickte. »Genau bei den Schiebetüren.«
»Es … Es geht ihm bestimmt gut«, versuchte ich Lucien zu beruhigen. Meine Stimme klang aber nicht wirklich überzeugend. Im Eiltempo ließ ich die vergangenen Minuten Revue passieren. Wie lange hatten sie geschossen? Nicht allzu lange. Glaubte ich zumindest. »Er konnte sich bestimmt in Sicherheit bringen.«
Ich war mir nicht sicher, ob er mir zugehört hatte. »Man fragt sich immer, wie man in Extremsituationen reagieren würde. Bei Unfällen oder irgendwelchen Tragödien. Ich dachte, dass ich gefasster sein würde.«
»Der Schock lähmt einen«, erwiderte ich. »Meine Mom ist Krankenschwester und hat einmal erzählt, wie ein Typ mit einer halb abgetrennten Hand in die Notaufnahme spaziert kam. Er hatte ein Tuch um die extrem blutende Wunde gewickelt, Platz genommen und hat auf seine Behandlung gewartet. Erst als er kollabierte, wurde man auf die Schwere seiner Verletzung aufmerksam. Keiner konnte verstehen, wie er die Schmerzen überhaupt so lange aushalten konnte.«
»Menschen handeln in Panik wahrscheinlich nie wirklich rational.«
»Du hast sehr rational gehandelt und mich hierhergebracht«, murmelte ich und schenkte ihm ein schwaches Lächeln.
Er sah mir tief in die Augen, ehe er zurücklächelte. »Obwohl du dich wie wild gegen mich gewehrt hast.«
»Ich war überfordert und dachte, du … du würdest mich entführen wollen oder so etwas.«
»Ja, das habe ich gemerkt.«
»Aber … danke. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du nicht da gewesen wärst.«
Darauf wusste keiner von uns beiden etwas zu erwidern. Vielmehr verkeilten sich unsere Blicke ineinander, und obwohl ich Lucien körperlich nicht näher kam, fühlte ich mich unglaublich verbunden mit ihm.
»Du hast traurig ausgeschaut, als du aus der Toilette kamst«, merkte er an, seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Oder vielleicht kam sie mir in der Enge des Raumes auch nur so intim vor.
Ich schluckte und versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen. »Manchmal plagt mich das Heimweh. Vor allem dann, wenn das Leben irgendwelche Herausforderungen an mich stellt und ich nicht weiß, wie ich diese bewältigen soll.«
Er hielt mich jetzt wahrscheinlich für ein naives kleines Mädchen. Prima.
»Was war die Herausforderung?«, fragte er jedoch verständnisvoll.
»Die Uni. Ich habe gewusst, dass es kein Zuckerschlecken wird. Aber so …«
»Man kommt an seine eigenen Grenzen.«
»Ja«, bestätigte ich. »Ich habe das Gefühl, nicht an der Aufgabe, sondern an mir selbst zu scheitern. Ich weiß aber noch nicht, ob ich bloß Angst habe, an meinen Schwächen zu arbeiten, oder tatsächlich völlig unbrauchbar bin.«
Was von beidem wäre schlimmer? Fatale Selbstüberschätzung oder Inkompetenz?
»Eine Ausbildung ist ein Prozess auf vielen Ebenen. Je mehr du dich darauf einlässt, dir Schwächen zugestehst und daran arbeitest, desto sicherer wirst du.« Lucien war jemand, dem man diesen Ratschlag abkaufte. Denn er selbst wirkte äußerst selbstbewusst und charismatisch.
Sein Handy begann zu läuten. Eilig zückte er es, doch er ging nicht ran, sondern drückte den Anrufer weg. »Nicht dein Freund?«
»Nein, leider nicht.«
Ich sah in seine dunklen Augen und meinte dann: »Glaubst du, sie haben Geiseln genommen?«
»Das denke ich nicht. Wahrscheinlich sind diese Typen weg oder tot oder verhaftet.«
»Was für Typen waren das? Hast du sie gesehen?«
»Ich habe sie nur kurz gesehen, glaube ich zumindest. Sie waren dunkel gekleidet und hatten Gewehre dabei. Die sahen aus wie Sturmgewehre. Aber ich habe keine Ahnung von Waffen, also verlass dich bitte nicht auf meine Einschätzung.«
Es war vermutlich fürchterlich feige von mir, aber ich wollte diesen Lagerraum nicht verlassen, um mich draußen der Realität stellen zu müssen. Hier war die Zeit irgendwie stehengeblieben. Ich hatte immer noch Angst, aber es war besser. Noch drehten sich meine Sorgen lediglich um Vermutungen. Doch wenn ich zurück zu unserem Tisch ging und herausfand, dass Sharon oder Momo oder Vera etwas passiert war, dann würde das alles verändern. Mein Leben hatte sich bereits durch dieses Erlebnis verändert, aber es würde noch belastender werden.
»Dann waren das also Terroristen«, überlegte ich laut.
»Wahrscheinlich.« Lucien sprach mit zusammengebissenem Kiefer, voller Abscheu für diese Tat, von deren Ausmaß wir noch keine Ahnung hatten.
Und das machte es für mich auch so schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn immerhin waren wir unverletzt. Wir konnten helfen, anstatt hier zu sitzen. »Wir müssen hier weg. Ich muss meine Freundinnen finden und du deinen Freund und wir … wir müssen die Menschen da draußen unterstützen. Irgendwie. So gut das geht.«
Lucien musterte zuerst mein Gesicht, dann die Tür neben uns, und schließlich stimmte er mit einem Nicken zu. »Okay. Aber nicht ohne Plan und Sicherheit.« Daraufhin tippte er auf sein Handy und hielt es sich ans Ohr. Ich hörte, dass es klingelte und am anderen Ende schließlich jemand ranging.
Der Lärm des Chaos, den wir lediglich gedämpft hörten, drang jetzt ungefiltert durch Luciens Handy zu uns durch. Es war eine Mischung aus Stimmen, Sirenen und Schreien. »Mathis?«, vergewisserte sich Lucien und trennte unsere Hände voneinander, als er aufstand und anfing, durch den Raum zu wandern. »Tu m’entends? Où es-tu?«
Hörst du mich? Wo bist du? Ich war erleichtert, dass ich ihn verstand und dass er seinen Freund erreicht hatte.
Lucien lauschte Mathis, sah dabei aber immer wieder prüfend zu mir. »J’arrive tout de suite.« Ich komme sofort. »Wir müssen zu ihm gehen. Komm«, wandte er sich an mich, nachdem er aufgelegt hatte.
Er reichte mir seine Hand, doch ich zögerte. »Wo ist er? Was ist draußen los?«
»Sie sind oben. Da gibt es einen Notausgang, damit wir nicht vorne rausmüssen.«
Ich raffte mich auf, aber meine Knie zitterten wahnsinnig, weshalb Lucien nach meinem Arm fasste und vor mir zur Tür ging. Bevor er öffnen konnte, hielt ich ihn auf. »Ich habe Angst«, gestand ich und hatte das Gefühl, hilflos in die Tiefe zu rasen.
»Ich weiß. Ich auch.« Dennoch schob er die Kisten beiseite, öffnete und unterband damit weitere Versuche meinerseits, Zeit zu schinden. »Warte«, bat er mich und steckte zuerst den Kopf durch den Spalt zwischen Tür und Wand.
Mein Herz raste, und ich klammerte mich an Luciens Shirt fest.
»Okay, gehen wir«, sagte er und öffnete die Tür ganz.
Ich atmete tief ein und wieder aus und richtete meinen Blick einzig auf Luciens Rücken, als wir unser Versteck verließen. Grölende Lautstärke empfing uns, sobald wir zurück im Flur waren. Doch da waren weit und breit keine Schüsse mehr zu hören, sondern nur Leute, die Befehle brüllten, andere wiederum klagten ihr Leid. Mir schnürte es die Kehle zu, aber Lucien ging unerbittlich Schritt für Schritt weiter.
Schließlich hastete ein Sanitäter auf uns zu. Ich wurde panisch, hatte eine gottverdammte Scheißangst vor ihm, weil ich mir vorstellte, er wäre einer der Terroristen, der sich bloß verkleidet hatte. Doch dann sprach er mit Lucien und erkundigte sich, ob wir verletzt waren. Lucien verneinte, und so schickte er uns nach oben.
Wir gingen weiter. Vorhin war mir dieser Flur nicht so lang vorgekommen. Es schien eine Ewigkeit zurückzuliegen, seit ich zur Toilette gegangen war. Nun wusste ich weder, was mit meinen Freundinnen passiert noch wie erheblich das Grauen tatsächlich war.
Einen Vorgeschmack bot mir aber Lucien, der, als wir um die Ecke bogen, ein bedrücktes »Merde sacrée« ausstieß.
Heilige Scheiße und ja, das traf diesen Anblick haargenau.
Dort, wo noch vor wenigen Momenten geordnet Tische und Stühle gestanden hatten, herrschte nun das reinste Chaos. Glasscherben schwammen in Rinnsalen unterschiedlicher Getränke und vermischten sich auf dem Boden mit Jacken, umgefallenen Möbelstücken und den hastig zurückgelassenen persönlichen Gegenständen der Gäste. Das Glas der Fensterscheiben war an einigen Stellen gesplittert, und ich konnte deutlich ein rundes Einschussloch erkennen.