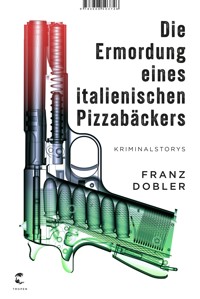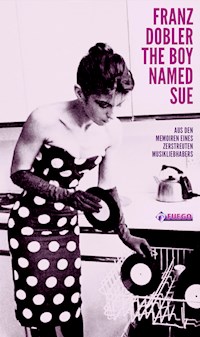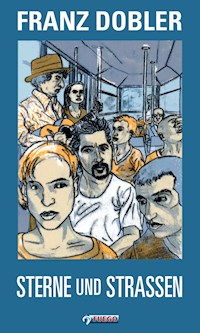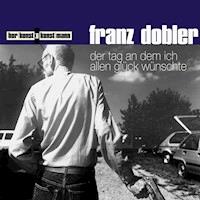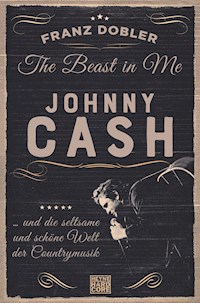
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Johnny Cash, der »Man in Black«, war bis zu seinem Tod im September 2003 eine der großen Legenden des Showbusiness. Wohl kaum ein Sänger hat die Herzen der Menschen so erwärmt, auch weit über seinen Tod hinaus ist Cash unantastbar, sein Charisma und Schaffen unerreicht. Der Schriftsteller Franz Dobler setzt der grenzübergreifenden Ikone mit seiner Biographie ein Denkmal und bietet gleichzeitig einen Rundgang durch die seltsame und schöne Welt der Countrymusik.
Die Neuausgabe mit einem neuen Vorwort des Autors, aktualisierter Diskografie und Chronik
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Am 12. September 2003 starb mit Johnny Cash eine der größten Legenden der amerikanischen Musik. Am Anfang seiner Karriere trat der begnadete Sänger mit Elvis Presley auf, Ende der 1960er-Jahre wurde er, vor allem mit seinen Gefängnis-Alben, zum weltweit bekanntesten Countrysänger. 2001 gelang ihm mithilfe des jungen Produzenten Rick Rubin und genialen Coverversionen von unter anderem Depeche Mode, Nine Inch Nails oder Nick Cave noch einmal ein unglaubliches Comeback, wodurch er viele neue Fans aller Generationen und Musik-Szenen erreichte. Franz Dobler erzählt in seiner facettenreichen Biografie nicht nur von Leben und Werk der Country-Ikone Johnny Cash, sondern auch von den schönen und seltsamen Licht- und Schattenseiten der American Countrymusic und den politischen Bedingungen, die den Sänger immer bewegten.
»Ich habe mich oft gefragt, ob Gangsta-Rapper wissen, wie wenig ihre Geschichten vom Verbrecherleben im Ghetto trennt von Johnny Cashs Geschichten vom Hinterwäldler-Verbrecherleben. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Johnny Cash das weiß.« Quentin Tarantino
Der Autor
Franz Dobler lebt in Bayern, ist großer Kenner der Countrymusik und als Musikjournalist und DJ auch sehr am Rest der Welt interessiert. Er schrieb außerdem die Musikbücher »Auf des toten Mannes Kiste«, »The Boy named Sue« und als Co-Autor »Rock’n’Roll Fever« und »Die Trikont-Story«. Für das Label Trikont gab er einige Compilations heraus, für seine Romane bekam er u.a. den Deutschen Krimipreis. Zuletzt erschien der Gedichtband »Ich will doch immer nur kriegen was ich haben will«, der mit dem Preis für »Die schönsten deutschen Bücher 2021« ausgezeichnet wurde.
Franz Dobler
The Beast In me
Johnny Cash
… und die seltsame und schöne Welt der Countrymusik
Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2002 im Kunstmann Verlag. 2004 im Heyne Verlag die aktualisierte und erweiterte Taschenbuchausgabe, die jetzt vom Autor noch einmal überarbeitet und aktualisiert wurde.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Taschenbuchausgabe 10/2021 Copyright © 2021 by Franz Dobler Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlagillustration: Alamy/A. F. Archive und envato elements/RetroBox Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-28282-0V001
Beware of the lies and false prophecies.
We are many with eyes but don't all really see.
You must be merciful, my friend, to obtain the same.
So if you break the chain don't pass the blame.
We should say unto all and I'll say it again:
it's not just to win, shake a hand, make a friend.
We who are pure at heart somehow might see there's still light in the world, come rejoice with me.
It's a new day.
Curtis Mayfield
Dieses Buch ist denen gewidmet, die es lesen müssen.
Vorwort des Autors zur Neuausgabe
Die letzte aktualisierte Version dieses Buchs ist vor siebzehn Jahren erschienen, ein Jahr nach dem Tod von Johnny Cash, nachdem die Originalausgabe zu seinem 70. Geburtstag 2002 veröffentlicht wurde. Das sind schon einige Jahre, und deshalb wird man ja wohl noch fragen dürfen, was inzwischen alles geschehen ist.
Ist die Bedeutung von Johnny Cash kleiner geworden? Wurde Countrymusik von HipHop zu Boden geworfen und bekommt keine Luft mehr? Ist Cash ein wenig in Vergessenheit geraten? Wurde ein Skandal aufgedeckt, der seinen guten Ruf beschädigt hat?
Keine Spur.
Im Gegenteil. Das Cash-Business läuft seit seinem Tod auf vollen Touren. Die Fans, die schon früher den Eindruck hatten, der Man In Black könne vielleicht sogar übers Wasser gehen, mussten ihre Meinung nicht ändern. Soweit ich weiß.
Allerdings wurde nach seinem Tod auch nichts veröffentlicht, was eine grundlegende Überarbeitung dieses Buchs oder ein neues Kapitel anlässlich dieser Neuausgabe gefordert hätte. Ist meine Meinung. Für diese 6. Auflage schreibe ich trotzdem ein neues Vorwort und habe Diskografie und Chronik aktualisiert.
Die Masse an neuem oder »neuem« Cash-Material ist groß, aber nicht ausreichend für einen Neubau dieses Buchs – alles, was nachgeschoben, ausgegraben, neu kommentiert, neu einsortiert, remixed oder auf T-Shirts gedruckt wurde, würde ich als Fußnoten bezeichnen, die dem zu Lebzeiten veröffentlichten Werk nichts Wesentliches hinzufügten. Selbst wenn einige dieser Fußnoten große Wirkung erzielten oder wirklich beachtlich sind. Auch in Bezug auf die Frage, ob Country inzwischen zwar nicht schöner, aber noch seltsamer geworden ist.
Beispiele für dies und das und auch den Raum, in dem sich diese Biografie bewegt: »Missing ol’ Johnny Cash« sangen 2015 seine alten Freunde Willie Nelson und Merle Haggard auf ihrem wunderbaren gemeinsamen Album Django and Jimmie noch bei guter Laune, bald darauf starb Haggard an seinem 79. Geburtstag, und musste nicht mehr erleben, dass seine Ablehnung des Präsidentschaftskandidaten Trump keine Wirkung hatte. Der unverwüstliche Willie Nelson hatte schon 2008 einen Salut an Cash abgeschickt, als er im Video »My Medicine« des ebenfalls Marihuana verehrenden Rap-Superstars Snoop Dogg gastierte, der sich damit tief vor dem »real American gangsta« Cash verbeugte; seine Drohung an das berühmteste Symbol und Konzerthaus der Countrymusik, »Grand Ol’ Opry, here we come!«, konnte er jedoch leider nicht wahr machen. Vielleicht kannte Haiyti den Song von Snoop, als sie einen ebenfalls charmanten Track aufnahm, der unser Thema berührt: »Fahre sonntags durch mein Barrio, Johnny, Johnny Cash im Radio, Ferrari, rotes Cabrio«, singt die junge Deutschrapperin in »Barrio«. Während US-Punkveteran Jello Biafra, sowohl Country-Hasser wie Country-Kenner, ebenfalls 2020 seinen Dead-Kennedys-Klassiker »Nazi Punks Fuck Off« als »Nazi Trumps Fuck Off« neu interpretierte, ehe die Trump-Nazis mit dem Sturm auf das Kapitol den Abgang des Präsidenten verhindern wollten.
Was hätte Johnny Cash wohl über Trump gesagt? Woher soll ich das wissen. Aber ich halte es für so gut wie ausgeschlossen, dass Cash diesem Präsidenten und seinem Berg von Lügen, hasserfüllten Reden, Verachtung von Minderheiten, rassistischen Äußerungen, Ignoranz gegenüber Klima- oder Covid-19-Pandemie-Problemen auch nur irgendwie wohlwollend begegnet wäre. Eine interessante Frage ist auch, ob Trump versucht hätte, den alten Cash sozusagen in den Arm zu nehmen. Schließlich gibt es ein paar patriotische Songs von ihm, die von den falschen Leuten gerne mal benutzt werden, um zu glauben oder zu behaupten, die Countrylegende wäre einer von ihnen. Auch um diese und jene Haltung geht es in dieser Biografie.
Country war und ist der stärkste Soundtrack des konservativen weißen Amerika, und in alle harten Konflikte der letzten Jahre, siehe »Black Lives Matter« und andere, die immer auch mit Trump verknüpft waren, wurde auch diese Musik mit einbezogen und ins Gebet genommen (das heißt scharf kritisiert oder angegriffen). Die meisten Countrykünstler*innen positionierten sich mit dem beliebten Statement: Besser nichts dazu sagen.
Johnny Cash dagegen hat sich in ähnlichen Situationen oft eingemischt, meist mit klaren Worten. Sein Bitter Tears-Album war nicht nur ein vehementer Einsatz für US-Indianer, sondern 1964 fast schon eine Art Anschlag auf das weiße Amerika und obendrein eine Aktion ohne Rückendeckung, was der Künstler heftig zu spüren bekam, bis hin zu Drohungen vom Ku-Klux-Klan, vor dem Cash nicht kuschte, sondern sich bewaffnete.
Für den Regisseur James Mangold war das offensichtlich jedoch nicht weiter der Rede wert, denn in seinem biografischen Spielfilm Walk The Line sieht man nichts davon. Und das ist nicht der einzige Grund für meine Behauptung, das äußerst erfolgreiche Biopic von 2005 tauge nicht viel: Blanker Unsinn ist schon allein die Idee, man könne eine Filmbiografie über Johnny Cash 1968 enden lassen und seine Liebesgeschichte mit June Carter in den Mittelpunkt der Handlung stellen. Alles, was einem Mainstream-Publikum Probleme bereiten könnte, wurde ausgelassen oder bis zur Farblosigkeit reingewaschen. Cashs Drogenabhängigkeit wird nur als mahnendes Beispiel vorgeführt, aber es wird nicht mal angedeutet, dass die Drogen viele Jahre ein wesentlicher Antrieb für seine außergewöhnliche Kreativität waren, für deren Vielseitigkeit sich der Regisseur ebenso wenig interessierte wie für sein politisches Engagement oder die immer wieder auftauchenden Kämpfe innerhalb der (Country-)Musikindustrie, die schließlich in Cashs »Fuck You«-Finger kulminierten … Großer Gott, Mangold, möchte man sagen, all das links liegen zu lassen! Von einer Hollywood-Romanze weggespült, deren Ergebnis, wie schon Mark E. Smith, der mit seiner Band The Fall mehrmals seine Country-Seite vorführte, gesagt hat, »Walk the fucking Line« lautet.
Würde ich mich jetzt auf der Linie des Films bewegen, würde ich das stärkste Verteidigungsargument, das James Mangold auf dem Konto hat, nicht erwähnen: Johnny Cash und June Carter waren in die Vorbereitungen eingebunden und mit Drehbuch und Wahl der Hauptakteure glücklich. Und das, obwohl Cash (nun gut, zwanzig Jahre zuvor) ein Gedicht mit dem Titel »Don’t Make a Movie About Me« geschrieben hatte, das so anfängt: »If anybody made a movie out of my life / I wouldn’t like it, but I’d watch it twice …« Abgedruckt ist es in dem sehr schönen und interessanten Biografie-Bildband Mein Vater Johnny Cash mit unveröffentlichten Fotos und handschriftlichen Dokumenten, den John Carter Cash 2011 veröffentlichte (ehe er sich an ein Kochbuch mit den Lieblingsgerichten der Eltern machte).
Der Berliner Comiczeichner Reinhard Kleist arbeitete zur gleichen Zeit wie James Mangold an einer Biografie und befürchtete, der Film würde seine im Jahr darauf veröffentlichte Graphic Novel überflüssig erscheinen lassen. Es kam anders. In meinem Vorwort zu Johnny Cash – I See a Darkness stellte ich die beiden Werke nebeneinander: »Je länger ich mir den Comic ansah, desto deutlicher wurden die Mängel des Films«, schrieb ich. Weil der Zeichner einen viel besseren Dreh gefunden hatte: Der alte Cash, schon bereit für Dr. Death, blickt auf sein Leben zurück. Und da sind sie nun: die Episoden mit »The Ballad of Ira Hayes«, die das rassistische Desaster in Amerika aufzeigen; mit Glen Sherley als zweitem Erzähler, dem Sträfling, dessen Song »Greystone Chapel« Cash beim Konzert im Folsom-Gefängnis spielte, den er nach seiner Entlassung unterstützte und seinen Weg ins Unglück dann doch nicht verhindern konnte; das von HipHop-Produzent Rick Rubin betreute spektakuläre Comeback. An meinem Fazit »Mangold hätte besser diesen Comic verfilmt« hat sich nichts geändert.
In jenem Sommer 2006 beschuldigte ich den Film, eine neue Viruskrankheit mit dem Namen Cashmania ausgelöst zu haben – eine Ironie, die ich heute wohl nicht riskieren würde. Für die Frankfurter Rundschau habe ich »die aktuelle Medikamentenliste für alle Infizierten aufgelistet: Ausgrabungen, Wiederveröffentlichungen, neue Tribute-Alben, Bücher und Best-of-Compilations, DVDs, Klingeltöne und, sagt mein erfahrener kleiner Finger, Raubpressungen. In der Zeitung eine Meldung, dass der Virus auch schwer aufs Gehirn schlagen kann: Barry Gibb von den Bee Gees kaufte das Cash-Haus in Hendersonville ›because of the musical inspiration‹. Ob er mit der Johnny Cash Prepaid MasterCard bezahlte, ist nicht bekannt. Andere spielten noch besser mit Worten: Der Werbespot für eine Hämorrhoiden-Salbe war mit ›Ring Of Fire‹ unterlegt (und wurde leider schnell von einem Gericht gestoppt).«
Anlass für meine medizinische Forschung war das Album American V: A Hundred Highways. Produziert, inszeniert, ausgewählt von Rick Rubin, aufgenommen in den letzten vier Monaten vor dem Tod des Sängers. »Da war Cash schon fast blind, saß im Rollstuhl, litt unter verschiedenen Krankheiten, konnte nicht mehr Gitarre spielen, und war nach dem Tod seiner Frau June Carter im Mai auch seelisch schwerstens angeschlagen (was seinen großartigen Galgenhumor in den letzten Interviews jedoch nicht verhinderte).« Zu dieser Zeit ging es weniger darum, noch ein neues Album zu verkaufen, erzählte Rick Rubin damals dem Independent, sondern um den »therapeutischen Wert von Musik«; ein Gitarrist, um dem Sänger Halt zu geben, und ein Toningenieur waren immer auf Abruf bereit, und er, Rubin, habe gewusst, »we need to keep this process going because this is what’s keeping him alive«.
In »Like The 309«, dem letzten Song, den er jemals schrieb, machte sich Cash ein Bild vom Tod. Es ist nicht der Sensenmann, auch keine verdammt gut gebaute »Lady Death«, wie sie von Charles Bukowski in seinem letzten Roman erträumt wurde, sondern ein präzises Symbol für die Realität. Er wartet auf »Dr. Death«. Bis zu dessen Ankunft wird er sich »fine« fühlen, dann möge man ihm den letzten Wunsch erfüllen: »Load my box on the 309« singt er mit schon vom Tod gezeichneter Stimme, doch von schlechter Laune keine Spur. Der Christ – der immer betonte, kein »christian artist« zu sein – erlaubte sich kein Hadern mit Gott. Mit dem Zug 309 und mit Hank Williams’ Beerdigungs-Ballade »On The Evening Train« war ein Kreis geschlossen: Auf seiner ersten Single 1955 sang der Ex-G.I. in »Hey Porter« von der Freude, endlich mit dem Zug nach Hause zu kommen. Alle Teile der American Recordings-Serie sind stark von Songs über Sterben und Tod geprägt, aber diese Nummer V ist das Todesalbum schlechthin.
Ich stellte in meinem Artikel einige Fragen. Dass Cash mit seiner Stimme nicht mehr das alte Format erreichen konnte, sagte Rick Rubin damals, habe ihm schwer zu schaffen gemacht. »Durfte man Cash in diesem Zustand noch aufnehmen? Man durfte. Nichts ist hier peinlich, nichts falsch. Großes Dokument, anrührend. Nein, Cash den Peinlichen findet man auf einigen alten Platten, die entstanden, als Rick Rubin noch im Sandkasten oder mit den Beastie Boys spielte.« Und die Frage, »ob es sich hier um pure Geldmacherei bei Cashmania-Opfern handelt? ›We need to capitalize from the movie‹, hätten die Leute von der Plattenfirma ständig zu ihm gesagt, berichtet Rubin, während er sich gesagt habe: ›No, we really need to distance ourselves from the movie.‹ Auch der Zusatz, dass Rubin allein in den letzten Monaten zwei seiner Produktionen auf Platz 1 der amerikanischen Album-Charts und sonst wo hatte (Red Hot Chilli Peppers, Dixie Chicks) und die Liste seiner Jobangebote wahrscheinlich von hier bis Graceland reichte, beantwortet die Frage nicht wirklich.« Jedenfalls hat Rubin nicht im Archiv gegraben, American V war schon geplant und in Arbeit, vollenden musste er das Album jedoch ohne Cash. »Woraus sich die Frage ergibt, ob er das durfte, die Musik unter die Gesänge dessen inszenieren, der sich nicht mehr dazu äußern konnte? Ja, er durfte es. Nicht der co-produzierende Sohn, die singende Tochter, die alten Freunde Willie Nelson und Kris Kristofferson, die Ex-Schwiegersöhne Nick Lowe und Rodney Crowell, die Fans Sheryl Crow, Kid Rock, Bono oder LL Cool J hätten es gedurft. Rick Rubin schon.« Denn Cash äußerte sich über den viel jüngeren Produzenten und Manager seines Comebacks immer auf eine Art, gegen die die Lobpreisungen von Papst-Anhängern sehr müde klingen. Rubin engagierte die Musiker, die mit Cash durch die American-Serie gegangen waren, »und sie spiegeln die Würde dieser letzten Gesänge in jedem Takt. Die Musik ist von reiner Schönheit, dezent, feierlich. Sie überrascht nicht, riskiert nichts, wozu auch.«
American V: A Hundred Highways profitierte zwangsläufig vom Cashmania-Effekt des Films, und der Effekt war nicht schlecht: Das Album schoss bei Erscheinen sofort auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Top-200-Album-Charts und auf Platz 1 der Country-Album-Charts. Es war nach Live At San Quentin 1969 erst das zweite Cash-Album, das die Top 200 anführte, und etwa ebenso lang lag sein letztes Nummer-1-Country-Album zurück. Charts-Position 7 in Deutschland war ähnlich bizarr, wie ein unerwartetes Monster aus dem Sumpf, und, so schrieb ich damals, »vielleicht steht der große Freund Israels sogar in den Hamas-Charts weit oben, ich schätze auf Nr. 666«.
Zu diesem Zeitpunkt war die Folge American VI bereits angekündigt, und als Ain’t No Grave schließlich 2010 erschien, eingespielt von fast der gleichen Mannschaft und im gleichen Style wie das Vorgängeralbum, hatte ich es schon vergessen. Zum Thema Cash hatte ich alles gesagt und schrieb nichts mehr darüber. Edo Reents beschrieb das Album in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so, wie es sich auch für mich anfühlte: Er sei »der Kunst zugetan, aber irgendwie auch überdrüssig, vor allem dieser ewigen Resteverwertung, die ›das neue Album‹ von Johnny Cash oder, demnächst, Jimi Hendrix zur blankesten Selbstverständlichkeit macht, als gäb’s keinen Gevatter Tod. Wie viele American Recordings von Johnny Cash sollen eigentlich noch kommen, nachdem es doch schon beim letzten, fünften Teil (…) geheißen und sogar dick auf dem Cover draufgestanden hatte: ›The Final Recordings‹?«
Die Fans aber sahen das anders, und dieses (anscheinend tatsächlich letzte) Album war in Deutschland mit Platz 3 das – zumindest, was die Charts angeht – erfolgreichste der gesamten American-Serie. Fast schon deep down underground war dagegen 2019 eine tatsächlich bedeutende Veröffentlichung, auf die nicht mehr viele gewartet haben dürften, weil die Aufnahmen schon seit Jahren illegal um die Welt gingen. Eingepackt in die 3-CD/LP-Box The Bob Dylan Bootleg Series Vol.15: Travelin’ Thru 1967–1969 featuring Johnny Cash, steckten hier hauptsächlich die legendären Nashville-Sessions, bei denen die beiden 1969 im Columbia Studio A achtzehn mehr oder weniger fertige Songs eher lustvoll als planvoll in wenigen Stunden eingespielt hatten. Offiziell war davon nur »Girl from the North Country« auf Dylans Album Nashville Skyline erschienen. Es war Bear-Family-Records-Gründer Richard Weize, der mir und dem Musiker Nils Koppruch eines nachts an der Hotelbar erzählte, dass Dylan die Aufnahmen für nicht gut genug hielt, um sie zu veröffentlichen. Das Gerücht, dass Dylan nur mit dem Nobelpreis für Literatur weichgekocht wurde, um endlich diese Sessions freizugeben, wage ich nicht zu beurteilen.
Die beinharten Cash-Fans können sich seit dem Tod der Countryikone auf jeden Fall über mangelnden weiteren Stoff nicht beschweren. Seit der letzten Aktualisierung dieser Biografie sind mindestens dreizehn neue Alben bzw. Produktionen erschienen, hauptsächlich Ausgrabungen wie ein Konzert von 1968 »at the Carousel Ballroom«. Ein Remix-Produkt wie Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra wurde nicht in die aktualisierte Diskografie aufgenommen, was nichts damit zu tun hat, dass ich sie für einen schlechten Witz halte (um es sanftmütig auszudrücken). Auch Produkte wie die Box The Complete Mercury Years oder neue Best-of-Compilations zähle ich hier nicht mit. Es gab außerdem Cover-Tribute-Alben wie A Girl Named Johnny Cash and other Tribute Songs oder die Punkrock-Versammlung Paid In Black Vol.2 sowie Bitter Tears Revisited mit großen Namen wie Emmylou Harris und Steve Earle. Dazu unter der Regie von Sohn John Carter Cash das Großprojekt Forever Words, unveröffentlichte Songtexte und Gedichte, zunächst als Buch und dann auch vertont mit populären Sänger*innen wie Alison Krauss, Elvis Costello oder T-Bone Burnett (es gab sogar noch eine nachgeschobene Deluxe-Edition mit 18 weiteren Versionen). Auch ein Film dazu ist in Arbeit – nein, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt, und hätte dabei fast das Yoga Tribute to Johnny Cash vergessen, das nur bei Bestellung auf CD-R gebrannt wird, oder den Hinweis, dass es mehrere Sammlungen mit Schlafliedern für Kleinkinder gibt, Cash-Hits in Instrumental-Versionen, was sicher besser ist als den Kleinen Texte wie »(Ghost) Riders in the Sky« ins Gehirn zu jagen.
Auch was neue Bücher betrifft, muss ich gestehen, dass meine Liste garantiert nicht vollständig ist: Allein 38 Titel, die nach Cashs Ableben erschienen, stehen auf der offiziellen Homepage johnnycash.com, und es würde mich glücklich machen, wenn ich Ihnen versichern könnte, dass ich jedes sorgfältig gelesen habe, um hier den einen oder anderen gehobenen Daumen abgeben zu können. Dort nicht zu finden sind nicht-englischsprachige oder angekündigte Werke wie Walk the Line: Dyess Colony – Die Heimat von Johnny Cash oder Citizen Cash: The Political Life and Times of Johnny Cash oder Ein Tribut an Johnny Cash: Eine Biografie in Bildern.
Ganz schön was los also auf dem Buchmarkt. Aber das ist nichts im Vergleich zu YouTube. Die unüberschaubare Masse wird täglich größer, nicht nur Live-Aufnahmen, offizielle Videos, tolle historische Schnipsel, sondern auch Coverversionen, Gitarrenanleitungen, eine Flut von Reaction- und First-Time-Hearing-Videos (die beweisen, dass Influencer dort die Macht übernommen haben, wo die Truppen des Islamischen Staats noch schwach sind) und immer wieder Dokumentationen wie The tragic real life story of June Carter Cash – Johnny Cash’s Wife, dreizehn Minuten Megaquatsch mit viel Werbungssoße ohne jede Tragik, was erwähnenswert ist, weil dieses neue Dingsbums schon am zweiten Tag 16000 Clicks eingefahren hat.
Dagegen waren es bloß 10400 Clicks in fünf Monaten für den Song »Goodnight America« vom neuen Album Our Country von Miko Marks & The Resurrectors. Das ist erwähnenswert, weil Marks eine der wenigen halbwegs bekannteren afroamerikanischen Countrysängerinnen ist – genauer gesagt, am Anfang ihrer Karriere 2005 viele Independent- und Newcomer-Preise bekam, ehe sie frustriert aus der Countrymetropole Nashville verschwand, weil deren Musikindustrie ihr keine Türen öffnete, um erst jetzt wieder ein neues großartiges Album mit Blues- und Soul-getränkten Countrysongs zu präsentieren.
Marks ist kein Einzelfall (und ich bin versucht zu sagen: natürlich kein Einzelfall). Künstler*innen müssen sich gar nicht weit von den durchschnittlichen Countrytexten über Bier und gebrochene oder heile Herzen absetzen und die Realität in die Songs reinballern wie Miko Marks, die »goodnight America, your dream is dead« singt, um sich ins kommerzielle Abseits zu befördern; siehe die vielsagenden YouTube-Clicks, an denen sich klar erkennen lässt, was in oder out ist.
Die Gesetze der amerikanischen Country-Industrie sind starr und mächtig und selten durchlässig – das zeigt auch die Geschichte von Johnny Cash –, und sie sind so alt wie die Beiträge von schwarzen Countrysänger*innen, die damals wie heute nicht die angemessene Beachtung finden. Und falls es in den letzten Jahrzehnten besser geworden war, so war Trump die passende Leitfigur, um die Sache wieder in die alte Ordnung zu bringen; der reaktionäre Rückschlag nach Barack Obama war im Country-Mainstream deutlich zu spüren. Musikjournalist Fabian Wolff hat es im März 2021 für den Tagesspiegel so auf den Punkt gebracht: »Nicht nur Covid-19 entzweite das ohnehin zutiefst gespaltene Country-Genre in den vergangenen Monaten noch weiter. Rassismus, Südstaatenerbe, Sexismus, Ästhetik und Moral: All diese Themen fahren in riesigen Trucks gegeneinander Rennen, während die Industrie sich die Ohren zuhält und den Lärm mit netten Worten über den blauen weiten Himmel, unter dem wir alle leben, übertönen will.« Mit einem Seitenhieb auf Cash übrigens, der beachtlich ist, weil diese Art Cash-Kritik selten ist: »Der Südstaatenmythos gehört zum Genre, selbst der oft als progressiver Rebell missverstandene Johnny Cash hat noch in den Achtzigern einen Tribut-Song an den Konföderiertengeneral Robert E. Lee aufgenommen. Dessen Statuen wurden zusammen mit denen anderer Sezessionisten und Kriegsverbrecher bei den Black-Lives-Matter-Protesten im vergangenen Sommer gestürzt.« Anlass für diesen Artikel über Geschichte und Gegenwart von Black Country war Mickey Guyton, die als erste Schwarze für einen Country-Grammy nominiert wurde, in der Kategorie Best Country Solo Performance für ihren Song »Black Like Me«. Nominiert. Neben vier anderen Performances – von denen eine den Grammy bekam. Tja … keine Ahnung, ob sich aus dieser Nominierung eine Trendwende ablesen oder erhoffen lässt.
Im Gegensatz zu aktuellen Countrystars wie Morgan Wallen, den viele garantiert für mehr als eine lächerlich klischeebeladene Kindergartenausgabe von Waylon Jennings halten, machen Outsider wie Marks und Guyton jedenfalls das Maul auf und kuschen weder musikalisch noch mit Worten vor den Countrybossen und ihren altbackenen Vorlieben. Johnny Cash hätten sie, da bin ich mir sicher, auf ihrer Seite. In den Trump-Jahren, das habe ich mir jetzt genauer angesehen, gab es zwar erstaunlich wenige Country-Artisten, die explizit für diesen Präsidenten getrommelt haben, aber die meisten hielten eben einfach die Klappe … bloß keinen Fehler machen! Superstar Garth Brooks wurde fälschlicherweise als Unterstützer bezichtigt, nur weil er für ein Unterstützer-Konzert angefragt worden war. Die Überreichung der »National Medal of Arts« durch den Präsidenten war drei Jahre ausgesetzt, weil man keine Ablehnungen riskieren wollte, ehe 2020 die Countrygrößen Toby Keith, der explizite Trump-Fan Ricky Skaggs und Alternative-Country-Darling Alison Krauss bereit waren, die Auszeichnung anzunehmen und Trump die Hand zu schütteln. Aber wer bin ich, dass ich mich nicht fragen würde, wie ich mich bei so einer Super-Auszeichnung verhalten würde? Mein Argument wäre: Die Präsidenten kommen und gehen, und Johnny Cash hat diese Auszeichnung auch angenommen.
Ich weiß, dass ich aufmerksame Leser*innen habe, und ich bin stolz darauf. Sie haben sicher schon bemerkt, dass ich hier rauszukommen versuche, und auch, dass ich angedeutet habe, dass ich seit meiner Zeit als Cashmania-Opfer nicht mehr der größte Countryfan unter der Sonne bin. Nicht mehr ständig verfolge, was da geht. Weil zu wenig geht. Weil die Musikwelt so viel mehr zu bieten hat. Weil ich zu selten im Countryschrott … ich möchte damit niemandem zu nahe treten, naja, ich gestehe, es ist mir egal … Perlen wie Miko Marks oder ein neues Album von Dale Watson oder die Black & White-Band Gangstagrass finde, die HipHop mit Bluegrass verbindet, durch den Titeltrack zur Fernsehserie Justified bekannt wurde und mit dem neuen Album explizit alle anspricht, nämlich alle Hautfarben und »Muslim, Christian or Hebrew«.
Die Arbeit an diesem Buch ist für mich gleichbleibend wichtig, ich habe sehr viel dabei gelernt, und hey, ich habe wahrscheinlich mehr Johnny-Cash-Songs im Kopf als die Vorsitzenden der Fanclubs.
Und das Buch bleibt für mich für immer verbunden mit meinen verstorbenen Freunden Wiglaf Droste, der mir das Buch eingebrockt hat, und dem Singer-Songwriter Nils Koppruch, mit dem ich damit auf Tournee war.
Wenn Sie bis hier gelesen haben, wünsche ich alles Gute und Glück und Gesundheit. Am 20. August 2021. Und vergessen Sie nicht: Don’t Take Your Guns to Town. Ausnahmen sind extrem selten.
Vorwort des Autors zur Taschenbuchausgabe
Die Originalausgabe dieses Buchs erschien zu Johnny Cashs 70. Geburtstag am 26. Februar 2002. Nach seinem Tod am 12. September 2003 war es für die Taschenbuchausgabe erforderlich, ein neues Kapitel zu schreiben: Das letzte Kapitel.
Es behandelt das letzte offizielle Album (The Man Comes Around), das letzte Video (Hurt), das letzte Konzert (in Hiltons, Virginia). Es erzählt auch vom letzten Album und vom Tod seiner Frau June Carter, vom letzten Krieg mit amerikanischer Beteiligung zu seinen Lebzeiten und ein paar Sachen mehr. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Kapitel kurz zu halten, aber nun ist es das längste des Buchs geworden. Es fiel mir schwerer, mich von diesem Buch endlich zu verabschieden, als ich dachte.
Es wurden die Fehler korrigiert, die mir bei der Erstausgabe unterlaufen waren. Ein paar Leser haben mir Hinweise gegeben, ich danke ihnen. Ein paar schwache Stellen habe ich zu stärken versucht.
Der sachliche Teil der Originalausgabe endete mit Kapitel VII. Ich habe daran nichts geändert, die letzten Abschnitte lesen sich immer noch wie das Ende; ich wollte nicht, dass die Erstfassung nun verschwindet, und deshalb haben wir auch die Einleitung nicht gestrichen. Das neue Kapitel ist die Nr. VIII. Die Kurzgeschichte ›Rhythm And Cocaine Blues‹, in der Johnny Cash eine Nebenrolle spielt, bildet weiterhin den literarischen Abschluss eines Sachbuchs. Einige kritisierten, dass diese Geschichte in einem Sachbuch nichts verloren habe. Ich kann dazu nur dies sagen: Ich war hier der Textchef, und der Textchef dachte, die Geschichte wäre doch eine schöne Ergänzung, natürlich auch, weil dem Textchef dieser Text gefiel. Leider ist es so wie im Leben dort draußen, auch der Textchef macht Fehler, aber wenn jemand zu ihm sagt, dass er einen Fehler gemacht hat, dann sagt er, nein, ist kein Fehler. Der Autor kann allerdings bestätigen, dass der Textchef schon Fehler gemacht hat. Jedoch nicht in diesem Fall.
Als Johnny Cash starb, hatte ich einen Auftrag im Schweizer Städtchen St. Gallen zu erledigen. Für seinen Todesfall hatte ich schon lange mit der Süddeutschen Zeitung einen Nachruf vereinbart, den ich jedoch erst im Ernstfall schreiben würde. Als der Fall eintrat, war ich froh, dass ich den Nachruf nicht schreiben konnte. Und ich merkte, dass ich ihn auch dann nicht hätte schreiben können, wenn ich die Zeit gehabt hätte. So konnte ich diesen Tag mit ein paar Freunden angemessen würdevoll begehen, und auch den langen und schönen Abend werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das letzte Kapitel für dieses Taschenbuch ist mein Nachruf.
Nach dem Tod von Johnny Cash sagte sein Freund und Produzent Rick Rubin etwas, dem ich mich, was dieses Buch betrifft, anschließen möchte. Die Arbeit mit ihm sei so großartig und erfüllend gewesen, sagte er, dass er jetzt immer noch Songs auswähle, um sie Cash für das nächste Album vorzuschlagen. Die Arbeit an den beiden Fassungen dieses Buchs hat mir mehr abverlangt, als ich befürchtet hatte, und ich habe dabei mehr gelernt, als ich erhofft hatte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es zu den wichtigsten Arbeiten in meinem Leben gehört haben wird.
Ich weiß nicht, wie man sich bei einem Toten bedanken kann. Ich weiß nicht, wo sie sind und was sie sind, wenn sie tot sind. Aber jetzt für diese eine Sekunde am 18. März 2004 um 18:00:12 glaube ich, dass die Toten unsere Gedanken hören können.
Einleitung
Der Stoff sucht sich seinen Autor aus, heißt es, und nicht der Autor seinen Stoff. Das klingt so gut, als wäre es von irgendeinem Stoff erfunden worden.
Bei diesem Buch war es so: Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Artikel über Countrymusik geschrieben, als ich Anfang 2001 einen sehr langen Beitrag über Johnny Cash im Internetmagazin Telepolis veröffentlichte, wo Country sonst kein Thema ist. Sein letztes Album American III: Solitary Man wurde überall gefeiert, und der Artikel wurde dann von der Berliner Tageszeitung junge Welt in vier Folgen nachgedruckt. Mein Freund und Kollege Wiglaf Droste hatte die Idee, eine Johnny Cash-Nacht in Berlin zu veranstalten. Wir ließen die Musik laufen, und während die Songs liefen, entschlossen wir uns, anders als geplant, keine Texte zu lesen. Wir hatten keine Lust, die Musik zu unterbrechen, und den Eindruck, dass das Publikum das verstehen könnte.
»Ich habe mit meiner Verlegerin gesprochen«, erzählte mir Droste ein paar Tage später am Telefon, »sie fand die Idee auch gut.« Ich fragte, welche Idee sie gut fanden. »Ich würde gern ein Buch von dir über Johnny Cash lesen, nächstes Jahr zu seinem 70. Geburtstag.« Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Ein paar Tage später rief mich Verlegerin Antje Kunstmann an. Der Anruf ließ mich nicht kalt, und ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Dann trafen wir uns zur ersten Besprechung, waren uns in allem einig, und ich versprach, darüber nachzudenken.
Dieses Buch machte mir etwas Angst, noch bevor ich mich entschlossen hatte, es zu schreiben. Ich sah mich in einem Berg von Arbeit versinken, die nicht so mein Gebiet ist. Der Stoff war riesig, eine der größten Karrieren der populären Musik des 20. Jahrhunderts. Ich würde monatelang nur noch Cash und nahe liegende Countrymusik hören, und das würde meiner Art, Musik zu hören, vollkommen widersprechen. Und ich würde den Mann danach nicht mehr hören können! Ich sagte zu.
Eine Menge Musikbücher langweilen mich, weil sie vor allem die Besessenheit des schreibenden Fans zeigen, seinen Eifer zum Datenwissen, seine Sammlerwut, seine Verehrung. Am Ende meiner Arbeit hatte ich die Johnny Cash-Chronik I’ve Been Everywhere auf dem Tisch. Das war spannend, denn ich hatte keine Ahnung gehabt, dass er am 5.12.’71 in Roanoake, Virginia, mit seiner Show gastiert hatte, und sogar die Konzerte, die angekündigt, dann aber abgesagt worden waren, hatte der Autor aufgelistet. Zum Dank für derartige Bemühungen wird man dann eines Tages nach dem Konzert backstage mit seinem Gott fotografiert. Ich selbst aber muss jede Leserin enttäuschen, die so was von diesem Buch erwartet. Es ist keine jedes Detail abhakende Biografie, und ich habe einige der etwa 75 Alben und wichtige Songs und große Hits nicht mal erwähnt.
Jetzt, am Ende der Arbeit, scheint es mir, als hätte ich seine vielen religiösen Platten mehr beachten sollen und weniger seine Drogenjahre. Aber ich habe die Drogenjahre nicht so ausführlich beschrieben, um das Buch spannender zu machen, sondern weil hier die Kluft zwischen Image und Realität der Countrymusik so deutlich ist, und, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es ist diese Art Line Dance, die mich interessiert. Ich wollte eine Balance schaffen, zwischen den Geschichten, die in diesem Leben wichtig sind, und denen, die mir wichtig scheinen, auch für ein größeres Bild von dieser Musik.
Wer schon einiges über Cash gelesen hat, wird hier bestenfalls ein paar neue Zusammenhänge oder Interpretationen finden können, aber keine neuen Fakten entdecken, auch kein Interview, das ich allein mit ihm geführt hätte – die häufigen Meldungen, dass er sich nach fast 50 Jahren Interviews nicht mehr für jedes begeistern könne, haben mir zu denken gegeben. Die Krankheitsmeldungen im Jahr 2001 waren so häufig wie in den Jahren zuvor. Er sagte, er wolle nichts anderes mehr tun, außer weiter Songs zu schreiben und aufzunehmen. Da wäre mir das Gebagger nach einem Interview lächerlich vorgekommen.
Viele haben mich bei diesem Buch mit Informationen und Material unterstützt, ihre Namen stehen im Anhang. Ich weiß nicht, wer ein Buch über Cash und Countrymusik schreiben könnte, ohne die vielen Arbeiten von Bear Family Records zu benutzen – ich nicht. Mein wichtigstes Nachschlagewerk zur Countrymusik allgemein war die Virgin Encyclopedia Of Country Music. Um sich vor Dieben zu schützen beziehungsweise sie überführen zu können, heißt es dort, habe man einige Fehler eingebaut. Diese Methode überzeugt mich, und ich habe sie auch für dieses Buch benutzt.
Am Ende schreibe ich die Einleitung und versuche verkrampft eine Frische zu zeigen, die ich nicht mehr habe. Es ist nicht immer ein Vergnügen, sich so lange im Schatten eines derart großen Künstlers aufzuhalten. Am Ende habe ich viel gelernt und sogar eine Ahnung davon bekommen, was mit dem Ende von ›The Beast In Me‹ gemeint sein könnte: »They’ve seen him out dressed in my clothes, patiently un-clear if it’s New York or New Year.«
Was mich glücklich macht, ist, dass ich die Songs von Johnny Cash immer noch so gut hören kann wie zuvor. Den Mann und seine Songs satt und über zu haben, das wäre das Buch nicht wert gewesen.
Augsburg/München, 13. Mai 2001 bis 1. Januar 2002
1 Biester, Killer und Geschäfte
Cover LP American Recordings, American Recordings 1994
Keine Chance
Einmal hat diese Musik verhindert, eine Frau kennen zu lernen, die ich sehr gern näher kennen gelernt hätte. So lernte ich sie an einem der Orte, die genau dafür erfunden wurden, nur sehr flüchtig kennen, nicht näher, als es in etwa zehn Minuten möglich ist. Wir hatten unseren Spaß in dieser kurzen Zeit, auch wenn wir uns nur über Banales unterhielten – wer woher, wer welche Bücher, welche Filme und solche Sachen, die gut sind, um sich schnell ein Bild von jemandem zu machen. Dann stellte sie eine neue Frage, und dummerweise musste ich diese Antwort geben:
»Ziemlich viel Countrymusik.«
Das vernichtete ihren bis dahin guten Eindruck von mir, und ich hatte nicht mal Zeit, ein einziges Wort hinzuzufügen. Sie sagte, »Ach Gottchen«, und ging weiter mit ihrem Glas, um bei anderen Leuten hängen zu bleiben. Ich hatte mich zum Glück nicht unsterblich verliebt in diesen zehn Minuten. Von Leuten, die nie was genauer wissen wollen, soll man die Finger lassen. Wäre sie nicht weggegangen, hätte ich sofort und ohne Übersetzung hinterhergeschickt:
»I love songs about horses, railroads, land, judgement day, family, hard times, whiskey, courtship, marriage, adultery, separation, murder, war, prison, rambling, damnation, home, salvation, death, pride, humor, piety, rebellion, patriotism, larceny, determination, tragedy, rowdiness, heartbreak and love. And mother. And God.«
Dann hätte ich vermutlich gesagt, dass diese schöne Aufzählung von Johnny Cash stammt, dass larceny Diebstahl heißt und dass ich selbst kein Bedürfnis nach Songs über Mutter, Gott und Patriotismus habe, dass es aber einige gibt, die einem helfen zu verstehen, warum so viele Leute ein Bedürfnis nach Songs über Mutter, Gott und Patriotismus haben. Vielleicht hätte ich sogar zugegeben, dass mir manche Lieder was geben, nur weil sie mich an meine Mutter erinnern, das sehr alte ›Will There Be Any Yodelers In Heaven?‹ zum Beispiel. Das wüsste ich gern, ob’s einen Himmel gibt, in dem Jodler erklingen, weil ich dann sicher wäre, dass sie manchmal etwas Spaß hat.
Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass Johnny Cashs Patriotismus nicht mit dem zu vergleichen ist, der uns seit Jahren wieder stärker in die Fresse schlägt. Weil’s in den Vereinigten Staaten von Amerika Leute gibt, die mit Patriotismus etwas meinen, was die Leute bei uns niemals damit meinen. »Auch wenn die Realität in den USA anders ist: Das Projekt USA steht für Demokratie, während das Projekt Deutschland nicht für ›alle Menschen sollen gleich sein‹, sondern ›alle Deutschen sollen gleich sein‹ steht«, hat es der deutsche Autor Maxim Biller kürzlich formuliert.
Cover LP Johnny Cash. Amiga/VEB Deutsche Schallplatten Berlin DDR 1980
Jedenfalls kann man mit dieser Aufzählung oft einen Punkt machen bei Leuten, die sich für diese Musik nicht oder kaum interessieren. Man kann auch schnell weiterkommen, wenn man erwähnt, dass Johnny Cashs letzte vier Alben von Rick Rubin produziert wurden, der ja, »aber wem sag ich das«, damals Run DMC oder die Beastie Boys produziert hat. Oft kommen dann viele Rückfragen geflogen. Man kann sich natürlich auch schweigend die Kante geben – in der Hoffnung, dass es schon in einem Strip-Poker enden wird, und der Verlierer ist dann der Erste beim russischen Roulette.
Ich ging also bald nach Hause und hörte ›Country My Ass‹. Ein seltsamer Song. Ein Countrysong, der wie nur irgendwas nach echtem Country klingt, aber der Sänger erzählt von einer Countrymusik, die ihm am Arsch vorbeigeht. Ist es also nicht klar, was jemand meint, wenn er Country sagt? Nein. Wie wir eben auch nicht viel wissen, wenn jemand Pop sagt. Das jener Frau zu erklären, hätte viel länger gedauert. Dazu hätten wir wirklich zu mir nach Hause gehen müssen. Da hätte ich dann fast ein ganzes Buch erzählen können. Falls uns nicht was dazwischengekommen wäre.
Der bekannteste Countrysänger der Welt
Er ist das seit Ende der 60er Jahre. Aber ohne sein unerwartetes, gigantisches, unvergleichliches Comeback in den 90er Jahren wäre er bestimmt nur in den interessierten Kreisen ein großer Name (und ich hätte dieses Buch nicht geschrieben). Der Mann, der als Jüngster in die Country Hall Of Fame gewählt wurde, 1980 mit 48 Jahren. Oder der Mann, der in der Show von Elvis auftrat, kurz bevor Elvis zu Elvis wurde. Es gibt nicht mehr viele, die erzählen können, was ihnen der junge Elvis nach der Show hinter der Bühne erzählt hat. Zu seiner späteren Frau June Carter sagte Elvis hinter der Bühne, dieser Cash sei der beste Songschreiber von allen. Er hatte die tiefste Stimme von allen, und sie konnte sehr böse klingen.
Als 1994 sein Album American Recordings herauskam, hatten ihn die großen Firmen, die aus Countrysongs Gold machen können, schon abgeschoben. Im selben Jahr wurde er populärer als jemals zuvor. Zu seinem alten Publikum bekam er ein neues, junges hinzu, das keine Ahnung hatte, wer Hank Williams gewesen war, aber nach dem Selbstmord von Kurt Cobain nachdenklich zum Sternenhimmel aufsah und sich fragte, ob’s dahinter überhaupt noch ein Nirvana geben mochte.
Die Platte kam nicht annähernd an frühere Verkaufszahlen heran, brachte ihn aber auf die Titelseiten der großen Magazine. Es wurde berichtet, der 62-Jährige habe in seiner 40jährigen Musikkarriere über 50 Millionen Platten verkauft und könne jetzt auch noch ein Video mit dem Supermodel Kate Moss vorweisen. Sie spielte die Delia aus dem Song ›Delia’s Gone‹. Johnny Cash spielte den todtraurigen, üblen alten Typen, der sie erschießt, weil sie sich herum- und ihn zur Verzweiflung treibt. Erst mit dem zweiten Schuss erwischt er sie richtig. Dann wirft er sie ins Grab und greift zur Schaufel.
Cash war der Einzige von den alten Countrystars, der nochmal solch einen Erfolg genießen konnte. George Jones und die etwas jüngeren Willie Nelson, Waylon Jennings und Merle Haggard – die immer nur in Amerika echt große Stars gewesen waren – hatten ebenfalls das Problem, keine netten Gesichter mehr zu haben, und keiner schien gewillt oder in der Lage, mit den lächerlichen Gymnastikposen eines Mick Jagger die ganze Bühnenbreite zu nutzen. Sie wurden bei den amerikanischen Countrysendern nicht mehr gespielt, die mit etwas zugemüllt waren, was sich dem Popmainstream angebiedert hatte, damit diejenigen, die aus Countrysongs Gold machen mussten, es Country nennen und zugleich den Popmarkt anzapfen konnten. Die Zuhörer hatten keine Probleme, es als Rettung vor dem bösen, das Land und seine Werte vernichtenden Hiphop zu empfinden. Wie in schlechten Kriminalromanen plötzlich irgendwo ein Hund bellt, so hörte man hier mal eine Geige, dann eine Steel-Guitar. Die Musik dieser alten Typen dagegen wirkte so, als würden sie in den Appalachen-Bergen in Höhlen leben und ein Reh mit den Händen töten. Und den alten, berühmten Sängerinnen wie Rose Maddox oder Loretta Lynn, erging’s denen besser? Sogar die jüngere Emmylou Harris hatte zu dieser Zeit das Problem der Showbiz-Abschiebung, weil sie nicht willens war, die Soundgesetze einzuhalten und in Videos ihren Bauchnabel zu zeigen. Aber es sollten noch einige schöne Überraschungen blühen. Seit Ende der 90er Jahre wird die Macht des Country-Establishments wieder durchlöchert. Der unerwartete Erfolg des Soundtracks zum Film O Brother Where Art Thou war das deutlichste Signal für etwas bessere Zeiten.
Cash hatte schon mehrere ungute Phasen durchgemacht und war am Ende immer für eine Überraschung gut gewesen, ohne dass ihm Courage, Intelligenz, frecher Witz, das Unabhängigbleiben und die Bereitschaft, etwas Neues zu versuchen, verloren gegangen wären. American Recordings bekam den Grammy für die beste Folkplatte des Jahres. Eingespielt von einem alten Sänger, allein mit Gitarre, die er so wenig sensationell bearbeitete wie damals zu Elvis’ Zeiten. Aber niemand hätte es eindrucksvoller machen können, und Johnny Cash hatte den Beat. Der Song ›Tennessee Stud‹ war dann in Quentin Tarantinos Film Jackie Brown zu hören, er kam aus dem Autoradio, das war jetzt cool. Am Ende der 90er Jahre war aus American Recordings eine Trilogie geworden, die Cashs Ruhm noch vergrößert hatte, und ohne dass er jeweils die Vorgängerplatte imitiert hätte. Es war, als wollten er und Rick Rubin den einen eine Lektion erteilen und den anderen eine anbieten. Das 96er Album Unchained wurde mit Tom Pettys Band eingespielt und war ein musikalischer Hieb gegen den auch nach Popmaßstäben belanglosen Countrypop. Das Album war vielmehr von Punk-Rock inspiriert, antreibend und krachend, verschonte aber auch keinen mit traurigen Songs, die vom Sterben erzählten. Es wurde Countryalbum des Jahres der Country Music Association, und das nächste bescherte dem Sänger wieder einen Grammy und war noch erfolgreicher. Bei American III: Solitary Man wurde das Schlagzeug wieder weggelassen, eine Country-Folk-Platte, die Songschätze aus dem gesamten 20. Jahrhundert präsentiert, darunter Coverversionen von Nick Cave und Will ›Bonnie Prince Billy‹ Oldham. In der Zeit davor hatte es mehrmals so ausgesehen – und nicht nur aus dem Blickwinkel der Boulevardpresse -, als wären Cashs Tage gezählt. Die Platte erschien im Oktober 2000, kam in den US-Country-Charts auf Platz 11 (und wurde in Deutschland von so gegensätzlichen Magazinen wie Spex und Musik Express in den Mitarbeiterlisten zur Platte des Jahres ganz oben notiert – wen schert’s, zur Hölle, ob das Country sein soll? Im Juli 2001 ist Solitary Man immer noch Nr. 2 der Lesercharts des deutschen Rolling Stone, davor nur die neue von Cash-Fan Nick Cave). Johnny Cashs letztes Album wurde im November 2002 veröffentlicht. American IV: The Man Comes Around wurde zum erfolgreichsten Teil der Serie, speziell durch das Video zum Song ›Hurt‹, der ihn zum ersten Mal seit 1990 in die Country-Single-Charts bringt; in den Album-Charts ist die Spitze bei No. 4 erreicht. Rubins vierte Produktion erhält abermals einen Grammy und wird im Mai 2003 mit 500000 verkauften Stück in den USA zur Goldenen Schallplatte.
Zumindest die ersten drei American-Teile waren also weit entfernt von seinen größten Erfolgen – aber der gigantische Ruf dieses Comebacks war am Ende des Jahrtausends bei jenen angekommen, mit denen Cash nichts mehr zu tun haben wollte. Bei Columbia/CBS Records, inzwischen gekauft vom Sony-Konzern, die ihn 1986 nach drei Jahrzehnten gefeuert hatten, hatte er wieder einen Marktwert, und es erschienen die erfolgreichen Gefängnis-Live-Alben, die ihn Ende der 60er zum Weltstar gemacht hatten, erstmals in voller Länge, und außerdem die 3-CD-Compilation Love God Murder, deren Zusammenstellung er sogar selbst bestimmen konnte, nicht zu vergessen ein unüberschaubarer Stapel sonstiger Best-Ofs, Early-Hits und Neuauflagen vergriffener Alben.
Regierung Nashville
Seit den 50er Jahren ist Nashville, Tennessee, die Hauptstadt der Countrymusik. Es heißt, dass heute dort mehr Song-writer, Musikgeschäft-Angestellte und Studioarbeiter leben als in irgendeiner anderen Stadt auf diesem Planeten. Die absoluten Zahlen von heute mögen rücklaufig sein – sind sie das eigentlich nicht immer und bei allen? -, aber Country ist im US-Musikgeschäft die Geldmaschine Nr. 1, auch wenn es Vorkommen kann, dass die Hiphop-Industrie zeitweise bessere Zahlen schreibt. Country Capital Of The World – das bedeutet ein Netzwerk aus Labels, Radiostationen, Konzert-und Promotionagenturen und Ladenketten, aus dem die fast absolute Herrschaft der Top-40-Radios entstanden ist. Auf diesem Countrysektor will man nicht hören, wenn Merle Haggard von der Gier singt, die ihn beim Anblick von alten Freunden befällt, wenn sie sich ein paar Linien Kokain genehmigen. Dass Mitte der 90er Jahre der Versuch fehlgeschlagen ist, mit diesem Country-Pop-Mainstream den deutschen Markt zu erobern, interessiert dort einen Dreck. Nur wenn man’s geschafft hätte, dass jede neue Platte der Dixie Chicks die auch nicht sexyere Gerri Halliwell oder Rammstein schlägt, wäre es interessant gewesen. So aber misst man diesem Markt etwa so viel Wert bei wie den Waffen afghanischer Rebellen, und man überlässt ihn, was ich dann verstehen kann, kampflos den stärksten Symbolen der deutschen Countrymusik, Truckstop mit Gelegenheitsfrontmann Stefan Raab. Nicht satisfaktionsfähig.
Deutschland ist nach den englischsprachigen Ländern der weltweit größte Musikmarkt, aber das bedeutet kaum mehr als die Aussage, dass Albert Ayler auf der Venus so gern gehört wird wie in Rostock. In den 80ern bereitete Pop dem US-Countrymarkt schwerste Probleme. Als man sich auf den riesigen Erfolg des John Travolta-Films Urban Cowboy und seinen Disney-Countrypop einließ, konnten sie schnell behoben werden. Kein Zufall, dass Cash in dieser Zeit von CBS gefeuert wurde, und am Ende des Jahrzehnts kam das Siegessymbol eingeritten, Garth Brooks. Ein Beispiel für die Größenordnung: sein 95er Album Fresh Horses wurde mit 4,5 Millionen Dollar von Capitol Records beworben. Damals wie heute hat Brooks mehr Tonträger verkauft als jemals ein anderer Künstler, mehr als Elvis, als Michael Jackson, als Herbert Grönemeyer. Nur eine Band hat er noch nicht übertrumpft, The Beatles. Vielleicht nicht gehässigere, auf jeden Fall aber informiertere Stimmen als ich glauben, das sei das Einzige, was ihn davon abhält, sich mit 42 Jahren in den Vorruhestand zu verabschieden.
Postkarte Nashville, 1999. Sammlung Ralf Richter
Will man nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen bei einer Darstellung der aktuellen Countryszene, dann bedient man sich, ohne verzerrende Wirkung, am besten zweier Namen: Johnny Cash und Garth Brooks. Der Unterschied ist viel größer als nur 30 Jahre Leben, 35 Jahre Karriere, etwa 70 produzierte und etwa 40 Millionen verkaufte Platten.
Cash stand selten und schon lange nicht mehr mit Cowboyhut und kariertem Hemd auf der Bühne, und Brooks ist nicht in einem Haushalt ohne fließend Wasser und Strom aufgewachsen und hat in seiner Kindheit auch nicht Baumwolle gepflückt. Damit soll nicht angedeutet sein, Brooks hätte kein Recht, diese Musik zu machen. Auch Julia Roberts’ Exehemann, der teure Anzüge, aber keinen Hut tragende Country-sänger Lyle Lovett, hat Cashs Erfahrungen nicht gemacht – wer hat das schon aus dieser Generation? Doch Brooks’ riesige Erfolge haben stark mit Symbolen zu tun, die eine bestimmte Tradition zu bewahren schienen. Musikalisch hat er nur einen Touch traditioneller Countrymusik eingebaut, in den Texten aber spricht er vage eine gute alte Zeit an – nicht indem er etwa von Kurbeltelefon oder Pferdegespann erzählen würde, sondern von Romantik, von ewiger Liebe, von der Familie als heiligem, geschütztem Ort. Mit perfekten Marketingfeldzügen wird dann eine weiße Schicht bedient, die eine unbestimmte Angst vor der modernen Welt hat. Die Logik von Sendern und Plattenfirmen ist nicht so unklar: Würde das Publikum kommerziell bedeutende Radiosender akzeptieren, die gleich verteilt Garth Brooks und die neuen Songs von unmodernen Typen wie Johnny Cash und Willie Nelson und Loretta Lynn sowie Klassiker spielen, dann würde es den Eindruck gewinnen, nicht mehr up to date zu sein. Garth Brooks aber vermittelt ihnen, dass sie zum gegenwärtigen Amerika gehören und keine Spur rückständiger sind als die permanent dreckige Wörter ausspuckenden Rapper aus L. A. oder New York. Natürlich gehören sie sowieso zu den USA von heute. Brooks hat bis 2001 100 Millionen verkaufte Tonträger vorzuweisen. Um die Millionen Menschen, die fehlen, weil sie das Kumpel-Kirche-Bier-Pick-up-Base-ball-Image von Brooks und vielen seiner männlichen Kollegen nicht anspricht, kümmern sich inzwischen viele junge, gut aussehende Sängerinnen. Die Dixie Chicks, Shania Twain oder Jamie O’Neal setzen ihr Körperkapital ebenso bewusst ein wie eine Lil’ Kim oder Destiny’s Child. Dass sie dabei etwas weniger zeigen als ihre afroamerikanischen Schwestern, liegt daran, dass der Begriff Country samt Image nicht einfach weggeworfen werden kann. Und warum wird das Ding nicht einfach Pop genannt? Weil sie sich dann aus dem riesigen Countrymarkt verabschiedet hätten.
Keine andere populäre Musik hat derart viel mit Tradition zu tun bzw. mit ihrer Vortäuschung. Deshalb verschwindet die Auseinandersetzung um wahren oder falschen Country nie. Es gibt immer Verräter, und jede Erneuerung spaltet die Anhängerschaft in feindliche Lager. In den 50er Jahren konnte man Country vor Rock’n’Roll beschützen, in den 60ern vor Pop, in den 70ern vor Rock. Alle drei Einflüsse waren musikalisch und kommerziell stark genug, um Country auf den Kopf zu stellen. Gegen Rock’n’Roll und Rock mussten sich diejenigen, die Country und sein Image gepachtet zu haben glaubten, geschlagen geben. Die Musikindustrie unterstützte diesen Einfluss erst dann, als sich der Erfolg deutlich abzeichnete. Rock’n’Roll war eine Publikumswelle, die alles überrollte, und Country-Rock oder Outlaw-Country wurde buchstäblich von Musikern erkämpft. Der Country-Pop seit den 90er Jahren aber geht vor allem auf das Konto der Plattenindustrie. Und ist die beste Geldmaschine aller Zeiten. Und wie im Mainstream-Pop habe ich auch hier bei vielen Künstlern den Eindruck, sie seien nichts anderes als eine Erfindung von Marketingspezialisten (was Garth Brooks und Shania Twain jedoch nicht sind). Für mich gehört das zu den übelsten Erscheinungen in der Musikgeschichte (gegen die in den letzten Jahren jedoch Widerstand gewachsen ist). Über all diese jungen Stars hat der 1962 geborene, stark tätowierte Dale Watson einen Song gemacht. Er heißt …
Country My Ass
… und gießt einen Kübel Hohn über die Yuppie-Country-Invasion: Der Junge, der für uns von seinen harten Lebenserfahrungen singt, aber die einzigen, die er hat, kreisen um fünf Nächte in Hotels mit weiteren fünf Tourtagen vor Augen, und die Satellitenschüssel ist kaputt! Diese Leute haben den Soul aus meiner Musik vertrieben, singt Dale, einer der besten jüngeren Off-Nashville-Musiker, keineswegs nur ein Undergroundstar und angemessen mit Courage und Kampfgeist ausgestattet. Als ihm nach vier Alben ein Deal mit einer großen Firma gelang, ließ er ihn platzen, weil sie meinte, sein Anti-Radio-Song ›The Legend‹ könnte auf keinen Fall veröffentlicht werden. Sein Live-Album Preachin’ To The Choir wurde 2001 mit dem Satz beworben: »Don’t Buy This Record! (If You Don’t Like Real Country Music).«
Vor diesem Hintergrund ist Johnny Cashs Comeback mit American Recordings 1994 noch überraschender. Er kam nicht zurück als eine Art männliche Tina Turner, als sensationell gut erhaltener Opa, sondern als der »Bad Lieutenant der Countrymusik«.1 Eine düstere, spartanische Platte mit gelegentlich sarkastischem Humor. Der Sänger als unheimliche, biblische Gestalt mit einer Mir-ist-alles-egal-Haltung – ich sage, was ich zu sagen habe, ob ihr mir zuhört, ist eure Sache, und ich spiele, wie ich spielen will, wenn ihr zuhören wollt, dann tut es. Gesänge zu Gott, Mörderballaden, scheinbar Lustiges über einen notorischen Pechvogel, ein Verliebter resümiert sein bisheriges Lie-besleben und sagt »every day is better than before, I’m like a soldier getting over the war«, und auch ›The Beast In Me‹ ist von bedrohlicher Melancholie durchzogen. Kein Soundtrack für wirtschaftliche Aufschwünge, schon eher die Erinnerung daran, dass der Amerikanische Traum nicht nur Nashville oder der Wall Street gehört.
Dale Watson, Rückseite CD Every Song I Write Is For You, Continental Song City 2001
Garth Brooks, Rückseite CD Seven, Capitol Nashville 1997
Merle Haggard, Booklet Rückseite CD Roots Volume I, Anti-Rec. 2001
Die Nashville-Popper kämpften darum, im aktuellen Soundspektrum anerkannt zu sein, Cash brauchte das nicht tun. Er hatte den damals 30-jährigen Rick Rubin, der mit seinem Label Def Jam ganz nach oben gekommen war. Die Namen, mit denen er in Verbindung gebracht wurde, lauteten: Beastie Boys, Run DMC, LL Cool J, Slayer, Red Hot Chilli Peppers. Jetzt war er Chefproduzent seines neuen Labels American Recordings. Er sah nicht nur aus »wie die Heavy-Metal-Version von Räuber Hotzenplotz«, sondern übte sich auch »täglich in transzendentaler Meditation, Tai-Chi und Yoga«. Mit Country war er bisher nicht in Verbindung gebracht worden, und es kostete ihn einige Mühe, Cash zur Zusammenarbeit zu überreden. Der war 1993 ohne Plattenvertrag und hatte keine Lust mehr auf Leute, die ihn für die Trends der 90er kompatibel aufbereiten wollten. Viele hatten mehr als nur elf Nr.-1-Hits gehabt. Wenige hatten so viele Platten verkauft. Kein lebendes Gesicht war so sehr zum Symbol für Country geworden. Die Musikwelt besteht aber nicht nur aus Tonträgern: Cash konnte Konzerte geben, so lang er eben konnte. Er war nicht abhängig von einem Plattenvertrag.
Das hatte er bisher gemacht: Rockabilly, Country, religiöse und Kinderplatten, Soundtracks für Filme, Konzeptalben und solche, auf denen er zwischen den Songs Stories erzählte, eine reine Sprechplatte mit der Rede eines Indianerhäuptlings, Fernsehshows und -filme, Hauptrollen in Fernseh- und Kinofilmen, eine Autobiografie und einen Roman über das Leben des Apostel Paulus.
Als Rick Rubin ihn endlich von seinem seriösen Interesse überzeugt hatte, fragte Cash ihn, was für eine Platte er denn mit ihm machen würde, und Rubin sagte, er würde nichts anderes tun, als ihn allein mit seiner Gitarre aufzunehmen. Sonst nichts. Das war die Platte, die Cash seit 30 Jahren machen wollte, aber alle anderen hatten abgelehnt: American Recordings.
Rubin brauchte keine Marketingarmee, um zu wissen, dass Cash weder einen Cowboyhut noch riesige Turnschuhe tragen musste, um akzeptiert und respektiert zu werden. Cash war überzeugend, und er gab nicht den netten Opa von nebenan. Er wirkte wie der Großvater, der gekommen war, um für seine verstorbenen Enkel Sid Vicious und Kurt Cobain Rache zu üben. Eine dunkle Gestalt, ein Pate. Er war 62, er war schon out gewesen, und jetzt war er wieder da, und er war übermütig. Zwei Songs wurden vor Publikum in einem der angesagtesten Lokale Amerikas aufgenommen, in Johnny Depps The Viper Room, Hollywood – nicht in Nashville. Das war die Handschrift von diesem Rubin.
Trotzdem, das Country-Establishment musste sich wegen American Recordings keine Sorgen machen. Die CD lag nicht in jedem Supermarkt herum. Im Radio wurde sie auch nicht gespielt – na gut, vielleicht in den Collegeradios und drüben in Europa, nachts, wenn die Intellektuellen und Selbstmordgefährdeten und Einsamen zuhörten, und die Freaks, die immer noch Vinyl kauften, und die Frauen, die sich fragten, ob es noch andere Möglichkeiten als Madonna gab, und die Girls, die Beck mochten, »I’m a looser, baby, so why don’t you kill me« -, und natürlich alle, die sich fragten, warum der Millionär und stolze junge Vater Kurt Cobain Selbstmord begangen hatte. Was soll’s, grinste da jemand in Nashville, diese Hühner bringen nicht die Kohle, die wir haben wollen, und wir haben nichts, was wir ihnen andrehen könnten – und trotzdem, da nervte irgendwas den großen Countryboss, dieses Supergirl, diese Kate war im Video, es wurde gespielt, Kate kaum als Kate Moss erkennbar, welche Arroganz, und sie wurde ermordet, und dieser alte Mörder: kein Fingerzeig auf das Böse, welche Frechheit! Falls in Nashville jemand sagte »Cash my ass« oder »Rubin my ass«, hatte er schon was verstanden. Die beiden hatten auf eine subtile Art nichts anderes gesagt, country-business my ass. Wer das nicht kapierte, sollte es bald unmissverständlich erklärt bekommen.
Die Anzeige
Johnny Cashs 96er Album Unchained bekam den Award für das beste Countryalbum des Jahres. Nach der Verleihung kauften sich Label und Künstler für 20000 Dollar eine ganzseitige Anzeige2 im großformatigen Branchenblatt Billboard Magazine. Sie nahmen ein Cash-Foto, das der berühmte Rock-Fotograf Jim Marshall 1969 beim Konzert im Gefängnis San Quentin geschossen hatte: über der Gitarre Cashs wutverzerrtes Gesicht und, dem Betrachter entgegengestreckt, aus der rechten Faust heraus ragend, sein ausgestreckter Mittelfinger. Links oben stand folgender Text: »American Recordings and Johnny Cash would like to acknowledge the Nashville music establishment and country radio for your support.« Rechts unten klein gedruckt: »Thanks to those who made a difference. You know who you are.«
Der strenggläubige, damals 65-jährige Baptist hatte damit eine Geste gemacht, die nicht nur für ihn selbst sprach, sondern auch für seine Altersgenossen, die pauschal vom dominierenden Charts-Only-Radio ignoriert wurden, obwohl sie der Inbegriff des Country waren.
Willie Nelson (64) kommentierte die Anzeige mit dem Satz »John spricht für uns alle« und ergänzte, er hätte sie sofort in seinem Tourbus aufgehängt. George Jones (66) sagte, die Anzeige hätte ihn laut auflachen lassen. Bald darauf wurde für seine neue Single ›Wild Irish Rose‹ in Billboard mit einem Foto geworben, auf dem verschiedene Arten von Bällen zu sehen waren, Footballs, Basketballs, Baseballs. Dazu folgender Text: »If radio had any, they’d play this record.« Balls: die Eier des Mannes. Also Courage haben. Nelson und Jones zählen zu den größten Namen, die Country zu bieten hat, und niemand konnte behaupten, dass sie nichts mehr zu bieten hatten.
Billboard Magazine 14.3.1998 (unter Verwendung eines Fotos von Jim Marshall 1969)
Was diese Alten umtrieb, waren nicht nur Verkaufsprobleme, sondern auch mindestens Probleme mit ihren Plattenfirmen beziehungsweise bei der Suche nach einer neuen. Für diejenigen von ihnen, die nicht zu den ganz großen alten Namen gehörten, war damit das Problem verbunden, nicht mehr genug ausreichend bezahlte Konzerte zu bekommen, um das auffangen zu können – professionelle Countrymusiker sind nicht billig, und sie waren weder in der Altersklasse noch in der Szene, in der sich Bands durchschlugen, die für ein Konzert gegen Freigetränke bereit sind, durch die Hölle zu gehen. Und was war mit denen, die es sowieso nicht mehr schafften, genug Konzerte zu geben? Tantiemen für alte Hits – nur wenn sie neu eingespielt wurden. Wahrscheinlich hörten sie zu Hause diesen längst verbannten alten Hank Williams-Hit: ›I’ll Never Get Out Of This World Alive‹.
Auch anderen Gruppen außerhalb des Country-Pop-Mainstream dürfte die Attacke des Nr.-1-Countrystars aus der Seele gesprochen haben: allen, die als viel zu real country angesehen wurden, womit gemeint war, dass ihnen der Pop-Appeal fehlte (wie Emmylou Harris). Und allen 80 Mitgliedern der 1997 gegründeten Black Country Music Association (BCMA).
Die Chance der afroamerikanischen Countrymusiker, passable Arbeits- und Vermarktungsbedingungen zu bekommen, ist nur knapp über null – obwohl etwa 25% der erwachsenen Afroamerikaner auch Country hören -, egal ob sie angepasst spielten wie The Wheels oder, damit mehrfach disqualifiziert, so rau wie Clarence Gatemouth Brown. Der kann zwar seine Swing-Blues-Alben in den USA herausbringen, aber nicht die Countryalben. Und eher werden wir auf dem Mars Square Dance tanzen, als dass der Traum von Andre »I’m The Bad Motherfucker« Williams, der Country liebende Schweinepriester des dreckigen Rhythm’n’Blues, in Erfüllung gehen wird: einmal in der Grand Ole Opry spielen. Wo man das Wort Pussy nicht so gern hört …3
Johnny Cashs Fuck You wurde von der in den 90ern entstandenen Szene, die sich mit Begriffen wie alt.country, Insurgent Country oder Roots-Music skizzieren lässt, besonders gut verstanden, denn viele von ihnen kamen aus dem Punkrock. Keiner von ihnen interessierte sich für den Nashville-Country-Pop, aber alle verehrten die alten Helden wie Jimmie Rodgers, Bob Wills, Hank Williams oder George Jones – und natürlich Johnny Cash. Denn ihre Musik taugt immer noch als Vorlage und Inspirationsquelle. Ihre Geschichten von den üblen und den schönen Seiten des Lebens haben nichts an Gültigkeit verloren – was natürlich nicht heißt, dass Rodgers’ Hobo-Songs heute etwas anderes als eine Geschichtslektion wären.
Cashs Comeback hat einem jungen Publikum, das auf Country ablehnend reagierte, einen Zugang gegeben. Sogar in Deutschland hat sich in den letzten fünf Jahren eine neue Countryszene gebildet, die mit dem, was deutscher Country von Truckstop bis Tom Astor bisher war, nichts zu tun hat. Nur wenige spielen real country, aber im Unterschied zur alten Szene ist dieses Nachgespiele, dieses So-tun-als-ob verschwunden, dieses Cowboy-und-Indianer-Freizeitpark-Getue, Karneval-Country. Was jedoch nicht heißt, dass der harte, fußstampfende, zur großen Sause aufrufende Honky-Tonk vergessen wäre, im Gegenteil: deshalb sind so viele Ex-Punkrocker dabei und Rockabillys, die etwas Soundveränderung brauchen. Und die Love-Parade hat sich in Technokarneval verwandelt – warum sich nicht in anderen, weniger überlaufenen Gegenden umsehen?