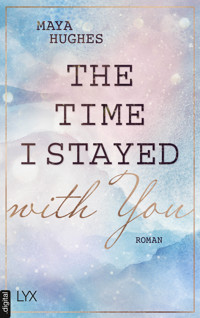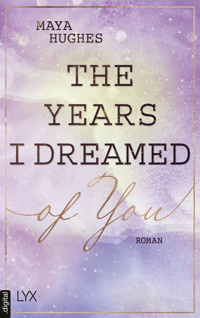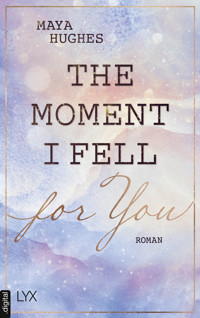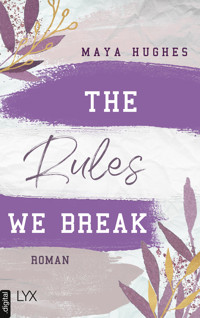
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fulton University Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein einziger Blick könnte alles zwischen ihnen verändern ...
LJ und Marisa sind seit Jahren unzertrennlich. Aber obwohl sie eigentlich keine Geheimnisse voreinander haben, verbergen beide, dass aus ihrer Freundschaft längst Liebe geworden ist. Denn zu tief sitzt die Angst, den wichtigsten Menschen im Leben wegen unerwiderter Gefühle zu verlieren. Außerdem ist Marisas Vater LJs Football-Coach und gar nicht damit einverstanden, dass dieser so viel Zeit mit seiner Tochter verbringt. Wenn LJ jedoch nach seinem Collegeabschluss Football-Profi werden will, ist er auf den guten Willen seines Trainers angewiesen. Aber als Marisa ihre Wohnung verliert, kann LJ nicht anders, als sie bei sich aufzunehmen - obwohl er weiß, dass er mit nur einem Ausrutscher alles, was er sich für seine Zukunft erträumt, verlieren könnte ...
"Man versinkt in diesem Buch, und die Protagonisten wachsen einem so sehr ans Herz, dass man sich gar nicht mehr trennen will." @FEDERUNDESELSOHR über THE MEMORIES WE MAKE
Band 4 der FULTON-UNIVERSITY-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Ende
Die Autorin
Die Romane von Maya Hughes bei LYX
Impressum
Maya Hughes
The Rules We Break
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katrin Reichardt
ZU DIESEM BUCH
LJ und Marisa sind seit Jahren unzertrennlich: Sie sind immer füreinander da, erzählen sich alles und unterstützen sich in jeder Situation. Aber beide verbergen vor dem anderen, dass aus Freundschaft längst Liebe geworden ist. Für LJ werden die wöchentlichen Filmabende und langen Partynächte mit seiner besten Freundin immer mehr zum Test seiner Willenskraft. Er ist nur einen sehnsüchtigen Blick oder eine zärtliche Berührung davon entfernt, alle Vorsicht in den Wind zu schlagen und Marisa seine Gefühle zu gestehen. Doch die Angst, sie könnten nicht erwidert werden, hält ihn davon ab. Außerdem ist Marisas Vater LJs Football-Coach und gar nicht damit einverstanden, dass dieser so viel Zeit mit seiner Tochter verbringt. Und wenn LJ nach dem College von einem erfolgreichen Team verpflichtet werden will, ist er jetzt mehr denn je auf den guten Willen seines Trainers angewiesen. Aber als Marisa ihre Wohnung verliert, kann LJ nicht anders, als sie bei sich aufzunehmen – obwohl er weiß, dass ein einziger schwacher Moment reichen würde, um nicht nur Marisa zu verlieren, sondern auch alles, was er sich für seine Zukunft erträumt.
Für Dawn! Jetzt, da ich dich gefunden habe, lasse ich dich nie wieder gehen! :-P
1. KAPITEL
L J
Sobald ich dieses vibrierende Ding, das irgendwo zwischen meinen Decken steckte, endlich gefunden hatte, würde ich es aus dem Fenster schmeißen.
Marisa hatte mir schon oft empfohlen, das Handy nach zehn Uhr abends in den Nachtmodus zu schalten, aber ich hatte ja nicht auf sie hören wollen. Ich würde jedenfalls dafür sorgen, dass sie niemals erfuhr, wie gut ihr Ratschlag gewesen war.
Normalerweise lag mein Handy immer auf dem Regal neben meinem Bett, aber diesmal war ich eingeschlafen, während ich für die Abschlussprüfungen gelernt und gleichzeitig den wachsenden Bluterguss an meinem Oberschenkel gekühlt hatte. Wenigstens standen bis zu den Sommerferien nur noch drei Frühjahrs-Football-Trainings an – und dann würde ich endlich eine Weile Ruhe vor Coach Saunders haben, der mich ständig auf dem Kieker hatte.
Warum hörte der Vibrationsalarm einfach nicht auf? Meine Arme und Beine lagen wie tonnenschwere Bleigewichte auf meiner Bettdecke. Krafttraining und Training auf dem Platz während der Saisonpause waren noch viel ätzender als jede Hell Week während der Spielzeit.
Nachdem ich meinem Ladekabel gefolgt war, fand ich schließlich mein Handy und stellte fest, dass ich fünf Benachrichtigungen über versäumte Anrufe hatte.
Mein Herz begann wie wild zu pochen. Die Anrufe stammten von einer unbekannten Nummer. Hatte vielleicht das Krankenhaus angerufen? War meinem Dad etwas passiert?
Bevor ich die Nummer antippen konnte, erwachte das Handy in meiner Hand erneut zum Leben. Ich nahm den Anruf noch vor dem ersten Klingeln an.
»Hallo?«
Jaulende Martinshörner und grollende Motorengeräusche übertönten die Stimme des Anrufers beinahe komplett. Ich presste die Hand auf mein freies Ohr, als ob das dabei helfen würde, die lauten Hintergrundgeräusche am anderen Ende der Leitung zu dämpfen.
Mein Herz fühlte sich an, als wäre jemand mit einem Stollenschuh daraufgetreten.
»LJ?«
»Marisa?« Ich sprang aus dem Bett und schlüpfte umständlich in meine Jeans. »Was ist passiert? Wo bist du?«
»Feuer … Meine Wohnung … Krankenwagen.«
Ich musste mich sehr anstrengen, um sie über das Rauschen eines Hochdruckreinigers auf Steroiden verstehen zu können – ach, nein, das musste das Brausen des Löschwassers sein.
»Ich bin schon auf dem Weg. Ich komme!«, brüllte ich ins Handy, obwohl ich mir nicht sicher war, ob sie mich überhaupt hören konnte. Ich knöpfte die Jeans zu, schnappte mir ein T-Shirt aus dem Wäschekorb und angelte mir meine Turnschuhe vom Boden.
Dann rannte ich aus dem Zimmer, kämpfte mich gleichzeitig in mein T-Shirt und klemmte mir die Schuhe kurzerhand unter den Arm.
»Mann, wo brennt’s denn?« Reece trat aus seinem Zimmer und rieb sich müde die Augen.
»Bei Marisa.«
»Ernsthaft?«
»Ich hab ihr ja gesagt, dass diese Wohnung eine Bruchbude ist. Ich hätte ihr eine bessere Bleibe suchen sollen.« Meine Turnschuhe landeten auf dem Boden. Rasch zog ich mir das T-Shirt richtig an.
»Die Schuhe passen nicht zusammen«, stellte er fest, als wäre das gerade unser gravierendstes Problem. »Geht es ihr gut?«
»Keine Ahnung. Ich fahre jetzt sofort hin.« Ich schlüpfte in einen Turnschuh und hielt mich dabei am Treppengeländer fest, damit ich nicht am Ende noch stürzte und mir mein verdammtes Genick brach. Die Angst um Marisa schnürte mir die Kehle zu und hinderte mich daran, klar zu denken.
Ich musste zu ihr. Ich musste sie sehen. Es musste ihr einfach gut gehen.
Ich setzte mich auf die unterste Stufe, steckte den Fuß in den zweiten Schuh, der nicht zum Ersten passte, und zog meine Schlüssel aus der Tasche.
Meine Haut war schweißnass. Draußen sprang ich direkt von der obersten Stufe der Verandatreppe auf den Gehweg und eilte zu meinem Auto, das einen halben Block entfernt stand. Wenn ihr irgendetwas zugestoßen war, würde ich durchdrehen.
Ich schaltete die Scheinwerfer ein und raste die leere Straße entlang.
An einer einsamen roten Ampel musste ich anhalten. Ungeduldig trommelte ich mit den Fingern aufs Lenkrad und versuchte, das verdammte Ding allein mit der Kraft meiner Gedanken dazu zu bewegen, endlich umzuschalten. Was zum Teufel sollte das überhaupt? Es war drei Uhr morgens.
Nach zwei stundenlangen Minuten hielt ich es nicht mehr länger aus, schaute mehrmals ganz genau in beide Richtungen und dachte: Scheiß drauf! Dann schoss ich mit quietschenden Reifen über die leere Kreuzung.
In einiger Entfernung stieg Rauch auf, und Flammen loderten hell vor dem dunklen Nachthimmel. Hinter einigen Bäumen konnte ich das oberste Stockwerk ihres fünfstöckigen Wohnhauses ausmachen. Angst explodierte in meiner Brust wie eine Granate, und Panik erfasste mich, die alles auslöschte, bis auf einen einzigen Gedanken: Ich muss zu Marisa.
Den Rest des Weges legte ich in Höchstgeschwindigkeit zurück. Schließlich erreichte ich das hintere Ende einer langen Reihe aus Löschfahrzeugen und Krankenwagen. Um ein Haar hätte ich vergessen, den Wagen auf »Parken« zu schalten. Überall auf dem Gehweg standen Menschen, die beobachteten, wie die Wohnanlage qualmte und brannte.
Atemlos wie nach einem extralangen Sprinttraining eilte ich auf einen Mann zu, der gerade in ein Funkgerät sprach.
»Marisa Saunders«, keuchte ich und schnappte nach Luft. »Marisa Saunders. Sie hat mich angerufen und gebeten, sie abzuholen.«
Der Typ musterte mich von oben bis unten, sagte wieder etwas in das Funkgerät auf seiner Schulter und verstand offenbar das Quäken, das er zur Antwort erhielt. »Krankenwagen Nummer 304. Die Zahl steht seitlich auf dem Fahrzeug und auf der Hecktür.«
»Geht es ihr gut?«
Löschwasser hing als feiner, feuchter Nebel in der Luft und vermischte sich mit dem Qualm. Die gelben und roten Lichter der Einsatzfahrzeuge blinkten unaufhörlich, und Glut und Asche regneten in der unmittelbaren Umgebung des Gebäudes auf den Boden herab. Waren alle Bewohner heil herausgekommen? Das Züngeln der Flammen wirkte geradezu hypnotisierend, und ihre Hitze erwärmte die Luft und vertrieb die noch frühlingshafte Kühle.
»Ich weiß es nicht. Momentan werden alle Bewohner auf Rauchvergiftung untersucht. Bis jetzt musste allerdings kaum jemand ins Krankenhaus.«
Sofort schnürte mir Panik die Brust zusammen, wodurch es noch schwerer wurde zu atmen, als es durch den Rauch, der mir in Augen und Lunge brannte, ohnehin schon war.
Geduckt schlüpfte ich unter dem gelben Absperrband hindurch und bahnte mir eilig einen Weg durchs hektische Gedränge, wich Rettungskräften aus und stieg über diverse Kabel und Ausrüstungsgegenstände hinweg, bis ich schließlich den Krankenwagen entdeckte.
Die Hecktüren standen offen, und auf der Trage im Inneren lag jemand. Unter einer Decke lugten nackte Füße hervor. Neben der Person saßen auf beiden Seiten Sanitäter, aber ich konnte nicht erkennen, was genau sie machten. Brauchte sie vielleicht Sauerstoff? Oder hatte sie Verbrennungen, die verbunden werden mussten?
War das überhaupt Marisa?
Die Sanitäter lehnten sich zurück, und sie setzte sich auf.
Ihre Haare waren völlig zerzaust, und ihr Gesicht rußverschmiert. Noch nie zuvor hatte sie so wunderschön ausgesehen. Mein Herz vollführte einen doppelten Salto, und ich musste mich zusammenreißen, um nicht sofort umzukippen.
Ihr Blick wanderte durchs Gewühl und blieb schließlich an mir hängen. Mit Tränen in den Augen begann sie zu lächeln, schlug die Decke beiseite und sprang aus dem Krankenwagen, ohne auf die Sanitäter zu achten, die ihr etwas nachriefen.
Ich breitete die Arme aus.
Sie prallte mit solcher Wucht gegen meine Brust, dass sie mich beinahe umwarf. Nachdem ich uns beide wieder ins Gleichgewicht gebracht hatte, schlang ich die Arme um sie.
»Geht es dir gut? Bist du okay?«
Sie drückte mich fest und legte das Kinn an meine Schulter. Dann erzitterte sie am ganzen Körper und umarmte mich sogar noch fester. »Einen Moment lang hatte ich da oben wirklich Riesenangst. Wir hätten unmöglich aus dem fünften Stock springen können.«
Ein eisiger Schauer schoss meinen Rücken hinab. Ich wollte gar nicht daran denken, in welcher Gefahr sie geschwebt haben könnte. »Du kommst mit zu mir, Risa. Geht es dir gut?«
Als sie nickte, stieß ihr Kinn gegen meine Schulter.
Ich rieb ihr den Rücken und schloss die Augen. Sie roch wie das Freudenfeuer beim alljährlichen Absolvententreffen, allerdings ohne den süßen Duft von S’Mores der den Brandgeruch etwas abmilderte. Sie war dem Feuer sehr nahe gewesen – so nah, dass sie voller Ruß war.
Ich hielt sie fest an mich gedrückt, bis sie mich schließlich losließ und einen Schritt zurücktrat. »Warum hast du eigentlich so lange gebraucht?«, fragte sie und boxte mich gegen die Schulter. Ich musste lachen. »Mir ist eiskalt.«
»Daran waren ungefähr sechs Löschfahrzeuge, ein paar Polizeiautos und eine Ampel schuld, die einfach nicht umschalten wollte.«
»Die auf der Hawthorne?« Zähneklappernd blickte sie zum Gebäude hinüber.
»Ja. Ich hasse diese verdammte Ampel.«
Der orangefarbene Feuerschein brachte eine Hälfte ihres Gesichts zum Leuchten. Auf der anderen Seite warf das Blaulicht des Krankenwagens, in dem schon wieder jemand anderes versorgt wurde, noch immer tiefe Schatten. »Durch die Ampel hast du ungefähr fünf Minuten länger gebraucht, richtig?«
»Theoretisch schon, wenn ich nicht einfach bei Rot über die Kreuzung gefahren wäre.«
»Ist nicht dein Ernst«, sagte sie und knuffte mich erneut gegen die Schulter.
»Doch, ist es.«
Wenigstens war sie trotz des Feuers noch immer die alte Nervensäge.
»Wieso denn? Hat es irgendwo gebrannt oder so?« Ihre Mundwinkel zuckten, und sie schaute noch einmal kurz zum Gebäude, wo die Flammen inzwischen noch höher loderten. »Ach so, ich schätze, in dem Fall werde ich es dir ausnahmsweise mal durchgehen lassen.« Sie lachte, doch das Lachen verwandelte sich in ein Husten, und ihr Blick wurde panisch.
Sofort stieg kalte Angst in mir hoch, und ich packte ihre Schultern.
»Ist sie in Ordnung?«, fragte ich an die Sanitäter gewandt, die bereits mit einem neuen Patienten beschäftigt waren.
Sie starrte mit zusammengekniffenen Augen zu mir hoch. »Das war bestimmt nur ein bisschen Asche. Mir geht’s gut. Entspann dich mal.«
Ich sollte mich entspannen, nachdem ich sie in einem Krankenwagen vorgefunden hatte? Keine Chance.
Durch den feinen Löschwassernebel fühlte sich jeder Teil des Körpers, der nicht dem lodernden Gebäude zugewandt war, sofort deutlich kälter an. Ich hatte nichts für sie dabei. Ich hätte besser mal mein Hirn einschalten und ihr einen Mantel oder einen Pullover mitbringen sollen. Oder eine Decke, Ersatzschuhe – irgendetwas.
Ich drehte den Kopf zum Krankenwagen und wiederholte meine Frage. »Ist sie in Ordnung?«
»Es geht ihr gut. Keine versengten Nasenhaare.«
»Juhuu«, murmelte Marisa leise.
»Aber sie braucht eine Dusche und muss aus diesen Kleidern raus.«
Sie begann wieder zu zittern und schlang die Arme um ihren Oberkörper. Ihre Lippen waren ganz blass, und sie starrte weiter gebannt in die Flammen.
Ich hatte an nichts anderes denken können als daran, mich zu versichern, dass es ihr gut ging. Nachdem ich das nun getan hatte, wurde die Liste der Dinge, die sie benötigte, allerdings zusehends länger.
Marisa zog ihr Handy aus der Schlafanzughose und tippte eine Nachricht. »Ich muss Liv finden.«
»Du hast ja dein Handy! Warum um alles in der Welt hast du mich dann vorhin von einer unbekannten Nummer aus angerufen?«
Sie sah mich etwas betreten an. »Ich hab völlig vergessen, dass ich es noch bei mir hatte.«
Ich legte die Hände auf ihre Schultern und schüttelte sie. »Du hast vergessen, dass du dein Handy bei dir hattest?«
»Kein Grund, sauer zu werden. Ich hätte im Feuer draufgehen können. Schon vergessen?« Sie deutete auf das Gebäude, das nach wie vor in Flammen stand.
»Glaubst du, dass jemand gestorben ist?«, flüsterte sie und sah mich an.
In diesem Augenblick verkündete das Aufleuchten ihres Displays einen eingehenden Anruf, und sie ging ran. »Liv, wo bist du? Geht es dir gut?«
Sie verstummte und presste das Handy fester ans Ohr. Liv war am anderen Ende der Leitung anscheinend kaum zu verstehen.
»Ich bin jetzt draußen. LJ ist hier, und wenn er mir weiter so dicht auf die Pelle rückt, bekommt er gleich einen Tritt in den Hintern. Er benimmt sich wie eine Glucke, als könnte ich jeden Augenblick tot umfallen.«
Ich benahm mich nicht wie eine Glucke.
Marisa legte eine Hand übers Handy. »Sie sagt, dass sie gerade untersucht wurde, und es klingt, als würde es ihr gut gehen.«
Wir gingen an der langen Schlange aus Rettungswagen entlang, die auf der Straße parkten und die provisorische Erstversorgung sicherten. Hin und wieder plärrte bei einem von ihnen plötzlich das Martinshorn los, und der Wagen machte sich auf den Weg ins nächstgelegene Krankenhaus.
»Du hättest nicht in dieser Wohnung sein sollen.«
»Fang nicht schon wieder damit an«, entgegnete sie genervt. Sie zitterte noch immer und klapperte mit den Zähnen. »Etwas anderes konnte ich mir nicht leisten, und man konnte dort angenehm wohnen. Na ja, zumindest bis …« Ihr Blick zuckte zum Feuer, das sich in ihren Augen spiegelte.
»Liv hat dir doch angeboten, mehr als die Hälfte der Miete zu übernehmen. Ihr beide hättet euch gemeinsam etwas Besseres suchen können.«
»Ich bin kein Schnorrer. Dass sie Geld hat, bedeutet noch lange nicht, dass ich das ausnutzen muss.«
»Ich hätte auch helfen können.«
»Wie gesagt: Ich bin kein Schnorrer. Außerdem würdest du, wenn du genug Geld übrig hättest, um meine Miete zu übernehmen, bestimmt keinen Aufschnitt aus der Mensa klauen.«
Diesmal hatte ihr Dickkopf sie tatsächlich fast das Leben gekostet.
Wir liefen auf der Suche nach Liv weiter an den aufgereihten Krankenwagen vorbei. Marisa deaktivierte die Stummschaltung ihres Handys und presste es wieder ans Ohr. »Ich kann hören, was sie hört.« Sie ging schneller, eilte voran.
Die Hecktüren eines Krankenwagens öffneten sich, und ein großer Kerl, der mir irgendwie bekannt vorkam, trat heraus. An seine ausgestreckte Hand klammerte sich Marisas Mitbewohnerin Liv. Dann machte es bei mir klick. Das war Ford. Livs Vielleicht-Freund hatte es ebenfalls geschafft herzukommen.
Marisa stürmte auf Liv zu und hätte sie, genau wie mich vorhin, beinahe umgeworfen. »Ich hab mir solche Sorgen gemacht, weil du einfach verschwunden bist.«
»Das Gleiche könnte ich auch von dir sagen.«
»Hör auf zu weinen – sonst muss ich auch weinen, und dann tickt er wieder aus. Er versucht mich krampfhaft dazu zu überreden, mit ihm zurück zum Puff zu kommen, aber ich werde dich hier nicht alleinlassen.«
Ich war überhaupt nicht ausgetickt. »Liv kann auch mitkommen.«
»Schon gut. Ich weiß doch, dass das Footballer-Haus auch so schon rappelvoll ist. Ich übernachte bei Ford.« Liv warf dem Mann über die Schulter hinweg einen Blick zu.
Er straffte sich. Das war nicht das erste Mal, dass Ford zu Livs Rettung eilte – aber wenigstens war sie diesmal nicht so sturzbetrunken wie bei der letzten Party im Puff. Jede Wette, dass er irgendwann in jener Nacht ihre Haare halten musste.
Marisa wechselte einen Blick mit Liv.
Ford schaute auf sie herab. »Sie bleibt bei mir. Wenn nötig, kannst du auch mitkommen.«
Jetzt wurde ich sauer. Glaubte er etwa, ich würde mich nicht um sie kümmern? Ich konnte vielleicht nicht mit einem Profisportlergehalt glänzen, mit dem sich alles in Ordnung bringen ließ – zumindest noch nicht –, aber ich konnte trotzdem dafür sorgen, dass es ihr gut ging. Marisa zu mir nach Hause zu holen war meine oberste Priorität, damit sie sich aufwärmen, duschen und sich ins Bett legen konnte. Um zu schlafen. Selbstverständlich nur, um zu schlafen.
»Ist schon gut, ich gehe mit LJ zu ihm nach Hause.« Marisa sah Liv fragend an und zog ein wenig den Kopf ein. »Bist du dir sicher?«
Liv fasste Fords Arm fester. »Ich bin mir sicher.«
»Dann sehen wir uns auf dem Campus? Wir müssen uns überlegen, wo wir auf Dauer wohnen werden und was wir wegen unserer Habseligkeiten unternehmen …« Marisa blickte zu der Todesfalle hinüber, die einmal ihr Wohnhaus gewesen war.
»Bringen wir erst mal den Rest der Nacht hinter uns und sehen morgen weiter. Ich muss duschen. Ich stinke nach Rauch«, meinte Liv und zupfte an ihrem T-Shirt.
Nachdem sich die beiden verabschiedet hatten, brachte ich Marisa zu meinem Auto. Am liebsten hätte ich sie getragen, damit sie nicht über den schmutzigen, nassen Boden laufen musste, aber ich hätte genauso gut versuchen können, eine verwilderte Katze auf den Arm zu nehmen.
Ihre Schritte waren langsam und schwerfällig. Man merkte ihr deutlich an, dass die Wirkung des Adrenalins inzwischen verpufft war.
Ich hätte sie gern an der Hand genommen, doch stattdessen legte ich den Arm um ihre Schulter und steuerte sie durch die umherlaufenden Menschen, die vor Ort waren, um das Feuer zu bekämpfen und sich um diejenigen zu kümmern, die ihre Bleibe verloren hatten. Sie brauchte ihre Hilfe jedoch nicht – sie hatte ja mich.
Ich öffnete die Autotür für sie, und dass sie mich klaglos gewähren ließ, war ein deutliches Zeichen dafür, wie todmüde sie in Wirklichkeit war. Normalerweise rannte sie immer so schnell ums Auto herum, dass ich gar keine Gelegenheit bekam, die Tür für sie aufzuhalten.
Ich ließ mich auf den Fahrersitz fallen und spürte ebenfalls, wie das Adrenalin abebbte. »Du kannst heute Nacht in meinem Bett schlafen. Ich lege mich auf die Couch.«
Sie gähnte, lehnte den Hinterkopf ans Seitenfenster und schaute zu mir herüber. »Ich kann auf der Couch des Todes übernachten. Wenn ich erst mal eingeschlafen bin, bekommt mich höchstens eine Blaskapelle, die ein Feuerwerk abschießt, wieder wach.«
»Du musst dich gründlich ausschlafen. Du schläfst in meinem Bett.« Als ich die Worte laut aussprach, spürte ich, wie mich Begierde durchzuckte. Der Adrenalinrausch, der mich getrieben hatte, als ich zu ihr geeilt war, um mich zu versichern, dass ihr nichts passiert war, war inzwischen verpufft und von einem anderen Gefühl abgelöst worden, das wie ein tiefes Summen meinen Körper erfasst hatte.
Sie verdrehte die Augen. »Du bist verdammt herrisch. Ich brauche erst mal eine Dusche, und dann diskutieren wir das aus. Du brauchst dein Bett. Du hast morgen Training.«
»Ist mir egal. Wir haben uns schon öfter ein Bett geteilt.«
Anstatt mir zu widersprechen, schloss sie die Augen.
Gut, damit war das geklärt. Ach du Scheiße, damit war das geklärt. Ich würde heute Nacht neben Marisa schlafen.
Schließlich kamen wir bei unserem Haus an. Es lag in der Nähe des Campus und stand in einer Reihe aus zahlreichen ähnlichen Häusern, die sich in teilweise gutem und teilweise recht vernachlässigtem Zustand befanden. Unseres hatte eine Zeit lang zu den populäreren Verbindungshäusern gehört, bis die Studentenverbindung, die darin gehaust hatte, wegen zu häufigen Regelverstößen rausgeflogen war.
Das Haus war dank der Beiträge, die die Mitglieder der Studentenverbindung eingezahlt hatten, gut in Schuss, doch der Name, der dem Haus damals verpasst worden war, war ihm leider ebenfalls erhalten geblieben: der Puff. Ein weiteres Erbe unserer Vorgänger waren die spontanen Partys, die immer dann im Haus ausbrachen, wenn wir am wenigsten damit rechneten.
In unserer Straße war es still. Selbst für die Unermüdlichen, die auch unter der Woche feierten, war es inzwischen zu spät geworden. Ich lenkte den Wagen wieder auf den Parkplatz, von dem ich vor weniger als einer Stunde losgefahren war.
Nachdem ich den Motor abgeschaltet hatte, lehnte ich mich im Sitz zurück und rollte den Kopf zur Seite, um sie anzusehen.
Ihre Lippen waren leicht geöffnet, und aus ihrer Kehle drang ein leises Schnarchen.
Im Licht der Straßenlaterne glommen ihre Haare wie ein Heiligenschein. Sie war hier, und sie war in Sicherheit. Bisher hatte ich nur ein einziges Mal in meinem ganzen Leben größere Angst gehabt – ein Gefühl, das ich nicht noch einmal erleben wollte.
Ich hätte sie verlieren können. Schnell verdrängte ich den Gedanken wieder und konzentrierte mich stattdessen auf das, was sie jetzt brauchte. Eine Dusche und eine anständige Portion Schlaf.
Ich legte die Finger oberhalb ihres Knies um ihr Bein und drückte vorsichtig zweimal.
Sie fuhr aus dem Schlaf hoch und riss den Kopf herum.
»Wir sind da.« Sie musste wirklich erschöpft sein, denn ich schaffte es, die Beifahrertür zu erreichen, bevor sie sie selbst öffnen konnte.
»Das wollte ich auch gerade machen«, grummelte sie und stieg aus. »Meine Zehen sind eiskalt.« Sie wackelte mit ihnen auf dem harten, dunklen Betonboden. Wenn ich ihr jetzt anbieten würde, sie hineinzutragen, würde sie mir wahrscheinlich einen Tritt verpassen. Also verkniff ich mir das Angebot lieber, hielt aber trotzdem vorsichtshalber auf der Verandatreppe nach Glasscherben oder abstehenden Holzsplittern Ausschau.
Im Haus brachte ich sie sofort in mein Zimmer, versorgte sie mit einem T-Shirt und Boxershorts und schickte sie unter die Dusche.
Ihr Schweigen verriet mir überdeutlich, wie dringend sie ins Bett musste – zur Abwechslung sparte sie sich jegliche Witzeleien oder bissige Kommentare.
In meinem Zimmer stank es nach Rauch. Der Geruch fiel mir jetzt, da wir uns nicht mehr in der Nähe des Brandes befanden, viel deutlicher auf. Als ich an meinem T-Shirt schnupperte, zuckte ich vor dem Brandgeruch zurück. Wenn sie aus dem Bad zurückkam, sollte es hier auf keinen Fall verkohlt riechen.
Rasch zog ich die Schuhe und meine rauchgeschwängerten Klamotten aus, schnappte mir mein Handtuch, das an der Tür hing, und wickelte es mir um die Taille. Meine stinkenden Sachen deponierte ich draußen vor der Zimmertür und holte mir neue.
Das Wasser im Badezimmer wurde abgedreht, und schon öffnete sich die Tür. Heiße, feuchte Luft waberte in den Flur.
Marisa rubbelte sich die Haare trocken, während sie in mein Zimmer zurückkam, doch als sie mich entdeckte, erstarrte sie mitten in der Bewegung.
Verflixt, vielleicht hätte ich mich lieber erst im Badezimmer ausziehen sollen. Andererseits hatte sie mich ja auch schon mal nur in Badehosen gesehen. Wenigstens hatte ich mir das Handtuch umgewickelt, und sie hatte mich nicht splitternackt überrascht, so wie letzten Sommer nach unserer Wasserbombenschlacht.
»Meine Sachen haben auch nach Qualm gerochen. Ich gehe schnell duschen.«
Sie in meinen Kleidern zu sehen hatte eine merkwürdige Wirkung auf mich – deren Folgen sich kaum durch ein Handtuch verstecken ließen. Eilig verbarg ich meine deutliche Erektion mit der Jogginghose und dem T-Shirt, die ich in der Hand hielt. Das Blut rauschte durch meine Adern, und ich hatte keine Ahnung, wie ich es schaffen sollte, die ganze Nacht lang neben ihr zu liegen. Vielleicht sollte ich doch die Couch nehmen. Ich eilte durch die Tür ins Badezimmer, drehte mich jedoch noch einmal um und steckte den Kopf zurück ins Zimmer.
»Geh ins Bett. Ich bin gleich wieder da.« Dann schaltete ich das Licht aus. Abgesehen vom fahlen Lichtschein, der vom Flur hereinfiel, war es im Zimmer nun dunkel.
Ich duschte so schnell und effizient wie möglich, und ich verkniff es mir, mich selbst von dem Druck zu befreien, der sich in meinem besten Stück aufgebaut hatte, als ich sie in meinen Klamotten gesehen hatte. Stattdessen drehte ich das eiskalte Wasser auf und wartete, bis ich die Kältefolter beenden konnte.
Nachdem ich aus der Dusche gestiegen war, sammelte ich ihre Kleider vom Boden auf, um sie ebenfalls draußen vor meiner Zimmertür auf den Boden zu legen. Morgen würde ich sie waschen und ausprobieren, ob man den Gestank mit ein paar Litern Waschmittel aus ihnen herausbekommen konnte.
Falls das nicht klappte, hatte ich allerdings nichts dagegen, dass sie weiterhin meine Kleider trug, bis wir ihr neue besorgen konnten oder sie Gelegenheit hatte, in ihrer Wohnung nachzusehen, was von ihren Sachen noch zu retten war.
In meinem Zimmer war es vollkommen still. Einen Augenblick lang dachte ich, dass sie vielleicht nach unten gegangen wäre, um sich etwas zu essen zu holen, doch dann drangen ihre leisen Atemzüge von meinem Bett zu mir herüber.
Ich hängte mein Handtuch auf und durchquerte den Raum.
Marisa lag ausgestreckt wie ein Seestern auf dem Bett und vereinnahmte es fast komplett für sich.
Schmunzelnd nahm ich ihren Arm, legte die Hand an ihre Taille und rollte sie ein Stück zur Wand. Sie gab ein leises Grummeln von sich, ließ sich aber von mir zur Seite schieben, griff nach ihrem Kissen und drückte es an ihre Brust.
Hätte ich nicht so eine masochistische Ader gehabt, hätte ich mir jetzt ein Kissen und eine Decke genommen und mich nach unten auf die viel zu kleine Couch verzogen, oder ich hätte sie noch ein Stückchen weiter zur Wand geschoben und mich mit dem Rücken an ihren gelegt. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten.
Ich glitt zu ihr ins Bett, schlang meinen Arm um sie und zog sie an mich. Nur für heute Nacht. Nur weil ich sie um ein Haar für immer verloren hatte. Nur weil ich einfach nicht anders konnte.
Ihre Haare rochen nach mir. Das gefiel mir zwar, aber trotzdem würde ich ihr bei nächster Gelegenheit etwas von ihrem Shampoo und ihrer Seife besorgen müssen.
»Gute Nacht, Marisa.« Ich schloss die Augen, atmete tief ein und passte den Rhythmus meiner Atemzüge an ihre an.
Heute Nacht würde ich sie in meinen Armen halten.
Morgen würde ich mir überlegen, wie ich damit klarkommen sollte, dass ich in die Tochter des Coachs verliebt war.
2. KAPITEL
Marisa
Ich drehte mich auf die Seite und strich mit der Hand über die Decke. Die Laken fühlten sich weich und behaglich an, wie Flanell. Das hier war nicht mein Bett.
Abrupt setzte ich mich auf und sah mich im Raum um – und da fiel mir alles wieder ein. Wie ich lange aufgeblieben war, um zu lernen. Wie mich Liv aufgeweckt hatte. Der beißende Qualm. Die Panik und die Angst. Wie wir blind die Treppe hinuntergekrochen waren und, nachdem wir es endlich nach draußen geschafft hatten, gierig die verrauchte Luft in unsere Lunge gesogen hatten. Und LJ.
Ihn zu sehen hatte mich auf eine Art und Weise beruhigt, wie ich es nicht erwartet hätte. Er war der einzige Mensch, den ich nach dem Brand hatte anrufen wollen. Meine Mom oder Ron zu verständigen war nicht infrage gekommen, und LJs Handynummer war eine der wenigen, die ich auswendig kannte.
Als ich ihn neben dem Krankenwagen stehen gesehen hatte, wäre ich beinahe in Tränen ausgebrochen. Ich hatte es nur geschafft, mich zusammenzureißen, weil ich genau wusste, wie sehr es ihn aufgewühlt hätte, mich weinen zu sehen. Nachdem er mich in die Arme genommen hatte, war die Angst verflogen, und als ich schließlich in seinem Bett lag, hatte ich schnell einschlafen können. An die Dusche konnte ich mich kaum noch erinnern, nur noch an sein Duschgel, dessen Duft nach Fichtennadeln und Orangenschalen, den ich selbst durch den Rauchgestank, der mir noch in der Nase hing, wahrnehmen konnte.
Die Jalousien waren an beiden Fenstern im Zimmer geschlossen. Da nur ein kleines bisschen Licht durch die Schlitze fiel, konnte ich nicht beurteilen, wie spät es sein mochte. Aber da es draußen offensichtlich hell war, musste es irgendwann zwischen sieben Uhr morgens und vier Uhr nachmittags sein. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich einen kompletten Tag verschlafen hätte.
Ich hatte keine Ahnung, wo mein Handy war. Ich musste bei der Arbeit anrufen und Bescheid sagen, dass ich nicht kommen würde. Die Schülerführungen im Philadelphia Museum of Art würden eine Weile ohne mich stattfinden müssen. Aber sicherlich würde niemand meine Museumskuratorinnen-Witzchen vermissen.
Ich schälte mich aus dem Bett und ging zum Fenster, um die Jalousien hochzuziehen, dann schaute ich mich um. LJs Handy lag auf dem Nachttisch neben seinem Bett, das in einer Zimmerecke stand. Sein Handtuch hing an der Innenseite der Tür, die ein Stück offen stand. Sein Schreibtisch war aufgeräumt, und aus den ordentlich aufgestapelten Lehrbüchern lugten farbige Klebezettel. Daneben lagen griffbereit und fein säuberlich aufgereiht Stifte und Textmarker. Die Tür seines Kleiderschranks war vollständig geschlossen, und abgesehen von seinen Schuhen lag nichts auf dem Boden herum. Sein Zimmer war schon immer viel ordentlicher gewesen als meins.
Schon als wir noch auf die Middle School gegangen waren und ich öfter mit meinem Schlafsack bei ihm übernachtet hatte, war ich mir dank seiner Ordnungsliebe nicht wie auf einer Pilzexpedition vorgekommen, sondern hatte miterleben können, wie es in einem normalen Haushalt zuging.
Heutzutage entschuldigte ich mein unaufgeräumtes Zimmer mit der Tatsache, dass ich den ganzen Tag lang mit Katalogisieren und Ordnen beschäftigt war und deshalb nach Feierabend Schluss damit war. Obwohl – im Grunde brauchte ich jetzt keine Entschuldigung mehr. Schließlich hatte ich auch kein Zimmer mehr – zumindest keines, in dem ich in absehbarer Zeit wieder wohnen würde. Bevor ich wieder zurück nach Hause zog und zur Uni und meinem Praktikum pendelte, schlief ich lieber im Zug.
Wahrscheinlich hatte meine Mom mein Zimmer nach meiner letzten Stippvisite im vergangenen Sommer sowieso in eine illegale Kneipe verwandelt. Nach diesem Besuch hatte ich mir geschworen, dass ich nie wieder zu Hause wohnen würde – obwohl es nach dem Auszug meines Dads ohnehin kein richtiges Zuhause mehr gewesen war.
Erinnerungen an die vergangene Nacht stahlen sich in meine Gedanken. Fühlte sich so ein Schock an? Gestern Abend war ich so verwirrt gewesen und hatte an nichts anderes denken können, als LJ zu sehen und Liv zu finden. Doch nun brach mehr und mehr die Realität über mich herein, verwandelte sich in eine wahre Sturzflut.
Auf der Straße vor meinem ehemaligen Wohnhaus hatte sich ein Löschfahrzeug ans nächste gereiht. Ich hätte sterben können. Ein Zittern breitete sich durch meinen ganzen Körper aus. Ich taumelte zurück zum Bett, kroch über die Matratze, zog die Knie an die Brust und lehnte mich mit dem Rücken an das Kopfteil des Bettes. Meine Kehle war so zugeschnürt, dass ich nur mit Mühe ausatmen konnte.
In diesem Moment ging die Zimmertür ganz auf, und LJ kam herein. In jeder Hand balancierte er einen Becher, auf dem eine Schüssel stand. »Du bist wach.« Er lächelte, und der Kloß in meinem Hals löste sich.
»Das bin ich.«
»Ich habe dir Frühstück gemacht.«
Mein Herz schlug höher, und ich rutschte an die Bettkante. »Das wäre nicht nötig gewesen.«
»Es sind doch nur Frühstücksflocken. Ich habe deine Milch vorher in der Mikrowelle aufgewärmt«, sagte er schaudernd und verzog angewidert den Mund.
»Das schmeckt total lecker.« Ich nahm ihm die Schüssel ab, die oben auf seinem Jenga-Geschirrtürmchen stand und stellte sie mir in den Schoß. Anschließend nahm ich ihm die Tasse ab und trank einen Schluck Milch, um meinen Magen ein wenig zu beruhigen.
Er hielt mir würgend einen Löffel hin, ohne mich dabei anzusehen.
»Möchte ich wissen, wo du den die ganze Zeit verstaut hattest?«, fragte ich und betrachtete das Ding misstrauisch, bevor ich es ihm abnahm. Schließlich hatte er beide Hände voll gehabt.
»Du vertraust mir also nicht?«, fragte er zuckersüß, bevor er sich seinen Schreibtischstuhl schnappte, ihn näher zum Bett rollte und seine Füße neben meinen übereinandergeschlagenen Beinen auf die Bettkante legte. Dann nahm er sich seine eigene Schüssel, setzte eine schmollende Miene auf und bedachte mich mit einem waschechten Hundeblick. Als er den Löffel zum Mund führte, ließ er auch noch seine Hand theatralisch zittern.
Ich brach in Gelächter aus. »Bist du sicher, dass du Football spielen willst? Vielleicht solltest du es lieber mal mit einem Schauspielkurs versuchen.« Meine perfekt durchgeweichten Apple Jacks schmolzen geradezu in meinem Mund, und wenn ich die kleinen grünen und orangefarbenen Kringel aufgegessen hatte, würde mir als Bonus noch die Milch bleiben, die dann ihren herrlichen Geschmack angenommen haben würde.
»Oh, du Kleingläubige. Diese Jogginghose hat Taschen.«
»Ach, das waren Löffel in deiner Tasche. Und ich hab schon gedacht, du freust dich, mich zu sehen.«
Er schnaubte auf die gleiche süße Art, wie er es schon seit der sechsten Klasse tat. »Wohl kaum. Du schnarchst, als wärst du ein Raddampfer auf großer Fahrt.«
»Wenn ich wirklich schnarchen würde – was ich nicht tue –, würde das eher wie das Liebesgeflüster zwischen Tinkerbell und einem Engel klingen.«
Es gab so viel zu tun, so viel in der realen Welt, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, und zu nichts davon hatte ich Lust.
»Wir sollten zu Kart-astrophe gehen.« Ich stellte meine Schüssel beiseite.
»Warum?«
»Warum nicht? Es ist Wochenende, und ich muss nirgendwo hin. Ich habe keine Wäsche, die ich waschen müsste – abgesehen von deiner, weil ich weiß, dass sich da einiges angesammelt hat. Und keine Bücher und Notizen, mit denen ich für die Uni lernen könnte.« Ich zuckte mit den Schultern. Gokartfahren war die perfekte Ablenkung von dem Gedanken daran, in welch tödlicher Gefahr ich geschwebt hatte.
»Wie wäre es, wenn wir uns vorher um ein paar andere Dinge kümmern würden, wie beispielsweise dem Dekan und deinen Professoren per E-Mail Bescheid zu geben, was passiert ist? Mein alter Laptop liegt noch im Schrank. Ich kann ihn hochfahren und meine alten Daten löschen, damit du ihn benutzen kannst.«
»Ich kann auch einen PC im Computerraum benutzen.«
»Dieser Punkt steht nicht zur Debatte. Wenn du in einigen Wochen, wenn die Prüfungen anstehen, nicht permanent im Computerraum sitzen willst, brauchst du einen Laptop. Hast du eigentlich deine Mom schon angerufen?«
»Warum sollte ich?«
»Damit sie sich keine Sorgen macht.«
»Sie weiß nichts von dem Brand, und sie wird auch nichts davon erfahren.«
»Was ist mit deinem Dad?«
Ich wich seinem Blick aus und betrachtete stattdessen die Bäume draußen vorm Fenster. »Was soll mit ihm sein?«
»Er arbeitet hier. Glaubst du nicht, dass er mitbekommen wird, dass eines der größten Studentenwohnheime außerhalb des Campus abgebrannt ist?«
»Warten wir doch mal ab, wie lange er braucht«, sagte ich und stellte den Timer an meiner imaginären Uhr.
»Marisa …«
Mir entging sein warnender Tonfall nicht, und ich kniff ungehalten die Augen zusammen. »Na schön, ich rufe ihn an.«
Er warf mir mein Handy zu.
Ich nahm es in eine Hand, starrte das Batteriesymbol an, das signalisierte, dass der Akku vollständig geladen war, und spürte, wie Wut in mir hochkochte. Ron verdiente es nicht, dass ich ihn anrief und ihn beruhigte, dass es mir gut ging. Wie viele Jahre Funkstille seinerseits hatte ich aushalten müssen, nachdem er meine Mom verlassen hatte – mich verlassen hatte? Wie viele verpasste Geburtstage? Weihnachten? Und alle anderen Feiertage, die dazwischenlagen?
»Später.« Ich ließ das Handy neben mich fallen.
LJ blickte zur Decke und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Muskeln unter seinem T-Shirt wölbten sich, und der Sitz seiner grauen Jogginghose war sowieso unfair. Alle Mädchen auf dem Campus durften ihn verzückt angaffen, nur ich nicht. Ich war die beste Freundin, seine Komplizin, aber niemals mehr als das.
Nach der langen Zeit sollte ich mich eigentlich daran gewöhnt haben. Die Abfuhr, die ich in unserem Senior Year kassiert hatte, hatte mich zwar getroffen, aber inzwischen hatte ich gelernt, mit den Grenzen unserer Beziehung zu leben und mich daran zu halten. Das verhinderte allerdings nicht, dass ich mir trotzdem ab und zu wünschte, mich von ihnen zu befreien.
In weniger als einem Jahr würde der Draft stattfinden, und danach wäre er nicht mehr mein bester Freund und ein Mitglied des Fulton-U-Football-Teams, dessen Spieler wie Campus-Götter behandelt wurden. Aus ihm würde ein Profisportler werden, mit allen Vorteilen, die so was mit sich brachte.
Ron war noch nicht mal ein Spieler oder gar ein Profi gewesen – er war beim College-Football geblieben und hatte mich und meine Mom für den Ruhm auf dem Spielfeld sitzen gelassen. Ich war sein eigen Fleisch und Blut. Wie hoch war da die Wahrscheinlichkeit, dass LJ mich, sobald er seine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt und den ersten fetten Scheck kassiert hatte, nicht auch einfach im Stich lassen würde?
LJ gab sich nur deshalb solche Mühe, die Freundschaft zu mir aufrechtzuerhalten, weil ich seinem Vater das Leben gerettet hatte. Aber dieser Umstand würde früher oder später seine Wirkung verlieren. Das Gefühl der Verpflichtung und Dankbarkeit mir gegenüber würde verblassen, und er würde fortgehen.
»Worüber grübelst du so angestrengt nach?« LJ setzte sich neben mir aufs Bett, verschränkte ebenfalls die Arme und imitierte meine Miene.
Obwohl ich versuchte, mir das Grinsen zu verkneifen, zuckte mein Mundwinkel nach oben. Auch wenn mich Bedenken plagten, bedeutete das noch lange nicht, dass ich die Zeit mit meinem besten Freund nicht genießen konnte, solang ich ihn noch hatte. Seufzend ließ ich den Kopf auf seine Schulter sinken und betrachtete unsere Beine, die auf dem Bett nebeneinanderlagen. Meine steckten in seiner Boxershorts, und an den Füßen trug ich dicke Weihnachtssocken, die seine Mutter vor zwei Jahren für die ganze Familie gekauft hatte. Er hatte eine graue Jogginghose an, und seine Füße, die in normalen Socken steckten, lagen direkt neben meinen. Ich könnte ihn ja ein bisschen ärgern und mit ihm füßeln und schauen, wie er darauf reagieren würde. »Ich denke über all den Kram nach, mit dem ich mich heute herumschlagen muss.« Ich rieb mir das Gesicht. »Zum Glück hast du mich dazu überredet, eine Mieterversicherung abzuschließen.«
Er richtete sich mit stolzgeschwellter Brust auf. Ich verdrehte genervt die Augen und knuffte ihn in die Rippen. »Blas dich nicht so auf.«
Er rieb sich die Seite. »Ich habe kein Wort gesagt.«
Ich sah ihn finster an. »Körpersprache. Das war unübersehbares Prahlen. Ein Himmelsschreiber wäre weit weniger offensichtlich gewesen.«
»Können wir diese LJ-ist-eine-Nervensäge-Nummer mal für einen Augenblick sein lassen? Lass uns lieber notieren, was du alles erledigen musst. Dann teilen wir die Liste untereinander auf und arbeiten sie ab.«
»Wie wäre es, wenn ich stattdessen wieder ins Bett gehen und so tun würde, als wäre ich gestern Nacht nicht beinahe bei einem Brand ums Leben gekommen?« Ich griff nach der Bettdecke, um sie mir wieder über den Kopf zu ziehen. Die Liste war überwältigend lang, dabei hatte ich noch nicht mal alles, was ich im Feuer verloren hatte, im Kopf katalogisiert. Es gab so viele Kleinigkeiten, deren Verlust mir erst auffallen würde, wenn ich in einigen Monaten oder einem Jahr danach suchte. Die wenigen Sachen, die ich mir für meine Reise nach Venedig in sechs Wochen besorgt hatte. Verdammt, mein Pass! Nichts da, ich würde heute auf keinen Fall aufstehen.
Er zerrte die Decke zurück. »Vergiss es. Legen wir los.« Er umfasste meine Taille, hob mich mühelos hoch und setzte mich auf den Schreibtischstuhl, genau wie er es damals in der Middle School auch immer gemacht hatte, bevor unsere Rangeleien irgendwann zu verfänglich geworden waren.
Anschließend drehte er den Stuhl um und schob mich damit an den Schreibtisch. Nun saß ich direkt vor einem Notizblock und einem Blatt Papier.
Er hielt mir einen Stift hin. »Schreib.«
Den Rest des Morgens verbrachten wir damit, E-Mails an meine Dekane und Professoren zu schicken, eine Liste mit allen Habseligkeiten aus meinem Zimmer zu erstellen, an die ich mich noch erinnern konnte, die nötigen Formulare für die Mieter-Versicherung auszufüllen, LJs Laptop für mich einzurichten und seine Klamotten durchzuschauen und wenigstens ein paar Sachen herauszusuchen, die ich anziehen konnte. Mein Termin für den Eilantrag auf einen neuen Pass war in zwei Tagen. Vorher würde ich zurück nach Moorestown fahren müssen, um mir eine Kopie meiner Geburtsurkunde zu besorgen. Lieber hätte ich mich selbst mit einem dieser dicken, samtigen Seile, die im Museum als Absperrung dienten, erwürgt.
Am frühen Nachmittag war mein Gehirn kaum mehr als ein Stück Schweizer Käse.
»Und deine Geldbörse. Wir müssen all deine Karten ersetzen lassen. Bei der Campus-Karte ist das ganz einfach, aber bei deinem Führerschein und der Kreditkarte wird es länger dauern.« Er hatte mich mit dem Versprechen geködert, dass ich Limonade bekommen würde – die einzige Sache, die mich dazu hatte bewegen können, sein Zimmer zu verlassen.
Ich ließ den Kopf auf den Küchentisch sinken und schlug ihn einige Male auf die hölzerne Tischplatte. »Genug. Genug für heute. Ich kann nicht mehr.« Ich drehte den Kopf zur Seite und spähte zu ihm hinüber.
Seine Miene wurde weicher. Er legte die Papiere, die er gerade durchgeblättert hatte, zurück in den Ordner, den er herausgesucht hatte, damit alle Unterlagen einen gemeinsamen Aufbewahrungsort hatten. »Wie wäre es, wenn wir uns ein Eis holen?«
Ich hob den Kopf. »Eis?«
»Ich spendiere dir eins.«
»Das musst du auch, denn die vierzehn Dollar, die ich noch hatte, sind zu Asche verbrannt.«
Wir gingen zu Fuß zu T-Sweets, einer der beliebtesten Eisdielen in Campusnähe, wo es grandiose Eisbecher und leckere traditionell hergestellte Eiscreme gab – und Softeis für Leute, die unter Geschmacksverirrung litten. Auf dem Weg dorthin kassierte ich eine Menge neugieriger Blicke.
Normalerweise lief am Nachmittag keine Frau in solchen Klamotten wie ich herum. Mein Aufzug sah eher nach einem frühmorgendlichen Walk of Shame aus, bei dem der Mann so nett gewesen war, der Frau etwas zum Anziehen zu leihen.
Obwohl ich nie den Eindruck gehabt hatte, dass LJ so viel größer war als ich, hatte ich seine schwarze Jogginghose an den Knöcheln hochkrempeln müssen. Wir waren eigentlich fast gleich groß, aber irgendwie waren Männer-Jogginghosen nicht für Frauen gemacht, und man kam ums Umkrempeln nicht herum.
Sein Batman-Shirt war leider nicht so weit geschnitten, wie es mir lieb gewesen wäre. Dank meiner E-Körbchengröße schaffte ich es problemlos, das XL-Herren-T-Shirt auszufüllen. Allerdings bekam niemand etwas davon zu sehen, weil ich derzeit leider auch keinen BH mehr besaß. Aus diesem Grund hatte ich den Reißverschluss seiner Kapuzenjacke ganz-zugezogen und hielt die Arme verschränkt, um meine beiden Schätzchen etwas abzustützen – und sah dabei aus, als würde ich unter meinem Pulli zwei Hundewelpen schmuggeln.
Wenigstens war es draußen noch nicht richtig Frühling und entsprechend kühl, weshalb meine Kleidung zumindest grundsätzlich einigermaßen angemessen war. Das eigentliche Problem waren die übergroßen Männersachen und die Flip-Flops, die mir andauernd von den Füßen flogen und zwei Schritte vor mir landeten.
»Warum hast du nur so große Füße?«, meckerte ich, als ich wieder mal einem der abtrünnigen Plastikdinger hinterherjagte.
»Wer im Glashaus sitzt … Deine Treter sind auch nicht gerade zierlich.«
Als wir bei T-Sweets ankamen, zog sich die Warteschlange wie üblich bis vor die Ladentür. Die fünf Tische drinnen waren schon besetzt. Als die Wartenden LJ bemerkten, bekamen viele leuchtende Augen.
Er blickte verlegen zu Boden, und ich musste lächeln.
Immer wenn er so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, bekam er ganz rote Ohren. Während wir uns der Eisdiele näherten, prasselten bei jedem Schritt mehr Fragen auf uns ein.
»LJ, wo, glaubst du, wirst du nächstes Jahr spielen?«
»Bereit für eine weitere Meisterschaft?«
Er setzte sein Pressekonferenzlächeln auf, hinter dem er verbarg, dass er innerlich schrie und am liebsten die Flucht ergriffen hätte, und beantwortete jede Frage, als hätte er sich die Antworten auf die Innenseite seiner Augenlider tätowiert.
»Macht ihr euch Sorgen wegen dieser Saison, weil so viele Seniors abgehen?«
Ich schob die Hand in seine Gesäßtasche und zog seine Geldbörse heraus. »Ich bestelle schon mal für uns.«
»Woher weißt du denn, was ich haben möchte?«
Ich wedelte nur mit der Brieftasche, stellte mich in die Schlange und überließ ihn seinen begeisterten Fans. Er nahm immer Schoko-Vanille-Eis mit Regenbogen- und Schokoladenstreuseln. Immer.
Jedes Mal stand er in der Warteschlange und starrte angestrengt die Karte an, doch wenn er dann vorn an der Theke ankam, bestellte er jedes Mal das Gleiche.
Die Schlange rückte rasch voran. Während ich wartete, spähte ich zum Schaufenster hinaus. LJ hielt in einer Jeans, die tief auf seinen Hüften saß, und einem T-Shirt, das jeden einzelnen seiner kräftigen Muskeln betonte, zwischen den Picknicktischen, die draußen vor dem Landen standen, Hof.
Er hasste es, so im Mittelpunkt zu stehen. In solchen Situationen würde er sich am liebsten in eine Schildkröte verwandeln und in seinen Panzer verkriechen.
Ich fand es toll. Ich liebte es zu beobachten, wie ihm genau die Aufmerksamkeit zuteilwurde, die er sich durch seinen Einsatz auf dem Spielfeld verdient hatte. Und mir gefiel, dass er zwar nervös wurde, wenn er vor seinen Fans stand, sich aber anschließend, als wir mit unserem Eis nach Hause liefen, noch genau an jede Frage erinnern konnte, die sie ihm gestellt hatten, und daran, wie großartig es sich angefühlt hatte, das eine oder andere Autogramm zu geben.
Ihm kam es so vor, als würde er nicht ins Rampenlicht gehören, doch damit lag er falsch. Er war der beste Mensch, den ich kannte. Zu schade, dass er nicht mal annährend so viel von sich selbst hielt, wie ich es tat.
3. KAPITEL
Marisa
Senior Year – Highschool
»Ich dachte, du würdest heute Abend nach Hause kommen?« Ich schlurfte die Treppe hinunter. Dabei drückte ich mir das Handy mit der Schulter ans Ohr und hielt mit den Händen das Treppengeländer fest umklammert. Unter meinen Füßen, die in Socken steckten, knarrte das Holz.
»Diese Gelegenheit konnte ich mir aber nicht entgehen lassen.«
»Seit wann ist ein Trip nach Atlantic City eine einmalige Gelegenheit?« Ich verzog das Gesicht. Meine Hüfte tat weh. Die Blutergüsse schmerzten heftig. Auch wenn ich diesen Preis gern zahlte, brauchte ich dringend Schmerztabletten.
»Weil ich nichts bezahlen muss und Frank außerdem ein High Roller ist und wir deswegen in der Präsidentensuite wohnen.«
»Und was soll ich heute Abend machen?«
»Warum gehst du nicht zu LJ? Du rennst doch sowieso andauernd zu ihm. Oder ruf deinen Vater an. Hach, sorry, ganz vergessen: Er ist ja weiß Gott wohin abgehauen, ohne ein einziges Mal zurückzublicken.«
Ich biss die Zähne zusammen und lenkte das Thema wieder auf den einzigen miesen Elternteil, der derzeit noch ein Wort mit mir wechselte – sie – und weg von den einzigen Menschen, auf die ich mich noch verlassen konnte.
»So oft bin ich doch gar nicht dort.« Ich achtete darauf, dass ich ihn, wenn wir Schule hatten, nie öfter als ein paar Mal die Woche besuchte und nur alle zwei Wochen einmal bei ihm übernachtete. Im Sommer erhöhte ich allerdings auf zwei Übernachtungen wöchentlich und vier Tage die Woche, die ich bei ihm verbrachte.
Keinesfalls wollte ich die Gastfreundschaft von LJs Familie überstrapazieren, zumal ich das Gefühl hatte, dass ich die meiner eigenen Mutter bereits deutlich überstrapaziert hatte.
»Es ist nicht meine Schuld, dass dein Vater beschlossen hat, lieber mit seinen total besonderen Sportgroupies durchzubrennen und uns zurückzulassen, sodass wir sehen müssen, wie wir allein klarkommen. Diese ganzen Versprechungen, dass er zum Geburtstag Geld oder an Weihnachten Geschenke schicken wird – und was macht er? Lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern.«
Noch so eine Bemerkung, die mir nicht gerade dabei half, meinen Bärenhunger zu vergessen.
»Der Arzt hat gesagt, dass ich mich einige Tage schonen soll.« Außerdem war LJs ganze Familie, nachdem ich vorgestern Knochenmark gespendet hatte, im Krankenhaus geblieben. Seit die Chemo begonnen hatte, hatten sie sich in Schichten damit abgewechselt, in Charlies Zimmer zu wachen.
»Vor zwei Tagen hast du mir noch einen fitten Eindruck gemacht. Und sollte sich nicht eigentlich seine Familie um dich kümmern? Nach allem, was du getan hast, stehen sie in deiner Schuld. Wir bekommen ja weiß Gott keinen Unterhalt von deinem Vater. Sie könnten uns ruhig etwas unter die Arme greifen.«
Ich presste die Finger auf den Nasenrücken, stakste zurück in mein Zimmer und versuchte, darin auf und ab zu gehen, gab es aber schnell wieder auf. Egal, was sie sagte, bei ihr ging es immer nur darum, wie schlecht die anderen waren – obwohl sie und mein Dad selbst mehr als genug Mist gebaut hatten. Aber ich brauchte jemanden, der für mich da war. Hier und jetzt. Vorsichtig zog ich die Shorts ein Stück von meiner Hüfte herunter. Die Blutergüsse sahen aus, als hätte ich Wettschulden bei diversen Buchmachern, aber immerhin verfärbten sie sich langsam gelb. Weh taten sie aber trotzdem noch. »Ich habe mich dazu bereit erklärt, weil es das einzig Richtige war. Wir kennen seine Familie schon, seitdem ich in der dritten Klasse war. Sie schulden mir rein gar nichts.« Eher schuldete ich ihnen etwas.
»Du hättest eine Gegenleistung verlangen sollen. Um Geld bitten sollen oder dergleichen. Niemand gibt irgendwas umsonst. Das solltest du dir besser mal merken.«
»Was gibst du denn als Gegenleistung für deinen Trip nach Atlantic City?«, entgegnete ich und biss mir auf die Innenseite der Wange.
»Na, jetzt klingst du ja trotz des kleinen Humpel-Theaters im Krankenhaus wieder ganz normal und fit.«
Ja, genau. Dass ich beim Verlassen des Krankenhauses kaum hatte laufen können, nachdem ich eine Vollnarkose bekommen und anschließend jemand in meinen Hüftknochen herumgebohrt hatte, um Knochenmark zu entnehmen, war selbstverständlich nur Theater gewesen.
Es wurde höchste Zeit, dass dieses Telefonat endete. Aber mein Magen war anderer Meinung und wollte sie nicht so schnell davonkommen lassen. »Anscheinend bin ich viel tougher, als gut für mich ist. Hast du mir Geld dagelassen?« Wenn sie beabsichtigte, auf unbestimmte Zeit zu verschwinden, musste ich einkaufen gehen.
Sie seufzte, als hätte ich sie nicht um Essensgeld gebeten, sondern um einen schicken, neuen BMW zum Geburtstag angebettelt. »Du bist achtzehn. Du bist stark und unabhängig. Dir fällt bestimmt etwas ein, Herzchen.«
»Wann kommst du wieder nach Hause?« Nicht, dass es mich störte, dass sie weg war. Dann musste ich mir wenigstens nicht zum hundertsten Mal irgendwelche Spitzfindigkeiten über mich oder die tausendste Schimpftirade über Ron anhören und ihr Gejammer, dass sie ihre eigenen Träume und Lebensziele geopfert hatte, um mit ihm zusammen zu sein, nur um am Ende ein Kind aufgehalst zu bekommen. Aber wenn sie hier wäre, könnte sie wenigstens Essen bestellen oder mir Geld geben, um welches zu kaufen.
Ich hörte, wie sie mit jemand anderem sprach. »Die nächste Runde Black Jack beginnt gleich, und ich bin Franks Glücksbringer. Ich muss los.« Damit war das Telefonat beendet.
Ich starrte das schwarze Display an. Eigentlich hätte mich nach all den Jahren nichts mehr überraschen dürfen. Inzwischen sollte ich mir jegliche Erwartungen an meine eigenen Eltern abgewöhnt haben. Ich schmiss das Handy hin, als wäre es mitverantwortlich dafür, dass die Person am anderen Ende der Leitung es immer wieder schaffte, das Messer noch ein wenig tiefer in die Wunde zu bohren. Ich blinzelte die Tränen in meinen Augen weg und massierte meine Hüfte.
So oft hatte ich mir geschworen, dass ich mir keine großen Hoffnungen mehr machen würde, dass ihr eines Tages vielleicht doch noch einfiel, dass sie eine Tochter hatte, und tat es doch immer wieder. Ich konnte mir noch so oft einreden, dass mir das alles egal war und es mich nicht berührte, trotzdem ging jedes Mal, wenn sie nicht in letzter Minute auftauchte, um mir zu versichern, dass alles gut werden würde, etwas in meinem Inneren ein Stück mehr kaputt.
Ich presste die Hand an meine Hüfte, verließ mein Zimmer und ging schlurfend die Treppe hinunter. Zwar klappte das inzwischen schon etwas besser, aber ich musste trotzdem aufpassen, dass die Schmerzen oder meine eingeschränkte Mobilität nicht noch schlimmer wurden. Schließlich war niemand da, der mir hätte helfen können.
Unten angekommen prüfte ich die aktuelle Essenssituation.
Im Kühlschrank klirrten zwei halb volle Flaschen mit Ketchup und Senf. Die Packungen mit Putenbrust, Schinken und Käse, die ich kürzlich dort deponiert hatte, waren nicht mehr da. Das Gleiche galt für meine Gewürzgurken und den Laib Weißbrot, auf den ich mich schon gefreut hatte. Um Brot und Aufschnitt für Sandwiches zu kaufen, hatte ich mein letztes Geld ausgegeben. Hätte ich mich darauf verlassen, dass meine Mutter mir etwas kochte, wäre ich unweigerlich verhungert.
Ich knallte die Tür des Kühlschranks zu, sodass sein spärlicher Inhalt im Inneren herumflog. Durch die dicke Tür hörte man das Klirren jedoch kaum. Sie hatte mein verdammtes Essen geklaut. Ich stieß einen erbitterten Schrei aus.
Schmerzmittel auf leeren Magen zu nehmen war nicht gerade ideal. Kotzen stand auf meiner heutigen Aktivitätenliste nicht unbedingt ganz oben, obwohl ich andererseits kaum etwas auskotzen konnte, wenn ich nichts gegessen hatte. Aber auch auf Übelkeit hatte ich wenig Lust.
Ich checkte die üblichen Stellen, an denen meine Mutter Geld versteckte, fand jedoch nur leere Flaschen. Also kehrte ich wieder in die Küche zurück und sah mich mit dem konfrontiert, was noch an Essbarem übrig war. Ich hatte mehrere Dosen Thunfisch im eigenen Saft und trockene Cornflakes zur Auswahl.
Vielleicht ein Cornflakes-Thunfisch-Sandwich? Ich nahm mir das Brot, das noch im Brotkasten lag.
Nach den grünen, haarigen Flecken zu urteilen, die den halben Laib überzogen, lag dieses Brot schon im Kasten, seitdem meine Mutter vor zwei Monaten zum letzten Mal einkaufen gegangen war.
Also nahm ich mir die Cornflakes-Packung, machte eine Dose Thunfisch auf und stand unschlüssig davor, als hätte ich eine Wette verloren. Ich könnte die Cornflakes ja zum Dippen benutzen. Wie eine Art Tortilla-Chips. Das war ja praktisch das Gleiche, oder?
Ein Klopfen an der Tür ersparte es mir, weiter darüber nachzudenken, ob es ein Anzeichen von Wahnsinn war, diesen Kram ernsthaft essen zu wollen.
So schnell es meine Hüfte zuließ, eilte ich zur Tür. Allerdings wurde eher ein Humpeln daraus. Aber die Schmerzen, die der Versuch zu rennen, verursachte, waren immer noch besser, als mich mit diesem Fraß in der Küche auseinanderzusetzen. Als ich vorsichtig den Vorhang an dem kleinen Fenster in der Tür beiseiteschob, entdeckte ich draußen ein Gesicht, dessen Anblick immer wie ein Sonnenstrahl an einem verregneten Nachmittag war. Doch als ich seinen unergründlichen Gesichtsausdruck bemerkte, zog sich mein Magen zusammen.
Mit klopfendem Herzen öffnete ich die Tür und machte mich auf seine Neuigkeiten gefasst. »LJ, was ist passiert?«
»Seit einer halben Stunde versuche ich, dich auf deinem Handy zu erreichen. Wo warst du?«
Das Handy, das ich angewidert hingeschmissen hatte, nachdem ich mit meiner Mutter gesprochen hatte, lag irgendwo auf meinem Bett oder auf dem Boden. Anscheinend hatte meine Suche nach Essen doch recht lange gedauert. Vielleicht knurrte deswegen auch mein Magen inzwischen noch lauter.
»Ich war genau hier. Wie geht es deinem Dad?«
Seine Miene hellte sich auf. »Es geht ihm gut. Sie haben die Transplantation heute durchgeführt. Das Ganze hat nur ein paar Stunden gedauert.«
»Tatsächlich? So bald? Ich dachte, dass es, nachdem sie das Knochenmark bei mir entnommen haben, noch eine Weile dauern würde.«
»Nein, sie waren schnell. Mom bringt ihn morgen nach Hause. Die Ärzte sagen, dass es ihm gut geht, was bedeutet …« Er rieb sich die Hände und grinste, als hätte er einen teuflischen Plan geschmiedet, der nun aufging. »Ich habe dir das hier besorgt.«
Er hielt mir eine Bäckertüte unter die Nase, während er seine eigene angewidert rümpfte. »Ein Everything Bagel mit Erdbeer-Frischkäse für dich.«
Ich riss ihm die Tüte aus der Hand. »Ernsthaft?« Als ich hineinspähte, schalteten meine Speicheldrüsen sofort in den Wasserfall-Modus. »Wie kann man einen Everything Bagel mit Erdbeer-Frischkäse nicht mögen?«
»Weil mein Magen über einen gewissen Selbsterhaltungstrieb verfügt. Aber abgesehen von dieser fragwürdigen kulinarischen Köstlichkeit habe ich noch eine Überraschung für dich.«
Ich stopfte mir ein Stück von der salzigen, süßen, knusprigen Leckerei in den Mund. »Eine Überraschung?«, nuschelte ich mit vollem Mund. Es könnte durchaus sein, dass mir dabei das eine oder andere Körnchen aus dem Mund flog.
Er zupfte eine der Servietten, die um die Tüte gewickelt waren, heraus und reichte sie mir. »Wir gehen auf Abschlussfahrt.« Er wischte sich die Hand an meinem Oberteil ab und deutete anschließend auf seines.
Er trug unser Abschlussfahrt-T-Shirt. Das Shirt zu der Abschlussfahrt, bei der ich eigentlich hatte mitfahren wollen, für die ich am Ende aber nicht genug Geld gehabt hatte, um sie vollständig zu bezahlen – weswegen ich auch noch die Anzahlung verloren hatte, für die ich den ganzen Sommer lang gespart hatte. Das hatte ich davon, dass ich meiner Mutter geglaubt hatte, dass sie mir mit dem fehlenden Betrag aushelfen würde.
Ich schüttelte den Kopf und stopfte mir den Mund noch voller. »Unsere ganze Klasse ist doch schon vor drei Tagen aufgebrochen.«
»Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht unsere eigene Abschlussfahrt machen können.« Mit einem breiten Football-Meisterschafts-Grinsen auf den Lippen rieb er sich die Hände. Ein solches Lächeln hatte ich schon lange nicht mehr bei ihm gesehen, nicht, seitdem Charlie die Untersuchungsergebnisse vom Arzt bekommen hatte: Lymphdrüsenkrebs.
»Wie soll das denn bitteschön gehen?«, fragte ich und öffnete die Tür nun komplett.
»Das wirst du schon sehen. Hol deine Schuhe«, sagte er. Seine Aufregung war richtig ansteckend.
Ich wandte mich um, verzog aber gleich darauf das Gesicht und hielt mir die Hüfte. Jetzt konnte ich endlich meine Schmerztabletten nehmen.
»Scheiße, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich hole dir dein Handy und deine Turnschuhe.« Er stürmte in mein Haus und schaute sich kurz um, bevor er die Treppe hinauf in mein Zimmer eilte. Zwar war er dort bisher nicht so oft gewesen wie ich in seinem Zimmer, aber er wusste trotzdem, wo er hinmusste.
Ich schlurfte in die Küche und entsorgte mein monströses Menü, bevor er es sehen konnte, rasch im Mülleimer. Wenn ich zurückkam, würde es bestimmt höllisch stinken, aber darum würde ich mich später kümmern.
Die Schmerztabletten lagen noch auf der Küchentheke. Ich schluckte sie trocken herunter und steckte das Tablettenfläschchen anschließend in die Hosentasche.
LJ kam mit meinem Handy und Schuhen in der Hand wieder die Treppe heruntergejoggt. »Wo ist deine Mom? Ich dachte, sie würde sich nach dem Eingriff um dich kümmern.«
»Eine Freundin hat sich die Hüfte gebrochen und sie musste sie im Krankenhaus besuchen.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Meine Ärmel waren so lang, dass nur die Fingerspitzen hervorlugten. »Sie bleibt nicht lange weg.«
LJ hatte ein ausgeprägtes Retter-in-der-Not-Syndrom. Stets war er der Erste, der versuchte, anderen zu Hilfe zu eilen. Manchmal kamen gute Dinge dabei heraus, wie etwa die Aktion, einen Knochenmarkspender für seinen Vater zu finden, aber auch grandiose Fehlschläge. Beispielsweise hatte er mich dazu gedrängt, Kontakt zu Ron aufzunehmen oder mich mit meiner Mom offen über meine Gefühle auszusprechen, und die Erinnerungen an diese beiden Versuche schmerzten mich noch immer. Entsprechend brauchte er nicht zu erfahren, dass meine Mom unterwegs war und sich mit irgendeinem Kerl, den sie wahrscheinlich kaum kannte, die Kante gab.
Hätte er es gewusst, wäre LJ wahrscheinlich mit einer ganzen Liste von Entzugskliniken und Familientherapeuten aufgetaucht. Aber man konnte nun mal nur Menschen helfen, die einsahen, dass sie ein Problem hatten. In den Augen meiner Mom war ihr einziges Problem jedoch der Umzug nach New York in weniger als zwei Monaten.
»Cool, sag ihr Bescheid, wo du bist.« Er reichte mir mein Handy. »Hätte ich dir eine Hose mitbringen sollen oder behältst du die Shorts an?«
Ich hob eine Augenbraue. »Wie lange kennst du mich schon?«
Er übergab mir meine Turnschuhe und hob die Hände. »Ich werde nie verstehen, weshalb deine Arme und Hände immer eiskalt sind, deine Beine dagegen heiß wie ein Schmelzofen. Bist du sicher, dass du nicht in Frankensteins Laboratorium zusammengesetzt wurdest?«, fragte er, streckte die Arme aus und imitierte einen zum Leben erweckten Leichnam.
»Vielleicht doch«, antwortete ich und machte neben ihm ebenfalls Frankensteins Monster-Gang nach, wobei das Ganze bei mir allerdings überzeugender ausfiel, weil die Schmerzmittel noch nicht wirkten.
»Das fängt ja schon mal gut an. Na los, gehen wir.«
Er schob mich eilig zur Tür hinaus, und diesmal protestierte ich deutlich weniger, als ich es sonst getan hätte. Wenn ich die Wahl hatte, entweder etwas mit LJ zu unternehmen oder mit leeren Vorratsschränken allein zu Hause zu hocken, war die Entscheidung klar.
Wie immer öffnete er mir die Autotür. Auf meine Fragen reagierte er allerdings äußerst schweigsam.
»Was hast du vor?«
Er startete den Wagen, und wir machten uns auf den Weg zu seinem Haus. »Während ich im Krankenhaus eingepfercht war, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist dort nämlich nicht rund um die Uhr Party angesagt.« Er zwinkerte mir zu und lächelte dabei, wie er es schon die ganze Zeit tat, seitdem er mein Haus betreten hatte.