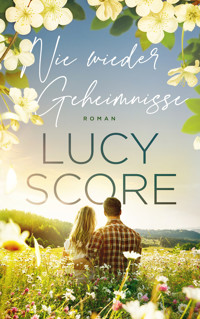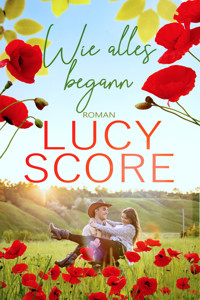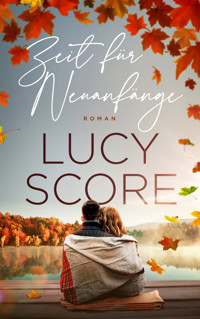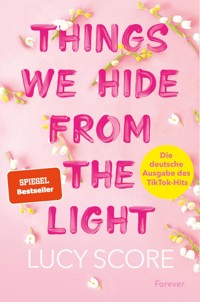
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knockemout
- Sprache: Deutsch
Der #1-New-York-Times-Bestseller auf Deutsch! Polizeichef Nash Morgan ist für zwei Dinge bekannt: Er ist ein guter Kerl und seine Uniformhose sitzt wie angegossen. Doch seit Nash im Dienst schwer verwundet wurde, leidet er unter PTBS und Depressionen. Denn er hat versagt und die einzige Familie, die er noch hat, in Gefahr gebracht. Obendrein muss er sich mit einer Stadt voller Bürger herumschlagen, die das Gesetz eher als "Leitfaden" betrachten. Das letzte, was er gebrauchen kann, ist seine neue Nachbarin Lina, die ihn Dinge fühlen lässt, die er schon Lange nicht mehr gefühlt hat. Lina ist auf der Durchreise und hat einen wichtigen Auftrag in Knockemout zu erledigen. Als Nash dahinterkommt, warum Lina wirklich in der Stadt ist, werden aus Freunden erbitterte Feinde. Aber die Funken zwischen ihnen kennen den Unterschied zwischen Liebe und Hass nicht … Von der Autorin des weltweiten Bestsellers Things We Never Got Over Kann unabhängig von Things We Never Got Over gelesen werden Band 1: Things We Never Got Over Band 2: Things We Hide From the Light Band 3: Things We Left Behind
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Things We Hide From The Light
Lucy Score ist New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin. Sie wuchs in einer buchverrückten Familie in Pennsylvania auf und studierte Journalismus. Wenn sie nicht gerade ihre herzzerreißenden Protagonist:innen begleitet, kann man Lucy auf ihrer Couch oder in der Küche ihres Hauses in Pennsylvania finden. Sie träumt davon, eines Tages auf einem Segelboot, in einer Wohnung am Meer oder auf einer tropischen Insel mit zuverlässigem Internet schreiben zu können.
Polizeichef Nash Morgan ist für zwei Dinge bekannt: Er ist ein guter Kerl und seine Uniformhose sitzt wie angegossen. Doch seit Nash im Dienst schwer verwundet wurde, leidet er unter PTBS und Depressionen. Denn er hat versagt und die einzige Familie, die er noch hat, in Gefahr gebracht. Obendrein muss er sich mit einer Stadt voller Bürger herumschlagen, die das Gesetz eher als „Leitfaden“ betrachten. Das letzte, was er gebrauchen kann, ist seine neue Nachbarin Lina, die ihn Dinge fühlen lässt, die er schon Lange nicht mehr gefühlt hat.
Lina ist auf der Durchreise und hat einen wichtigen Auftrag in Knockemout zu erledigen. Als Nash dahinterkommt, warum Lina wirklich in der Stadt ist, werden aus Freunden erbitterte Feinde. Aber die Funken zwischen ihnen kennen den Unterschied zwischen Liebe und Hass nicht …
Lucy Score
Things We Hide From The Light
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin1. Auflage Juni 2023ISBN 978-3-95818-742-9© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023© 2023 by Lucy ScorePublished by arrangement with Bookcase Literary AgencyDie amerikanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel: Things We Hide From The Light.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von © Kari March DesignsAutorinnenfoto: © Brianna WilburE-Book powered by pepyrusISBN: 978-3-95818-745-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1Ein winziges Glutnest
2Vermeidungstaktik
3Tot im Graben
4Richtig schmutzig
5Was unter der Dusche passiert …
6Schwanzvergleich
7Das war kein Trockenvögeln
8Grüne Bohnen und Lügen
9Die Tour vermasselt
10Schwitzen mit den Oldies
11Panik hat noch niemandem geholfen
12Willkommen in der Gefahrenzone
13Bettgefährten
14Snackraub und schwarze Schafe
15Der Teufel trägt Anzug
16Doppelter Dank
17Bettgeflüster
18Eggs Benedict für Arschlöcher
19Kaki steht ihr nicht
20Geständnisse eines Mitfahrers
21Das war’s dann wohl
22Showdown beim Fußball
23Team Lina
24Pecan Pie und spitze Ellbogen
25Strafzettel
26Welcher Nash?
27Die Schlange muss weg
28Erdbeerwochen-Unhappy-Hour
29Berufsorientierungstag gerockt
30Observation, aber bitte mit Drama
31Dürfen es ein paar Zwiebelringe sein?
32Höfliche Warnung
33Bookoween
34Unvermeidlich
35Zu weit getrieben
36High fives und Orgasmen
37Ganz schöne Delle
38Erstes Date
39Die ganze Gang versammelt
40Bitte recht freundlich
41Weise Worte
42Schoko mit Schoko
43Mieser Tag, mieser Rat
44Oder ist das der Regen
45Der Fallschirm wird schon aufgehen
46Die Gummipenisse sind schuld
47Ohne Hose und mit dem Arsch nach oben
48Da habt ihr die Falsche entführt
49Eine offene Rechnung
50Brecklin, du nervst
51Wann hast du ihn mit der Mistgabel gestochen?
Epilog
Bonusepilog:Ein paar Jahre später
Anmerkung
Danksagung
Leseprobe: Crushing on the Cop
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1Ein winziges Glutnest
1Ein winziges Glutnest
Nash
Die FBI-Agenten in meinem Büro hatten aus zwei Gründen Glück.
Erstens war mein linker Haken seit der Schussverletzung nicht mehr so zielsicher wie früher.
Zweitens war ich nicht in der Lage, irgendwas zu fühlen, vor allem nicht genug Wut, um etwas Dummes anzustellen.
»Das FBI versteht Ihr besonderes persönliches Interesse daran, Duncan Hugo aufzuspüren.« Special Agent Sonal Idler saß kerzengerade in ihrem Hosenanzug auf der anderen Seite meines Schreibtischs. Ihr Blick streifte den Kaffeefleck auf meinem Hemd.
Der Mann neben ihr, Deputy U.S. Marshal Nolan Graham, trug einen Schnurrbart und wirkte, als würde er zu der Sache hier gezwungen. Und er schien mir die Schuld daran zu geben.
Ich wollte etwas anderes fühlen als die alles verschlingende Leere, die mich wie eine Flut überrollte. Aber da war nichts.
»Ich kann es nicht gebrauchen, dass Sie mit Ihrer Truppe in meinen Ermittlungen rumpfuschen«, fuhr Idler fort.
Auf der anderen Seite der Scheibe kippte sich Sergeant Grave Hopper ein Pfund Zucker in den Kaffee und warf den beiden Agenten finstere Blicke zu. Hinter ihm herrschte im Großraumbüro der übliche Betrieb des Kleinstadt-Polizeireviers.
Das Telefon klingelte. Tastaturen klapperten. Beamte gingen ihrer Arbeit nach. Und der Kaffee war beschissen.
Alle waren putzmunter und quicklebendig. Alle außer mir.
Ich tat nur so.
Ich verschränkte meine Arme und ignorierte das heftige Ziehen in der Schulter.
»Die Höflichkeit weiß ich zu schätzen. Aber was soll das mit dem besonderen Interesse heißen? Ich bin nicht der einzige Cop, der sich im Dienst eine Kugel gefangen hat.«
»Sie sind auch nicht der Einzige auf der Liste.« Graham meldete sich zu Wort.
Ich spannte den Kiefer an. Mit dieser Liste hatte der ganze Albtraum angefangen.
»Sie wurden nur als Erster ins Visier genommen«, sagte Idler. »Ihr Name stand auf Anthony Hugos Liste mit Beamten und Informanten. Vielleicht haben wir damit endlich etwas gegen ihn in der Hand.«
Zum ersten Mal war so etwas wie Emotion in ihrer Stimme zu hören. Special Agent Idler hatte also selbst noch eine Rechnung mit dem Gangsterboss Anthony Hugo offen.
»Der Fall muss absolut wasserdicht sein. Wir können es nicht gebrauchen, dass irgendwer aus der Stadt auf eigene Faust ermittelt. Auch nicht jemand mit Dienstmarke.«
Ich rieb mir übers Kinn und stellte erstaunt fest, dass dort mehr als ein Bartschatten stand. Rasieren hatte ich in letzter Zeit nicht sonderlich weit oben auf meine Prioritätenliste gesetzt.
Special Agent Idler nahm also an, dass ich Nachforschungen anstellte. Naheliegend in Anbetracht der Umstände. Aber sie kannte mein Geheimnis nicht. Das kannte niemand. Von außen heilten meine Wunden zwar, ich zog jeden Tag meine Uniform an und kam aufs Revier. Aber in mir drin war nichts mehr. Nicht einmal der Wunsch, den Mann zu finden, der schuld an allem war.
»Was erwarten Sie von meiner Dienststelle, wenn Duncan Hugo hier auftaucht und auf noch ein paar Bürger schießen will? Sollen wir einfach weggucken?«
Die FBI-Agenten warfen einander einen Blick zu. »Ich erwarte, dass Sie uns über eventuelle Vorkommnisse in Ihrer Stadt in Kenntnis setzen«, sagte Idler streng. »Uns stehen ein paar mehr Mittel und Wege zur Verfügung als Ihrer Behörde. Außerdem sind wir auf keinem Rachefeldzug.«
Ich spürte etwas in der Leere aufflackern. Scham.
Eigentlich sollte ich auf einem Rachefeldzug sein. Eigentlich sollte ich alles daransetzen, diesen Mann eigenhändig zur Strecke zu bringen. Wenn schon nicht um meinetwillen, dann für Naomi und Waylay. Er hatte die Verlobte meines Bruders und ihre Nichte verschleppt und terrorisiert wegen dieser Liste, die mir zwei Schussverletzungen eingebracht hatte.
Ein Teil von mir war an jenem Abend gestorben, und was noch übrig war, schien mir des Kämpfens nicht wert.
»Marshal Graham wird eine Weile in der Nähe bleiben. Das eine oder andere im Auge behalten«, fuhr Idler fort.
Das schien den Schnurrbart in etwa so sehr zu freuen wie mich.
»Was zum Beispiel?«
»Die restlichen Zielpersonen auf der Liste stehen unter staatlichem Schutz, bis wir die Bedrohung nicht mehr als akut einstufen«, erklärte Idler.
Jesus. Es würde die ganze Stadt auf den Kopf stellen, wenn rauskam, dass FBI-Agenten sich hier rumdrückten und nur darauf warteten, dass irgendwer was Illegales machte.
»Ich brauche keinen Schutz. Wenn Duncan Hugo auch nur zwei Hirnzellen hat, ist er garantiert nicht mehr in der Gegend.« Zumindest redete ich mir das spät in der Nacht ein, wenn ich nicht schlafen konnte.
»Bei allem Respekt, Chief, Sie wurden angeschossen. Sie haben Glück, dass Sie noch unter uns sind.« Grahams Schnurrbart zuckte selbstgefällig.
»Was ist mit der Verlobten meines Bruders und ihrer Nichte? Bekommen sie auch Schutz?«
»Für uns besteht kein Grund zur Annahme, dass Naomi und Waylay Witt sich derzeit in Gefahr befinden.«
Das Ziehen in meiner Schulter wuchs zu einem stumpfen Pochen, passend zu dem in meinem Kopf. Mir fehlte es an Schlaf und Geduld, und wenn die beiden Nervensägen sich nicht bald aus meinem Büro verzogen, konnte ich nicht garantieren, dass ich die Beherrschung behielt.
Mit einer großen Portion Südstaatencharme erhob ich mich von meinem Schreibtisch. »Verstehe. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich muss mich um meine Stadt kümmern.«
Die Agenten standen auf, und wir schüttelten uns flüchtig die Hände.
»Wäre nett, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten könnten. Wo ich ja ein ›besonderes persönliches Interesse‹ habe«, fügte ich hinzu, als sie bereits an der Tür waren.
»Wir teilen Ihnen mit, was wir können«, erwiderte Idler. »Ebenso erwarten wir Ihren Anruf, sobald Sie sich an irgendetwas bezüglich der Schießerei erinnern.«
»Sicher doch«, presste ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Dank der Dreifaltigkeit aus körperlichen Wunden, Gedächtnisverlust und der leeren Taubheit war ich nur noch ein Schatten meiner selbst.
»Wir sehen uns«, sagte Graham. Es klang wie eine Drohung.
Ich wartete, bis sie sich aus meinem Revier verpisst hatten, dann schnappte ich mir meine Jacke. Als ich den Arm in den Ärmel schob, meldete sich das Loch in meiner Schulter lautstark zu Wort. Das in meiner Brust fühlte sich nicht viel besser an.
»Alles klar, Chief?«, fragte Grave, als ich das Großraumbüro betrat.
Unter normalen Umständen hätte mein Sergeant darauf bestanden, sich das ganze Gespräch haargenau nacherzählen zu lassen und anschließend eine Stunde über Zuständigkeitsblödsinn zu meckern. Aber seit ich angeschossen worden war, behandelten mich alle wie ein rohes Ei.
»Alles klar.« Das klang barscher als beabsichtigt.
»Willst du los?«
»Ja.«
Die eifrige neue Streifenpolizistin schnellte von ihrem Stuhl wie aus einem Schleudersitz. »Wenn Sie Mittagessen möchten, kann ich was von Dino’s holen, Chief.«
Tashi Bannerjee war in Knockemout aufgewachsen und kam frisch von der Police Academy. Ihre Schuhe waren blitzblank und ihr dunkles Haar zu einem überkorrekten Dutt gesteckt. Vor vier Jahren in der Highschool hatte sie noch einen Strafzettel bekommen, weil sie auf einem Pferd durch einen Fast-Food-Drive-in geritten war.
»Ich kann mir selber was zu essen holen«, antwortete ich patzig.
Sie wirkte einen kurzen Moment getroffen, und ich hatte das Gefühl, einen Welpen getreten zu haben. Fuck. Ich wurde noch wie mein Bruder.
»Aber danke für das Angebot«, fügte ich etwas weniger feindselig hinzu.
Na toll. Jetzt musste ich mir was Nettes einfallen lassen. Schon wieder. Noch eine »Tut mir leid, dass ich ein Arschloch bin«-Geste, für die ich keine Energie hatte. Diese Woche hatte ich schon Kaffee, Donuts und – nach einem besonders peinlichen Wutausbruch wegen des Thermostats im Großraumbüro – Schokoriegel von der Tanke mitgebracht.
»Ich geh zur Physio. Ich bin in circa einer Stunde wieder da.«
Als ich die Glastür des Knox Morgan Municipal Center aufstieß, traf mich der Herbst Nord-Virginias mit voller Wucht. Die Sonne ließ den Himmel so blau erstrahlen, dass mir die Augen wehtaten. Am Straßenrand hatten sich die Bäume mit rotbraunen, gelben und orangen Blättern in Schale geworfen, und die Schaufenster der Innenstadt waren voller Kürbisse und Stroh.
Beim Dröhnen eines Motorrads hob ich den Kopf und sah Harvey Lithgow vorbeicruisen. Er trug Teufelshörner auf dem Helm, auf dem Rücksitz war ein Gerippe aus Plastik festgebunden.
Er hob die Hand zum Gruß und knatterte mit mindestens zehn Meilen über der Geschwindigkeitsbegrenzung davon.
Normalerweise war der Herbst meine Lieblingsjahreszeit. Ein Neuanfang. Hübsche Mädchen in weichen Pullovern. Football-Saison. Homecoming. Kalte Abende, an denen man sich an Feuer und Fusel wärmte.
Aber jetzt war alles anders. Ich war anders.
Da ich hinsichtlich der Physiotherapie gelogen hatte, konnte ich mich kaum beim Mittagessen in der Stadt blicken lassen, also machte ich mich auf den Heimweg.
Ich würde mir ein Sandwich schmieren, auf das ich keinen Appetit hatte, allein dasitzen und mir überlegen, wie ich den Rest des Tages rumbringen konnte, ohne ein allzu großer Arsch zu sein.
Ich musste mich echt zusammenreißen. So schwer war es auch nicht, den Bürohengst zu spielen.
»Morgen, Chief.« Tallulah St. John, Mechanikerin und Eigentümerin des Café Rev, überquerte direkt vor meinen Augen bei Rot die Straße. Ihre langen schwarzen Braids hingen über die Schultern ihres Overalls. In einer Hand trug sie eine Einkaufstasche und in der anderen einen Kaffee, den höchstwahrscheinlich ihr Mann gemacht hatte.
»Morgen, Tallulah.«
Das Gesetz zu missachten, gehörte in Knockemout zum guten Ton. Während ich mich mittlerweile an Schwarz und Weiß hielt, schienen alle um mich herum in einer Grauzone zu leben. Diese Stadt war von gesetzeslosen Rebellen gegründet worden und machte sich nicht viel aus Regeln und Vorschriften. Mein Vorgänger im Amt hatte die Bürger über zwanzig Jahre lang einfach gewähren lassen, seine Dienstmarke poliert und persönliches Kapital aus seiner Stellung geschlagen.
Ich war jetzt seit fast fünf Jahren Chief. Diese Stadt war meine Heimat und ihre Bewohner meine Familie. Und nun würde ihnen bald aufgehen, dass ich sie nicht mehr beschützen konnte.
Mein Handy gab einen Ton von sich, und ich griff mit der linken Hand danach, bis mir einfiel, dass ich es gar nicht mehr auf dieser Seite trug. Leise fluchend zog ich es mit der rechten hervor.
Knox: Sag den Feds, die können dich mal, mich auch und die ganze scheiß Stadt dazu.
Natürlich hatte mein Bruder das mit den FBI-Agenten gehört. Wahrscheinlich verbreitete sich die Meldung wie ein Lauffeuer, seit jemand ihren Wagen in die Main Street hatte einbiegen sehen. Aber mir war nicht danach, das Ganze zu diskutieren. Mir war eigentlich nach gar nichts.
Das Handy klingelte in meiner Hand.
Naomi.
Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich den Anruf mit Freuden angenommen. Die neue Kellnerin mit der Pechsträhne hatte es mir angetan, bevor sie sich unerklärlicherweise in meinen griesgrämigen Bruder verliebte. Ich hatte sie mir aus dem Kopf geschlagen – leichter als gedacht –, aber Knox’ Genervtheit genossen, wenn seine Zukünftige mir Aufmerksamkeit schenkte.
Doch jetzt kam es mir wie eine Verpflichtung vor.
Ich ließ die Mailbox rangehen und bog um die Ecke in meine Straße.
»Morgen, Chief.« Neecey schleppte die Tafel der Pizzeria vor den Eingang. Dino’s öffnete tagtäglich um Punkt elf Uhr. Ich hatte es also nur vier Stunden an meinem Arbeitsplatz ausgehalten. Ein neuer Rekord.
»Morgen, Neece«, erwiderte ich kraftlos.
Ich wollte nach Hause und die Tür zumachen. Die Welt aussperren und in Dunkelheit versinken, anstatt alle drei Meter für Small Talk stehen zu bleiben.
»Ich habe gehört, der Fed mit dem Schnurrbart bleibt ne Weile hier. Meinst du, ihm wird es im Motel gefallen?« Ihre Augen funkelten verschmitzt.
Neecey war eine kaugummikauende Tratschtante mit Brille. Aber sie hatte recht. Knockemouts Motel war der Albtraum jedes Hygieneprüfers und verstieß gegen so ziemlich jede Auflage. Das Ding sollte dringend jemand kaufen und abreißen lassen.
»Sorry, Neece, da muss ich rangehen«, log ich und hielt mir mein Handy ans Ohr.
Als sie wieder im Restaurant verschwand, steckte ich es ein und eilte auf meinen Hauseingang zu.
Doch die Erleichterung war von kurzer Dauer: Die Tür aus geschnitztem Holz und dickem Glas, die zum Treppenhaus führte, wurde von einer Kiste offen gehalten, auf der Akten stand.
»Mist!« Von oben hörte ich eine Frauenstimme, die definitiv nicht meiner älteren Nachbarin gehörte.
Als ich hinaufschaute, fiel mir ein schicker schwarzer Rucksack entgegen. Auf halber Treppe blieb mein Blick an zwei langen, schlanken Beinen hängen.
Sie steckten in glänzenden moosgrünen Leggings. Die Aussicht wurde immer besser. Der flauschige graue Pullover war so kurz, dass ein Streifen weiche gebräunte Haut über definierten Muskeln zum Vorschein kam und sanfte Kurven betonte. Auch das dazugehörige Gesicht verdiente besondere Beachtung. Wangenknochen, die in Marmor gemeißelt gehörten. Große dunkle Augen. Volle, genervt geschürzte Lippen.
Ihr dunkles Haar war kurz geschnitten und sah aus, als sei gerade jemand mit den Fingern hindurchgefahren. Meine Hände zuckten.
Angelina Solavita, besser bekannt als Lina, beziehungsweise als Ex-Freundin meines Bruders, war ein echter Hingucker. Und stand in meinem Treppenhaus.
Das bedeutete nichts Gutes.
Ich bückte mich und hob die Tasche zu meinen Füßen auf.
»Sorry, dass ich dich mit meinem Gepäck beworfen hab«, rief sie, während sie einen Riesenrollkoffer die letzten Stufen hochwuchtete.
Über die Aussicht konnte ich mich nicht beklagen, aber auf den Small Talk gut verzichten.
Die Wohnung neben meiner eigenen stand zum Glück leer, doch ich hatte genug damit zu tun, gegenüber einer älteren Witwe zu wohnen, die keinerlei Wert auf Privatsphäre legte. Ich konnte nicht noch mehr Unruhe im Haus gebrauchen. Auch nicht, wenn sie so aussah wie Lina.
»Du ziehst hier ein?«, rief ich ihr zu, als sie wieder oben auf der Treppe erschien. Es klang gezwungen, meine Stimme angestrengt.
Sie schenkte mir ein schmales, sexy Lächeln. »Ja. Was gibt’s zum Abendessen?«
Ich sah zu, wie sie die Treppe herunterjoggte.
»Da findest du was Besseres.« Ich hatte ewig nicht mehr selbst gekocht. Meistens nahm ich mir irgendwo was mit, wenn ich das Essen nicht sowieso vergaß.
Lina blieb auf der letzten Stufe direkt vor mir stehen und musterte mich langsam von Kopf bis Fuß. Aus ihrem Lächeln wurde ein breites Grinsen. »Jetzt verkauf dich nicht unter Wert, Hotshot.«
So hatte sie mich schon vor ein paar Wochen genannt, als sie meine Wunden versorgt hatte, die wieder aufgegangen waren, nachdem ich meinem Bruder den Arsch gerettet hatte. Damals hätte ich eigentlich an den Berg von Papierkram denken sollen, der dank einer Entführung mit anschließender Schießerei auf mich wartete. Stattdessen hatte ich an die Wand gelehnt dagesessen und mich von Linas ruhigen, fähigen Handgriffen und ihrem reinen, frischen Duft ablenken lassen.
»Flirtest du mit mir?« Das war mir rausgerutscht.
Immerhin hatte ich ihr nicht gesagt, dass ich den Geruch ihres Waschmittels mochte.
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Du bist mein gut aussehender neuer Nachbar, der Polizeichef und der Bruder meines College-Freundes.«
Sie beugte sich einen Zentimeter vor, und ein winziger, warmer Funke regte sich in meiner Magengegend. Ich wollte ihn festhalten, ihn umklammern, bis er mein eisiges Blut aufgetaut hatte.
»Und ich habe eine Schwäche für blöde Ideen. Du auch?« Ihr Lächeln wurde langsam gefährlich.
Mein altes Ich hätte sich jetzt ins Zeug gelegt. Sich an der gegenseitigen Anziehung erfreut. Aber so war ich nicht mehr.
Ich hielt ihren Rucksack am Riemen hoch. Ihre Finger legten sich auf meine, als sie danach griff. Unsere Blicke trafen sich und hielten einander. Aus dem kleinen Funken wurde ein Glutnest, das mich beinahe daran erinnerte, wie es war, etwas zu fühlen.
Beinahe.
Sie sah mich aufmerksam an. Mit ihren whiskeybraunen Augen schien sie in mir zu lesen wie in einem offenen Buch.
Ich zog die Finger unter ihren hervor. »Was machst du noch mal beruflich?« Sie hatte es beiläufig erwähnt, als langweilig bezeichnet und das Thema gewechselt. Aber ihren Augen entging nichts, und ich war neugierig, was für ein Job es ihr gestattete, wochenlang in Nirgendwo, Virginia, rumzuhängen.
»Versicherung.« Sie warf sich den Rucksack über die Schulter.
Keiner von uns rührte sich vom Fleck.
»Was für eine Versicherung?«
»Wieso? Auf der Suche nach einer neuen Branche?«, neckte sie und entfernte sich langsam.
Aber ich wollte, dass sie blieb. Ich wollte, dass sie die schwachen Funken weiter anfachte, damit ich merkte, ob in mir noch etwas war, das sich entzünden ließ.
»Soll ich das nehmen?« Ich deutete mit dem Daumen auf die Aktenkiste an der Tür.
Das Lächeln verblasste. »Mach ich schon«, sagte sie knapp und wollte an mir vorbeigehen.
Ich versperrte ihr den Weg. »Mrs Tweedy würde mir das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie wüsste, dass ich dich die Kiste die Treppe hochtragen lasse.«
»Mrs Tweedy?«
Ich zeigte nach oben. »2C. Sie ist gerade mit ihrer Gewichthebertruppe unterwegs.«
»Wenn sie unterwegs ist, wird sie nicht erfahren, dass du deine Schusswunden durchs Hochschleppen nicht strapaziert hast. Wie sind sie verheilt?«
»Gut«, log ich.
Sie machte »hm« und zog wieder die Augenbraue hoch.
Sie glaubte mir nicht. Aber meine Gier nach diesen winzigen Gefühlsfitzelchen war so groß und verzweifelt, dass es mir egal war.
»Mir geht’s blendend«, sagte ich.
Ich hörte ein leises Klingeln und sah einen Anflug von Unmut, als Lina ihr Handy aus irgendeiner versteckten Tasche am Bund ihrer Leggings fischte. Ganz kurz sah ich Mom auf dem Display aufleuchten, dann drückte sie den Anruf weg. Anscheinend gingen wir beide unserer Familie aus dem Weg.
Ich nutzte ihre Unachtsamkeit und schnappte mir die Kiste – mit dem linken Arm. Meine Schulter schmerzte, und eine eiskalte Schweißperle lief mir über den Rücken. Aber als sich unsere Blicke erneut trafen, waren die Funken sofort wieder da.
Ich wusste nicht, was es war, aber ich brauchte es.
»Dann ist die Morgan’sche Sturheit bei dir also genauso ausgeprägt wie bei deinem Bruder.« Sie steckte das Handy wieder in die Tasche, musterte mich noch einmal prüfend und ging wieder nach oben.
»Apropos Knox.« Ich gab mir Mühe, meiner Stimme nichts anmerken zu lassen. »Du wohnst in Apartment 2B?« Meinem Bruder gehörte das Gebäude, inklusive Bar und Barbershop im Erdgeschoss.
»Ab jetzt, ja. Vorher war ich im Motel.«
»Schwer zu glauben, dass du es dort so lange ausgehalten hast.«
»Heute Morgen habe ich eine Ratte mit einer Kakerlake kämpfen sehen, die genauso groß war wie die Ratte. Da hat’s mir gereicht.«
»Du hättest auch bei Knox und Naomi unterkommen können«, presste ich heraus, bevor mir die Luft zum Sprechen wegblieb. Meine Kondition war im Eimer und ihr wohlgeformter Arsch in den Leggings vor mir nicht gerade förderlich.
»Ich hab gern mein eigenes Reich.«
Oben angekommen, folgte ich ihr zu der offenen Tür neben meiner, während mir eisiger Schweiß über den Rücken lief. Ich musste echt wieder ins Gym. Wenn ich schon den Rest meiner Tage als gefühlskalter Zombie zubringen musste, wollte ich wenigstens in der Lage sein, mich beim Treppensteigen zu unterhalten.
Lina stellte ihren Rucksack in die Wohnung und wollte mir die Kiste abnehmen.
Wieder berührten sich unsere Finger.
Wieder fühlte ich etwas. Und zwar nicht nur den Schmerz in der Schulter und die Leere in der Brust.
»Danke für die Hilfe«, sagte sie und nahm die Kiste.
»Wenn du irgendwas brauchst, ich bin nebenan.«
Ihre Mundwinkel zuckten kaum merklich nach oben. »Gut zu wissen. Man sieht sich, Hotshot.«
Ich blieb wie angewurzelt stehen, nachdem sie die Tür geschlossen hatte, und genoss das letzte bisschen Glut in mir.
2Vermeidungstaktik
Lina
Ich schloss meine neue Wohnungstür und ließ den eins fünfundachtzig großen, verwundeten, grüblerischen Nash Morgan stehen.
»Denk nicht mal dran«, murmelte ich.
Normalerweise hatte ich nichts dagegen, ein kleines Risiko einzugehen, ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Aber ich hatte dringendere Sachen zu erledigen, als die Traurigkeit davonzuflirten, die wie ein Umhang über Nashs Schultern lag.
Verwundet und grüblerisch, dachte ich, als ich meine Akten durchs Zimmer zerrte.
Es überraschte mich nicht, dass ich ihn anziehend fand, nichts reizte mich mehr als eine Herausforderung. Ich wollte hinter die Fassade blicken, herausfinden, woher die Schatten in seinen traurigen Draufgängeraugen kamen.
Nash schien mir allerdings der Typ Feste Beziehung zu sein, und dagegen war ich allergisch.
Ich mochte den Spaß, den Kick bei der Jagd. Ich spielte gern mit den Teilen eines Puzzles, bis ich das ganze Bild zusammenhatte – und wandte mich dann dem nächsten zu. Zwischendurch wollte ich mich in mein eigenes Reich zurückziehen und das Essen bestellen können, auf das ich Lust hatte.
Ich stellte die Kiste ab und nahm meine neue Bleibe in Augenschein.
Die Wohnung hatte Potenzial: hohe Decken, abgenutzte Dielen, große Fenster zur Straße. Ich verstand, dass Knox in das Gebäude investiert hatte. Er hatte schon immer ein Auge für versteckte Schönheit gehabt.
Im Wohnbereich stand eine ausgeblichene Couch mit Blumenmuster vor einer kahlen Backsteinwand, dazu ein runder kleiner Esstisch mit drei Stühlen sowie ein Regal aus alten Obstkisten unter den Fenstern.
Die Küche mit ihren Trockenbauwänden war ungefähr zwanzig Jahre zu alt. Egal, ich kochte sowieso nicht. Die Arbeitsflächen aus grellgelbem Sperrholz hatten schon bessere Zeiten gesehen. Aber es gab eine Mikrowelle und einen Kühlschrank, der groß genug für Lieferessen und ein Sixpack war, also würde ich schon zurechtkommen.
Das Schlafzimmer war bis auf einen begehbaren Kleiderschrank leer, den ich als Fashion Victim durchaus nötig hatte. Das angrenzende Bad war zwar hübsch retro mit der Klauenfuß-Badewanne, allerdings hatte auf dem nutzlosen Säulenwaschbecken praktisch nichts von meiner Make-up- und Hautpflege-Sammlung Platz.
Ich seufzte. Je nachdem, wie gemütlich das Sofa war, konnte ich mir die Anschaffung eines Betts vielleicht erst mal sparen. Ich wusste nicht, wie lange ich noch hier sein würde, wie viel Zeit ich brauchte, bis ich fand, was ich suchte.
Hoffentlich nicht allzu lange.
Ich ließ mich auf die Couch fallen und betete, sie möge bequem sein.
Fehlanzeige.
»Wieso bestrafst du mich?«, fragte ich zur Decke gewandt. »Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bremse für Fußgänger. Ich spende für diesen Gnadenhof. Ich esse Gemüse. Was willst du denn noch?«
Das Universum gab keine Antwort.
Ich dachte an mein Townhouse in Atlanta. Ich war es gewohnt, bei der Arbeit weniger Komfort zu haben. Wenn ich nach einem Langzeitaufenthalt im Zweisternemotel zurückkehrte, wusste ich meine teure Bettwäsche, mein dick gepolstertes Designersofa und meine fein säuberlich sortierte Garderobe wieder zu schätzen.
Aber dieser Langzeitaufenthalt hier wurde langsam lächerlich.
Je länger ich in der Stadt blieb, ohne Hinweis oder Licht am Ende des Tunnels, desto unruhiger wurde ich.
Wochen über Wochen in einer Kleinstadt achtunddreißig Minuten Fahrt vom nächsten Sephora entfernt ohne das leiseste Anzeichen, dass ich auf der richtigen Spur war, setzten mir langsam zu.
Ich war gelangweilt und frustriert, eine gefährliche Kombination, mit der ich unmöglich die nagenden Zweifel im Hinterkopf ignorieren konnte. Zweifel daran, ob mir der Job noch so viel Spaß machte wie früher. Diese Gedanken waren aufgetaucht, als der letzte Auftrag komplett schiefgegangen war. Noch was, worüber ich nicht nachdenken wollte.
»Na gut, Universum«, wandte ich mich wieder an die Decke. »Ich brauche eine Sache, die gut läuft. Nur eine. Ein Schuh-Sale oder eine Spur in diesem Fall hier, bevor ich den Verstand verliere.«
Diesmal reagierte das Universum mit einem Anruf.
»Hi, Mom«, sagte ich gleichermaßen genervt wie liebevoll.
»Da bist du ja! Ich habe mir Sorgen gemacht.« Die Sorge war Bonnie Solavita in die Wiege gelegt worden.
»Ich habe Sachen hochgetragen«, erklärte ich.
»Du übertreibst es aber nicht, oder?«
»Es waren ein Koffer und ein Stockwerk.« Ich hob den Deckel von der Aktenkiste. »Was ist bei euch so los?« Gegenfragen hielten die Beziehung zu meinen Eltern am Leben.
»Ich bin auf dem Weg zu einem Meeting, und dein Vater hängt mal wieder unter der verdammten Motorhaube.«
Mom hatte in ihrem Job als Marketingleiterin pausiert, um mich mit ihrer Fürsorge zu ersticken, bis ich drei Staaten weiter ans College gegangen war. Seitdem hatte sie ihre Tätigkeit wieder aufgenommen und kletterte in einer nationalen Gesundheitsorganisation die Karriereleiter empor.
Mein Vater Hector war seit sechs Monaten Klempner im Ruhestand. »Die verdammte Motorhaube« gehörte zu einem 1968er Mustang Fastback, der dringend etwas Zuwendung brauchte und den ich ihm vor zwei Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte – dank eines fetten Bonusschecks von der Arbeit. So einen hatte er als gut aussehender Junggeselle in Illinois gehabt, bis er ihn gegen einen Pick-up-Truck eingetauscht hatte, um eine Farmerstochter zu beeindrucken. Dad hatte die Farmerstochter geheiratet und dem Auto jahrzehntelang nachgetrauert.
»Hat er ihn zum Laufen gebracht?«
»Noch nicht. Gestern hat er mich beim Abendessen mit einer zwanzigminütigen Abhandlung über Vergaser zu Tode gelangweilt. Also habe ich ihn zurückgelangweilt, wie wir unsere Werbebotschaften für den Ostküsten-Speckgürtel optimieren.«
Ich musste lachen, bis ich jemanden im Hintergrund eine hektische Frage stellen hörte.
»Nehmen Sie die zweite Präsentation, daran habe ich gestern Abend noch was gemacht. Ach, und holen Sie mir noch ein Pellegrino, bevor Sie reingehen, ja? Danke.« Mom räusperte sich. »Entschuldige bitte, Süße.«
Über den Unterschied zwischen ihrer Boss- und ihrer Mom-Stimme konnte ich mich endlos amüsieren.
Trotz des knallharten Terminkalenders meiner Mutter war es der Wunsch meiner Eltern, auf Schritt und Tritt über mein Wohlergehen informiert zu sein. So sprach ich fast jeden Tag mit einem von ihnen. Denn wenn ich es zu lange schleifen ließ, standen sie gern mal unangekündigt vor der Tür.
»Du bist immer noch in Washington, oder?«
Ich zuckte zusammen, weil ich wusste, was jetzt kam. »So ungefähr. In einer Kleinstadt nördlich von D. C.«
»In Kleinstädten lassen sich beschäftigte Karrierefrauen immer von irgendeinem Grobian mit eigenem Laden verführen. Oh, oder von einem Sheriff! Hast du den Sheriff schon kennengelernt?«
Eine Kollegin hatte meine Mutter vor Jahren auf den Geschmack von Romance-Büchern gebracht. Seither unternahmen sie einmal im Jahr einen gemeinsamen Trip, der rein zufällig in irgendeiner Signierstunde gipfelte. Und nun rechnete Mom immer damit, dass mein Leben sich in eine Romcom verwandelte.
»Den Polizeichef«, korrigierte ich. »Der wohnt sogar nebenan.«
»Das beruhigt mich schon mal, dass du einen Polizisten in der Nachbarschaft hast. Die können auch Erste Hilfe, weißt du.«
»Und ein paar andere Sachen«, meinte ich trocken und versuchte, nicht genervt zu klingen.
»Ist er single? Sieht er gut aus? Irgendwelche Red Flags?«
»Glaube schon. Auf jeden Fall. Und so gut kenne ich ihn noch nicht. Aber er ist Knox’ Bruder.«
»Oh.«
Meine Eltern hatten Knox nie kennengelernt. Sie wussten nur, dass wir – ganz kurz – am College zusammen gewesen und seitdem befreundet waren. Mom gab ihm irrtümlicherweise die Schuld dafür, dass ihre siebenunddreißigjährige Tochter immer noch frei und ungebunden war.
Sie sehnte sich zwar nicht verzweifelt nach einer Hochzeit und Enkelkindern, aber würde erst Ruhe geben, wenn jemand anders in meinem Leben die Rolle des besorgten Beschützers übernahm. Ganz egal, wie eigenständig ich war. Für Mom und Dad blieb ich die Fünfzehnjährige im Krankenhausbett.
»Dein Vater und ich haben gerade darüber gesprochen, übers Wochenende wegzufahren. Wir könnten uns in den Flieger setzen und vorbeikommen.«
Das Letzte, was ich brauchte, waren meine Eltern, die mir durch die Stadt folgten, während ich versuchte zu arbeiten.
»Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin«, sagte ich diplomatisch. »Kann sein, dass ich in den nächsten Tagen schon heimfahre.« Unwahrscheinlich, es sei denn, ich deckte eine neue Spur in dem Fall auf. Aber immerhin war es keine komplette Lüge.
»Ich verstehe nicht, wieso du nie absehen kannst, wie lang deine Firmen-Schulungen gehen«, überlegte Mom. Bevor ich mir darauf eine Antwort ausdenken musste, hörte ich wieder jemanden mit ihr reden. »Ich muss auflegen, Süße. Das Meeting geht los. Also sag Bescheid, wenn du wieder in Atlanta bist. Dann besuchen wir dich dort, bevor du zu Thanksgiving kommst. Wenn wir es richtig timen, können wir auch mit zu deinem Termin.«
Klar. Weil ich meine Eltern sicher mit zu einem Arzttermin schleppen würde. »Darüber reden wir später.«
»Hab dich lieb, Süße.«
»Ich dich auch.«
Ich legte auf und stieß einen Seufzer aus, der sich zu einem Stöhnen steigerte. Selbst über die Entfernung schaffte es meine Mutter, dass ich mich fühlte, als hätte ich ein Kissen auf dem Gesicht.
Es klopfte an der Tür, und ich fragte mich argwöhnisch, ob meine Mutter dahinterstand und mich überraschen wollte.
Aber dann hörte ich einen dumpfen Schlag an der Unterseite der Tür. Darauf folgte ein barsches: »Mach auf, Lina. Der Scheiß hier ist schwer.«
Ich ging zur Tür und riss sie auf – dahinter standen Knox Morgan, seine hübsche Verlobte Naomi und deren Nichte Waylay.
Naomi grinste und hielt eine Topfpflanze mit grün glänzenden Blättern in der Hand. Knox guckte finster und schleppte anscheinend zentnerschweres Bettzeug. Waylay sah gelangweilt aus und hatte zwei Kissen in der Hand.
»Das passiert also, wenn man aus dem Kakerlakenmotel auszieht? Unangemeldeter Besuch?«
»Aus dem Weg.« Knox drängelte sich mit einer eierschalenfarbenen Bettdecke an mir vorbei.
»Tut uns leid, dass wir einfach so reinplatzen, aber wir wollten dir unsere Geschenke zum Einzug überreichen«, sagte Naomi. Sie war groß, brünett und kleidete sich mädchenhaft. Alles an ihr war weich: der gewellte Bob, das Strickmaterial ihres langärmeligen Kleides über ihren üppigen Kurven, die Art, wie sie den äußerst ansehnlichen Arsch ihres Verlobten betrachtete, der auf dem Weg in mein Schlafzimmer war.
Schöne Hintern waren bei den Morgans anscheinend erblich bedingt. Naomis Mom Amanda zufolge galt Nashs Arsch in seiner Uniformhose als das Wahrzeichen der Stadt.
Waylay trat zögerlich über die Türschwelle. Ihr blondes Haar trug sie zum Pferdeschwanz gebunden, was den Blick auf ihre auswaschbaren blauen Strähnchen freigab. »Hier.« Sie drückte mir die Kissen in die Hand.
»Danke, aber ich ziehe hier nicht richtig ein«, stellte ich klar und warf sie aufs Sofa.
»Knockemout lässt einen nicht so einfach wieder weg.« Naomi gab mir die Pflanze.
Sie musste es wissen. Vor ein paar Monaten war sie mit der Absicht hergekommen, ihrer Zwillingsschwester aus der Patsche zu helfen, und dann selbst mitten in die Schusslinie geraten. Innerhalb weniger Wochen war Naomi Vormund ihrer Nichte geworden, hatte zwei Jobs gefunden, war entführt worden und hatte Knox »Beziehungen-sind-nichts-für-mich« Morgan dazu gebracht, sich in sie zu verlieben.
Nun lebten sie in einem großen Haus am Stadtrand und planten ihre Hochzeit. Ich nahm mir vor, Naomi eines Tages meiner Mutter vorzustellen. Bei so einem Happy End aus dem wahren Leben würde sie durchdrehen.
Knox kam mit leeren Händen aus dem Schlafzimmer zurück. »Das Bett kommt heute Nachmittag.«
Ich blinzelte. »Ihr schenkt mir ein Bett?«
»Find dich damit ab.« Er legte Naomi den Arm um die Schultern und zog sie an sich.
Naomi knuffte ihm in den Bauch. »Sei ein bisschen höflicher.«
»Nö«, knurrte er.
Ein schönes Paar. Der große, tätowierte Griesgram mit dem Bart und die kurvenreiche, strahlende Brünette.
»Was der Wikinger damit sagen will: Wir freuen uns, dass du in der Stadt bleibst, und dachten, mit einem Bett hast du es bequemer«, übersetzte Naomi.
Waylay ließ sich auf die Couch fallen. »Wo ist der Fernseher?«
»Ich habe noch keinen. Aber wenn es so weit ist, ruf ich dich an, damit du mir beim Anschließen hilfst, Way.«
»Fünfzehn Mäuse.« Sie verschränkte die Hände hinterm Kopf. Die Kleine war ein Technik-Genie und hatte kein Problem damit, sich ihr Talent vergolden zu lassen.
»Waylay«, sagte Naomi entsetzt.
»Was? Das ist der Freundschaftspreis.«
Ich überlegte, ob ich jemals ein so enges Verhältnis zu jemandem gehabt hatte, dass ich einen Freundschaftspreis bekommen hätte.
Knox zwinkerte Waylay zu und drückte Naomi noch einmal an sich. »Ich muss was mit Nash besprechen.« Er deutete mit dem Daumen hinter sich zur Tür. »Leens, wenn du noch was brauchst, sag Bescheid.«
»Ach, ich bin schon froh, dass ich hier nicht mit einer Kakerlakenarmee um die Dusche kämpfen muss. Danke, dass ich eine Weile hierbleiben kann.«
Er hob die Hand, grinste knapp und war verschwunden.
»Waylay! Was machst du da?«, rief Naomi ihrer Nichte zu, die im Schlafzimmer verschwunden war.
»Rumschnüffeln.« Die Zwölfjährige erschien mit den Händen in den verzierten Taschen ihrer Jeans im Türrahmen. »Schon gut. Sie hat gar nichts hier drin.«
Aus dem Flur erklang lautes Klopfen. »Mach auf, Arschloch«, brummte Knox.
Naomi verdrehte die Augen. »Ich entschuldige mich für meine Familie. Anscheinend wurden sie alle von Wölfen aufgezogen.«
»So was Unzivilisiertes kann auch ganz charmant sein.« Als ich bemerkte, dass ich immer noch die Pflanze in der Hand hielt, ging ich zum Fenster und stellte sie auf eine der leeren Kisten.
»Das ist ein Maiglöckchen. Es blüht zwar erst im Frühling, aber symbolisiert Glück«, erklärte Naomi.
Natürlich. Naomi achtete auf jede Kleinigkeit.
»Wir sind außerdem hier reingeplatzt, weil wir dich für Sonntag zum Abendessen mit der ganzen Familie einladen wollen.«
»Es gibt Grillhähnchen, aber bestimmt auch haufenweise Gemüse«, warnte mich Waylay und ging zum Fenster.
Ein Essen, das ich nicht bestellen musste, und den gezähmten Knox als Sahnehäubchen dazu? »Klar. Sag mir einfach, was ich mitbringen soll.«
»Nur dich selbst. Im Ernst, meine Eltern, Stef und ich machen schon mehr als genug Essen«, versicherte mir Naomi.
»Wie wär’s mit Alkohol?«, schlug ich vor.
»Dazu sagen wir bestimmt nicht Nein.«
»Und eine Flasche Limo«, sagte Waylay.
Naomi warf Waylay einen erzieherischen Blick zu.
»Bitte«, fügte das Mädchen schnell hinzu.
»Wenn du eine ganze Flasche von dem zahnverätzenden Zeug willst, dann wirst du heute Mittag einen Salat zur Pizza essen und heute Abend Brokkoli«, beharrte Naomi.
Waylay verdrehte die Augen und schlenderte zum Tisch. »Tante Naomi hat voll den Gemüsetick.«
»Glaub mir, da gibt es schlimmere Ticks.«
Sie beäugte meine Aktenkiste und fischte mit flinken Fingern eine Mappe heraus.
»Netter Versuch, Oberspürnase.« Ich nahm sie ihr entschlossen aus der Hand.
»Waylay!«, schimpfte Naomi. »Lina arbeitet bei einer Versicherung. Das sind bestimmt vertrauliche Informationen.«
Wenn sie wüsste.
Ich schnappte mir den Deckel und legte ihn wieder auf die Kiste.
Wieder ertönte nebenan ein Klopfen. »Nash? Bist du dadrin?«
Wie es aussah, versteckte ich mich nicht als Einzige vor meiner Familie.
»Na los, Way. Wir gehen lieber, bevor Knox noch das ganze Haus demoliert.« Naomi streckte die Hand nach ihrer Nichte aus. Waylay schmiegte sich an ihre Seite.
»Danke für die Pflanze … und das Bett … und die Bleibe.«
»Ich bin so froh, dass du hierbleibst«, sagte Naomi, als wir vor der Tür standen.
Konnte ich nicht von mir behaupten.
Vor Nashs Tür ging Knox die Schlüssel an seinem Bund durch.
»Ich glaube, er ist nicht da«, sagte ich schnell. Was auch immer mit Nash los war, er hatte bestimmt keine Lust darauf, dass sein Bruder seine Wohnung stürmte.
Knox schaute hoch. »Ich hab gehört, er ist von der Arbeit aus hierher.«
»Streng genommen wurde uns gesagt, dass er von der Arbeit zur Physiotherapie wollte, aber Neecey von Dino’s hat ihn vor dem Haus gesehen«, fügte Naomi hinzu.
In der Kleinstadt wusste echt jeder über jeden Bescheid. »Ich hab mit meinem Kram einen Heidenlärm auf der Treppe veranstaltet, er ist bestimmt schon wieder weg.«
Knox steckte seine Schlüssel ein. »Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich ihn suche.«
»Ich auch«, sagte Naomi. »Ich wollte ihn für Sonntag einladen, aber es ging nur die Mailbox ran.«
»Dann sag ihm, dass ich ihn auch suche«, meldete Waylay sich zu Wort.
»Wieso das denn?«, wollte Knox wissen.
Waylay zuckte in ihrem rosa Pulli mit den Schultern. »Ich wollte mich nicht ausgeschlossen fühlen.«
Knox nahm sie scherzhaft in den Schwitzkasten und wuschelte ihr durchs Haar.
»Mann! Deshalb brauche ich extrakrasses Haarspray!« Waylay meckerte zwar, aber ich sah ihre Mundwinkel nach oben zucken, als mein tätowierter Freund ihr einen Kuss auf den Kopf gab.
Naomi und Waylay hatten gemeinsam das Unmögliche geschafft und Knox Morgan in einen Softie verwandelt. Und ich hatte dabei einen Platz in der ersten Reihe.
»Das Bett kommt um drei. Essen am Sonntag ist um sechs«, erklärte Knox schroff.
»Aber komm ruhig früher. Vor allem, wenn du Wein mitbringst.« Naomi zwinkerte mir zu.
»Und Limo.«
Die drei machten sich auf den Weg nach unten, Knox in der Mitte mit dem Arm um seine Mädels.
Ich sah ihnen nach und schloss meine Tür. Das glänzende Grün der Pflanze zog meinen Blick an. Sie war das einzige Heimelige in dem kahlen Raum.
Ich hatte noch nie eine Pflanze besessen. Generell hatte ich noch nie etwas gehabt, das nicht auch ein paar Tage oder Wochen ohne mich überstand.
Hoffentlich würde ich sie nicht umbringen, bis meine Angelegenheiten hier geklärt waren. Seufzend nahm ich die Mappe, die Waylay in der Hand gehabt hatte, und schlug sie auf.
Duncan Hugos Gesicht blickte mir entgegen.
»Du kannst dich nicht ewig verstecken«, sagte ich.
Nebenan hörte ich Nashs Tür leise auf- und wieder zugehen.
3Tot im Graben
Nash
Die Sonne ging über den Bäumen auf und verwandelte die reifbedeckten Grashalme in glitzernde Diamanten, als ich meinen SUV an den Straßenrand lenkte. Ich ignorierte meinen hämmernden Herzschlag, die schwitzigen Hände und die Enge in meiner Brust.
Beinahe ganz Knockemout lag noch im Bett. Wir waren eher die Stadt der Nachtschwärmer als die der Frühaufsteher.
Ich konnte gut drauf verzichten, dass alle sich über Chief Morgan das Maul zerrissen, der erst auf sich schießen lassen und dann den Verstand verloren hatte, weil seine Erinnerung einfach nicht zurückkommen wollte.
Knox und Lucian würden sich einmischen und ihre Nasen in Dinge stecken, die sie nichts angingen. Naomi würde mir mitleidige Blicke zuwerfen und mich mit Essen versorgen. Liza J. würde so tun, als sei nichts passiert, was für mich als Morgan die erträglichste Reaktion war. Irgendwann wäre ich genötigt, mich beurlauben zu lassen. Was zum Teufel bliebe mir dann noch?
Durch den Job hatte ich wenigstens einen Grund, den Anschein zu wahren. Einen Grund, morgens aufzustehen.
Und wenn ich schon jeden Tag aufstand, dann konnte ich genauso gut meine Uniform anziehen und mich nützlich machen.
Ich parkte den Wagen und drosselte den Motor. Mit dem Schlüssel in der Hand öffnete ich die Tür und trat auf den Schotterstreifen neben der Straße.
Es war ein heller Morgen. Nicht feucht und rabenschwarz wie die Nacht damals. Zumindest daran konnte ich mich erinnern.
Die Angst bildete ein nervöses Knäuel in meiner Magengrube.
Ich atmete tief durch. Vier Sekunden einatmen. Sieben Sekunden halten. Acht Sekunden ausatmen.
Ich machte mir Sorgen. Sorgen, dass ich mich nicht erinnern würde. Sorgen, dass ich mich erinnern würde.
Auf der anderen Straßenseite lag ein komplett überwuchertes Grundstück.
Ich konzentrierte mich auf das kantige Metall der Schlüssel, das sich in meine Haut drückte, und auf die knirschenden Steinchen unter meinen Stiefeln. Langsam ging ich auf das Auto zu, das nicht da war. Das Auto, an das ich mich nicht erinnern konnte.
Der Druck in meiner Brust verstärkte sich. Vielleicht konnte mein Hirn sich nicht erinnern, etwas anderes in mir aber schon.
»Einfach weiteratmen, Arschloch«, sagte ich mir.
Vier. Sieben. Acht.
Vier. Sieben. Acht.
Endlich gehorchten mir meine Füße und bewegten sich weiter vorwärts.
Ich hatte mich dem Wagen, einem dunklen Viertürer, von hinten genähert. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Ich hatte mir das Material der Dashcam an die tausend Mal angeschaut und gehofft, es würde meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Aber es kam mir jedes Mal vor, als würde ich jemand anderem zusehen.
Neun Schritte von meiner Tür bis zum hinteren Kotflügel des anderen Wagens.
Mit dem Daumen hatte ich das Rücklicht berührt. All die Jahre im Dienst war es ein harmloses Ritual gewesen, bis der Abdruck diesmal das Auto identifiziert hatte.
Kalter Schweiß lief mir den Rücken runter.
Wieso konnte ich mich nicht erinnern?
Würde ich mich je erinnern?
Würde ich ihn kommen sehen, wenn Hugo zurückkehrte, um die Sache zu beenden?
Würde ich mir die Mühe machen, ihn aufzuhalten?
»Niemand hat Bock auf ein erbärmliches Arschloch, das sich in Selbstmitleid suhlt«, murmelte ich laut vor mich hin.
Mit zitterndem Atem ging ich noch drei Schritte, bis ich vor der imaginären Fahrertür stand. Dort war Blut gewesen. Als ich zum ersten Mal zurückgekommen war, hatte ich mich noch nicht aus meinem Auto zwingen können. Ich hatte einfach hinterm Steuer gesessen und auf den rotbraunen Schotter gestarrt.
Jetzt war es weg. Von der Natur beseitigt. Aber ich sah es immer noch vor mir.
Ich hörte immer noch das Echo eines Geräuschs. Etwas zwischen einem Knistern und einem Knirschen. Es verfolgte mich in meinen Träumen. Ich wusste nicht, was es war, aber es fühlte sich so wichtig an.
»Fuck«, stieß ich hervor.
Ich rieb mir mit dem Daumen die Stelle zwischen den Augenbrauen.
Ich hatte meine Waffe zu spät gezogen. Ich erinnerte mich nicht mehr, wie die beiden Kugeln in mein Fleisch getroffen hatten. Wie ich umgefallen war. Oder wie Duncan Hugo ausgestiegen war und sich über mir aufgebaut hatte. Ich erinnerte mich nicht mehr, was er gesagt hatte, als er mir auf das Gelenk meiner Schusshand trat. Und auch nicht daran, wie er ein letztes Mal gezielt hatte. Auf meinen Kopf.
Ich wusste nur, dass ich gestorben wäre.
Ohne die Scheinwerfer.
Glück gehabt. Nichts als Glückhatte mich vor der tödlichen Kugel bewahrt.
Hugo war davongerast. Zwanzig Sekunden später hatte mich eine Krankenschwester erspäht, auf dem Weg zu ihrer Schicht in der Notaufnahme, und sich sofort an die Arbeit gemacht. Ohne Zögern. Ohne Panik. Dann hatte es noch mal sechs Minuten gedauert, bis Hilfe gekommen war. Die Ersthelfer hatten ihren Job geübt und effizient gemacht. Sie hatten ihre Ausbildung nicht vergessen.
All das, während ich beinahe leblos neben der Straße gelegen hatte.
Ich hatte keine Erinnerung daran, wie die Krankenschwester über mein eigenes Funkgerät Hilfe gerufen hatte, während sie meine Wunde zudrückte. Ich erinnerte mich auch nicht daran, wie Grave neben mir gekniet und mir ins Ohr geflüstert hatte, während mir die Sanitäter das Hemd vom Leib schnitten. Keine Erinnerung, wie ich auf die Bahre geladen und ins Krankenhaus gebracht worden war.
Ein Teil von mir war genau hier gestorben.
Vielleicht hätte es den Rest auch treffen sollen.
Ich trat nach einem Stein, verfehlte ihn und rammte den Zeh gegen den Boden. »Aua. Fuck.«
Diese ganze Selbstmitleidsnummer ging mir auf den Sack, aber ich wusste nicht, wie ich es abschütteln sollte.
Ich hatte mich selbst damals nicht retten können.
Und auch den Übeltäter nicht zur Strecke gebracht. Nicht mal ansatzweise.
Es war pures Glück, dass ich überhaupt noch da war.
Ich schloss die Augen, holte wieder tief Luft und kämpfte gegen die Anspannung. Mir lief ein Schauer über den Rücken, als die Morgenluft den kalten Schweiß verdunsten ließ.
»Reiß dich zusammen. Denk an was anderes. Irgendwas, das dich nicht mit Selbsthass erfüllt.«
Lina.
Der Gedankengang überraschte mich. Aber da war sie. Stand auf der Treppe zu meiner Wohnung, mit funkelnden Augen. Hockte neben mir in der dreckigen Lagerhalle, die Mundwinkel belustigt nach oben gezogen. Immer selbstbewusst, immer in Flirtlaune. Ich machte die Augen zu und klammerte mich an diesem Bild fest. Ihre sportliche Figur, betont durch hautenge Kleidung. Die gebräunte, glatte Haut. Die braunen Augen, denen nichts entging.
Ich roch förmlich den sauberen Duft ihres Waschmittels und konzentrierte mich auf ihre vollen rosigen Lippen, als könnten sie allein mich auf dieser Welt halten.
In meiner Magengegend regte sich ein Nachhall der Glut von gestern.
Dann riss mich ein Geräusch rechts von mir aus meinen Tagträumen.
Ich griff nach meiner Waffe.
Ein Jaulen. Vielleicht auch ein Wimmern. Meine angespannten Nerven und das Adrenalin verstärkten das Summen in meinen Ohren. War das eine Halluzination? Oder ein scheiß wild gewordenes Eichhörnchen, das mich anfallen wollte?
»Ist da jemand?«
Stille.
Das Grundstück parallel zur Straße fiel nach ein paar Metern zu einem Entwässerungsgraben ab. Dahinter erstreckte sich ein Dickicht aus Dornen, Unkraut und Essigbäumen, das nach und nach in ein Waldstück überging. Auf der anderen Seite lag die Hessler-Farm, die jedes Jahr mit ihrem Maislabyrinth und dem Kürbisfeld die Massen anlockte.
Ich horchte angestrengt und versuchte, meinen Puls und meine Atmung unter Kontrolle zu bringen.
Ich hatte gute Antennen. Zumindest hatte ich das immer gedacht. Als Sohn eines Süchtigen hatte ich gelernt, die Launen anderer abzuschätzen, nach Anzeichen Ausschau zu halten, dass gleich etwas aus dem Ruder lief. Meine Polizeiausbildung hatte mich gelehrt, Situationen und Menschen noch besser zu lesen.
Aber das war vorher gewesen. Nun waren meine Sinne gedämpft, und mein Instinkt wurde vom leisen Dröhnen der Panik erstickt, die unter der Oberfläche lauerte. Vom unaufhörlichen, bedeutungslosen Knistern, das ich immerzu in meinem Kopf hörte.
»Falls hier irgendwo wild gewordene Eichhörnchen sind, macht euch lieber vom Acker«, rief ich in die menschenleere Landschaft.
Dann hörte ich es tatsächlich. Ein schwaches Rasseln, Metall gegen Metall.
Das war kein Eichhörnchen.
Mit gezogener Dienstwaffe bewegte ich mich den Abhang hinab, das gefrorene Gras knirschte unter meinen Füßen. Jeder Atemstoß wurde als silberne Wolke sichtbar, und mein Herz sorgte für einen Trommelwirbel in meinen Ohren.
»Knockemout PD«, rief ich und drehte mich mit ausgestreckter Waffe im Halbkreis um mich selbst.
Ein kalter Windstoß fuhr durch die Blätter, ließ den Wald rascheln und mich unter dem Schweiß auf meiner Haut frösteln. Ich war allein hier draußen.
Ich kam mir vor wie ein Idiot und steckte die Waffe ins Holster.
Mit dem Unterarm wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. »Das ist doch lächerlich.«
Ich wollte zurück zu meinem Wagen und wegfahren. Ich wollte so tun, als gäbe es diesen Ort hier nicht, als gäbe es mich nicht.
»Na gut, Eichhörnchen. Diese Runde geht an dich.«
Ich blieb stehen. Ich hörte zwar kein Geräusch mehr und sah auch keinen zuckenden Eichhörnchenschwanz, aber ein unsichtbares Stoppschild befahl mir, mich nicht vom Fleck zu rühren.
Spontan legte ich die Finger an den Mund und stieß einen kurzen, schrillen Pfiff aus.
Diesmal ließen sich das klägliche Jaulen und das metallische Scharren nicht leugnen. Ha, meine Instinkte waren also doch nicht völlig im Eimer.
Ich pfiff noch einmal und folgte dem Geräusch zum Eingang eines Abflussrohrs. Ich hockte mich hin, und da war er. Etwa einen Meter tief im Rohr saß ein schmutziger, tropfnasser Hund auf einem Haufen Laub und Schutt. Er war eher klein und vielleicht mal weiß gewesen, sein mattes Fell stand jetzt in schlammig-braun gesprenkelten Büscheln ab.
Ich hatte also doch nicht meinen verdammten Verstand verloren. Was für eine Erleichterung.
»Hey, Kumpel. Was machst du denn dadrin?«
Der Hund legte den Kopf schief, und die Spitze seines verdreckten Schwanzes zuckte zaghaft.
»Ich mach nur die Taschenlampe an, damit ich dich besser sehe, ja?« Langsam und vorsichtig zog ich die Lampe aus dem Gürtel und ließ den Lichtkegel über den Hund schweifen.
Er zitterte erbärmlich.
»Sitzt wohl ganz schön in der Klemme, was?«
Der Hund winselte und hielt die Vorderpfote hoch.
»Ich werde jetzt ganz langsam nach dir greifen. Okay? Ich tu dir nichts. Versprochen.« Ich legte mich auf den Bauch ins Gras und schob mich ins Rohr. Es war eng und bis auf den Strahl meiner Taschenlampe stockdunkel.
Der Hund wimmerte und zog sich zurück.
»Ich verstehe dich. Ich hab auch Angst, wenn es eng und dunkel ist. Aber du musst jetzt tapfer sein und zu mir kommen.« Ich tätschelte das schlammige, geriffelte Metall. »Komm her, Kumpel.«
Jetzt stand er aufrecht auf allen vier Pfoten, na ja, drei, denn die eine hielt er immer noch hoch.
»Braver Stinkehund. Komm her, dann kriegst du eine Bulette«, versprach ich.
Mit viel zu langen Krallen trommelte der Hund einen aufgeregten Rhythmus, als er an Ort und Stelle herumtänzelte, aber näher kam er immer noch nicht.
»Oder Chicken Nuggets? Ich besorg dir eine ganze Box.«
Diesmal legte er den Kopf auf die andere Seite.
»Hör zu, Kumpel. Ich will echt nicht erst in die Stadt fahren, einen Fangstab holen und dir eine Heidenangst einjagen. Es wär einfacher, wenn du deinen Arsch hier rüberschieben könntest.«
Das verfilzte Fellknäuel starrte mich unbeeindruckt an. Dann machte er einen zaghaften Schritt vorwärts.
»Braver Hund.«
»Nash!«
Ich hörte meinen Namen eine Millisekunde, bevor ich hochschrak und mit dem Kopf gegen die Oberseite des Rohrs stieß.
»Autsch! Fuck!«
Der Hund sprang völlig verängstigt zurück in sein schmutziges Nest.
Ich kroch aus dem Rohr, mein Kopf und meine Schulter schmerzten. Ganz instinktiv hob ich die Hand und riss meinen Angreifer zu Boden.
Angreiferin.
Lina lag warm und weich unter mir. Sie hatte die Augen erschrocken geweitet und klammerte sich mit beiden Händen an meinem Hemd fest. Sie schwitzte und trug Ohrhörer.
»Was machst du hier, verdammt?«, fragte ich und riss ihr einen Hörer aus dem Ohr.
»Ich? Wieso zum Teufel liegst du hier am Straßenrand rum?«
Sie wollte mich mit den Fäusten und den Hüften von sich schieben, aber trotz meines Gewichtsverlusts hatte sie keine Chance.
Erst da wurde mir bewusst, in welcher Position ich mich befand. Wir lagen Brust an Brust, Bauch an Bauch. Mein Becken befand sich zwischen ihren langen, wohlgeformten Beinen. Ich spürte die Hitze ihrer Mitte, als würde ich das Gesicht in einen Ofen halten.
Mein Körper reagierte entsprechend, ich wurde steinhart.
Ich war erleichtert und entsetzt zugleich. Entsetzt aus offensichtlichen Gründen. Erleichtert über die Tatsache, dass meine Ausrüstung noch funktionsfähig war. Ich hatte sie keinem Testlauf unterzogen, seit ich angeschossen worden war. An mir war so vieles kaputt, da wollte ich mir nicht noch Gedanken um meinen Schwanz machen müssen.
Lina keuchte unter mir, und ich sah den Puls an ihrem schlanken, eleganten Hals. Mein Ständer pulsierte noch heftiger. Ich betete um ein Wunder, damit sie es nicht mitbekam.
»Ich dachte, du liegst tot im Graben!«
»Das höre ich ständig«, stieß ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor.
Sie schlug mir gegen die Brust. »Sehr witzig, du Arsch.«
Sie bewegte kaum merklich die Hüften. Mein Schwanz bekam es sofort mit, und weder die vorgeschobene Professionalität noch meine Manieren konnten die Bilder dessen aus meinem Kopf vertreiben, was ich am liebsten mit ihr angestellt hätte.
Ich wollte mich bewegen, wollte in diese Hitze stoßen und mich mithilfe ihres Körpers selbst wiederbeleben. Ich wollte sehen, wie sie die Lippen leicht öffnete und die Augen schloss, während ich sie nahm. Ich wollte spüren, wie sie die Muskeln um mich herum anspannte, wollte hören, wie sie meinen Namen mit ihrer heiseren Sexstimme flüsterte.
Ich wollte mich so tief in ihr versenken, dass sie mich beim Loslassen mitnahm.
Das war mehr als Nullachtfünfzehn-Anziehung, ich stand nicht einfach auf sie. Was ich empfand, war hart an der Grenze zu unkontrollierbarem Verlangen.
»Leck mich«, murmelte ich.
»Was, hier?«
Ich sah ihr erschrocken in die Augen, in denen Belustigung und noch etwas anderes schimmerten. Etwas Gefährliches.
»War nur ein Scherz, Hotshot. Mehr oder weniger.«
Sie bewegte sich wieder unter mir, und mein Kiefer verkantete sich. Meine Lunge brannte, weil ich das Atmen vergessen hatte. An meinem Schweiß war nun nichts mehr kalt.
»Deine Waffe drückt ganz schön.«
»Das ist nicht meine Waffe«, stieß ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor.
Sie grinste frech. »Ich weiß.«
»Dann hör auf, dich zu bewegen.«
Dreißig Sekunden später konnte ich mich von ihr schieben. Ich stand auf und half ihr hoch. Weil ich immer noch durcheinander war, zog ich heftiger als nötig, und sie prallte gegen meine Brust.
»Vorsicht, Großer.«
»Sorry.« Ich legte ihr die Hände auf die Schultern.
»Du musst dich nicht entschuldigen. Darauf würde ich nur bestehen, wenn du nicht so eine gesunde körperliche Reaktion darauf gezeigt hättest, auf mir zu liegen.«
»Gern geschehen?«
Wie es aussah, war sie gerade joggen gewesen. Sie trug Leggings und ein dünnes Oberteil mit langen Ärmeln, beides hauteng. Ihr Sport-BH war türkis und die Sneaker orange. Ihr Handy hatte sie an ihrem Oberarm befestigt, am Hosenbund steckte ein kleines Pfefferspray.
Sie legte den Kopf schief und musterte mich schweigend von oben bis unten. Ich spürte ihren Blick, als würde er mich umarmen. Gute Neuigkeiten für mein abgestorbenes Inneres. Schlechte Neuigkeiten für die Erektion, die ich eigentlich loswerden wollte.
So blieben wir einen aufgeheizten Augenblick lang stehen, näher beieinander, als wir sollten, mit wandernden Blicken und angehaltenem Atem.
Die Funken in meiner Magengegend hatten sich wieder entzündet, flogen umher und wärmten mich von innen. Ich wollte sie wieder berühren. Ich musste einfach. Aber als ich die Hand ausstreckte, erklang ein schrilles Piepsen.
Lina zuckte zurück und schlug sich aufs Handgelenk.
»Was war das?«
»Nichts. Nur … ein Alarm«, sagte sie und fummelte an ihrer Uhr herum.
Sie log. Eindeutig. Aber bevor ich eine Erklärung verlangen konnte, drang wieder das jämmerliche Winseln aus dem Abflussrohr.
Lina zog die Augenbrauen hoch. »Und was war das?«
»Ein Hund. Glaube ich zumindest.«
»Das hast du also gemacht?« Sie ging um mich herum auf das Rohr zu.
»Nein. Ich krieche immer zwei-, dreimal die Woche in Abflussrohre. Gehört zum Job.«
»Witzig, Hotshot«, rief Lina über die Schulter, als sie sich vor das Rohr kniete.
Ich stieß mir mit dem Finger zwischen die Augenbrauen und versuchte, ihre provokative Haltung zu ignorieren, meine Erregung war so schon kaum zu bändigen.
»Du versaust dir die Klamotten«, warnte ich sie und schaute hoch in den blauen Himmel statt auf ihren Hintern, während sie auf allen vieren vorwärtskrabbelte.
»Dafür gibt es Waschmaschinen und Shopping.« Sie duckte sich in die Öffnung.
Ich sah runter auf meine Erektion, die sich gegen den Reißverschluss und meinen Gürtel stemmte.
»Hey, Süßer. Komm zu mir, dann wird alles gut.«
Sie sprach mit dem Hund, das wusste ich. Aber etwas bescheuert Verzweifeltes in mir sprang auf ihren tröstlichen Ton an.
»Ich mach das schon«, sagte ich zu ihrem runden Arsch in der schiefergrauen Laufhose.
»Braver Junge oder braves Mädchen«, sagte Lina und kroch wieder aus dem Rohr. Sie hatte Schmutz an den Wangen und Ärmeln. »Hast du irgendwas Essbares im Wagen, Hotshot?«
Wieso war ich da nicht draufgekommen? »Ich hab Beef Jerky im Handschuhfach.«
»Gibst du unserem neuen Freund was von deinen Snacks ab? Ich glaube, mit einem guten Lockmittel kriege ich ihn oder sie.«
Sie war ein gutes Lockmittel. Ich wäre auf dem Bauch durch gefrorenen Schlamm gerobbt, nur um einen besseren Blick auf sie zu erhaschen, aber das galt für mich und nicht für irgendeinen halb erfrorenen Streuner.
Ich ging zurück zu meinem SUV und befahl meinem Blut, aus meinem Schritt abzufließen. Neben dem Trockenfleisch schnappte ich mir ein paar andere Sachen aus dem Notfallset im Kofferraum – eine einfache Leine, einen Napf und eine Flasche Wasser.
Als ich mit dem ganzen Zeug zurückkam, steckte Lina bäuchlings noch tiefer im Rohr und war nur noch von der Hüfte abwärts zu sehen. Ich hockte mich neben sie und sah in den Eingang. Mein schmutziges kleines Fellknäuel hatte sich weiter vorgewagt und war fast in Schleck- oder Schnappweite.
»Sei vorsichtig«, warnte ich sie.
»Die süße Kleine wird mir nichts tun. Höchstens das Shirt ruinieren, aber das ist die Sache wert. Nicht wahr, Prinzessin?«
Mir wurde angst und bange. »Lina, ich mein’s ernst. Das ist ein Fall für die Polizei. Lass mich das machen.«
»Du willst nicht ernsthaft behaupten, dass das zitternde Hündchen hier ein Fall für die Polizei ist!« Ihre Stimme hallte unheimlich durch das Rohr.
»Ich will nicht, dass du dich verletzt.«
»Das werde ich nicht, und wenn doch, dann war es meine freie Entscheidung. Außerdem passt du mit deinen breiten Heldenschultern eh nicht hier durch.«
Ich hätte das örtliche Tierheim anrufen sollen. Der dünne Deke würde prima in das Rohr passen.
»Her mit dem Beef, Nash.« Lina streckte den anderen Arm nach hinten und wackelte mit den Fingern.
Mein halb steifer Schwanz hatte immer noch alle Mühe, zu ignorieren, wie ihre Leggings sich an ihren Hintern schmiegten. Aber es gelang mir, die Tüte aufzureißen und ihr ein Stück Fleisch zu geben.
Lina nahm es und hielt es dem Hund hin. »Hier, meine Süße.«
Das schlammige Fellknäuel kroch zaghaft auf ihre Hand zu.
Kleine Hunde konnten auch beißen, und wer wusste schon, von welchen Parasiten das halb erfrorene Häufchen befallen war? Was, wenn Lina eine wiederherstellende Gesichts-OP bräuchte? Das wäre alles meine Schuld.
Lina machte Lockgeräusche, der Hund kam immer näher, und mein Herz drohte, aus meiner Brust zu springen.
»Schau doch mal. Ein schönes Stück Beef Jerky.« Sie wedelte verlockend mit dem Trockenfleisch vor dem Hund herum.
Ich griff nach ihrer Hüfte und machte mich bereit, sie rauszuziehen.
»Nein, der nette Mann will mich bloß umarmen. Der will dir keine Angst machen. Nash, wenn du noch fester zupackst, krieg ich blaue Flecken. Und zwar keine von der angenehmen Sorte.«
Ich sah runter auf meine Finger, die Knöchel waren ganz weiß, also lockerte ich meinen Griff.
»Braves Mädchen!« Ich wollte mich runterbeugen, aber meine Schulter ließ mich nicht, und Linas wohlgeformter Hintern versperrte mir sowieso die Sicht.
»Ich hab unsere Süße schön fest im Arm. Aber es gibt ein Problem.«
»Was?«
»Ich kann nicht gleichzeitig rauskriechen und sie festhalten. Du musst mich ziehen.«
Ich starrte wieder auf ihren Arsch. Beim Verfassen des Einsatzberichtes musste ich so einiges weglassen, sonst würde Grave sich nie wieder einkriegen.