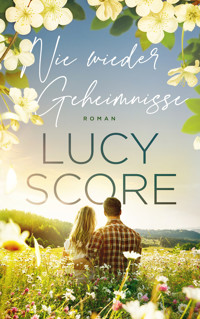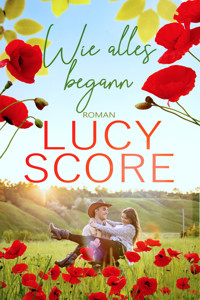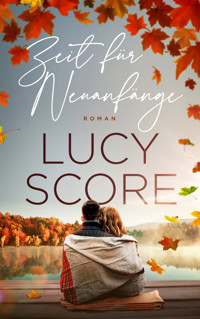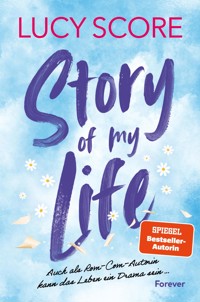4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knockemout
- Sprache: Deutsch
Endlich die Geschichte von Lucian und Sloane, auf die ganz BookTok sehnlich wartet Der #1-New-York-Times Bestseller Lucian Rollins ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der sich vor nichts und niemanden fürchtet – bis auf vor Sloane Walton, der frechen Kleinstadt-Bibliothekarin, die Lucian gerade mal bis zur Brust reicht. Denn Denn Sloane und Lucian verbinden nicht nur verborgene Gefühle, sondern auch ein altes Geheimnis, das droht, Lucians Rachepläne zu durchkreuzen. Sloane kann Lucian nicht ausstehen, doch als sie in die Schusslinie gerät, weicht Lucian ihr nicht mehr von der Seite. Und nicht nur die Wortgefechte zwischen ihnen werden hitziger … Von der Autorin des weltweiten Bestsellers Things We Never Got Over Band 1: Things We Never Got Over Band 2: Things We Hide From the Light Band 3: Things We Left Behind
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Things We Left Behind
Lucy Score ist New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin. Sie wuchs in einer buchverrückten Familie in Pennsylvania auf und studierte Journalismus. Wenn sie nicht gerade ihre herzzerreißenden Protagonist:innen begleitet, kann man Lucy auf ihrer Couch oder in der Küche ihres Hauses in Pennsylvania finden. Sie träumt davon, eines Tages auf einem Segelboot, in einer Wohnung am Meer oder auf einer tropischen Insel mit zuverlässigem Internet schreiben zu können.
Lucian Rollinsverfolgt sein ganzes Leben nur ein Ziel: Er will Rache. Lucian verbringt jede freie Minute damit, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, um den Einfluss seines Vaters auf sein Imperium auszumerzen. Lucian ist so kurz davor alles zu erreichen – bis Sloane Walton ihm mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Sein Beschützerinstinkt dreht völlig durch, als seine alte Kindheitsfreundin ins Kreuzfeuer gerät …Sloane Waltonist eine brillentragende und katzenliebende Bibliothekarin, die Lucien »Luzifer« Rollins mit jeder Faser ihrer Existenz verachtet. Sie ist sich sicher, dass der aalglatte Businessmogul seine Seele an den Teufel verkauft hat. Lucian füllt seine maßgeschneiderten Anzüge inzwischen verdammt gut aus, keine Spur mehr von dem einsamen Teenager, mit dem sie einst alles geteilt hat, sogar das böse Geheimnis um seinen Vater …
Lucy Score
Things We Left Behind
Roman
Aus dem Englischen von Ina Streich
Forever by Ullsteinwww.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinNovember 2023© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023© 2023 by Lucy ScorePublished by arrangement with Bookcase Literary AgencyWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Miningim Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Die amerikanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel: Things We Left BehindUmschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von © Kari March Designs
E-Book powered by pepyrus
ISBN: 978-3-95818-746-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1 Beerdigungsburrito
2 Behalt den Mantel und lass mich in Frieden
3 Margarita-Talk
4 Teufel und Engel
5 Der heiße Typ in meinem Zimmer
6 Frühstücksüberfall
7 Das böse Geschäftsimperium
8 Ausschlag im Hochzeitskleid
9 Schmusen mit dem Teufel
10 Genervt und hungrig
11 Shania Twain ist ne coole Braut
12 Livin’ La Vida Biblioteca
13 Abendessen unter Strom
14 Alarmsignale
15 Stripeinlage auf dem Gefängnisparkplatz
16 Knusprige Suppe und schlechte erste Dates
17 Bedrohlich nahe
18 Trümmer der Vergangenheit
19 Alles falsch gemacht
20 Dann soll sie auch kein anderer haben
21 Der dümmste, heißeste Fehler aller Zeiten
22 Sloane als letzte Rettung
23 Ich bin noch nicht fertig mit dir
24 Friedensverhandlungen bei Käsesandwiches
25 Ich werde kein chemisches Schwanzpeeling machen
26 Dewey-Dezimal-Gerechtigkeit
27 Speziallieferung Sexolyte
28 Schreib das ruhig auf meinen Grabstein
29 Jetzt wird’s bescheuert
30 Hat hier jemand Rattatouille bestellt?
31 Schluss mit dem Fickfest
32 Für mich gestorben
33 Grumpy Bär
34 Eine schöne altmodische Prügelei
35 Du liebst mich, du Idiot
36 Zu viele dicke Dinger
37 Ganz schön heiß hier
38 Nicht mehr alle Latten am Zaun
39 Wer hat hier eine Kopfverletzung
40 Chardonnay im Gesicht
41 Die Buttermesser-Verteidigung
42 Vulkan der Lust
43 Hopsgenommen
44 Es geht nicht um Schubladen
45 Schnippi, schnipp, schnapp
46 Bücher können Leben retten
47 Wieder gut
48 Die glücklichen Paare
Epilog Weihnachtshochzeit
Bonusepilog Glücklich und zufrieden
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Leseprobe: Story of My Life
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1 Beerdigungsburrito
Widmung
Für mein zwölfjähriges, siebzehnjähriges, einundzwanzigjähriges und dreißigjähriges Ich. Du warst nie, nie so schlimm, wie du immer gedacht hast. Das wird schon alles.1 Beerdigungsburrito
Sloane
Die Hollywoodschaukel quietschte rhythmisch, als ich mich mit dem Zeh vom Holzboden der Veranda abstieß. Der Januar schob mir eiskalte Finger unter die Decke und meine Kleidung. Aber das brauchte er gar nicht, innerlich war ich schon zu Eis erstarrt.
Mir fiel der Weihnachtskranz, der an der leuchtend violetten Haustür hing, ins Auge.
Ich musste ihn abnehmen.
Ich musste wieder zur Arbeit.
Ich musste zurück nach oben und das Deo benutzen, das ich vergessen hatte.
Anscheinend musste ich einiges. Und alles fühlte sich so schwer an. Wieder rein und die Treppe hoch in mein Schlafzimmer zu gehen, war so, als müsste ich den Mount Everest besteigen.
Sorry, Knockemout. Musst du wohl mal mit einer müffelnden Bibliothekarin klarkommen.
Ich sog die schneidende Luft ein. Komisch, dass ich mich selbst an so was Automatisches wie Atmen erinnern musste. Trauer legt sich einfach über alles, auch wenn sie absehbar ist.
Ich hob die Tasse meines Dad mit der Aufschrift TRÄNEN DER GEGENSEITE und stärkte mich mit einem Schluck Wein zum Frühstück.
Den Rest des Tages würde ich im unerträglich warmen Knock’Em Stiff verbringen, Knockemouts Bestattungsinstitut mit dem pietätlosen Namen. Dort drin fiel die Temperatur nie unter vierundzwanzig Grad, damit die zumeist älteren Besucher nicht froren.
Ich atmete eine silbrige Wolke aus. Als sie sich aufgelöst hatte, fiel mein Blick auf das Haus nebenan.
Ein unscheinbares zweigeschossiges beiges Gebäude mit zweckmäßiger Gartengestaltung.
Zugegebenermaßen sahen die meisten Häuser, verglichen mit meinem skurrilen viktorianischen Haus mit Rundumveranda und dem auffälligen Türmchen, ziemlich langweilig aus. Und dadurch, dass das Haus dort drüben so verlassen war, wurde der Kontrast umso größer. Seit über zehn Jahren sah ich lediglich ab und an eine Truppe, die den Garten in Schuss hielt, und manchmal kam der unausstehliche Eigentümer zu Besuch.
Ich fragte mich, warum er es nicht einfach verkauft oder abgefackelt hatte.
Meine Haustür ging auf, und meine Mutter trat heraus.
Für mich war Karen Walton schon immer wunderschön gewesen. Selbst heute, selbst in Trauer, sah sie hübsch aus.
»Was meinst du? Zu viel?« Langsam drehte sie sich in ihrem neuen kleinen Schwarzen im Kreis. Es hatte einen U-Boot-Ausschnitt, lange Ärmel und einen schwingenden, funkelnden Tüllrock. Ihr glatter blonder Bob wurde von einem Samtband zusammengehalten.
Vor ein paar Tagen war meine Freundin Lina mit uns Beerdigungsoutfits shoppen gegangen. Mein Kleid war kurz, aus figurbetontem tiefschwarzem Strick mit versteckten Rocktaschen. Es war wunderschön, und ich würde es nie wieder anziehen.
»Du siehst toll aus«, versicherte ich ihr und hob einladend die Decke hoch.
Sie setzte sich und tätschelte mir das Knie.
Die Hollywoodschaukel war schon immer wichtig für unsere Familie gewesen. Hier hatten wir nach der Schule gesessen, Snacks gegessen und geredet. Meine Eltern hatten sich das ganze Jahr über einmal die Woche zur Happy Hour auf der Schaukel getroffen. Wenn zu Thanksgiving der Abwasch erledigt war, machten wir es uns hier alle mit unserem Lieblingsbuch und einer kuscheligen Decke gemütlich.
Als meine Eltern vor zwei Jahren nach Washington gezogen waren, um näher bei Dads Ärzten zu sein, hatte ich das alberne Ungetüm von Haus in Olivgrün, Violett und Dunkelblau geerbt. Ich hatte es schon immer geliebt. An keinem anderen Ort auf der Welt würde ich mich jemals zu Hause fühlen. In Momenten wie diesem wurde mir allerdings bewusst, dass unsere Familie statt größer kleiner wurde.
Mom seufzte. »So ein Mist.«
»Wenigstens sehen wir bei dem Mist gut aus.«
»So sind wir Waltons eben.«
Die Tür ging wieder auf, und meine Schwester Maeve gesellte sich zu uns. Sie trug einen schlichten schwarzen Hosenanzug mit Wollmantel und hielt eine dampfende Tasse Tee in der Hand. Sie sah wie immer hübsch aus, aber müde. Ich nahm mir vor, sie mir nach der Beerdigung vorzuknöpfen, um rauszufinden, was mit ihr los war.
»Wo ist Chloe?«, fragte Mom.
Maeve verdrehte die Augen. »Sie kann sich nicht zwischen zwei Outfits entscheiden.«
Maeve quetschte sich neben unserer Mutter auf das Polster.
Meine Nichte war Fashionista erster Güte. Soweit das für eine Zwölfjährige mit begrenztem Taschengeld im ländlichen Virginia möglich war.
Wir schaukelten eine Weile schweigend.
»Wisst ihr noch, wie euer Vater den Weihnachtsbaum gekauft hat, der so breit war, dass er nicht durch die Tür gepasst hat?« Mom lächelte.
»So fing das mit dem Verandaweihnachtsbaum an«, erinnerte sich Maeve.
Das versetzte mir einen Stich. Dieses Weihnachten hatte ich keinen Baum auf der Veranda aufgestellt. Im Haus auch nicht. Ich hatte lediglich bei der Spendengala in Chloes Schule den inzwischen vertrockneten Kranz gekauft. Der Krebs hatte alle Pläne in unserer Familie durchkreuzt.
Das würde ich nächstes Weihnachten wiedergutmachen, beschloss ich. Wir würden alle zusammen feiern und fröhlich sein.
Das hatte Dad sich so gewünscht. Er wollte, dass das Leben für uns weiterginge, auch wenn wir ihn schrecklich vermissten.
»Euer Vater war immer für die motivierenden Ansprachen zuständig. Jetzt werde ich das übernehmen. Das habe ich ihm versprochen. Also, wir fahren jetzt zu dem Bestattungsinstitut und verschaffen ihm die schönste Beerdigung, die diese Stadt je gesehen hat. Wir werden lachen und weinen und uns darauf besinnen, was für ein Glück wir hatten, dass er überhaupt so lange bei uns war.«
Maeve und ich nickten, uns kamen jetzt schon die Tränen. Ich blinzelte sie fort. Das Letzte, was meine Mom und meine Schwester brauchten, war eine Heulattacke meinerseits.
»Kriege ich ein ›Ja, verdammt‹?«, fragte Mom.
»Ja, verdammt«, erwiderten wir mit zitternden Stimmen.
Mom sah uns eine nach der anderen an. »Das war erbärmlich.«
»Tut mir wirklich leid, dass wir uns so wenig für Dads Beerdigung begeistern können«, gab ich trocken zurück.
Mom griff in ihre Rocktasche und zog einen Flachmann aus rosa Edelstahl heraus. »Das hier hilft vielleicht.«
»Es ist neun Uhr zweiunddreißig«, sagte Maeve.
»Ich trinke eh schon.« Ich hielt meine Tasse hoch.
Mom reichte meiner Schwester den Flachmann. »Wie euer Vater immer so schön sagte: ›Wenn wir den ganzen Tag saufen wollen, müssen wir langsam mal anfangen.‹«
Maeve seufzte. »Na schön. Aber wenn wir jetzt anfangen zu trinken, sollten wir lieber nicht selbst fahren.«
»Darauf trinke ich«, stimmte ich zu.
»Prost, Dad.« Maeve nahm einen Schluck und verzog das Gesicht.
Sie gab Mom den Flachmann zurück, und die prostete uns stumm damit zu.
Die Tür flog wieder auf, und Chloe stürmte auf die Veranda. Meine Nichte war mit einer gemusterten Strumpfhose, lila Satin-Shorts und einem gerippten Rollkragenoberteil bekleidet. Die dunklen Haare hatte sie zu zwei Knoten auf dem Kopf frisiert. Chloes Lider zierte ein dunkles Lila. »Glaubst du, das lenkt zu viel Aufmerksamkeit von Opa ab?« Sie warf sich mit in die Hüften gestemmten Händen in Pose.
»Um Himmels willen«, murmelte meine Schwester und schnappte sich wieder den Flachmann.
»Siehst wunderschön aus, meine Süße.« Mom lächelte ihr einziges Enkelkind an.
Chloe vollführte eine Pirouette. »Danke, ich weiß.«
Die pummelige, missmutige Katze, die ich mitsamt dem Haus geerbt hatte, schlich sich auf die Veranda. Dieser halbwilde Flohsack war auf den herrschaftlichen Namen Lady Mildred Meowington getauft worden. Mit der Zeit war daraus Milly Meow Meow geworden. Wenn ich sie zum achtzehnten Mal am Tag mahnte, nicht am Sofa zu kratzen, beließ ich es inzwischen bei Meow Meow oder einfach »Hey, Arschloch«.
»Geh rein, Meow Meow, sonst musst du den ganzen Tag hier draußen bleiben«, warnte ich sie.
Die Katze zeigte keine Reaktion. Stattdessen rieb sie sich an Chloes schwarzer Strumpfhose, setzte sich vor sie hin und widmete sich in aller Ruhe ihrem Katzenpoloch.
»Na lecker«, kommentierte Maeve.
»Toll. Und wie krieg ich die Haare jetzt wieder weg?«, meckerte Chloe.
»Ich hol die Fusselrolle.« Ich stand von der Schaukel auf und tippte die Katze mit dem Fuß an, bis sie sich auf den Rücken rollte und ihren dicken Bauch präsentierte. »Noch jemand Wein?«
»Ihr kennt den Spruch.« Mom zog meine Schwester auf die Füße. »Chardonnay ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.«
Der wohlig-warme Schwips begann nach ungefähr zwei Stunden zu schwinden. Ich wollte nicht hier sein, in diesem Raum mit seiner düsteren Pfauenmustertapete vor einer Urne aus Edelstahl Beileidsbekundungen entgegennehmen und mir Geschichten darüber anhören, was für ein großartiger Mann Simon Walton doch war.
Es würde keine neuen Geschichten mehr geben, wurde mir bewusst. Mein lieber, kluger, gutherziger, zerstreuter Vater war nicht mehr da.
»Ich weiß gar nicht, was wir ohne Onkel Simon machen sollen.« Meine Cousine Nessa hatte ein pausbäckiges Baby auf der Hüfte sitzen, während ihr Mann den Dreijährigen in Schach hielt, der eine Fliege um den Hals trug. Mein Dad hatte auch immer Fliegen getragen. »Er und deine Mom sind einmal im Monat zu uns gekommen, damit Will und ich ausgehen konnten.«
»Er hat gern Zeit mit euren Kindern verbracht«, versicherte ich ihr.
Meine Eltern hatten nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich eine große Familie wünschten. Deshalb hatten sie auch ein geräumiges viktorianisches Haus mit achtzehn Zimmern gekauft, in dessen riesigem Esszimmer zwanzig Leute Platz hatten. Maeve hatte pflichtbewusst ein Enkelkind in die Welt gesetzt, aber eine Scheidung und ihre äußerst erfolgreiche Karriere als Juristin hatten ein zweites vorerst unmöglich gemacht.
Und dann war da noch ich. Ich war leitende Bibliothekarin der besten öffentlichen Bücherei weit und breit, rackerte mich ab, um unseren Bestand zu vergrößern und die Angebote zu verbessern. Hochzeit und Kindern war ich nicht näher als mit dreißig. Und das war auch schon eine ganze Weile her.
Nessas Baby machte mit der Zunge Geräusche und sah mich überaus selbstgefällig an.
»Oh-oh«, sagte meine Cousine.
Ich folgte ihrem Blick zu dem Kleinkind, das seinem Vater zu entwischen versuchte, indem es im Kreis um den Urnensockel herumrannte.
»Halt mal.« Nessa gab mir das Baby. »Mama muss schnell und unauffällig ein Unglück verhindern.«
»Weißt du, was?«, sagte ich zu dem Baby, »meinem Dad würde es bestimmt gefallen, wenn dein Bruder aus Versehen seine Asche verschüttet. Er würde sich kaputtlachen.«
Das Baby schaute mich aus den größten blauesten Augen an, die ich je gesehen hatte. Der spärliche blonde Flaum auf dem Kopf war fein säuberlich mit einer frechen rosa Schleife gebunden. Das Kind streckte ein sabberfeuchtes Händchen aus und fuhr mir mit dem Finger über die Wange.
Das zahnlose Lächeln überraschte mich genauso wie das fröhliche Glucksen, das irgendwo aus dem runden Bäuchlein kam. Ein überschäumendes Glücksgefühl stieg in mir auf.
»Krise abgewendet.« Nessa war zurück. »Oooh, sie mag dich!«
Meine Cousine nahm mir ihre Tochter wieder ab, und mich wunderte, wie schnell ich das warme Etwas auf meinem Arm vermisste. Leicht benebelt sah ich der kleinen Familie nach, die sich auf meine Mutter und meine Schwester zubewegte.
Ich hatte gehört, wie Schnuppern an einem Babyköpfchen die biologische Uhr zum Ticken bringen konnte, aber dass dieser Countdown bei einer Beerdigung losging?
Natürlich wollte ich eine Familie haben. Ich hatte immer gedacht, das würde sich schon fügen … nach dem College, als ich meinen ersten Job hatte, oder mit meinem Traumjob in meiner Heimatstadt, dann nach dem Umzug der Bibliothek in das neue Gebäude.
Ich wurde auch nicht jünger. Wenn ich eine eigene Familie wollte, dann musste ich mich jetzt darum kümmern.
Shit.
Evolutionsbedingte Instinkte übernahmen das Ruder, und ich fasste Bud Nickelbee ins Auge, der mir gerade sein Beileid aussprach. Bud, die Bohnenstange, trug immer Latzhosen. Weil ich selbst Brillenträgerin war, störte mich sein John-Lennon-Gestell nicht. Aber sein langer grauer Pferdeschwanz und sein Plan, später einmal in aller Abgeschiedenheit in Montana zu leben – das war ein echtes No-Go.
Ich brauchte einen Mann, der jung genug war, sich mit mir durch das Babyalter zu quälen. Und das am besten hier, mit einer vernünftigen Infrastruktur in der Nähe.
Das Thema biologische Uhr wurde von Knox und Naomi Morgan in den Hintergrund gedrängt. Der bärtige Bad Boy von Knockemout hatte sich letztes Jahr Hals über Kopf in Naomi verliebt, als sie hier aufgetaucht war. Es war die Lovestory schlechthin.
Apropos evolutionsbedingte Instinkte, der grummelige Knox im Anzug – mit leicht schiefer Krawatte, als wäre es ihm einfach zu blöd, sie richtig zu binden – war eindeutig vaterschaftstauglich. Sein breitschultriger Bruder Nash in kompletter Polizeiuniform stand hinter ihm und hielt besitzergreifend die Hand seiner Verlobten, der wunderschönen und stylishen Lina. Beide Männer wären erstklassige Samenspender.
Ich konzentrierte mich. »Danke, dass ihr da seid.«
Naomi sah in ihrem dunkelblauen Wollkleid sehr weiblich aus, ihr brünettes Haar lag in schwungvollen Wellen. Als wir uns umarmten, roch es entfernt nach Möbelpolitur. Immer, wenn Naomi gestresst, gelangweilt oder fröhlich war, putzte sie. Das war ihre Liebessprache.
»Das mit Simon tut uns leid. Er war so ein toller Mensch«, sagte sie. »Ich bin froh, dass ich ihn Thanksgiving kennengelernt habe.«
»Ich auch.«
Das war die letzte offizielle Feier bei den Waltons gewesen. Das Haus war aus allen Nähten geplatzt, so viele Freunde und Familie waren da gewesen. Und Essen. Unfassbar viel Essen.
Ich musste mich zusammenreißen, um nicht loszuheulen. Es hörte sich an, als hätte ich einen Schluckauf, als ich mich von Naomi löste.
»Sorry, zu viel Wein zum Frühstück«, meinte ich leichthin.
Unsere Freundin Lina in ihrem sexy Hosenanzug und den beneidenswerten Stilettos trat vor. Sie sah mich voller Mitleid an und umarmte mich unbeholfen. Lina stand nicht gerade auf Körperkontakt, außer bei Nash. Daher wusste ich die Geste umso mehr zu schätzen.
»Das ist echt scheiße«, flüsterte sie und ließ mich wieder los.
»Ja. Da hast du recht.« Ich räusperte mich und schluckte die Tränen runter. Wut konnte ich. Wut war einfach, sauber, sogar machtvoll. Die komplizierteren Gefühle teilte ich einfach nicht so gern mit anderen.
Lina trat zurück und schlüpfte unter Nashs Arm. »Was machst du nach dem ganzen Rummel hier?«
Ich wusste genau, warum sie das fragte. Die beiden wären für mich da, wenn ich sie darum bat. Ach was, selbst wenn ich nicht darum bat.
»Mom ist über Nacht mit ein paar Freundinnen in einem Wellnesshotel, und Maeve hat die Gäste von außerhalb zu einem Familienessen eingeladen.« Das stimmte. Es kamen wirklich Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen zu Besuch. Aber ich hatte mir fest vorgenommen, eine Migräne vorzuschützen und mich zu Hause so richtig in meiner Trauer zu suhlen.
»Lass uns uns bald mal treffen. Aber nicht bei der Arbeit«, fügte Naomi streng hinzu. »Nimm dir so lange wie nötig frei.«
»Ja. Mach ich. Danke.«
Meine Freundinnen gingen weiter in Richtung meiner Mom und ließen ihre zukünftigen Baby-Daddys bei mir stehen.
»Echt beschissen, der ganze Scheiß«, brummte Knox und nahm mich in den Arm.
Ich lächelte an seiner Brust. »Kannst du laut sagen.«
»Wenn du irgendwas brauchst, Sloaney Baloney.« Nash umarmte mich ebenfalls. Er musste den Satz gar nicht beenden. Wir waren zusammen aufgewachsen. Ich wusste, dass ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Genauso wie auf Knox, auch wenn der das nicht aussprach. Er würde einfach auftauchen, mit grimmiger Miene irgendwas Nettes für mich tun und dann sauer werden, wenn ich mich bedanken wollte.
»Danke, Leute.«
Nash trat zurück und ließ den Blick über die Menge schweifen, die aus dem Saal ins Foyer strömte. Selbst bei einer Beerdigung achtete unser Polizeichef wie ein Hütehund auf die Sicherheit seiner Herde. »Wir haben nie vergessen, was dein Dad für Lucian getan hat.«
Ich verkrampfte mich. Immer, wenn jemand seinen Namen aussprach, klingelte es in meinem Kopf, als hätte der Name irgendwas zu bedeuten. Aber das tat er nicht. Nicht mehr.
»Na ja, Dad hat in seinem Leben einer Menge Menschen geholfen«, sagte ich verlegen.
Das stimmte. Simon Walton hatte als Anwalt, Coach, Mentor und Vater viel Gutes getan. Wenn ich darüber nachdachte, waren er und seine Vollkommenheit wahrscheinlich auch der Grund für mein bislang ehe- und babyloses Dasein. Wie sollte ich auch einen Lebenspartner finden, wenn niemand an das heranreichen konnte, was meine Eltern miteinander gehabt hatten?
»Wenn man vom Teufel spricht«, raunte Knox.
Wir richteten alle den Blick auf den hinteren Eingang, der durch den düster dreinblickenden Mann in einem sauteuren Anzug plötzlich geschrumpft wirkte.
Lucian Rollins. Seine Freunde nannten ihn Luce oder Lucy, aber derer gab es nicht viele. Ich und seine zahlreichen anderen Feinde nannten ihn Luzifer.
Ich hasste es, wie mein Körper auf den Mann reagierte, wann immer er einen Raum betrat. Dieses Kribbeln, als würden meine Nerven zeitgleich die gleiche Botschaft empfangen.
Mit dem angeborenen biologischen Mechanismus, der vor einer drohenden Gefahr warnte, konnte ich umgehen. Nicht umgehen konnte ich allerdings damit, wie sich das Kribbeln augenblicklich in ein warmes, glückseliges Ach, da bist du ja verwandelte, als hätte ich mit angehaltenem Atem auf ihn gewartet.
Ich hielt mich eigentlich für eine offene, tolerante und einigermaßen reife Erwachsene. Aber Lucian konnte ich nicht ertragen. Seine bloße Existenz triggerte mich. Genau das wurde mir jedes Mal bewusst, wenn er irgendwo auftauchte, als hätte ihn irgendein blöder, verzweifelter Anteil in mir heraufbeschworen. Bis mir einfiel, dass er nicht mehr der hübsche, verwegene Junge aus meinen jugendlichen Bücherwurmfantasien war.
An seine Stelle war ein kühler, erbarmungsloser Mann getreten, der mich ebenso sehr hasste wie ich ihn.
Unsere Blicke trafen sich. Da waren Vertrautheit und Unbehagen.
Wie seltsam, ein Geheimnis mit dem Jungen zu teilen, den ich einmal geliebt hatte, und es nun mit dem Mann zu teilen, den ich nicht ausstehen konnte.
Er bahnte sich einen Weg durch die Menge, seine Macht und sein Reichtum waren offenbar.
Aber er kam nicht zu mir. Er ging direkt zu meiner Mutter.
»Mein lieber Junge.« Mom breitete die Arme aus, und Lucian drückte sie mit beunruhigender Vertrautheit an sich.
Ihr lieber Junge? Lucian war ein vierzigjähriger Größenwahnsinniger.
Die Morgan-Brüder gesellten sich zu ihrem Freund und meiner Mom.
»Wie geht’s denn, Sloane?« Mrs Tweedy, Nashs ältere und fitnessverrückte Nachbarin, trat vor. Sie trug einen schwarzen Velours-Trainingsanzug und ein schickes Stirnband.
»Mir geht’s ganz gut. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.« Ich schüttelte ihre schwielige Hand.
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Mom sich aus Lucians Umarmung löste. »Ich kann dir gar nicht genug danken für das, was du für Simon getan hast. Für mich. Für unsere Familie«, sagte sie unter Tränen.
Ähm, wie bitte?
Mein Gott, wie schön er war. Wie von den Göttern geschaffen. Was für umwerfend schöne Dämonenbabys er zeugen würde.
Nein. Nein. Ganz bestimmt nicht. Lucian Rollins war bestimmt kein potenzieller Fortpflanzungspartner für mich.
Ich verrenkte mir den Hals, um meine Mutter und Lucian zu belauschen.
»Ich stehe in eurer Schuld«, sagte er mit belegter Stimme.
Worüber zum Teufel redeten die da? Klar, meine Eltern und Lucian hatten sich nahegestanden, als er der missratene Teenie von nebenan gewesen war. Aber das hier schien sich auf etwas zu beziehen, das neueren Datums war. Warum wusste ich nichts davon?
Vor meinem Gesicht schnippte jemand mit den Fingern und riss mich aus den Gedanken.
»Alles gut bei dir, Kleines? Du siehst blass aus. Willst du was essen? Ich hab einen Proteinriegel und einen Flachmann dabei.« Mrs Tweedy wühlte in ihrer Sporttasche.
»Alles in Ordnung, Sloane?« Mom und Lucian sahen mich an.
»Alles gut«, versicherte ich ihr eilig.
»Sie war wie weggetreten«, petzte Mrs Tweedy.
»Wirklich, mir geht’s gut«, beharrte ich und mied Lucians Blick.
»Du stehst hier seit über zwei Stunden. Geh doch mal an die frische Luft«, schlug Mom vor. Ich wollte gerade anmerken, dass sie genauso lange hier gestanden hatte wie ich, als sie sich an Lucian wandte. »Wärst du so nett, sie zu begleiten?«
Er nickte und stand plötzlich direkt neben mir. »Ich komme mit.«
»Nicht nötig.« Erschrocken machte ich einen Schritt zurück. Ein großer Aufsteller mit Trauergebinde versperrte mir den Fluchtweg. Ich stieß mit dem Po dagegen, und die Blumen der Feuerwehr von Knockemout gerieten ins Wanken.
Lucian verhinderte, dass der Kranz umfiel, und legte mir seine große warme Hand auf den unteren Rücken. Es war, als würde mir ein Blitz in die Wirbelsäule fahren.
Es war keine bewusste Entscheidung von mir, mich von ihm aus dem brütend heißen Raum führen zu lassen, aber so war es eben, ich gehorchte ihm wie ein gut erzogener Golden Retriever.
Naomi und Lina sahen mich besorgt an.
Lucian brachte mich zur Garderobe, und keine Minute später stand ich vor dem Bestattungsinstitut auf dem Bürgersteig, kein Gedränge und kein Stimmengewirr mehr. Ein düsterer, winterlicher Mittwoch. In der Kälte beschlug meine Brille sofort.
»Hier.« Genervt hielt Lucian mir einen Mantel hin.
Er war groß, dunkel und böse.
Ich war klein, schön und stark.
»Gehört mir nicht«, erwiderte ich.
»Aber mir. Zieh ihn an, sonst erfrierst du noch.«
»Wenn ich ihn anziehe, verschwindest du dann?«
Ich wollte allein sein. Durchatmen. Hoch in die Wolken schauen und meinem Vater sagen, dass er mir fehlte und dass ich mich, sollte es schneien, hinlegen und Schnee-Engel für ihn machen würde.
»Nein.« Er nahm die Sache in die Hand und legte mir den Mantel um die Schultern.
Er war aus dicker Wolle, vielleicht Kaschmir, mit einem seidig glänzenden Futter. Schwer. Sexy. Er hing an mir wie eine Gewichtsdecke. Und roch … Himmlisch war nicht das richtige Wort. Herrlich gefährlich. Der Duft dieses Mannes war ein Aphrodisiakum.
»Hast du heute schon was gegessen?«
Ich blinzelte. »Was?«
»Ob du heute schon was gegessen hast?« Ungeduldig betonte er jedes Wort.
»Nicht in diesem Ton, Luzifer«, sagte ich, allerdings mit weniger Wut als sonst.
»Also nicht.«
»Entschuldige bitte, dass wir Whiskey und Wein zum Frühstück hatten.«
»Mein Gott«, murmelte er und griff nach mir.
Statt einen Satz nach hinten zu machen oder ihm einen Schlag gegen den Hals zu verpassen, blieb ich verdattert stehen. War das ein ungeschickter Versuch, mich zu umarmen? Oder wollte er mich betatschen?
»Was machst du da?«, quietschte ich.
»Stillhalten«, befahl er. Seine Hände verschwanden in den Manteltaschen.
Er war genau dreißig Zentimeter größer als ich. Das wusste ich, weil wir uns mal gemessen hatten. Die Bleistiftmarkierung war immer noch am Türrahmen in meiner Küche zu sehen. Teil der Geschichte, die wir beide zu leugnen vorgaben.
Er holte eine einzelne Zigarette und ein elegantes silbernes Feuerzeug hervor.
Nicht mal schlechte Angewohnheiten hatten Lucian Rollins unter Kontrolle. Der Mann gestattete sich eine einzige Zigarette pro Tag. Wie nervig.
»Sicher, dass du jetzt schon deine einzige Raucherpause machen willst? Ist ja noch nicht mal Mittag.«
Er starrte mich schweigend an, zündete die Zigarette an, steckte das Feuerzeug wieder ein und nahm sein Handy. Seine Daumen flogen über das Display, dann schob er das Gerät wieder in die Tasche. Er riss die Zigarette aus dem Mund und atmete den blauen Rauch aus, ohne mich aus den Augen zu lassen.
»Ich brauch keinen Babysitter. Du hast dich blicken lassen, jetzt kannst du wieder gehen. Hast sicher Wichtigeres zu tun, als an einem Mittwoch in Knockemout rumzuhängen.«
Er musterte mich über seine Zigarette hinweg und schwieg weiterhin. Wie immer schien er fasziniert und abgestoßen. So wie ich, wenn ich die Schnecken in meinem Garten beobachtete.
Ich verschränkte die Arme. »Na schön. Wenn du unbedingt bleiben willst, warum hat meine Mom gesagt, sie schuldet dir was?«
Er betrachtete mich weiter schweigend.
»Lucian.«
»Sloane.« Mein Name klang rau, wie eine Warnung. Und obwohl mir die Kälte den Rücken raufkroch, spürte ich etwas Warmes und Gefährliches in mir erwachen.
»Musst du immer so ätzend sein?«, fragte ich.
»Ich will mich heute nicht mit dir streiten. Nicht hier.«
Sofort schossen mir heiße Tränen in die Augen. Wie demütigend.
»Es werden keine neuen Geschichten mehr dazukommen«, murmelte ich.
»Was?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nichts.«
»Du sagtest, es werden keine neuen Geschichten mehr dazukommen«, hakte er nach.
»Hab nur Selbstgespräche geführt. Ich werde nie wieder eine neue Erinnerung an meinen Dad haben.« Es war mir so peinlich, wie mir die Stimme brach.
»Fuck«, brummte Lucian. »Setz dich.«
Ich war so sehr damit beschäftigt, meine Tränen vor meinem schlimmsten Feind zu verbergen, dass ich kaum registrierte, wie unsanft er mich auf den Bordstein drückte. Wieder durchsuchte er die Manteltaschen und hielt mir ein Taschentuch vors Gesicht.
Ich zögerte.
»Wenn du dir mit meinem Mantel die Nase putzt, musst du mir einen neuen kaufen, und das kannst du dir nicht leisten«, warnte er.
Ich riss ihm das Taschentuch aus der Hand.
Er setzte sich neben mich, wobei er darauf achtete, mehrere Zentimeter zwischen uns Platz zu lassen.
Wir schwiegen, und ich gab mir Mühe, mich wieder unter Kontrolle zu bekommen.
»Du hättest mich auch mit einem netten normalen Streit ablenken können«, beschwerte ich mich.
Seufzend stieß er noch eine Rauchwolke aus. »Also gut. Es war bescheuert und selbstsüchtig von dir, heute Morgen nichts zu essen. Jetzt macht sich deine Mutter dadrin Sorgen um dich, was einen ohnehin schlimmen Tag für sie noch schlimmer macht. Deine Schwester und deine Freunde machen sich ebenfalls Sorgen um dich. Jetzt passe ich hier draußen auf, dass du nicht umkippst, damit sie weiter trauern können.«
Ich setzte mich gerade hin. »Vielen Dank für deine Anteilnahme.«
»Du hast heute nur eine Aufgabe. Deine Mutter zu stützen. Für sie da zu sein. Ihre Trauer zu teilen. Tu, was auch immer sie heute braucht. Du hast deinen Dad verloren, aber sie ihren Mann. Du kannst später noch trauern. Aber heute geht es um sie.«
»Du bist so ein Arsch, Luzifer.« Ein scharfsinniger Arsch, der gar nicht mal so unrecht hatte.
»Reiß dich zusammen, Pixie.«
Der alte Spitzname brachte das Fass zum Überlaufen. Ich war voller Zorn. »Du bist so ein arroganter, besserwisserischer …«
Ein verbeulter Pick-up mit Knockemout Diner-Aufklebern an den Türen bremste mit quietschenden Reifen direkt vor uns, und Lucian gab mir seine Zigarette.
Er stand auf, als das Seitenfenster runtergelassen wurde.
»Bitte sehr, Mr Rollins.« Bean Taylor, der dürre, hektische Geschäftsführer des Diners, beugte sich aus dem Auto und reichte Lucian eine Papiertüte. Bean aß ununterbrochen frittierte Diner-Leckereien, ohne je ein Gramm zuzunehmen. Sobald er einen Salat anrührte, wurde er dick.
Lucian gab Bean einen Fünfzig-Dollar-Schein. »Stimmt so.«
»Danke, Mann! Tut mir echt leid mit deinem Dad, Sloane«, rief der durchs Fenster.
Ich lächelte schwach. »Danke, Bean.«
»Muss wieder los. Meine Frau schmeißt gerade den Laden, der brennen immer die Hash Browns an.«
Er fuhr davon, und Lucian legte mir die Tüte in den Schoß.
»Iss.«
Dann drehte er sich um und ging wieder in das Beerdigungsinstitut.
»Dann behalte ich den Mantel eben«, rief ich ihm hinterher.
Ich sah ihm nach, und als ich sicher war, dass er verschwunden war, öffnete ich die Tüte und fand in Alufolie verpackt meinen Lieblings-Frühstücksburrito vor. Der Diner lieferte eigentlich nicht aus. Und Lucian hätte eigentlich nicht wissen dürfen, was ich am liebsten zum Frühstück aß.
»Zum Aus-der-Haut-Fahren«, murmelte ich und hielt mir kurz den Filter der Zigarette an die Lippen, sodass ich ihn beinahe schmecken konnte.
2 Behalt den Mantel und lass mich in Frieden
Lucian
Als ich in die Auffahrt des mir verhassten Hauses bog, schneite es bereits seit fast einer Stunde dicke Flocken. Ich atmete tief durch und lehnte mich gegen den beheizten Ledersitz meines Range Rovers. Die Scheibenwischer schoben ächzend den Schnee hin und her.
Wie es aussah, würde ich wohl hier übernachten müssen. Als hätte ich das nicht ohnehin vorgehabt.
Als hätte ich keine Reisetasche auf dem Rücksitz.
Als hätte ich nicht den albernen Drang, in der Nähe zu bleiben. Nur für alle Fälle.
Ich drückte auf die Fernbedienung für das Garagentor und sah im Licht der Scheinwerfer zu, wie es leise aufging.
Auf meinem Armaturenbrett blinkte ein Anruf auf.
Special Agent Idler.
»Ja?«
»Ich dachte, es interessiert Sie vielleicht, dass seit dem Sommer niemand irgendwas von Felix Metzer gehört oder gesehen hat«, kam sie direkt zur Sache. Die FBI-Agentin hatte noch weniger für sinnlosen Small Talk übrig als ich.
»Wie ungünstig.« Ungünstig, aber nicht völlig unerwartet.
»Lassen Sie uns das Ganze abkürzen und sagen Sie mir einfach gleich, dass Sie nichts mit seinem Verschwinden zu tun haben«, sagte sie unverblümt.
»Meine Kooperation bei dieser Ermittlung sollte doch wenigstens zur Unschuldsvermutung gereichen.«
»Wir wissen beide, dass Sie die Möglichkeit haben, jeden verschwinden zu lassen, der Ihnen lästig ist.«
Ich warf einen Blick auf das abstruse Nachbarhaus. Ausnahmen bestätigten die Regel.
Ich hörte ein Feuerzeug klicken, dann einen scharfen Atemzug, und wünschte, ich hätte meine einzige Zigarette des Tages nicht schon geraucht. Sloanes Schuld. In ihrer Nähe schwächelte meine Selbstbeherrschung.
»Hören Sie, ich weiß, dass Sie Metzer wahrscheinlich nicht zerstückelt und an Ihre abgerichteten Piranhas verfüttert haben, oder was auch immer Reiche sich im Aquarium halten. Ich bin einfach angepisst. Unser nichtsnutziger Clanspross hat uns den Namen genannt, wir haben uns abgemüht, aber auch die Spur führt bloß ins Leere.«
Je länger mein Team mit Idlers Team zusammenarbeitete, desto weniger nervte sie mich. Ich bewunderte ihren unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn, auch wenn ich selbst auf Rache aus war.
»Vielleicht ist er untergetaucht.«
»Hab kein gutes Gefühl bei der Sache«, erwiderte Idler. »Da will jemand aufräumen. Würde mich echt ankotzen, wenn ich deswegen nicht dazu komme, Anthony Hugo höchstpersönlich die Zellentür vor der Nase zuzuhauen.«
»Ich kümmere mich.« Einen Mann wie Anthony Hugo würde ich bestimmt nicht ungeschoren davonkommen lassen, nachdem er Menschen wehgetan hatte, die mir wichtig waren.
»Bis Metzer oder seine Leiche auftauchen, stecken wir wieder mal in der Sackgasse.«
»Mein Team arbeitet daran, Hugos Finanzen zu entwirren. Da finden wir schon, was wir brauchen«, versprach ich. Hugo war gut, aber ich war besser und beharrlicher.
»Für einen Zivilisten, der bald Opfer der Aufräumarbeiten werden könnte, sind Sie aber verdammt gelassen.«
»Wenn Hugo es auf mich abgesehen hat, muss er sich warm anziehen«, erwiderte ich.
»Wie dem auch sei, tun Sie nichts Unüberlegtes. Zumindest nicht, bevor Sie mir was Handfestes gegen den Bastard geliefert haben.«
Mein Team hatte ihr schon das eine oder andere geliefert, aber das FBI wollte eine wasserdichte Anklage, die ihn lebenslang hinter Gitter brachte. Dafür würde ich schon sorgen.
»Ich tu mein Bestes. Solange Sie sich nicht einfallen lassen, irgendwelche Deals zu machen, die mein Umfeld in Gefahr bringen.« Mein Blick streifte wieder das Haus nebenan. Immer noch alles dunkel.
»Hugo ist der dicke Fisch. Es wird keine Deals geben«, versprach Idler.
Ich betrat den Vorraum, der mit Garderobe und Schränken perfekt für eine Familie eingerichtet war, die es nicht gab. Die Möbel, die Oberflächen, selbst der Grundriss des Hauses hatten sich verändert. Aber weder ein neuer Anstrich noch neue Teppiche oder neues Mobiliar konnten die Erinnerungen löschen.
Ich hasste immer noch alles.
Auch finanziell ergab es keinen Sinn, dieses gottverdammte Haus zu behalten. Aber hier stand ich nun. Übernachtete wieder einmal hier, als könnte ich die Macht bannen, die es über mich hatte, wenn ich nur genug Zeit hier verbrachte.
Es wäre so viel klüger, es einfach zu verkaufen und damit abzuschließen.
Genau deshalb war ich letzten Sommer zurückgekehrt. Aber ein Blick in diese grünen Augen – kein sanftes Moosgrün, nein, in Sloane Waltons Augen loderten smaragdfarbene Flammen –, ein Blick, und all meine Pläne waren dahin.
Es ging mir gegen den Strich, dass der Grund für mein Leben in D. C. an so etwas erbärmlich Zerbrechlichem hing. Dass ich so erbärmlich zerbrechlich war.
Sobald ich sicher sein konnte, dass für die Waltons gesorgt war, würde ich hier endgültig alle Zelte abbrechen.
Ich schaltete das Licht in der Küche ein, alles sauber in Grau und Weiß, und starrte den Kühlschrank aus Edelstahl an.
Hunger hatte ich keinen. Beim Gedanken an Essen wurde mir leicht übel. Ich wollte noch eine Zigarette. Einen Drink. Aber ich war sehr diszipliniert. Ich traf Entscheidungen, die mich stärker und klüger machten. Ich gewichtete langfristige Ziele immer höher als schnelle Befriedigung.
Ich öffnete das Gefrierfach und griff nach irgendeiner Packung, zog den Deckel ab und erwärmte den Inhalt in der Mikrowelle.
Ich ließ der Trauer Raum.
Ich wollte kämpfen. Wüten. Zerstören.
Ein guter Mann war gestorben. Und ein anderer, ein böser, war so gut wie ungestraft davongekommen. Und in beiden Fällen konnte ich nichts daran ändern. Trotz all des Vermögens, das ich angehäuft hatte, war ich wieder einmal machtlos.
»Sieht schon besser aus hier«, hatte Simon gesagt, als er durch die offene Garagentür reingeschlendert war.
Ich war verschwitzt und schmutzig gewesen und war der Trockenbauwand und den Geistern mit dem Vorschlaghammer zu Leibe gerückt.
»Findest du?«, hatte mein Mitte-zwanzig-Ich gefragt. Es hatte ausgesehen, als wäre die Küche explodiert.
»Manchmal muss man erst alles einreißen, bevor man es wieder aufbauen kann. Soll ich dir helfen?«
Und einfach so hatte der Mann, der mir das Leben gerettet hatte, sich einen Hammer geschnappt und mir geholfen, die hässlichsten Teile meiner Vergangenheit dem Erdboden gleichzumachen.
Es klingelte, und ich hob den Kopf. Ich überlegte, den Störenfried einfach zu ignorieren. Aber es klingelte erneut.
Genervt riss ich die Tür auf, und mein Herz geriet ins Stolpern. So war das immer, wenn ich sie unerwartet sah. Etwas in mir, tief drinnen, sah sie und wollte sie festhalten. Als sei sie ein Lagerfeuer, das in dunkler Nacht Wärme und Güte versprach.
Aber ich wusste es besser. Sloane bot keine Wärme. Sondern Verbrennungen dritten Grades.
Sie trug immer noch das schwarze Kleid von der Beerdigung, aber statt der High Heels, mit denen sie mir weiter die Brust raufreichte, hatte sie nun Schneestiefel an. Und meinen Mantel.
Sie schob sich mit einer Papiertüte in der Hand an mir vorbei.
»Was machst du da?«, wollte ich wissen, als sie durch den Flur ging. »Du solltest eigentlich bei deiner Schwester sein.«
»Spionierst du mir nach, Luzifer? Mir war heute Abend nicht nach Gesellschaft«, rief sie über die Schulter.
»Was willst du dann hier?« Ich folgte ihr durchs Haus, wollte sie auf keinen Fall hierhaben.
»Du zählst nicht als Gesellschaft.« Sie warf den Mantel auf die Küchenanrichte. Ich fragte mich, ob er nach ihr roch oder ob sie, nachdem sie ihn getragen hatte, nun nach mir roch.
Sloane öffnete einen Schrank nach dem anderen. Stellte sich auf die Zehenspitzen. Der Saum ihres Kleides rutschte nach oben, und mir fiel auf, dass sie auch die Strumpfhose ausgezogen hatte. Einen kurzen, schwachsinnigen Augenblick fragte ich mich, ob sie noch mehr ausgezogen hatte, dann riss ich meine Aufmerksamkeit von ihrer Haut los.
Ich wusste nicht genau, wann es passiert war. Wann das Mädchen von nebenan sich in die Frau verwandelt hatte, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging.
Sloane fand einen Teller und kippte den Inhalt der fettigen braunen Tüte schwungvoll darauf.
»Da, jetzt sind wir quitt«, verkündete sie. Der winzige Stecker in ihrer Nase funkelte. Wäre sie mein, wäre es ein echter Diamant.
»Was ist das?«
»Abendessen. Du hast mit deinem Frühstücksburrito einen vorgelegt. So bin ich dir nichts mehr schuldig.«
Zwischen uns gab es kein »Danke« und kein »Gern geschehen«. Wäre ohnehin nicht ehrlich gemeint gewesen. Aber wir fühlten uns beide genötigt, die Waage im Gleichgewicht zu halten.
Ich schaute runter auf den Teller. »Was ist das?«
»Echt jetzt? Wie reich muss man sein, damit man einen Burger und Pommes nicht erkennt? Ich wusste nicht, was du magst, also hab ich genommen, was ich mag.« Sie setzte sich auf den Tresen, schnappte sich eine Pommes vom Teller und aß sie mit zwei Bissen auf.
Sie sah müde und aufgedreht zugleich aus.
Ich griff um sie herum und nahm mir eine Pommes vom Teller. Nichts als ein Vorwand, ihr näher zu kommen. Mich zu testen.
»Wieso bist du hier, Sloane?«
Sie nahm sich noch eine Pommes und zeigte damit auf mich. »Weil ich wissen will, warum meine Mom dich heute wie den verlorenen Sohn der Waltons begrüßt hat. Was glaubt sie, dir schuldig zu sein? Worüber habt ihr da geredet?«
Das würde ich ihr bestimmt nicht erzählen.
»Hey, es ist schon ziemlich spät. Ich bin müde. Geh lieber nach Hause.«
»Es ist gerade mal halb sechs, nerv nicht.«
»Ich will nicht, dass du hier bist.« Die Wahrheit rutschte mir einfach so raus.
Sie setzte sich aufrechter hin, machte aber keine Anstalten, zu gehen. Mein Temperament hatte ihr noch nie groß imponiert. Das war Teil des Problems. Entweder überschätzte sie ihre Unverwundbarkeit, oder sie unterschätzte, was in mir lauerte.
Sie legte den Kopf schief und warf sich das lange blonde Haar über die Schulter. Sie hatte es anders getönt, statt verblasstem Himbeerrosa hatte sie nun silbrige Spitzen. »Weißt du, woran ich heute während der Feier die ganze Zeit denken musste?«
Sie hatte, ebenso wie ihre Mutter und ihre Schwester, sehr gewählt und emotional vor den Trauergästen gesprochen. Aber berührt hatten mich die einzelne Träne, die ihr über die Wange gerollt war, und die weiteren, die sie mit meinem Taschentuch abgewischt hatte.
»An zehn neue Möglichkeiten, wie du mir auf den Zeiger gehen kannst, zum Beispiel, indem du meine Privatsphäre verletzt?«
»Wie froh es Dad gemacht hätte, wenn wir wenigstens so getan hätten, als würden wir uns verstehen.«
Ihr Schlag war meisterhaft ausgeführt. Schlechtes Gewissen war eine scharfe Waffe. Simon wäre entzückt gewesen, wenn seine Tochter und sein »Schützling« zumindest einigermaßen freundlich miteinander umgegangen wären.
»Aber das ist ja jetzt nicht mehr nötig«, fuhr sie fort und sah mir fest in die Augen. In ihrem Blick lag nichts Freundliches. Nur Schmerz und Trauer, die ich ebenso empfand. Aber wir würden sicher nicht gemeinsam trauern.
»Sehe ich auch so.«
Sie seufzte und sprang vom Tresen. »Cool. Dann geh ich mal.«
»Nimm den Mantel.« Ich hielt ihn ihr hin. »Es ist kalt.«
Sie schüttelte den Kopf. »Dann müsste ich ihn ja zurückbringen, und ich will lieber nicht noch mal hierherkommen.« Sie sah sich kurz um, und mir wurde klar, dass auch für sie ein paar Geister hier rumspukten.
»Nimm den Scheißmantel, Sloane.« Meine Stimme war rau. Ich drückte ihn ihr in die Hand, ließ ihr keine Wahl.
»Bist du meinetwegen hier?«, fragte sie plötzlich.
»Was?«
»Du hast mich schon verstanden. Bist du meinetwegen hier?«
»Ich bin gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Dein Vater war ein guter Mensch, und deine Mutter war immer nett zu mir.«
»Warum bist du diesen Sommer zurückgekommen?«
»Weil meine ältesten Freunde sich aufgeführt haben wie Kinder.«
»Und ich habe dabei keine Rolle gespielt?«, bohrte sie.
»Tust du nie.«
Sie nickte knapp. In ihrem hübschen Gesicht war keinerlei Regung zu erkennen. »Gut.« Sie nahm mir den Mantel ab und schob die Arme durch die zu langen Ärmel. »Wann verkaufst du das Haus?« Sie zog das silberblonde Haar aus dem Kragen.
»Im Frühjahr.«
»Gut«, wiederholte sie. »Wäre schön, zur Abwechslung mal anständige Nachbarn zu haben.«
Dann verließ Sloane Walton mein Haus, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Ich aß den kalten Burger mit Pommes anstelle des TK-Gerichts, das ich mir aufgewärmt hatte, wusch den Teller ab und stellte ihn zurück in den Schrank. Dann wischte ich alle Spuren vom Tresen und Boden, die mein ungebetener Gast hinterlassen haben könnte.
Ich war müde. Das war nicht gelogen. Ich wollte nur noch heiß duschen und mich mit einem guten Buch ins Bett legen. Schlafen würde ich nicht. Erst, wenn sie eingeschlafen war. Außerdem hatte ich noch zu tun. Ich ging hoch in mein altes Zimmer, das ich jetzt vor allem als Büro benutzte.
Ich setzte mich an den Schreibtisch vor das große Erkerfenster, durch das ich den Garten und Sloanes Haus sehen konnte. Mein Handy meldete eine eingegangene Nachricht.
Karen: Es ist wunderbar hier. Genau das Richtige nach so einem Tag. Vielen Dank noch mal, das war sehr aufmerksam und großzügig von dir. PS: Meine Freundin würde dir gerne mal ihre Tochter vorstellen.
Dazu schickte Sloanes Mutter ein zwinkerndes Emoji und ein Selfie von sich mit ihren Freundinnen, die alle gleiche Bademäntel trugen und grünen Matsch im Gesicht hatten. Sie hatten rote, geschwollene Augen, aber ihr Lächeln wirkte echt. Manche Menschen konnten das Allerschlimmste überstehen, ohne dass ihre Seelen Schaden nahmen. Die Waltons zum Beispiel. Ich hingegen war schon beschädigt zur Welt gekommen.
Ich: Gern geschehen. Keine Töchter bitte.
Ich scrollte durch den Rest der Nachrichten, bis ich den Verlauf gefunden hatte, nach dem ich suchte.
Simon: Hätte ich mir in diesem Leben einen Sohn aussuchen können, wärst du es gewesen. Pass auf meine Mädchen auf.
Die letzte Nachricht, die ich von dem Mann bekam, den ich so geschätzt hatte. Der Mann, der so töricht angenommen hatte, mich retten zu können. Ich lockerte die Finger und wünschte mir schon wieder, ich hätte mir die eine Zigarette des Tages aufgespart. Stattdessen presste ich mir die Handballen auf die Augen und kämpfte gegen das Brennen an, das ich dort spürte.
Dann nahm ich das Handy wieder in die Hand und scrollte durch meine Kontakte. Sie sollte nicht allein sein, rechtfertigte ich mich vor mir selbst.
Ich: Sloane ist nicht bei ihrer Schwester. Sie ist allein zu Hause.
Naomi: Danke für den Hinweis. Ich hatte so ein Gefühl, sie würde sich heimlich abseilen. Lina und ich kümmern uns drum.
Meine Pflicht war getan, also fuhr ich meinen Laptop hoch und begann, einen Finanzbericht zu lesen. Ich erhielt einen Anruf.
Emry Sadik.
Ich beschloss, mich lieber in meinem Unglück zu suhlen, als darüber zu reden, also ließ ich die Mailbox rangehen.
Kurz darauf kam eine Nachricht.
Emry: Ich ruf immer wieder an. Erspar uns das doch und geh einfach ran.
Dann klingelte mein Handy.
»Ja?«, fragte ich trocken.
»Ah, sehr gut. Also bist du noch nicht komplett im Selbstzerstörungsmodus.« Dr. Emry Sadik war Psychologe, Elite-Performance-Coach und – was am schlimmsten war – zufällig mein Freund geworden. Der Mann kannte die meisten meiner dunkelsten Geheimnisse. Ich hatte den Versuch aufgegeben, ihn davon abzubringen, mich retten zu wollen.
»Rufst du aus einem bestimmten Grund an, oder willst du mir einfach auf den Geist gehen?«
Ich sah ihn vor mir an seinem Schreibtisch sitzen, im Hintergrund ein stumm geschaltetes Baseballspiel, vor ihm das Kreuzworträtsel des Tages. Emry glaubte an Routine und Effizienz … und daran, dass man für seine Freunde da sein sollte, auch wenn die das gar nicht wollten.
»Wie ist es gelaufen heute?«
»Gut. Deprimierend. Traurig.«
Knack. Pling. Pistazienschalen fielen in eine Schüssel.
»Wie fühlst du dich?«
»Wütend. Ein Mann wie er hätte noch so viel Gutes tun können. Er hätte mehr Zeit haben müssen. Seine Familie braucht ihn noch.« Ich brauchte ihn noch.
»Nichts erschüttert uns so sehr in unseren Grundfesten wie ein unerwarteter Todesfall.« Emry wusste, wovon er sprach. Seine Frau war vor vier Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. »Wenn die Welt ein gerechter Ort wäre, hätte dein Vater dann mehr Zeit gehabt?«
Knack. Pling.
In einer gerechten Welt hätte Ansel Rollins seine komplette Strafe abgesessen und wäre am Tag seiner Entlassung eines schmerzhaften und qualvollen Todes gestorben. Stattdessen war er der Haft durch einen Schlaganfall entkommen, der sein Leben still und leise im Schlaf beendet hatte.
»Du bist seit fünfzehn Jahren nicht mehr mein Therapeut. Ich muss mit dir nicht mehr über ihn reden.«
»Als einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die du überhaupt duldest, gebe ich doch nur zu bedenken, dass kein normaler Mensch den Tod von zwei Vaterfiguren innerhalb eines halben Jahres einfach so wegsteckt.«
»Ich dachte, wir wären uns einig, dass ich kein normaler Mensch bin«, erinnerte ich ihn.
Emry lachte unbeirrt. »Du bist normaler, als du denkst, mein Freund.«
Ich schnaubte. »Brauchst ja nicht gleich beleidigend werden.«
Knack. Pling.
»Und wie lief es mit Simons Tochter?«
»Welcher?«, stellte ich mich extra begriffsstutzig.
Emry lachte auf. »Zwing mich nicht, durch das Schneegestöber zu dir zu fahren.«
Ich schloss die Augen, damit ich nicht in Versuchung kam, Sloanes Haus zu betrachten. »Es war … ganz okay.«
»Also hast du dich auf der Beerdigung nicht danebenbenommen?«
»Das tue ich fast nie«, platzte ich müde heraus.
Knack. Pling.
»Wie ist Sadies Klaviervorspiel gelaufen?« Ich wechselte zu einem Thema, das mein Freund unmöglich ignorieren konnte: seine Enkelkinder.
»Meiner bescheidenen Ansicht nach hat sie alle anderen Fünfjährigen mit ihrer mitreißenden Interpretation von I’m a Little Teapot an die Wand gespielt.«
»Natürlich war sie die Beste.«
»Ich schick dir das Video, sobald ich raushab, wie man zehn Minuten verwackelte Aufnahmen in eine Nachricht packt.«
»Kann es kaum erwarten.« Er wusste, dass das nicht stimmte. »Hast du dich schon getraut, deine Nachbarin anzusprechen, oder versteckst du dich immer noch hinterm Vorhang?«
Mein Freund hatte sich in die modebewusste, geschiedene Frau von gegenüber verguckt und nach eigenen Angaben bisher nur in ihre Richtung gegrunzt und genickt.
»Die richtige Gelegenheit hat sich einfach noch nicht ergeben. Außerdem möchte ich auf die Ironie hinweisen, dass ausgerechnet du mich ermutigen willst, wieder zu daten.«
»Für manche ist Verheiratetsein das Richtige. Vor allem für Leute wie dich, die ständig das Essen anbrennen lassen und sich von einer netten Frau davon abbringen lassen müssen, sich wie ein Sitcom-Star aus den Achtzigern anzuziehen.«
Nebenan streiften Scheinwerfer den Zaun zwischen meinem und Sloanes Garten. Ich stand auf und trat an das Fenster, durch das man die Vorderseite ihres Hauses sehen konnte.
Emry lachte. »Lass meine Strickjacken da raus. Steht das Essen nächste Woche noch? Ich glaube, ich habe jetzt endlich eine Eröffnung, die deinen verdammten Springer alt aussehen lässt.«
Unsere Freundschaft beinhaltete ein Essen und eine Partie Schach alle zwei Wochen. Er war gut. Aber ich war jedes Mal besser.
»Das bezweifle ich. Aber ich bin dabei. Tschüss, Emry.«
»Gute Nacht, Lucian.«
Ich öffnete einen weiteren Finanzbericht am Laptop, als es an der Tür klingelte.
Beide Morgan-Brüder standen mit vor Kälte hochgezogenen Schultern vor meiner Haustür. Sie stapften rein und klopften auf den Fliesen im Eingangsbereich den Schnee von ihren Stiefeln. Waylon, Knox’ Basset, kam ebenfalls reinmarschiert, stupste mir mit dem Kopf gegen die Knie und trottete ins Wohnzimmer.
Knox hielt einen Sixpack Bier hoch. Nash hatte eine Flasche Bourbon und eine Tüte Chips dabei. Das pelzige weiße Köpfchen seiner Hündin Piper lugte oben aus dem Reißverschluss seiner Jacke.
»Die Frauen sind nebenan«, meinte Knox, als würde das alles erklären, und ging in die Küche. »Hab dir doch gesagt, dass er immer noch den Anzug anhat«, rief er seinem Bruder zu.
Ich strich mir über die Krawatte und bemerkte, dass sie beide inzwischen die Knockemouter Winteruniform aus Jeans, Thermoshirt und Flanellhemd trugen.
»Wir dachten, wir bleiben lieber in der Nähe, damit das nicht wieder so ausartet wie letztes Mal.« Nash setzte Piper auf dem Boden ab und folgte seinem Bruder. Die Hündin trug einen roten Pullover mit weißen Schneeflocken darauf. Sie beäugte mich skeptisch und tapste Nash hinterher durch den Flur.
Ich wollte keine Gesellschaft. Und ich wollte nicht in irgendwelche betrunkenen Eskapaden von Sloane und ihren Freundinnen mit reingezogen werden. »Letztes Mal« hatten Naomi und Sloane sich heldenhaft volllaufen lassen und Lina geistesgegenwärtig »geholfen«, einen Kautionsflüchtling zu schnappen. Na ja, Naomi war mehr oder weniger geistesgegenwärtig gewesen, Sloane hatte dem Typen einfach ihre spektakulären Brüste gezeigt.
Dass ich das verpasst hatte.
»Ich muss noch arbeiten.«
»Dann gucken wir einfach ganz leise einen Actionfilm mit Explosionen und so«, erwiderte Nash fröhlich.
Vor dem großen Flatscreen-TV im Wohnzimmer stand eine gemütliche Sofalandschaft.
»Haben deine Kameras Sloanes Haus gut im Blick?«, fragte Knox.
»Ich weiß nicht«, antwortete ich zögerlich. »Wieso?«
»Ich trau denen zu, dass sie mitten in der Nacht losrennen und auf dem Highway ne Horde Schneemänner bauen«, erklärte Nash.
»Ich seh mal nach, was sich machen lässt.«
Ich ging wieder nach oben und holte meinen Laptop, aber vorher warf ich noch einen Blick aus dem Fenster in die graue Winternacht. Sloanes Schlafzimmerlampen waren aus. Viel zu oft hatte ich mich gefragt, warum sie in ihrem alten Kinderzimmer geblieben war, statt in das Schlafzimmer ihrer Eltern umzuziehen.
Mit genervtem Seufzen rief ich den Feed der Überwachungskamera auf, was ich sonst tunlichst vermied. Und zwar die, die auf Sloanes Haustür und Einfahrt gerichtet war. Ich war stolz darauf, dass ich mir das sonst nie ansah, selbst wenn ich Heimweh nach einem Zuhause hatte, das nie meins gewesen war.
Ich hörte die Brüder im Wohnzimmer plaudern und zog mir widerwillig Jogginghose und T-Shirt an, dann stieg ich in die wollgefütterten Pantoffeln, die mir Karen vorletztes Weihnachten geschenkt hatte. Anschließend schlurfte ich wieder nach unten.
»Er ist ja doch ein Mensch«, kommentierte Nash, als ich reinkam.
»Nur nach außen hin«, versicherte ich ihm.
Diesen Sommer hatte Nash sich zwei Kugeln gefangen, weil sein Name auf Anthony Hugos Abschussliste gestanden hatte. Nach ein paar unschönen Monaten war es ihm gelungen, sich aus seinem Tief zu befreien – mithilfe der umwerfenden Lina. Während er sie überzeugt hatte, sich einen Ring an den Finger stecken zu lassen, versuchte ich, sie zu überzeugen, Vollzeit für mich zu arbeiten. Sie war klug, gewitzt und konnte besser führen, als sie sich selbst eingestehen wollte.
Ich setzte mich zu ihnen auf die Couch und zeigte den Brüdern die Kameraeinstellung. »Da.«
»Perfekt«, meinte Knox.
»Was gucken wir?«, fragte ich.
»Wir haben Die Verurteilten und Der blutige Pfad Gottes zur Auswahl. Entscheide du«, antwortete Nash.
»Dann Der blutige Pfad«, entgegnete ich automatisch.
Knox startete den Film, während Nash Whiskey einschenkte. Er schob uns die Gläser hin und erhob seins. »Auf Simon. Den Mann, von dem wir uns alle ne Scheibe abschneiden sollten.«
»Auf Simon«, wiederholte ich und spürte einen deutlichen Stich.
»Meint ihr, Sloane kommt damit klar?«, fragte Nash.
Ich verschränkte die Arme und überspielte das nervige Herzklopfen, das ich immer bekam, wenn jemand in meiner Gegenwart ihren Namen erwähnte.
Knox schüttelte den Kopf. »Ist ein schwerer Schlag. Aber nach dem Burrito von unserem Luce ging es ihr schon besser.«
Nash zog die Augenbrauen hoch und warf mir einen Blick zu.
»Es ging wirklich um einen Burrito.«
»Den anderen Burrito hätte Sloane ihm abgerissen.« Knox grinste, wurde aber sofort wieder ernst. »Naomi glaubt, sie wird ganz schön dran zu knabbern haben und es sich nicht anmerken lassen wollen.«
»Und Naomi hat meistens recht«, bemerkte Nash.
»Gebt Bescheid, wenn ich irgendwas für sie tun kann«, sagte ich und schob die Verantwortung damit reflexhaft von mir.
Knox feixte. »Wie das mit dem Burrito?«
Ich sah ihn ausdruckslos an. »Ich meinte eher moralische oder finanzielle Unterstützung aus der Ferne. Mein Burrito will nichts mit Sloane Walton zu tun haben.«
»Klar. Erzähl das deinem Burrito.« Nash nahm sein Handy in die Hand und zuckte zusammen. »Na toll. Lina schreibt gerade, dass die Mädels Margaritas machen.«
Knox stellte seinen Bourbon ab. »Fuck.«
3 Margarita-Talk
Sloane
Ich stapfte durch den Schnee. Wie immer nach einer Unterhaltung mit diesem unerträglichen Mann war ich so richtig auf hundertachtzig.
Ich betrat mein Haus und hängte Lucians herrlichen Mantel an die Garderobe. Ich sah mich schon unter der Dusche und im Schlafanzug. Ich wollte keine Gesellschaft. Ich wollte einen ruhigen Abend.
Ich öffnete die Glastür zum Arbeitszimmer neben der Diele. Dort hatte sich jahrelang Dads Arbeitszimmer befunden. Als ich eingezogen war, hatte ich daraus eine Bibliothek oder ein Lesezimmer machen wollen, aber dazu war ich noch nicht gekommen. Wie zu vielen anderen Sachen auch nicht.
Ein gemütlicher Raum mit Kassettendecke und großen Erkerfenstern zur vorderen Veranda. Darin standen ein Schreibtisch und ein paar wacklige Billigregale mit Fotos, Urkunden und verstaubten juristischen Fachzeitschriften.
Ich setzte mich auf den Bürostuhl. Als er das vertraute Quietschen von sich gab, musste ich mit Tränen in den Augen lächeln. Ich hatte immer genau gewusst, wenn ein Fall ihn belastete. Dann schloss er sich nach dem Essen hier ein, vertiefte sich in die Akten und schaukelte nachdenklich vor und zurück, vor und zurück.
Ich schaltete die Schreibtischlampe ein. Ein grässlicher Flohmarktfund mit ausgebleichtem Stoffschirm und einem schweren, mit Meerungeheuern verzierten Messingfuß. Meine Mutter hatte immer gesagt, die Lampe sei eine Beleidigung, aber Dad bestand darauf, dass sie eine ordentliche Lichtquelle und somit perfekt war.
So war mein Vater. Selbst im Hässlichsten sah er noch immer das Gute.
Der Rest des Schreibtischs war bis auf eine altmodische Unterlage mit Kalender und einen Stifthalter ohne Stifte leer. Auf dem Kalenderblatt klebten überall bunte Zettel.
Wäsche aus der Reinigung holen.
Blumen zum Hochzeitstag bestellen! Diesmal größerer Strauß!
Sloane von dem Buch erzählen.
Ich fuhr mit den Fingerspitzen seine abgehackte Schrift entlang.
»Du fehlst mir, Dad«, flüsterte ich.
Wenn ich heiraten und Kinder haben würde, wie konnte ich ihnen jemals vermitteln, was er mir bedeutet hatte?
Na großartig, dachte ich und zog Lucians bescheuertes, immer noch feuchtes Taschentuch aus der Tasche. Jetzt zerbrach mein Herz in noch viel winzigere Stücke, all das im Licht dieser fürchterlichen Lampe.
Das Schluchzen, das ich den ganzen Tag zurückgehalten hatte, brach aus meiner Kehle hervor.
Ich hatte den tollsten Mann verloren, den ich je gekannt hatte.
Alle bauten darauf, dass ich stark war und zurechtkam. Meine Mutter und Schwester, meine Freunde, meine Stadt. Sie sollten sich keine Sorgen machen, wie tief der Abgrund meiner Trauer war. Aber jetzt und hier konnte ich mir gestatten, zu sein, was ich war. Am Boden zerstört.
Ich putzte mir geräuschvoll die Nase.
So etwas hatte ich erst ein Mal gefühlt. Als ich einen anderen Mann verloren hatte – oder vielmehr einen Jungen.
Lucian.
Sein Name trieb auf einer Welle von Rotz und Wasser zu mir. Trotz unserer Differenzen war er heute für mich da gewesen.
Es klingelte.
»Was denn jetzt wieder?«, murmelte ich.
Ich putzte mir noch mal die Nase.
Es klingelte wieder, und ich fluchte leise. Mit einem frischen Taschentuch wischte ich mir die verlaufene Schminke aus dem Gesicht, setzte meine Brille wieder auf und ging zur Tür.
Auf meiner Veranda stand ein Fremder mit den Händen in den Jeanstaschen. Er war vielleicht Mitte zwanzig und hatte kurzes, lockiges Haar. Außerdem trug er einen Ohrring, ein Georgetown-Law-Sweatshirt unter einem Wollmantel und ein entschuldigendes, schiefes Lächeln im Gesicht.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sind Sie Sloane?«
»Hm«, krächzte ich und räusperte mich. »Ja.«
»Ihr Dad hat mir viel von Ihnen und Ihrer Schwester erzählt.« Er nickte und schluckte heftig. »Wahrscheinlich hätte ich vorher anrufen sollen, aber ich hatte eine Prüfung, die ich nicht verpassen konnte, und bin danach direkt hergefahren. Ich fühl mich total mies, weil ich die Beerdigung verpasst hab.« Er fuhr sich durch die kurzen Locken.
Ich sah ihn verständnislos an. »Kennen wir uns?«
»Äh, nein. Noch nicht. Ich bin Allen. Allen Upshaw.«
»Waren Sie mit meinem Vater befreundet?«
»Nein. Aber vielleicht hätten wir Freunde werden können. Er war eher ein Mentor für mich. Der Grund, dass ich Jura studiere …« Allen verstummte und sah ungefähr so deprimiert aus, wie ich mich fühlte.
Er tat mir leid. »Möchten Sie nicht reinkommen? Ich wollte gerade Kaffee oder Tee machen.«
»Gern. Danke.«
Ich ging voraus in die riesige Küche. Die vorherigen Bewohner hatten sie vergrößert und mit mehr Schränken und Arbeitsflächen versehen, als ich je würde brauchen können. Die Wände waren mit altmodischer, aber hübscher Karotapete und ernsten Essensstillleben in Goldrahmen verziert.
»Sieht genauso, aber irgendwie auch anders aus«, sagte Allen. »Ich war vor ein paar Jahren mal hier, bevor Ihre Eltern nach D. C. gezogen sind.«
»Wir wollten das Haus nicht verkaufen, also bin ich eingezogen«, erklärte ich und schaltete die Kaffeemaschine ein. Ich bat ihn, sich zu setzen.
Allen schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist. Er war die letzten paar Jahre ein so wichtiger Teil meines Lebens.«
Ich stellte ihm den Kaffee hin und machte mir auch einen, obwohl ich eigentlich keinen wollte.
»Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber er ist genau zu dem Zeitpunkt in mein Leben getreten, als ich ihn am meisten gebraucht habe.«
»Wie denn?«
»Ich wollte eigentlich immer Architekt werden, aber mit fünfzehn habe ich ein paar Dummheiten gemacht.« Er umfasste die Tasse mit beiden Händen.
»Das machen wir doch alle als Teenager.« Ich nahm ihm gegenüber Platz.
Sein Mund zuckte. »Genau das hat Ihr Dad auch gesagt. Aber meine Dummheiten hatten Konsequenzen. Die meine Mom zu tragen hatte. Da beschloss ich, dass ich Anwalt werden will.«
»Sehr gut.«
»Ich hab Ihren Dad bei einer Jobmesse kennengelernt. Nach der Highschool war ich ganz auf mich gestellt, hab bei meiner Tante im Keller gewohnt und zwei Jobs gehabt, um Geld fürs Jurastudium zu sparen. Simon gab mir das Gefühl, dass ich es schaffen konnte. Er hat mir seine Karte gegeben und gesagt, ich soll ihn anrufen, wenn ich mal Hilfe brauche. Ich hab noch am selben Abend angerufen.« Allen schwieg und lächelte verschmitzt.
Mein Herz zog sich zusammen.