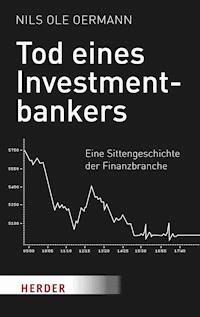
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Auswüchse der Finanzwirtschaft gefährden seit Beginn der Finanzkrise vor zehn Jahren unseren Wohlstand und unsere Sicherheit. Dafür mitverantwortlich war ein Kulturwandel in den Finanzinstituten, durch den die Mentalität des Investmentbankings führend wurde. Ausgehend von dem bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückten Deutsche Bank-Vorstand Edson Mitchell erzählt Nils Ole Oermann am Beispiel der Deutschen Bank, wie sich dieser Kulturwandel vollzog. Unter Mitchells Führung stieg die Deutsche Bank Mitte der 1990er Jahre von einem zweitklassigen Marktteilnehmer zum Global Player im Investmentbanking auf - mit Folgen, die noch heute spürbar sind, für die Deutsche Bank und weit darüber hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nils Ole Oermann
Tod eines Investmentbankers
Eine Sittengeschichte der Finanzbranche
Aktualisierte Neuausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung und -motiv: © Designbüro Gestaltungssaal
E-Book-Konvertierung: Barbara Herrmann, Freiburg
ISBN (E-Book): 978-3-451-81101-2
ISBN (Buch): 978-3-451-06909-3
And when I saw that, I realized that selling was the greatest career a man could want.
(Arthur Miller, Tod eines Handlungsreisenden)
Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen: so hoher Aemter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will blos zeigen, wie es eigentlich gewesen.
(Leopold von Ranke)
Inhalt
0. Vorwort zur Neuauflage
1. Prolog: »I buy and sell other people’s money«
2. Das Ziel: Die Wege nach Eldorado
3. Die Philosophie: Programm und Politik der neuen Conquista
4. Die Rekruten: Von Reitern und Fußsoldaten
5. Die Operationen der Finanzconquista: Angriff und Verteidigung
6. Epilog: »Vertrauen ist der Anfang von allem«
Anmerkungen
Heck der Beechcraft King Air N 30 EM-B200, mit der Edson Mitchell am 22. Dezember 2000 tödlich verunglückte.1
0. Vorwort zur Neuauflage
Die erste Auflage dieses Buches ist im Februar 2013 erschienen. Als der Verlag Herder nun vorschlug, eine überarbeitete Neuauflage herauszubringen, wünschte er sich natürlich einen Abschnitt zu dem Thema »Was seitdem geschah« – in der Welt der Banken, der Investmentbanker, und der Deutschen Bank. Diese Welt ist auch unsere Welt. Das haben wir spätestens in der globalen Finanzkrise seit 2007 gelernt.
In die Welt der Banken ist mehr Ordnung und mehr Sicherheit eingekehrt. Die Regeln und die Aufsicht wurden verschärft. Die Banken haben ihre internen Kontrollen verbessert und verzichten auf mancherlei windige Geschäfte. Früheres Fehlverhalten, das zum Teil erhebliche kriminelle Energie verriet, wurde aufgearbeitet und mit Sanktionen belegt. Gewiss hätte es nicht geschadet, wenn noch einige Verantwortliche mehr hinter Schwedische Gardinen gekommen wären, aber jedenfalls ist klar geworden, dass grundsätzlich niemand »too big to jail« ist.
Dieses große, grobe Bild vom Zustand der Bankenwelt wird allerdings komplexer, je näher man herantritt. In den USA werden Teile der von Präsident Obama und seinem Berater Paul Volcker durchgesetzten Bankenregulierung schon wieder rückgängig gemacht – vor allem mit dem Argument, der Bankensektor sei überreguliert, und das koste die Banken Geld, die Kunden Nerven und Kredit, und die Volkswirtschaft Wachstum. Dazu ist zu sagen: Einerseits ist es sinnvoll, komplexe Gesetze und Verordnungen im Licht der Erfahrungen anzupassen, die man bei ihrer Anwendung macht. Andererseits sollten die Wählerschaft und der Gesetzgeber auf der Hut sein vor der Wall-Street-Lobby: Sie befürwortet den Rückbau der Regeln enthusiastisch; aber im Zweifel tut sie das nicht aus Sorge um den Kleinsparer und die Wachstumsaussichten der Realwirtschaft, sondern weil die Großbanken die Hände und den Rücken wieder so frei wie nur möglich bekommen wollen. Wenn die Lobbyisten beklagen, die geltenden Gesetze seien zu belastend, dann verbinden sie das gern mit der Beteuerung, eine solche Krise wie 2007/2008 könne nicht wiederkehren. Wer aber auf die Weltgeschichte der Finanzkrisen zurückblickt, der weiß: Wer nicht haftet, zockt, und wer im Banken- und Finanzwesen unbeaufsichtigt und ungehindert zockt, der verzockt irgendwann die Zukunft seiner Mitbürger.
Auch in Europa ist das Bild der Bankenwelt bei näherem Zusehen durchwachsen. Noch immer schleppen viele Banken erhebliche Mengen an Non-Performing-Loans mit, das heißt notleidend gewordene Kredite. Am schlimmsten ist die Lage diesbezüglich im italienischen Bankensektor. Das schafft Risiken für die gesamte Euro-Region, und es ist kein Zufall, dass längst eine erhebliche Kapitalflucht aus Italien begonnen hat. Auch dass viele Banken ungute Mengen von Staatsanleihen ihrer Heimatstaaten besitzen, stellt eine Hypothek dar. Diese Staatsanleihen gelten regulatorisch als risikolos, das heißt die Banken müssen sich nicht mit Eigenkapital gegen mögliche Ausfallrisiken absichern, und das ist schön für ihre Bilanz. Aber die Ausfallrisiken sind da. Überschuldete Staaten und unterkapitalisierte Banken, verbunden durch angeblich beiderseits »risikolose« Staatsverschuldung in den Anleihen-Portfolios der Banken – eine potenziell höchst explosive Verbindung, die leider andauert.
Die Welt der Investmentbanker hat seit 2013 mehr und mehr die alten, paradiesischen Züge wieder angenommen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt nun stärker bei der Begleitung von Unternehmen an den Anleihe- und Aktienmärkten und bei der Beratung zu Fusionen und Übernahmen. Die Konstruktion von komplexen Finanzprodukten und der (Eigen)Handel damit ist gegenüber den Zeiten vor der Finanzkrise etwas zurückgetreten; aber das lässt sich verschmerzen, denn den verbliebenen großen US-amerikanischen Investmentbanken geht es wieder gut (sie sind größer als je zuvor), und den Investmentbankern geht es glänzend: ihre Gehälter und Boni sprudeln nur so. Auch das Ausdenken immer neuer »strukturierter« Papiere und Derivate wird nicht aus der Mode kommen. Sogar die Europäische Kommission beteiligt sich daran, zum Beispiel mit ihrem Vorschlag für sogenannte European Safe Bonds, die angeblich die finanzielle Verflechtung von Staaten und ihren heimischen Banken aufheben, in Wahrheit aber nur die Vergemeinschaftung von Schulden bewirken und den gebotenen Zusammenhang von Handeln und Haften schwächen.
Auch den Investmentbankern, die für die Deutsche Bank arbeiten, geht es gut. Zwar erbringen sie anders als vor der Finanzkrise nicht mehr den Löwenanteil am Gewinn der Bank, sondern lagen 2017 etwas unter dem Beitrag, den zusammengerechnet die Privat- und Firmenkundenberater und die Vermögensverwalter der Deutschen Bank stellten. Aber mit 1,4 Milliarden Euro Boni erhielten die 17 000 Mitarbeiter der Investmentsparte mehr als die übrigen 80 000 Bankangestellten zusammen.
Ihren Investmentbankern hat die Deutsche Bank bis vor Kurzem, bis zum Wechsel der Führung von John Cryan zu Christian Sewing im April 2018, immer wieder erstaunliche Zuwendung(en) (üb)erwiesen. Sewing kam anders als Ackermann und Jain nicht aus dem Investmentbanking und setzte sich gegen den Investmentvorstand Markus Schenck durch, was Signalwirkung hatte. Die Investmentbanker erhielten seit 2010 (für die Zeit davor gab die Bank noch keine Zahlen heraus) insgesamt 22 Milliarden Euro an Boni, sie wurden für unersetzlich erklärt und mit Halteprämien in Milliardenhöhe zum Bleiben bewogen, und es wurden für Millionenbeträge zusätzliche »Leistungsträger« angeworben.
Nur mit den Leistungen der Sparte will es nicht so recht klappen, ganz im Gegenteil: Viele Erfolge der Investmentbanker aus den Zeiten unter der Ägide von Joseph Ackermann und Anshu Jain haben sich längst als hochproblematisch erwiesen. Die Deutsche Bank hat seit der Finanzkrise rund 18 Milliarden US-Dollar an Straf- und Vergleichszahlungen leisten müssen, zum Beispiel für faule Geschäfte und Anlegertäuschungen im Zuge der US-Subprime-Krise und für die Mittäterschaft bei der Manipulation der für die Banken und ihre Kunden wichtigen Liborund Euribor-Zinssätze. Und die Investmentsparte war auch an vielen der giftigen Papiere und Geschäfte beteiligt, die in den 2012 neugeschaffenen und bis 2017 eigenständigen Unternehmensbereich »Noncore operations unit« eingebracht wurden, eine Art bankinterner Bad Bank, die insgesamt um die 20 Milliarden Euro Verluste verbucht hat.
Chart der Deutschen Bank Aktie bereinigt in Euro zwischen 1998 und 20181
Die Welt der Deutschen Bank ist also seit der Erstauflage dieses Buches alles andere als heil gewesen. Darum musste sie vier Mal neue Aktien ausgeben, um an zusätzliches Kapital zu gelangen – insgesamt 30 Milliarden Euro. Darum konnte sie ihren Aktionären kaum Dividenden zahlen. Darum sitzt sie noch immer auf einer veralteten Datenverarbeitung. Darum wurde sie von der Chefin ihrer Datenverarbeitung »das dsyfunktionalste Unternehmen, für das ich je gearbeitet habe«, genannt. Darum befinden sich der Aktienkurs und der Börsenwert der Deutschen Bank seit Jahren wenn nicht im freien Fall, so doch in einem besorgniserregenden Sinkflug: Als Edson Mitchell im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt seines Wirkens war, lag der Aktienkurs des Unternehmens bei knapp 100 Euro. Als die erste Auflage dieses Buches erschien, kostete eine Deutsche Bank-Aktie noch bei über 30 Euro. Während ich dies hier schreibe, ist die Aktie für unter neun Euro zu haben, und die Bank ist an der Börse nur noch um die 20 Milliarden Euro wert (nach wie erwähnt vier Kapitalerhöhungen um insgesamt 30 Milliarden Euro!).
Wie gesagt: Die Welt der Banken, der Investmentbanker und der Deutschen Bank ist auch die unsere. Seltsamerweise habe ich das am eigenen Leibe erfahren. Schon bei der Niederschrift von »Tod eines Investmentbankers« war ich überrascht und durchaus beeindruckt davon, wie offen mir Führungskräfte der Bank Rede und Antwort standen. Ich hätte aber nicht erwartet, was nach dem Erscheinen des Buches geschah: Ein Vorstandsmitglied der Bank bat mich um meinen persönlichen Rat, um meine Beratung aus der Position des Wirtschaftsethikers, der es für möglich und nötig hält, »anständig Geld zu verdienen«, und der die Voraussetzungen dafür beim Namen zu nennen versucht. Die Deutsche Bank hat sich einen Kulturwandel auf die Fahnen geschrieben, an dem viele mit großem Ernst arbeiten. Daran hatte ich einen kleinen Anteil. Es hat meine Sicht der Vergangenheit nicht verändert, aber es hat mein Verständnis für die Aufgaben und Chancen der Zukunft erweitert und vertieft.
Liebe Leserin, lieber Leser, seien Sie unbesorgt: Aus meiner Sittengeschichte der Finanzbranche ist in der 2. Auflage deswegen keine Heiligengeschichte geworden. Aber ich bin mit Blick auf die Deutsche Bank ein wenig optimistischer geworden, dass es eine abgeschlossene Geschichte werden könnte.
1. Prolog: »I buy and sell other people’s money«
Ihr kennet ihn – den Schöpfer kühner Heere,
Des Lagers Abgott und der Länder Geißel,
Die Stütze und den Schrecken seines Kaisers,
Des Glückes abenteuerlichen Sohn,
Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen,
Der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg
Und, ungesättigt immer weiter strebend,
Der unbezähmten Ehrsucht Opfer fiel.
(Friedrich Schiller, Wallenstein – Prolog)
Eine Ikone im Büro
Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, erinnert in ihrem Anfang und ihrem Ende an Schillers »Wallenstein«, an »des Glückes abenteuerlichen Sohn, der, von der Gunst der Zeiten emporgetragen«, auf einer Bahn von Ehrgeiz und Erfolg in den Tod rast. Unsere Geschichte könnte beginnen im Londoner Büro eines der damals mächtigsten Bankangestellten der Welt: in dem Büro von Anshuman »Anshu« Jain, bald nachdem er Mitte 2012 gemeinsam mit Jürgen Fitschen neuer Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank geworden war. In Jains Büro steht damals die Fotografie eines Mannes, den außerhalb der Welt des Investmentbanking wenige kennen: Edson Mitchell, der Wallenstein dieser Geschichte und Jains Mentor. Wallenstein mag auf seine Berühmtheit und Bekanntheit Wert gelegt haben, Mitchell blieb lieber unerkannt und unbehelligt, wenn er in New York, in London und manchmal auch in Frankfurt am Main einkaufen ging.
Edson von Mitchell III. wurde als Nachkomme schwedischer Einwanderer in einfachen Verhältnissen am 19. Mai 1953 in Portland, Maine, geboren. Ohne ihn wäre Anshuman Jain, der 1963 geborene Sohn eines Karrierebeamten aus Jaipur im indischen Bundesstaat Rajasthan, wohl nie auf die Idee gekommen, von der Londoner Investmentbank Merrill Lynch zur Deutschen Bank zu wechseln. Jain folgte damals seinem Mentor zu Deutschlands großer Universalbank. Er war einer von Edson Mitchells engsten Mitarbeitern, wenn auch Anfang der 1990er Jahre noch auf viel niedrigerer Hierarchieebene. Mitchell entwickelte ein besonderes Interesse an dem jungen Mann und förderte ihn nach Kräften. Solche intensiven Beziehungen gibt es häufiger in der Arbeitswelt. Bedeutsam auch für Dritte werden sie, wenn die Beteiligten zu den einflussreichsten Investmentbankern ihrer Zeit aufsteigen.
Für dieses Buch wurde in vielen persönlichen Gesprächen und Interviews von Frankfurt über Berlin bis in den Süden Floridas, von Maine über Boston bis in den Londoner Bankendistrikt über Jahre die Karriere von Edson Mitchell aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet, weil an seiner ungewöhnlichen Karriere so viel Typisches dieser Branche wie in einem Brennglas gebündelt erscheint. Und weil noch immer viele Menschen die Hitze dieser Karriere spüren und von den beiden Männern der eine erheblichen und fortwirkenden Einfluss auf das deutsche Bank- und Finanzwesen gehabt hat.
Warum fällt das Foto in Anshu Jains Büro auf? Es zeigt einen Mann mit grünen Augen, der sportlich, charismatisch und etwas verwegen wirkt. Es zeigt jemanden, der offensichtlich weder zu Anshu Jains indischer Verwandtschaft zählt noch prominent ist. Gerade dadurch aber weckt es Neugier: Zu wem bekennt sich der Vorstandsvorsitzende, indem er seinen Besuchern das Bild zeigt? Woran erinnert ihn das Portrait, was inspiriert ihn daran, was mag er von dem Mann auf dem Foto gelernt haben? Sind Fragen danach erlaubt, vielleicht gar willkommen? Ist das Foto ein Test für die Aufmerksamkeit von Gästen, für ihre Eingeweihtheit in personelle Zusammenhänge und für ihre Unbefangenheit, nötigenfalls zu fragen, um zu lernen?
Es gibt Besucher, die kannten beide Büros – das des Vorstandsvorsitzenden und das von Edson Mitchell in der Great Winchester Street Nr. 23, der Londoner Zentrale der Deutschen Bank. Da haben sie keine Fotos von Mentoren bemerkt – die hatte Mitchell nicht, und er wird wohl stolz darauf gewesen sein. Nicht Fotos blieben den Besuchern von dem spartanisch eingerichteten Arbeitsplatz in Erinnerung, sondern vor allem ein Kühlschrank. Aus dem bot nämlich der Amerikaner seinen Gästen beliebig viele Dosen Diet Coke an. Die trank er dann selber in großen Mengen mit, um das Eis zu brechen. »People never remember what you tell them. They always remember how you made them feel.« Auch an Mitchells Mentholzigaretten erinnern sich die meisten – er brauchte eine betriebliche Ausnahmegenehmigung, um sie im Büro zu paffen – und zwar unablässig. Das Rauchen war eines der Laster, die er sich erst spät angewöhnt hatte, aber dann frönte er ihm so exzessiv, wie er alles betrieb, was ihm Spaß machte.
Vom Nutzen und Nachteil einer »Sittengeschichte«
Dieses Buch ist keine Biografie Edson Mitchells, auch wenn es punktuell Einblicke in das zuweilen bunte Leben eines besonders charismatischen Investmentbankers gewährt. Es ist eine biografische Analyse der Finanzbranche in der Annahme, dass sich diese besser über einen Lebenslauf als über irgendwelche Systemtheorien erschließt. Wer war jener Edson Mitchell? Und vor allem: Warum lässt sich am Beispiel seines Lebens und seiner Persönlichkeit eine »Sittengeschichte« der Finanzbranche vor und während einer der größten Wirtschaftsund Bankenkrisen der Welt erzählen?
Eigentlich sollte der Untertitel des Buches »Anthropologie« oder »Psychogramm der Finanzbranche« heißen, doch das schien am Ende zu akademisch, um der schillernden Persönlichkeit eines Charismatikers gerecht zu werden, der es laut Anshu Jain durchaus genoss, als solcher betrachtet und bewundert zu werden. »Sittengeschichte« trifft es besser, gerade weil das Wort ein wenig verstaubt klingt, ganz so, als nähme ein Viktorianer mit spitzen Fingern ein nicht ganz sittsames Buch zur Hand. Bei »Sittengeschichte« geht es nicht um eine wissenschaftlich-psychologische Individualanamnese, sondern um »Così fan tutte« – so oder so ähnlich machen es viele, wenn nicht alle. Sittengeschichten zeichnen die Entwicklung von Bräuchen und Gebräuchen einer Gesellschaft, einer Gruppe oder Kultur nach. Sie berichten von dem, was sich in einer identifizierbaren Gruppe von Menschen gehört und was nicht, wie dort Reden und Handeln in Einklang stehen oder eben gerade nicht. An Mitchells Karriere, an den Erfolgen wie den Niederlagen eines Mannes, der vielleicht einer der prägendsten Investmentbanker seiner Zeit war, lässt sich eine Typologie der Finanzindustrie und der darin gelebten Wertvorstellungen ad personam entwickeln. Die Edson Mitchell tragende, ihn wie Jain befördernde und von ihnen mitgeprägte Kultur lebt in global aufgestellten Banken und Finanzsystemen. Sie lebt letztlich von Individualisten, von visionären Eroberern und charismatischen Söldnern.
Kann man aus dem Leben und den Verhaltensweisen eines außergewöhnlichen Vertreters der Finanzindustrie belastbare Schlüsse ziehen hinsichtlich der Sitten und Gebräuche, die in dieser Branche gelten? »Die Investmentbanker« gibt es natürlich genauso wenig wie »die Deutsche Bank«, aber die Arbeit jener Investmentbanker, die als moderne »Konquistadoren« den Gegenstand dieses Buches bilden, ist klar abgrenzbar von der Arbeit jener laut Bundesbank rund 650 000 in Deutschland tätigen Bankangestellten, die ihren Lohn im Jahr 2011 mit dem Leihen und Verleihen des Geldes ihrer Kunden und dem Vermarkten anderer Finanzdienstleistungen verdienten – davon arbeiteten nur ein knappes Drittel bei Privatbanken.1 Und die Analyse einer Karriere eines so außergewöhnlich erfolgreichen wie auch in vielem typischen Vertreters dieser Zunft, der viele der mit dem Investmentbanking verbundenen Stereotype erfüllt und sich doch auch von ihnen abhebt, hilft da weiter.
Zudem bietet Edson Mitchells Karriere gerade in den aktuellen Diskussionen und Kontroversen um die Finanzbranche wichtige Anhaltspunkte für grundsätzlichere wirtschaftsethische Fragen, die sich in Zeiten globaler Finanzkrisen offenbar so drängend stellen, dass das Thema »Deutsche Bank« dem SPIEGEL kurz vor Weihnachten 2012 eine eigene Titelgeschichte wert war.2
Warum schaffte es zur Jahrtausendwende ein charismatischer Amerikaner in den Vorstand dieser ursprünglich sehr deutschen Institution, der so gar nicht zur deutschen Kultur eines »Bankbeamten« passen wollte? Und warum entschied sich eine im Vergleich zu amerikanischen Investmenthäusern eher risikoscheue Bank nach 1989 überhaupt dazu, im Nachhall des Falles der Berliner Mauer eine globale Investmentbank zu werden? Haben sich Mitchell und seine Kollegen mit ihrem neuen Geschäftsmodell letztlich strategisch falsch verhalten, weil sie den Bogen überspannten? Frisst gar die Revolution am Ende ihre Kinder?
Für Leopold von Ranke besteht die Aufgabe eines Historikers darin, zu »zeigen, wie es eigentlich gewesen«.3 Er ist weder Enthüllungsjournalist noch Hagiograf, der erbauliche Heiligengeschichten aufschreibt. Er soll Menschen und deren Entscheidungen in ihren unterschiedlichsten Facetten nicht belehrend erklären, sondern möglichst wahrheitsgetreu zu beschreiben versuchen – als Grundlage jeden Verstehens. Im konkreten Fall sollte er beispielsweise darlegen können, was einen Mann wie Edson Mitchell getrieben hat, wenn er einem Frankfurter Börsianer auf die Frage, wer er denn sei, geantwortet haben soll: »Ich bin Gott.«4 Wie lebte, dachte, entschied jemand, dem dieses Zitat zugeschrieben wird, und inwieweit war er darin typisch für eine ganze Branche – und ist es womöglich noch?
Wer moralisiert, der will über Menschen urteilen, statt deren Handlungen vertieft zu verstehen. Und wer ohne ökonomische Sachkenntnis und pauschal über »die« Schuld »der Banken« schwadroniert, der analysiert nicht ethisch, sondern er erliegt der Versuchung zu moralisieren. Bezüglich dieser nur scheinbar honorigen Beschäftigung stellte Joseph Ratzinger zu Recht fest: »Eine Moral, die dabei die Sachkenntnis der Wirtschaftsgesetze überspringen zu können meint, ist nicht Moral, sondern Moralismus, also das Gegenteil von Moral.«5 Wer im Sinne einer übergeordneten Systemtheorie des Investmentbanking »die Bank« oder alle für alles verantwortlich sein lässt, der macht am Ende niemanden konkret haftbar. Daher der vorgelegte Versuch, konkrete Personen und ihr Handeln im Investmentbanking seit den 1990er Jahren in ihren volkswirtschaftlich-historischen Zusammenhängen zu beschreiben. Es handelt sich hier also um eine biografisch-exemplarische Aufarbeitung der Bankenkrise, die zumindest ein Brandbeschleuniger war für jene Währungs- und Schuldenkrise, mit der wir uns aktuell so schwertun.
Mein Buch ist keine Apologie der Deutschen Bank oder eine Hagiografie Edson Mitchells. Die Deutsche Bank war tatsächlich mehr oder weniger zufällig Untersuchungsgegenstand – als Mitchells Arbeitgeber, die für ihn am rechten Ort zur rechten Zeit interessante, aufstrebende AAA-Bank, die dem Amerikaner das Spielfeld für sein Talent zur Verfügung stellen konnte. Genau so erklärten die meisten meiner Gesprächspartner, warum Mitchell in den zwei Türmen an der Taunusanlage, dem Frankfurter Hauptsitz der Deutschen Bank, Mitte der 1990er Jahre anheuerte. Meine Recherchen waren dabei weder von einer finanzpolitischen, noch gar von einer persönlichen Agenda getrieben, wie man es bei den jüngst erschienenen Memoiren »Die Unersättlichen. Ein Goldman-Sachs-Banker rechnet ab« des Goldman Sachs-Bankers Greg Smith schon bei der Lektüre des Titels vermuten muss.6
Dieses Buch ist auch keine Auftragsarbeit, und darin unterscheidet es sich von zahlreichen jener Werke, die bisher über Banken in Deutschland geschrieben wurden. Hagiografien wie »Josef Ackermann. Leistung aus Leidenschaft« oder kapitalismuskritische Titel wie »Bank-Räuber« oder boulevardorientierte Reißer wie »Die Gier war grenzenlos. Eine deutsche Börsenhändlerin packt aus« haben schon in ihrem Grundkonzept nicht primär die Motivation aufzuschreiben, »wie es eigentlich gewesen«.7 Ausgangspunkte meiner Untersuchung waren das Interesse an dieser Branche, die Neugierde auf Menschen und hier und da sogar eine gewisse Belustigung beziehungsweise ein gelindes Entsetzen darüber, welche Blüten der Umgang mit viel Geld zu treiben vermag.
Mein Buch ist auch keine wissenschaftliche Analyse im Sinne einer strukturierten Suche nach Wahrheit, sondern das, was die Angelsachsen ein insight nennen. Man kann Hunderte Werke über das Wesen des Investmentbanking oder die Finanzkrise studieren, ohne überhaupt zu verstehen, mit welchen Akteuren und welchen Motivlagen man es bei Investmentbankern zu tun hat. Wie findet man darüber etwas heraus? Indem man sich einen Einzelfall vornimmt; und indem man mit möglichst vielen Zeitzeugen, Freunden, Verwandten und Kollegen spricht, indem man vorgelegte Dokumente detailliert analysiert und wie jeder ordentliche Jurist die Ausgangsfrage stellt: »Wer will was von wem woraus?« Dieses Buch ist schließlich keine abstrakte Systemanalyse, sondern es schildert den Aufstieg und Fall eines besonderen Investmentbankers und seiner Nachfolger. Es hinterfragt, wie diese ihr Gegenüber, die Politik, die Gesellschaft, in der sie sich bewegen, sehen, und wie sie mit Risiken und ihren Kunden umgehen, wie sie handeln und verkaufen und was sie dabei umtreibt. Mit diesem Ansatz leistet es vielleicht gerade über den biografischen Zugriff einen Beitrag zum besseren Verständnis von Banken- und Finanzkrisen und deren Ursachen.
Wohlgemerkt: Ich bin kein Globalisierungskritiker oder Gegner des Kapitalismus. Gerade von Bankern erwartete ich anfangs zudem auch nicht, dass sie ihr Herz auf der Zunge tragen. Ich rechnete sogar damit, dass die meisten der von mir für ein Interview Angefragten absagen würden, aber das Gegenteil war der Fall. Offenbar war ich laut Google-Recherche zumindest »nicht irgend so ein Spinner oder Occupy-Aktivist«, wie es einer meiner Gesprächspartner als Ergebnis seiner Vorbereitung auf unser Interview einmal offenherzig feststellte. Die Branche scheint mitteilungsbedürftig zu sein, wohl auch deshalb, weil sie sich falsch verstanden und ungerecht beurteilt fühlt.
One should know where one stands: Ich betrachte die Finanzbranche als dienenden Teil der freien Marktwirtschaft. Bei den Überlegungen zur aktuellen Diskussion um Bankenregulierung und alternative Wirtschaftsformen musste ich oftmals an Winston Churchills Äußerungen über die Demokratie im Rahmen seiner Rede vor dem britischen Unterhaus am 11. November 1947 denken: Die Demokratie, so Churchill, sei eine ziemlich schlechte Staatsform, aber besser als alle anderen bisher ausprobierten Staatsformen. Für den modernen Kapitalismus gilt nichts anderes: Ich halte die soziale Marktwirtschaft kombiniert mit einer hohen bilanziellen Eigenkapitalquote der Banken für eine angemessene Möglichkeit, den Kapitalismus so zu organisieren, dass Banken und Bankiers verantwortungsbewusst mit dem Geld der anderen umgehen.
Der Inhaber einer Privatbank, den ich nach der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt quasi als Kontrastprogramm besuchte, antwortete auf meine Frage: »Kannten Sie Edson Mitchell?«, zunächst lächelnd: »Ja, den kannten wir sehr gut.« Und auf meine zweite Frage: »Warum sind Sie nie in vollem Umfang in die Geschäfte eingestiegen, mit denen dieser Mitchell so unglaublich erfolgreich war?«, antwortete der freundliche Herr mit eher nachdenklichem Blick sinngemäß, das Bankhaus bestehe seit Generationen, und man mache diese Art von Geschäften darum nicht, weil seine Nachfolger immer noch etwas vorfinden sollen, was sich zu führen lohne. So verdiene man vielleicht weniger in guten Zeiten, verliere aber auch deutlich weniger in schlechten. Und das sagt jemand, der zu einem perfekt sitzenden Nadelstreifenanzug eine schwarze Plastikarmbanduhr im Wert von weniger als hundert Euro trägt. Vertrauen ist schließlich der Anfang von allem, um die Deutsche Bank zu zitieren.
Dies ist also eine Sittengeschichte der Finanzbranche, die Darstellung eines so einzigartigen wie typischen Einzelfalles. Einzigartig wurde das Leben eines der wichtigsten Investmentbanker auch durch sein abruptes Ende: Mitchell starb zwei Tage vor Weihnachten 2000 bei einem, um nicht zu sagen: bei seinem Flugzeugabsturz. Er starb so schnell und spektakulär, wie er lebte.
Der Tod des Investmentbankers
Der Anfang vom Ende seiner Geschichte, der Beginn dieser Erzählung, datiert auf den 21. Dezember 2000. Der Mann auf dem Foto in Anshu Jains Büro besucht mit seiner Geliebten die Weihnachtsfeier der Deutschen Bank in London. Ausgerichtet wurde diese legendäre Party im Grosvenor House, einem Fünfsternehotel mit über 400 Zimmern an der feinen Londoner Park Lane nahe Mayfair, wo heutzutage allein das Parken elf Britische Pfund pro Stunde kostet. Kurz zuvor hatte Mitchell das vielleicht letzte dienstliche Gespräch seines Lebens mit Josef Ackermann geführt. Es ging wie so oft um die Aufstellung und Zukunft der Deutschen Bank im Investmentbanking. In unserem Interview erinnerte sich Josef Ackermann sehr gut an dieses letzte Gespräch wie auch an die Tragödie, die folgen sollte.
Über 1500 Gäste trafen sich an diesem Abend in London, um einen ungewöhnlich erfolgreichen Jahresabschluss mit den Investmentbankern aus dem Bereich Global Markets zu feiern, die für einen Großteil des Gewinns der Deutschen Bank verantwortlich zeichneten. Kaum fünf Jahre nach seinem Wechsel war Edson Mitchell seinem Ziel, aus diesem Institut eine der erfolgreichsten Investmentbanken der Welt zu machen, ein gutes Stück näher gekommen. Just in diesem Geschäftsjahr 2000 war er gemeinsam mit seinem amerikanischen Kollegen Michael Philipp in den Vorstand der Deutschen Bank eingezogen. Es wird sicherlich nicht jedem gefallen haben, dass mit Mitchells Berufung ab Sommer 2000 nun auch im Vorstand der Deutschen Bank Englisch gesprochen und protokolliert wurde.
Dem neuen Vorstand Edson Mitchell war es mit einer kleinen Gruppe von ca. 100 »Indianern« als deren »Häuptling« gelungen, aus der Investmentbanking-Abteilung eines in diesem Geschäftsfeld eher unbedeutenden, aber kapitalstarken deutschen Finanzinstituts einen echten player am Markt zu machen. Vor Mitchells Ägide war die Deutsche Bank im Bereich Investmentbanking/Global Markets im Vergleich mit anderen Geldhäusern nicht nennenswert vertreten. Der Amerikaner und seine Kollegen brachten die Deutsche Bank in den einschlägigen Ranglisten in weniger als fünf Jahren unter die internationalen Top 10 jener Bereiche, die sie verantworteten. Sowohl Rolf-E. Breuer als auch Anshu Jain betonten im Interview, wie wichtig solche Rankings damals wie heute sind, wenn man seinen strategischen Schwerpunkt im Investmentbanking haben will: Niemand macht gern Geschäfte mit der Nr. 24; ob nun Nr. 24 der örtlichen Klempnerbetriebe oder Nr. 24 der globalen Investmentbanken.
Die Anregung, das Verhältnis Mitchells zu seinen Mitarbeitern mit dem Bild eines Indianerhäuptlings im Stile Karl Mays oder gar als Chef einer Gruppe von »Söldnern« und »Eroberern« zu beschreiben, stammt im Übrigen aus Gesprächen mit Mitchells wichtigsten Vorgesetzten und wurde von vielen seiner Kollegen bestätigt, ja zugespitzt. Mitchell habe seine »Indianer« ausgewählt, eigenständig angeheuert und geführt und sei als deren Motivator und als Verwalter der Kriegs- und Bonuskasse extrem talentiert gewesen. Auch das Wort »Söldner« oder »Konquistador« sei in diesem Zusammenhang nicht falsch. Als Konquistadoren bezeichnete man die Teilnehmer an der spanischen Eroberung Süd- und Mittelamerikas im 16. Jahrhundert. Das Ziel dieser Soldaten, Entdecker und Eroberer war es, möglichst schnell zu großem Reichtum zu kommen.8 Keiner meiner Gesprächspartner korrigierte oder unterbrach mich jemals, wenn ich im Zusammenhang mit Edson Mitchell eines der beiden Worte verwendete, obwohl das Wort »Söldner« im Deutschen, ähnlich wie »mercenary« im Englischen, eine negative Konnotation hat. Im Gegenteil: Wie bei Eroberern und Söldnern, exakt so sei ihr Geschäftsmodell gewesen, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank, und ich dürfe das gern wörtlich so zitieren: Mitchell und seine Truppen seien »Konquistadoren«, seien moderne »Wallensteins« gewesen. Er eroberte das siebentorige Theben natürlich nicht allein9 – es war das Gemeinschaftswerk der von ihm zusammengestellten Truppen.
Häuptling, Konquistador, Wallenstein, Hannibal – das Phänomen Mitchell lud zu vielen Beschreibungen ein. Für Rolf-E. Breuer war er »ein Banker der Superlative«.10 Für andere ein Haifisch. Wieder andere nannten ihn »the silent mafioso«, weil er stumm durch die Handelsräume schlich und genau mitbekam, was an welchem Arbeitsplatz glückte und was nicht. Einige nannten ihn wegen der anschließenden Personalgespräche mit den Inhabern jener Arbeitsplätze, an denen zu wenig glückte, schlichtweg »Terminator«, da diese Gespräche selten länger als zwei Minuten dauerten.11
Jedenfalls: Der Banker der Superlative war an jenem vorweihnachtlichen Abend im feinen Grosvenor House im Herzen Londons in »brillanter Stimmung«, aufgeräumt und so gewinnend und charmant, wie Mitchell es auch sein konnte, wenn er denn wollte.12 Er tat das, was er mit seinen Teams auch besonders gut konnte: feiern. Er hatte allen Grund. Perfekte Zahlen, eine gefestigte Position in seiner Bank und der bevorstehende Weihnachtsurlaub in seinem Heimatort Rangeley im US-Bundesstaat Maine bestimmten seine Laune an diesem Abend. Nach der Weihnachtsfeier verbrachte er die Nacht in London, um am nächsten Morgen, getrennt von seiner Geliebten, mit einem Linienflug nach Boston, Massachusetts, zu fliegen.13 Vor dem Zielort Rangeley, wo er mit seiner französischen Geliebten und seinen Kindern die Weihnachtsferien verbringen und am Saddleback Mountain Ski fahren wollte, machte er eine Zwischenlandung in seinem Geburtsort Portland, Maine. Dort kaufte er Weihnachtsgeschenke, um sich dann von dem langjährigen und erfahrenen Piloten Stephen A. Bean in die Weihnachtsferien befördern zu lassen.
Flugroute14





























