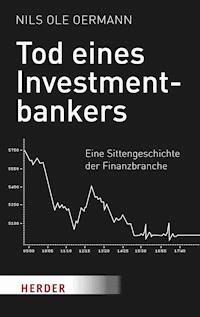12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Margot Honecker im Mai 2016 starb, hatte sie fast ein Vierteljahrhundert im chilenischen Exil verbracht. Nils Ole Oermann ist vermutlich der letzte Besucher aus der Bundesrepublik, den sie dort kurz vor ihrem Tod empfangen hat. Über drei Jahre stand Oermann mit ihr, die sonst jedes Interview strikt ablehnte, in Kontakt und traf sie mehrfach. In "Zum Westkaffee bei Margot Honecker" lässt der Autor diese Begegnungen in Chile Revue passieren - die einstige Ministerin für Volksbildung der DDR sprach verblüffend offen über Sozialismus und Kapitalismus, über die Bundesrepublik und die DDR, über Gregor Gysi, Wladimir Putin und Wolf Biermann. Zugleich zeigte die bekennende Stalinistin keinerlei Reue, wenn es etwa um ihren Beitrag zu einem System ging, das kritische junge Menschen kategorisch von Ausbildung- und Karrierechancen ausschloss. Mehr noch: Im Denken und Fühlen von Margot Honecker war bis zu ihrem Tod die DDR ein intakter Staat. Oermanns Buch lässt den Leser unmittelbar erfahren, mit welchen Hoffnungen und Zielen Menschen wie Margot Honecker die DDR aufbauten. Und warum sich durch Menschen wie sie daraus ein totalitäres Regime entwickelte, das sich vierzig Jahre halten konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Nils Ole Oermann
Zum Westkaffee bei Margot Honecker
Letzte Begegnungen mit einer Unbeirrten
Hoffmann und Campe
Mitleid mit Menschen, die eine Diktatur inszeniert und aufrechterhalten haben, muss man nicht übertreiben.
Helmut Schmidt
Eine kleine DDR mitten in Chile
5. April 2016, 14.40 Uhr, La Reina, Santiago de Chile:
Die Frau hinter der Kuchentheke lächelte. Wer mochte der Fremde sein, der da gleich eine ganze Blaubeertorte kaufte? Mir hingegen war beklommen zumute. Ich stand in einem kleinen Café in La Reina, übersetzt »die Königin«. La Reina ist ein schmucker Vorort der chilenischen Hauptstadt mit ihren sechs Millionen Einwohnern. Kein »Nobelstadtteil«, wie manche Medien in Deutschland über Honeckers selbstgewähltes Exil schrieben, aber eine gutbürgerliche Wohngegend. Gleich würde ich sie wiedersehen, zum vierten und letzten Mal, sie, die »meistgehasste Frau der DDR«, wie die Welt anlässlich ihres 80. Geburtstages 2007 titelte: Margot Honecker.
In den vergangenen Tagen hatten wir mehrmals miteinander telefoniert, um einen Termin für ein Treffen zu finden. Manchmal hatte ihre Stimme geschwächt geklungen, manchmal fest. Mit einem Besuch sei es schwierig, sagte sie mir. Sie könne das Bett nicht mehr verlassen, und ihr Befinden sei jeden Tag höchst unterschiedlich. Hatte ihr fortgeschrittenes Krebsleiden sie äußerlich sehr verändert? Dachte sie angesichts ihrer schweren Krankheit anders über ihr Leben als bisher? Bereute sie gar plötzlich etwas, im Angesicht des Todes? Ich sollte es bald erfahren, an jenem zunächst klaren und dann wieder wolkenverhangenen Tag im April, der auf der Südhalbkugel ein Herbstmonat ist und in dem sich die Blätter zu färben beginnen. Während ich in der Konditorei für mein Gastgeschenk zahlte und mein Kuchenpaket in Empfang nahm, ging mir noch dieser Gedanke durch den Kopf: Auch Chile ist ein Land, in dem eine Diktatur vielen Müttern ihre Kinder genommen hat, in dem Andersdenkende verfolgt, eingesperrt, erniedrigt und sogar ermordet wurden. Hätte mich die Frau hinter der Kuchentheke weiterhin angelächelt, wenn sie gewusst hätte, wer da in ihrer Nachbarschaft direkt am Fuße der Kordilleren lebte und für wen der Kuchen bestimmt war?
Es war meine dritte Reise nach Chile, es sollte das vierte und letzte ausführliche Gespräch mit Margot Honecker, geborene Feist, werden. Schon 2013 und 2015 war ich ihretwegen in die chilenische Hauptstadt gereist. Inzwischen hatten wir per E-Mail Kontakt gehalten. Doch ab Anfang 2016 waren meine Mails zum ersten Mal ohne Antwort geblieben. Ich wusste um Margot Honeckers Krebserkrankung und vermutete sofort, dass sich ihr Zustand akut verschlimmert haben könnte. Denn nicht nur, wenn es um die Beantwortung von Mails ging, hatte ich diese alte Dame als einen Menschen kennengelernt, dem preußische Sekundärtugenden wie Ordnung, Fleiß und Disziplin äußerst wichtig waren.
Als ich gleich nach Ostern 2016 in Chile gelandet war, konnte ich sie zunächst überhaupt nicht mehr erreichen. Wie in den Jahren zuvor rief ich sie erst direkt vom Flughafen und dann von meiner Unterkunft aus an und war darauf eingestellt, dass sie mich wieder zwei, drei Tage würde warten lassen, ehe sie zum Kaffee bat – stets für 15 Uhr, wobei trotz des unberechenbar dichten Stadtverkehrs pünktliches Erscheinen erwartet und Gebäck und Westkaffee gereicht wurden – für ostdeutsche Sorten wie Röstfein Mocca Fix Gold und Rondo hatte sich Margot Honecker dem Vernehmen nach schon zu DDR-Zeiten nicht erwärmen können.
Doch wenn ich diesmal die übliche Telefonnummer anrief, dann tat sich auch nach langem Läuten nichts. Ich wusste weder, wie es genau um sie stand, noch wie ich weiter verfahren sollte. Schließlich, nach drei Tagen, an einem Sonntag, hörte ich plötzlich doch ihre Stimme. Ja, sie wisse, dass ich in der Stadt sei. Und ja, sie habe meine Nachrichten bekommen, aber sie könne E-Mails nicht mehr beantworten. Ein Treffen? Das wolle sie nicht versprechen, es gehe ihr gesundheitlich nicht mehr gut. Es komme doch sehr auf ihre Tagesform an, ob sie Gäste empfangen könne.
Ich versuchte behutsam, zu ergründen, wie krank sie war, ob ihr die Krankheit Angst machte und ob diese neue Situation ihre Sicht auf Gott, die Welt und die Politik verändert habe. Ja, sehr krank, und nein, sie wisse ja, seit sie ihren an Krebs erkrankten Mann bei seinem Sterben begleitet und bis zum Schluss gepflegt habe, was da auf sie zukomme. Und dann ganz plötzlich, präzise und hart: Sie liege im Sterben. Nur ihre engste Familie sowie »drei deutsche und drei chilenische Genossen« wüssten, dass ihr Brustkrebs im Januar aggressiv wiedergekommen sei und über mehrere Organe bis zur Wirbelsäule gestreut habe.
Diese sechs Genossen würden nun alle weiteren Angelegenheiten, einschließlich der Modalitäten ihrer Bestattung, für sie regeln. Sie könne seit längerem das Bett nicht mehr verlassen. Ihre Tage seien gezählt, das wisse und akzeptiere sie. Das erzähle sie mir, sagte sie, weil ich mich bisher stets an unsere Absprachen gehalten habe und sie mir darum vertraue. Ich dürfe kommen, aber keiner Menschenseele davon erzählen, denn sonst würden die Journalisten sie belagern wie damals ihren Mann und ihr »die letzten Tage meines Lebens zur Hölle machen«. Ich versprach ihr zu ihren Lebzeiten Vertraulichkeit und wurde gewissermaßen nun temporär ihr »Genosse Nr. 7«.
Sogleich wechselte sie das Thema und sprach lieber über unsere zurückliegenden Treffen (»Wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen?«), über meine und ihre Familie, über die politische Vergangenheit der Eheleute Honecker, über ihre DDR und vor allem über ihre Sicht der Gründe, warum es diesen Staat nicht mehr gab. So bewegten wir uns auch in diesem Telefonat rasch wieder hin zu den Themen und in die Atmosphäre unserer früheren Gespräche. Ich spürte, dass Margot Honecker Gefallen daran hatte und mich wohl als eine Art Verbindung zur fernen Heimat empfand, ich bot ihr offenbar eine belebende Abwechslung. Am Ende des Gesprächs fragte ich, ob ich wieder anrufen dürfe. Sie bejahte, und nach zwei weiteren Telefonaten lud sie mich zu sich ein – wie immer für 15 Uhr, am Dienstag, dem 5. April 2016. Allerdings bestellte sie mich an einen anderen Ort als in den Jahren zuvor. Schon durch diesen Ortswechsel war mir klar, dass dies unser letztes Gespräch werden sollte. Doch ich war mir wie immer ganz sicher, dass sie den angebotenen Termin einhalten würde.
Bisher hatte ich sie in ihrem Haus besucht, in einer Siedlung mit hohem Zaun, Einlasskontrolle und Anmeldung der Gäste durch einen Torwächter. Irgendwie passte es, wie ich fand, zu einem Domizil der Honeckers, die ihre politische Macht nur durch Zäune und Wächter hatten aufrechterhalten können. Ihr Haus war geräumig gewesen, zwei Etagen mit zusammen deutlich über hundert Quadratmetern, und die Honeckers hatten sie eingerichtet, ohne zu sparen und ohne zu protzen. Im ersten Stock waren zwei Schlafzimmer, die auch ihr Mann Erich nach seinem Eintreffen in Santiago im Januar 1993 bis zu seinem Tod im Mai 1994 genutzt hatte.
Die Einrichtung wirkte teilweise chilenisch-modern, teilweise ostdeutsch-retro: ein modernes weißes Sofa und ein, wie in La Reina üblich, üppig bepflanzter Garten mit Terrasse, auf der wir saßen. Auf den Regalen bunte Kelche aus der DDR und andere realsozialistische Staubfänger. Dazu viele Bücher, meist Historisch-Sozialistisches, aber auch deutschsprachige Romane und viele Bildbände zu Kunst und Geographie. Überhaupt: lateinamerikanische Kunstwerke, Bilder mit den typischen bunten Häusern aus der Stadt Pablo Nerudas, Valparaiso. Davon einige, die dem Stil nach ihr 1974 in der DDR geborener Enkel Roberto Yáñez Betancourt y Honecker, ein freischaffender Künstler, gemalt haben könnte. Valparaiso ist eine Stadt voller Künstler. »Eine verrückte Stadt«, sagte Margot Honecker.
Das Interieur wurde komplettiert durch einen Fernseher und einen Computer, mit denen sie nach eigener Angabe intensiv das politische Tagesgeschehen in Deutschland verfolgte. Sie sagte: »Mein Enkel hat mir das Internet beigebracht. So kann ich jeden Tag mehrere Stunden deutsche Nachrichten lesen, und vor allem kann ich auch mit Genossen in Deutschland in Kontakt bleiben.« Als ich das hörte, vermutete ich, dass ihr Chile als der Ort des Exils immer noch fremd geblieben war. In ihrem Kopf und ihrem Herzen lebte diese Frau in Deutschland. Oft fragte sie mich: »In Deutschland, wie geht’s lang?« Die deutsche Tagespolitik interessierte sie sehr, und sie begann ihren Morgen regelmäßig mit der Lektüre von Spiegel Online.[1] In Chile hingegen, da sei sie seit ihrer Ankunft 1992 im Land kaum gereist, und sie spreche auch fast kein Spanisch. In Kuba, da sei sie öfter eingeladen gewesen. Auch in Namibia und Nicaragua sei sie schon gewesen, auf Einladung der dort führenden Genossen, aber Chile kenne sie mit Ausnahme ebenjener Pazifikstadt Valparaiso und Santiago kaum – und das nach über zwanzig Jahren Aufenthalt. Umso mehr Aufmerksamkeit widmete sie offenbar ihrem eigenen Stückchen Chile: Kein Stäubchen, glatte Böden und blitzblanke Fliesen waren ein Beleg dafür, dass in jenem zweistöckigen Haus mit vier Zimmern jemand wohnte, der sehr auf Sauberkeit achtete.
Nach Erich Honeckers Tod war der erwähnte Enkel Roberto zu seiner Großmutter gezogen, die ihn unterstützte. Der stämmige junge Mann fasste seine Befindlichkeit in ihrem südamerikanischen Exil einmal in einem Interview in folgendem bemerkenswerten Satz zusammen: »Ich bin der letzte DDR-Bürger, weil ich bei ihr lebe.«[2]
War ich in dieser Wohnung, dann kam ich mir zwar nicht vor wie in einer der damals so begehrten 3-Zimmer-Plattenbauwohnungen in Halle-Neustadt, Jena-Lobeda, Leipzig-Grünau oder Rostock-Lichtenhagen, denn dafür war es zu gutbürgerlich. Es fühlte sich aber auch nicht an wie in einer typisch chilenischen Wohnung mit ihrem offenen, hellen, südamerikanischen Flair. Die Einrichtung machte es einem gleich begreiflich: Hier wohnte seit fast einem Vierteljahrhundert eine Diktatorenwitwe, die gefühls- und verstandesmäßig in der intakten DDR und heilen Welt der SED lebte, die aber gleichzeitig auf einem weit höheren Standard zu konsumieren gewohnt war als die allermeisten DDR-Bürger.
Doch jenes Domizil gehörte nun der Vergangenheit an. Dorthin, wo ich sie 2013 und 2015 getroffen hatte, sollte ich also dieses Mal nicht mehr kommen – niemals wieder. Margot Honecker war ein letztes Mal umgezogen – und zwar als Pflegefall in das Reihenhaus ihrer Tochter Sonja, das ebenfalls in La Reina und nicht weit von ihrer alten Wohnung lag, diesmal ohne dicke Grenzmauer, aber immerhin mit dickem Wachmann. Es war das vorletzte Haus in einer langen Reihenhaussiedlung. Eine edle braune Holztür. Wiederum einladend eingerichtet, wiederum nicht luxuriös, aber auch nicht billig. Margot Honecker sagte, sie wolle jetzt ihre alte Wohnung in La Reina vermieten, um sich mit den zusätzlichen Einnahmen angemessen pflegen lassen zu können. Rund um die Uhr wurde sie von chilenischen Krankenschwestern versorgt, die der bettlägerigen alten Frau Morphin gegen die Schmerzen verabreichten: »Ich kriege alle vier Stunden Opium gespritzt.« Sie sagte das mit fester Stimme und ohne jede Bitterkeit.
Im Haus ihrer Tochter also sollten wir uns wiedersehen, und vom Krankenlager aus begrüßte Margot Honecker mich in jenem Zimmer, in dem sie einen Monat später sterben sollte. Als ich es betrat, lag keinerlei Geruch nach Alter, nach Krankheit oder Tod in der Luft, wie man ihn aus manchem Pflegeheim kennt. Bis auf die zahlreichen Tablettenpackungen deutete in dem hellen, freundlichen Zimmer nichts darauf hin, dass Margot Honecker nur noch vier Wochen zu leben haben sollte.
Ihr Gesicht wirkte auch nicht fahl oder eingefallen, wie ich das erwartet hatte, sondern sie hatte den leicht gebräunten, beinahe gesunden Teint jener Frau, die während der Zeit unserer Begegnungen auf sich, auf ihre Gesundheit und auf ihr Äußeres genau geachtet hatte. Exakt sitzende, gestärkte Blusen, wache Augen und kein Gramm Fett zu viel, ohne dabei je mager oder krank zu wirken. So kontrolliert begegnete mir Margot Honecker nicht nur zu diesem Anlass.
Als ich den Raum langsam, ja vorsichtig betrat, saß sie bereits kerzengerade auf dem Bett, in modischem Poloshirt und dunkelblauem Pullover, eine weiße Decke über die Beine gebreitet. Sie wirkte trotz des Morphins nicht benebelt. Und sie klang auch nicht schwach wie manchmal am Telefon. Sie war ganz bei sich und schien sich auf ihren Gast zu freuen. In keinem unserer Gespräche hatte sie trotz ihres hohen Alters je ein Problem gehabt, sich an Menschen und Ereignisse zu erinnern. Sie zeigte bis zum Schluss nicht das leiseste Anzeichen einer Altersdemenz.
Sie war bestens auf meinen Besuch vorbereitet – alles wie immer eigentlich. Mit einer Ausnahme: Wir wussten beide, dass es der letzte Besuch sein sollte. Das hatte sie mir bereits am Telefon gesagt. Ein Abschied für immer, nicht unter Freunden, aber unter Menschen, deren Wege sich mehrfach gekreuzt und die sich offenbar etwas zu sagen hatten.
Eigentlich bildeten wir eine höchst unwahrscheinliche Kombination. Sie, die gebürtige Hallenserin, war nicht nur fast ein halbes Jahrhundert älter als ich. Wir hatten auch in zwei deutschen Staaten gelebt, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Sie war bekennende Stalinistin und machtbewusste Ministerin, First Lady in einem totalitären Staat und unbeirrbar linientreue Ideologin. Ich wiederum wirke politisch interessiert, aber undogmatisch als Hochschullehrer an einer westdeutschen Universität und bemühe mich, mit und für junge Leute strukturiert Wissen zu schaffen. Wissenschaft ist für mich genau das: Diese bedingungslose wie strukturierte Suche nach Wahrheit, ohne zugleich Wahrheitsmonopole anzustreben oder diese auch nur zu akzeptieren.
Das war bei ihr ganz anders. Sie glaubte genau zu wissen, was wahr und was unwahr war. Einmal rekonstruierten wir gemeinsam den Liedtext des bekannten Songs der FDJ-nahen Gruppe Oktoberklub, der da lautet: »Sag mir, wo du stehst«. Darin heißt es: »Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. / Auch nickende Masken nützen uns nichts, / Ich will beim richtigen Namen dich nennen, / Und darum zeig mir dein wahres Gesicht!«
Während ich mich fragte, warum überhaupt irgendein Staat ein »Recht« darauf haben sollte, »mich zu erkennen«, und ob es nicht Gott allein vorbehalten bleiben sollte, uns beim rechten Namen zu nennen, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich Margot Honecker solche Fragen nicht stellte. Natürlich hatte der sozialistische Staat jederzeit das Recht, zu fordern: »Sag mir, wo du stehst.« Und da gab es keinen Raum für Ambivalenzen oder differenziertere Haltungen, sondern nur: Freund oder Feind, Revolutionär oder Konterrevolutionär, Genosse oder Klassenfeind, wahr oder unwahr.
Manchen Menschen, die anderen Böses angetan haben, geht das so sehr nach, dass sie Albträume haben und schlecht schlafen. Andere schlafen bestens. Am Ende unserer Gespräche nehme ich stark an: Wegen innerer Unruhe über ihren rigorosen Umgang mit Klassenfeinden und Gegnern ihres Regimes hat diese Frau keine Minute Schlaf verloren.
Ich habe über die Jahre öfter darüber nachgedacht, was Margot Honecker dazu bewogen haben mag, über einen längeren Zeitraum mit mir zu sprechen und mir damit Vertrauen zu schenken. Waren es vielleicht gerade die Unterschiede zwischen unseren Lebenswegen, die sie anzogen? Sie betonte mehrfach: »Ich bin Autodidakt.« Sie hätte gern mehr formale Bildung genossen. Sie habe darum einen hohen Respekt vor Bildung und Wissen. Gleichzeitig hatte sie als Ministerin für Volksbildung das Bildungswesen der DDR mit eiserner Härte ideologisch verbogen. Und sie hatte alle, bei denen sie abweichende Ansichten auch nur vermutete, gnadenlos von Bildungs- und Lebenschancen ausschließen lassen.
Ebendas, die Zerstörung von Biographien, haben die Verbände der Opfer des SED-Regimes Margot Honecker anlässlich ihres Todes noch einmal vorgeworfen. Von der Partei Die Linke war übrigens zu diesem Anlass überhaupt nichts zu hören – vermutlich deshalb, weil Margot Honecker aus jener Partei, da hieß sie noch Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS), im Februar 1990 ausgetreten ist, angewidert von all den Häutungen. Zugleich trauerte die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) um ihr »Ehrenmitglied Genossin Margot Honecker« mit großem Porträt auf der Webseite der Partei. Sie sei »auch fernab ihrer Heimat (…) der DDR und der gerechten Sache des Sozialismus immer treu geblieben«.
»Genossin Honecker« war zeitlebens konsequent. Konsequent, auch gegen sich selbst, das schien sie immer zu sein, was einem einerseits zunächst einen gewissen Respekt abnötigte und ihr andererseits zum Vorwurf gereichte, denn sie hatte ein Leben lang zweifellos einen Irrweg verfolgt – hart und unerbittlich.
Aber zurück zu Honecker und Oermann, dem seltsamen Paar in diesem chilenischen Krankenzimmer: Weiteres trennte uns und verband uns anscheinend doch. Neben meiner Tätigkeit in Forschung und Lehre an einer Universität arbeite ich weiterhin ehrenamtlich in meinem Dorf als ordinierter und aktiver Pastor der evangelischen Kirche. Und die Kirchen waren in der DDR aus Margot Honeckers Sicht vor allem eines: Schutzräume für Staatsfeinde. Zudem war ich beratend für große Wirtschaftsunternehmen tätig gewesen, also aus ihrer Sicht ein Experte für die Optimierung des ausbeuterischen Kapitalismus.
Meine Habilitationsschrift hat – ausgerechnet – Richard Schröder betreut, SPD-Fraktionsvorsitzender der ersten und einzigen frei gewählten DDR-Volkskammer und einer der schärfsten und klügsten Kritiker des SED-Regimes, was Margot Honecker doch eigentlich abstoßen musste – oder eben neugierig machen. Gleich zu Anfang hatte ich ihr meinen Lebenslauf gemailt. Es war ihr also zudem bekannt, um nun das Maß wirklich vollzumachen, dass ich beruflich sowohl dem Bundesminister der Finanzen und dem geistigen Vater des Einigungsvertrages Wolfgang Schäuble seit fast 15 Jahren zuarbeite als auch der Persönliche Referent von Bundespräsident Horst Köhler gewesen bin, der ja bei der Herstellung der Deutschen Einheit und beim friedlichen Abzug der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, also bei der Abschaffung der DDR und der Aussöhnung Deutschlands mit Russland, eine wichtige Rolle gespielt hat.
Aus ihrer Sicht musste ich fast wirken wie ein Abgesandter der Totengräber des zweiten deutschen Staates, wie ein apokalyptischer Reiter des ärgsten Klassenfeindes, der BRD. Ich selbst sah meinen ersten Besuch 2013 als eine zunächst zweckfreie Forschungs-, ja gewissermaßen Besichtigungsreise an. Ich nutzte einfach die seltene Chance, einer so interessanten wie hochumstrittenen Person persönlich zu begegnen. Anfangs war es vor allem diese Inaugenscheinnahme, verbunden mit dem Wunsch, eine Art Mythos zu besichtigen, der mich in dieses Haus in Chiles Hauptstadt geführt hatte. Sie hingegen wird zumindest mit der Möglichkeit gerechnet haben, dass da ein westdeutscher Abgesandter der Politik und Hochfinanz mit einer klaren wie finsteren politisch-journalistischen Agenda ebendiese Person der Zeitgeschichte aufsucht – selbst wenn ihr unser gemeinsamer, in seinem Klassenstandpunkt unverdächtiger Bekannter versichert hatte, dass da ein »freundlicher Mensch« zu ihr käme. Schließlich war es ihr ja schon einige Male zuvor so ergangen.
Waren all das nicht absolute Unverträglichkeiten und denkbar schlechte Voraussetzungen für gute Gespräche? Dennoch habe ich nach unserem ersten Treffen gleich die nächste Einladung zu Kaffee und Gebäck erhalten und dankend angenommen, und sie begegnete mir stets freundlich, ja heiter und aufgeschlossen.
Margot Honecker empfand unsere Treffen ganz offenbar als anregend. Warum das so war? Ich weiß es nicht. Aber sind nicht in einem solchen Fall selbst die Vermutungen interessant?
Eine erste Vermutung: Margot Honecker hatte, wie erwähnt, durchaus Respekt vor Bildung, Wissenschaft und Forschung. Möglicherweise hatte sie darum den Eindruck, dieser Wissenschaftler aus der »BRD« biete aufgrund seines akademisch seriösen und vor allem auch im englischsprachigen Ausland erworbenen Profils eher als ein Journalist die Gewähr, gut zuhören und verstehen zu wollen und zu können, objektiv zu sein und fair zu urteilen. Sie sagte mir das auch gleich zu Anfang und ganz ohne Umschweife: »Wenn Sie ein Journalist wären und kein Wissenschaftler, dann hätte ich mich nie mit Ihnen getroffen.« An irgendwelche Autorisierungen von Interviews war ganz offensichtlich gar nicht zu denken. Und kamen wir in unseren Gesprächen ab und an auf Journalisten zu sprechen, verzog sie meist das Gesicht, als hätte sie plötzlich einen schlechten Geschmack im Mund.
Gemeldet hatte ich mich bei ihr, ohne vorab einen detaillierten Plan zu haben. Der gemeinsame Bekannte hatte erwähnt, dass er sie recht gut kenne und dass er sie öfter in ihrem chilenischen Exil kontaktiere. Er hatte mir ihre E-Mail-Adresse gegeben und sie darüber informiert, wer sich da melden werde. Und ich formulierte schließlich einfach einmal eine Gesprächsanfrage und klickte auf Senden.
Eine zweite Vermutung: Ein Gesprächspartner wie ich war nach ihrem Dafürhalten weder ein Feind, der sich unter Vorwänden einschlich, um dann ihr Vertrauen reißerisch zu missbrauchen und Bilder aus ihrer Wohnung an die Regenbogenpresse zu verkaufen, noch ein kritikloser Freund, der ohnehin alle ihre Überzeugungen teilte und immerfort bloß Jasager war. Ersteres glaubte Margot Honecker 2012 erlebt und erlitten zu haben, jedenfalls stellte sie es mir so dar: »Einer von uns«, damit meinte sie einen mit ihr befreundeten Journalisten und »Genossen«, sei mit einem Herrn bei ihr aufgetaucht, und der ihr unbekannte Mann habe ihr einige ungeschminkte Antworten entlockt – und sich erst danach als Mitarbeiter der ARD zu erkennen gegeben. Dieses legendäre und einzige ausgestrahlte Interview war Teil des Dokumentarfilms Der Sturz – Honeckers Ende, der mit beachtlichen 4,2 Millionen Zuschauern seinerzeit ordentlich Furore gemacht hatte[3] – auch aufgrund der Härte und Kälte, mit der Margot Honecker ganz wie eine »lila Hexe« (so wurde sie in der DDR wegen ihrer damaligen Haarfarbe gern genannt) über Mauertote (»Die brauchten ja nicht über die Mauer zu klettern«), Schießbefehl (diesen nannte sie eine bösartige West-Lüge, denn es habe nur Bestimmungen über den ordnungsgemäßen Waffengebrauch gegeben), in sogenannten »Werkhöfen« eingesperrte und misshandelte Jugendliche (»Banditen«) und anderes DDR-Unrecht gesprochen hatte. So redete man eben unter den Freunden und Gleichgesinnten, für die Öffentlichkeit hätte sie solche Äußerungen niemals autorisiert; aber der Interviewer hatte sich erst nachträglich als Feind entpuppt und seine Beute weidlich ausgeschlachtet.
Der wegen seiner zeitweisen Nähe zu den Nazis berühmt-berüchtigte Staatsrechtler Carl Schmitt hat geschrieben, politisch zu denken setze die Fähigkeit voraus, Freund und Feind unterscheiden zu können. Unter diesem Gesichtspunkt war Margot Honecker von sich als echtes politisches Naturtalent überzeugt, denn sie glaubte, alle Welt treffsicher in Freund und Feind einteilen zu können. Und sie ärgerte sich sehr darüber, dass dieser Instinkt sie bei jenem NDR-Journalisten im Stich gelassen zu haben schien. Er hatte es ihr aber auch schwergemacht, weil er ihrer Überzeugung nach heimlich von der Freund- in die Feind-Schublade gewechselt war. Ich passte anscheinend in keine der beiden Schubladen.