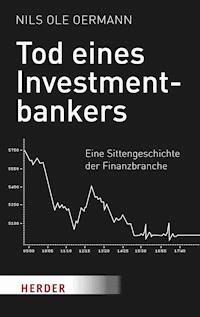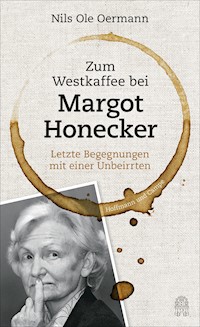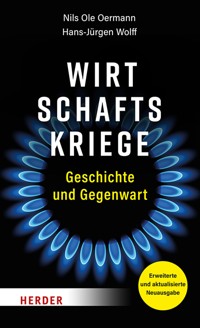
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch von Nils Ole Oermann und Hans-Jürgen Wolff erklärt eindrucksvoll, wie Handel und Wirtschaft als Waffe im Kampf um die internationale Vormachtstellung eingesetzt werden. Es bietet eine sachliche und fundierte Analyse der wirtschaftlichen Auseinandersetzungen von der Kolonialisierung Amerikas bis zum Zollkrieg von Donald Trump. In einer Zeit, in der Handelskonflikte, Zölle und Sanktionen die internationalen Beziehungen dominieren, liefert dieses Standardwerk wertvolle Einblicke in die Mechanismen und Strategien, die hinter diesen wirtschaftlichen Machtspielen stehen. Es zeigt - die historische Hintergründe und Entwicklungen von Wirtschaftskriegen - den Einfluss der Globalisierung und internationaler Beziehungen auf Handelskriege - die Rolle von Sanktionen, Zöllen und Protektionismus in der modernen Wirtschaftspolitik - sowie die wirtschaftlichen und politischen Machtspiele im globalen Kontext, insbesondere zwischen den USA, China und Russland Dieses Buch ist ein unverzichtbares Werk für alle, die die aktuellen Entwicklungen besser einordnen und die Auswirkungen wirtschaftlicher Konflikte auf die Weltpolitik verstehen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nils Ole Oermann/Hans-Jürgen Wolff
Wirtschaftskriege
Geschichte und Gegenwart
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand
Umschlagmotiv: © Ilya Rumyantsev / GettyImages
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timișoara
ISBN Print: 978-3-451-38548-3
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-82981-9
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-82982-6
Inhalt
Einleitung „Krieg, Handel und Piraterie“
Kapitel 1Wirtschaftlicher Wettbewerb, Handelskriege und ihre Ursachen in der Moderne
Enge Verbindung: Wirtschaft, Wettbewerb und Wettstreit
Die Anfänge im 16. Jahrhundert – Entdeckungen, Plünderung und Krieg
Vom Merkantilismus zur modernen Handelstheorie – mit der Konstante Sklaverei
Der Kapitalismus als Kriegstreiber, oder die Kapitalisten?
Kapitel 2Die Begriffe Sanktion, Handelskrieg und Wirtschaftskrieg
Wirtschaftssanktionen
Handelskriege
Wirtschaftskriege
Bewaffneter Konflikt mit wirtschaftlicher Zielsetzung
Kampf gegen die feindliche Kriegswirtschaftskraft im bewaffneten Konflikt
Kampf gegen die gegnerische Wirtschaftskraft ohne bewaffneten Konflikt
Der Wirtschaftskrieg des Westens mit Russland
Kapitel 3Handels- und Wirtschaftskriege in der Geschichte
Überblick 1500–1945
Das Beispiel Großbritannien
Kapitel 4Ein Land erdrosseln, um seinen König umzustimmen? Wirtschaftskriege aus ethischer Sicht
Kriegsgründe, Kriegsziele und Kriegführung
Zur Ethik von Sanktionen
Weiß man wirklich, was man anzettelt? Eine Folgenabschätzung
Die Komplexität steigt – auch in der wirtschaftsethischen Abwägung
Kapitel 5Sanktionen, Handelskonflikte, Wirtschaftskriege und Recht
Das Völkerrecht für bewaffnete Konflikte
Das Recht zu Eingriffen in Handels- und Finanzbeziehungen außerhalb bewaffneter Konflikte
Überblick
WTO und GATT
Kritik an der WTO-Praxis und Reformdebatte
Kapitel 6Die Ökonomie von Handel und Wettbewerb und die Handelspolitik bis 1945
Die Ökonomie von Handel und Wettbewerb
Handelstheorie und das Plädoyer für Schutz- und Erziehungszölle
Die Aktualität der Debatte über den Freihandel
Gibt es den optimalen Zoll? Zölle gegen Arbeitslosigkeit?
Sozialer Ausgleich für Freihandelsverlierer?
„Die Dosis macht das Gift“ – auch beim Freihandel?
Die handelspolitische Praxis bis 1945
Kapitel 7Die Wirksamkeit von Wirtschaftssanktionen, Gewinnbarkeit von Handelskriegen, Erfolgsaussichten des Wirtschaftskrieges mit Russland, Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsbeziehungen und Kriegsursachen
Die Wirksamkeit von Wirtschaftssanktionen
Die Gewinnbarkeit von Handelskriegen – der Fall des Präsidenten Trump
Ist Handelskrieg immer eine Mission impossible?
Die Stationen des Handelskrieges von Präsident Trump
Der IKT-Konflikt
Die wirtschaftlichen Folgen
Gesamtbewertung
Die Erfolgsaussichten des Wirtschaftskrieges mit Russland
Die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsbeziehungen und Kriegsursachen
Kapitel 8Was prägt Wirtschaftskriege heute? Die Entwicklung seit 1989
Demografische und technologische Sprünge
Umwälzungen in Wirtschaft und Finanzen
Auf dem Weg in eine neue Weltordnung?
Veränderungen in der Wirtschaftskriegführung
Spionage, Kriminalität und Kriegführung ohne bewaffneten Konflikt im Cyberspace
Wirtschaftliche Signalgebung, Aggressionen und Sanktionen
Sanktionen im internationalen Finanzsystem
Währungskrieg
Kapitel 9Die chinesische Herausforderung und der uneinige Westen
Washington geht auf Gegenkurs, Europa ringt um eine Haltung
Wonach strebt die Volksrepublik China?
Chinas militärischer Fußabdruck wird größer
China durchdringt die Wirtschaftsräume der Welt
Chinas finanzieller Einfluss wächst
Chinas Drang nach Wissen – und nach Kontrolle
Kapitel 10Was tun?
Sieben Empfehlungen
Umfassender Systemwettbewerb
Das westliche Modell wieder zum Leuchten bringen
Wirtschaft und Finanzen in Einklang mit der Außen- und Sicherheitspolitik
Westeuropa, die EU und die transatlantische Partnerschaft
Reform der internationalen Wirtschaftsordnung und Durchsetzung ihrer Regeln
China, Russland, Iran
Kein Ende in Sicht
Anhang
Anmerkungen
Über die Autoren
Einleitung „Krieg, Handel und Piraterie“
In den Staatenbeziehungen sind Handelskonflikte Alltag. Sie wurzeln im wirtschaftlichen Wettbewerb und in politischen Interessengegensätzen. Handelskonflikte durchziehen die Geschichte seit der Antike, sie prägen auch gegenwärtig wieder das Geschehen, sie beeinflussen unser aller Leben, und sie können es elend machen.
Handelskonflikte werden schnell bösartig. Es gibt ein Abwärtskontinuum, das fugenlos von hartem Wettbewerb bis zu umfassendem Wirtschaftskrieg und bewaffneter Auseinandersetzung reicht. Der Weg nach unten erweist sich oft als Talfahrt wider Willen. Handelskonflikte und die Entscheidungen, die in ihnen getroffen werden, weisen stets ihre je eigene Mischung von Motiven, Erwartungen, Überzeugungen und Weltsichten auf. Sie werden von vielschichtig verschlungenen politischen, wirtschaftlichen und geistigen Faktoren angetrieben und unterscheiden sich darum alle voneinander. Außerdem bestätigen sie William Faulkners Feststellung: „Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.“ Der Protektionismus, den Alexander Hamilton erwog und den Friedrich List empfahl, taucht in modernen asiatischen Entwicklungsstrategien wieder auf;1 die Opiumkriege des 19. Jahrhunderts gegen China sind in der Volksrepublik China von schmerzhafter Gegenwärtigkeit; der Zusammenbruch der Sowjetunion beeinflusst noch immer zutiefst die Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa sowie in Zentralasien. Und dieweil die Vergangenheit keineswegs vergangen ist, grenzt sie obendrein ans Unvorhersagbare: Wer hätte sich vorstellen können, dass Harry Dexter White, einer der wichtigsten amerikanischen Architekten der internationalen Wirtschafts- und Finanzordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, starke Sympathien für die Sowjetunion hegte und auf dem Weg von den Wirtschaftssanktionen der USA gegen Japan bis zum japanischen Angriff auf Pearl Harbor eine bedeutsame Rolle spielte?2 Wer hätte gedacht, dass die chinesische Botschaft in Belgrad 1999 von der U.S. Air Force möglicherweise gezielt bombardiert wurde, um amerikanische Tarnkappenbombertechnologie zu zerstören, die China sich verschafft hatte?3 Und wer wusste damals, als US-Präsident Donald J. Trump auf Strafzölle gegen Stahlimporte aus mit Amerika verbündeten Nationen drängte und das mit dem Schutz der nationalen Sicherheit begründete, dass ihm sein Verteidigungsminister James Mattis schriftlich erwiderte, solche Strafzölle seien unnötig und drohten wichtige Allianzen und damit die Sicherheit der USA zu gefährden?4
Aus all diesen Gründen der Komplexität und der bekannten und unbekannten Unbekannten ist es schwierig, das dichte Geflecht von Handelskriegen darzustellen und zu entwirren. Es ist nötig, sie durch viele Linsen zu betrachten und die unterschiedlichen Befunde zu einem Gesamtbild zusammenzuführen, das ihre Geschichte und Ideengeschichte zeigt, ihre wirtschaftlichen und politischen Antriebskräfte und Folgen, ihre ethischen und rechtlichen Grenzen und den Einfluss des technischen Fortschritts (vom mechanischen Webstuhl über chininhaltige Medikamente bis zum Zündnadelgewehr). Die Erkenntnisse fallen getrennt an und müssen doch zusammen erfasst werden; sie haben keine gemeinsame logische Wurzel und beziehen sich doch auf dasselbe Thema; sie ergänzen sich und relativieren sich zugleich gegenseitig. Darum liegt eine Schwierigkeit unserer Darstellung darin, dass wir nicht alles auf einmal sagen können, weshalb wir unsere Leser fast bitten möchten, das Buch zweimal zu lesen (so wie man den Roman Emma von Jane Austen am besten zweimal liest, um ihn gänzlich zu genießen).
Wir wollen zeigen, wie über den Zusammenhang von Wirtschaft und Macht gedacht werden sollte, nicht was. Das heißt allerdings nicht, dass wir weder Überzeugungen hegen noch Vorverständnisse besitzen. Zunächst einmal denken wir, dass der Mensch eine ziemlich gefährliche Spezies ist. Die Menschen sind nicht von Natur aus gut und allenfalls durch die herrschenden Umstände oder das „falsche“ politische System verdorben. Viele Zeitgenossen würden in jedem sozialen Umfeld eigensüchtig und rücksichtslos ihren Vorteil suchen, allein oder in Gruppen (darum setzte Augustinus ungerechte Königreiche mit Räuberbanden gleich und Räuberbanden mit ungerechten Kleinstaaten). Das gilt auch im Bereich der Wirtschaft. Darum teilen wir nicht die einst populäre Ansicht, Märkte bräuchten kaum Regulierung, weil sie Fehlverhalten von selbst bestraften und Fehlentwicklungen schnell und zu minimalen Kosten korrigierten. Im Gegenteil: Volkswirtschaften und die Weltwirtschaft brauchen starke und kluge Regeln, ständige Aufsicht und wirksame Eingriffe, um ihr faires Funktionieren und akzeptable soziale Resultate zu sichern. In der Wirtschaft wie in der Politik gibt es keinen Ersatz für regelbasierte Ordnungen,5 sonst drohen Willkür, Anarchie, Faustrecht und Ungerechtigkeit. Im Grunde lässt sich die Weltgeschichte als das Streben nach regelbasierten Ordnungen erzählen. Dieses Streben hat freilich ebenso wenig ein Ende wie die Geschichte. Die internationalen Beziehungen werden voraussichtlich nicht einen Zustand erreichen, in dem ein unpersönlicher Mechanismus widerstreitende Interessen ausbalanciert und Konflikte auflöst (künstliche Intelligenz mag eines fernen Tages dazu verhelfen). Darum ist die Fähigkeit zur Selbsthilfe und Selbstverteidigung wichtig, und darum ist für die bestehenden Regeln oft ein starker Manager oder sogar ein Hegemon nötig. Allerdings können auch Regeln und ihre Durchsetzung unfair sein. Jede Ordnung hat ihre politische Ökonomie, die sich für gewöhnlich aufdecken lässt, indem man prüft, wer von den herrschenden Verhältnissen in welchem Umfang profitiert und wen sie womöglich Chancen kosten.6 Gerade um Handelskriege zu erklären, ist oft ein genauer Blick auf die politische Ökonomie der jeweiligen internationalen Beziehungen und der inneren Verhältnisse in den beteiligten Staaten nötig.7 Als ebenso nötig kann sich ein genauer Blick auf entstehende Ordnungen erweisen, um Ungerechtigkeiten zu verhindern.
Die Frage, wer unter welchen Umständen was will und was bekommt, lässt sich zuspitzen: Sind vor allem profitsüchtige und einflussreiche Interessengruppen verantwortlich für den Ausbruch von Handelskriegen, besonders der bewaffneten und gewaltsamen? Es gibt eine Denkschule und die immer wieder plausibel wirkende Intuition, als treibende Kraft hinter Handelskriegen den Kapitalismus als solchen oder „die Kapitalisten“, „Händler des Todes“ und „gierige Banker“ zu vermuten. Wir betrachten diese Verdächtigungen als widerlegt. Moderne Industrienationen werden nicht von mächtigen Interessengruppen in Handelskriege oder gar bewaffnete Konflikte gelotst. Wenn Politiker über Konflikte, Krieg und Frieden entscheiden, werden sie von Erwägungen über die Sicherheit, die Selbstbehauptung und die Wohlfahrt ihrer Nation bestimmt, nicht von beschränkten Gruppeninteressen (auch wenn es nicht schadet, die Politiker ständig daran zu erinnern, dass sie vor allem dem Gemeinwohl verpflichtet sind). Und es sind Staaten, nicht Gruppeninteressen, die in den internationalen Beziehungen bei Weitem die wichtigsten Akteure sind und bleiben werden.
Leider führt diese Ausrichtung der politischen Entscheidungsträger am jeweiligen Wohl ihrer Nation nicht zu einer selbststabilisierenden internationalen Harmonie. Zwar lassen sich immer mehr nationale Interessen nur noch angemessen definieren und verwirklichen, wenn man dabei auch das globale Gemeinwohl berücksichtigt und die internationale Zusammenarbeit sucht. Aber viele zwischenstaatliche Interessenkonflikte bleiben, und Rivalitäten, gegenseitige Abneigungen, Großmachtpolitik und die wohlbegründete Furcht vor bösen Absichten haben weiter starken Einfluss auf die internationalen Beziehungen. Darum bleibt vernünftigerweise Wachsamkeit der Preis der Freiheit.
Falls das ein wenig nach Thomas Jefferson und NATO klingt,8 soll es uns recht sein. Wir betrachten schließlich die Welt aus der Perspektive einer westlichen freiheitlichen Demokratie, deren Grundsätze und Werte wir teilen. Das schränkt einerseits unseren Blickwinkel ein. Andererseits sind wir davon überzeugt, dass das westliche Modell für alle Völker attraktiv sein kann – vorausgesetzt, die westlichen Demokratien bringen ihr Modell wieder zum Leuchten. Das ist dringend geboten, denn es wird von innen wie von außen herausgefordert. Im Innern hat es Kraft, Vertrauen, Zustimmung und Legitimität verloren, und das aus eigener Schuld. Nach außen muss es sich mit völlig andersartigen politischen Systemen auseinandersetzen, vor allem mit der Russischen Föderation und der Volksrepublik China. Gegen Russland führt der Westen mittlerweile (Dezember 2022) einen Wirtschaftskrieg ohne gegenseitigen Schießkrieg. Im Verhältnis zu China sucht der Westen noch immer nach einer gemeinsamen Haltung für eine Herausforderung von beispielloser Größe, für eine wahrlich systemische Konkurrenz. Alle diese Aufgaben folgen aus den tiefgreifenden Veränderungen seit 1989. Innerhalb von 30 Jahren hat die Welt mehrere Revolutionen erlebt: die Auflösung des Sowjetblocks, den Wiedereintritt Chinas in die Weltwirtschaft und in die Weltpolitik, den Aufbruch Afrikas und eine permanente Revolution der Informations- und Kommunikationstechnologien, die den Welthandel verändert haben, den Kapitalismus, den öffentlichen Diskurs, die staatliche Überwachung – und den Handels- und Wirtschaftskrieg.
Das bis hierher Gesagte hat den Aufbau des Buches bestimmt. Kapitel 1 behandelt das Kontinuum von fließenden Übergängen zwischen wünschenswertem wirtschaftlichem Wettbewerb und tödlichem Handelskrieg und untersucht, ob für viele oder für die meisten Handels- und Wirtschaftskriege der Kapitalismus als solcher oder kommerzielle Interessengruppen verantwortlich sind. Kapitel 2 bringt Definitionen der Begriffe Wirtschaftssanktion, Handelskrieg und Wirtschaftskrieg. Es ist notwendig, sich mit allen drei Begriffen zu befassen, weil viele Ideen und Instrumente des Wirtschaftskampfes in allen drei Bereichen entwickelt und verfeinert wurden. Außerdem sind klare Begriffe nötig, um übermäßiger Kriegsrhetorik vorzubeugen, die nur die internationale Atmosphäre vergiftet und politische Debatten überhitzt. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Geschichte der Handels- und Wirtschaftskriege von etwa 1500 bis 1956. Um 1500 begann das sogenannte Zeitalter der Entdeckungen und der europäischen Expansion, und der europäische Staat der Frühen Neuzeit entwickelte sich rasch. Das Enddatum ergibt sich aus der Tatsache, dass die Geschichte von England und Großbritannien ausführlicher erzählt wird: Für Großbritannien war, was die wirtschaftliche Kriegführung anbelangt, 1956 ein einschneidendes Jahr, weil es damals in der sogenannten Suezkrise eine empfindliche Niederlage erlitt. Das Vereinigte Königreich wurde nicht zufällig für eine nähere Betrachtung ausgewählt. Erstens hat Großbritannien das meiste gelernt und gelehrt, was man braucht, um Handelskriege zu gewinnen. Zweitens haben die britische Wirtschaft, Marine und Regierung von etwa 1815 bis 1914 die Weltwirtschaft geprägt, ja geschaffen – durch die Eroberung der Welt und die Aufrechterhaltung einer internationalen Ordnung, durch die Versorgung der Welt mit Industriegütern und indem sich England als offener Markt für die Exporte anderer Länder anbot, die ja doch Geld verdienen mussten, um britische Waren kaufen zu können.9 Kapitel 4 befasst sich mit der Ethik von Wirtschaftssanktionen, und in Kapitel 5 wird das derzeit geltende Recht für Handelskonflikte und Wirtschaftskriege dargestellt. Kapitel 6 behandelt die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte des internationalen Handels und die Handelspolitik bis 1945. Kapitel 7 untersucht die Wirksamkeit von Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die Gewinnbarkeit von Handelskriegen, die Erfolgsaussichten des Wirtschaftskrieges westlicher Demokratien mit Russland und ob und wie die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großmächten mit der Entstehung von Krisen und Kriegen zwischen ihnen zusammenhängen. Kapitel 8 widmet sich den tiefgreifenden Veränderungen in der Technologie, in der Weltwirtschaft und in den internationalen Beziehungen seit 1989. Kapitel 9 skizziert den Aufstieg Chinas und die bisherige Reaktion des Westens, und in Kapitel 10 versuchen wir, das Bild mit einer Reihe von Empfehlungen für Nationen abzurunden, die in freiheitlichen Demokratien leben.
Die erste Auflage dieses Buches erschien im April 2019. Damals wirkten sein Thema und seine Empfehlungen hierzulande noch auf viele Betrachter wenig akut. Eine völlig überarbeitete und erheblich erweiterte Ausgabe erschien im August 2022 auf Englisch.10 Inzwischen gab es auch in Deutschland kein wichtigeres politisches Thema mehr. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die internationalen Beziehungen radikal verändert. Er fügt vor allem der Ukraine, aber auch Drittstaaten Schäden zu, für die Russland völkerrechtlich haftet. Die meisten westlichen Demokratien führen gegen Russland Wirtschaftskrieg. Er ist in seinem Umfang und seiner Schärfe beispiellos zwischen Großmächten, die sich nicht im bewaffneten Konflikt miteinander befinden. Ein Ende ist nicht abzusehen. Die russische Aggression hat zugleich das Verhältnis des Westens zur Volksrepublik China weiter belastet, denn China hat zwar diese Aggression weder verursacht noch bisher gefördert, steht aber grundsätzlich ausdrücklich an der Seite Moskaus. Ohnehin haben sich die Beziehungen des Westens zu China verschlechtert, weil die Volksrepublik sich seit Langem unfaire Wettbewerbsvorteile verschafft, seit geraumer Zeit immer fordernder und kompromissloser auftritt, eigene Minderheiten unterdrückt und fremde Bürger und Nationen unberechtigt und unakzeptabel drangsaliert. Im Westen verändert sich angesichts all dessen das Denken über die Globalisierung und ihre Gestaltung. Der unüberbrückbare Gegensatz zwischen Demokratien und Autokratien wird besser verstanden, die Zerbrechlichkeit vieler Produktions- und Lieferketten kommt zu Bewusstsein, und die Sensibilität für eigene Abhängigkeiten von nichtbefreundeten Mächten wächst. Alle Staaten tasten sich und andere auf wirtschaftliche Verwundbarkeiten ab, denn sie wollen gegnerische Angriffe besser abwehren können und die eigenen Sanktionsinstrumente schärfen. Die westlichen Demokratien sehen ihre systemischen Rivalen und die Globalisierung mit anderen Augen. Ob sie aus dem so Erkannten auch die richtigen Schlüsse ziehen, bleibt abzuwarten.
In diesem Buch wird der Wirtschaftskrieg gegen Russland an mehreren Stellen ausführlich behandelt, vor allem in Kapitel 2 im Anschluss an die Definition von Wirtschaftskrieg, in Kapitel 7 im Anschluss an die Untersuchung über die Effektivität von Wirtschaftssanktionen und Gewinnbarkeit von Handelskriegen und in Kapitel 10 bei der Frage, wie die westlichen Demokratien künftig strategisch mit China, Russland und Iran umgehen sollten.
Was wäre ein deutsches Buch ohne Goethe-Zitat? In Faust. Der Tragödie zweiter Teil wird der weltläufige Teufel Mephistopheles als Kauffahrer ausgesandt. Er kehrt zurück als Chef einer Piratenflotte und verkündet bei seiner Ankunft gut gelaunt, der Rollenwechsel habe sich im gleitenden Übergang einfach so ergeben, denn: „Krieg, Handel und Piraterie, / Dreieinig sind sie, nicht zu trennen.“11 Kann das jemals wahr gewesen sein, ist es vielleicht selbst heute noch wahr, oder hat dieser Teufel nur versucht, sich herauszureden und noch dazu die Heilige Dreifaltigkeit zu verspotten? Wir werden versuchen, es herauszufinden …
Kapitel 1Wirtschaftlicher Wettbewerb, Handelskriege und ihre Ursachen in der Moderne
Enge Verbindung: Wirtschaft, Wettbewerb und Wettstreit
Es gibt zu viele, die vom Wohlstand durch Globalisierung schwärmen und achselzuckend über deren Verlierer hinwegsehen; die den Freihandel loben und ihn zum eigenen Vorteil verhindern; die eine regelbasierte internationale Ordnung preisen, darin aber bloß Trittbrettfahrer sein wollen und die Instandhaltungskosten anderen überlassen. Oliver Cromwell verlangte von seinem Porträtmaler ein ungeschöntes Gemälde: Es solle ihn zeigen mit allen Unzulänglichkeiten, „warts and all“ (mit allen Warzen). Solchem Realismus fühlen auch wir uns verpflichtet bei der Beschreibung der Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Wettstreit und Krieg.
Die meisten Menschen wollen mehr als nur leben – sie wollen gut leben. Dafür arbeiten sie, dafür arbeiten sie mit anderen zusammen, und dafür arbeiten sie gegen andere an. Schon im friedlichen Handel und Wandel steckt harter Wettkampf, ja strukturelle Gewalt: Wer bietet die beste Ware, produziert am günstigsten, macht den höchsten Gewinn? Wer schlägt die Konkurrenten aus dem Feld? Was Ordnungshüter „die Fähigkeit zur Aggression“ („the gift of aggression“)1 nennen, das kennzeichnet auch so manchen ehrbaren Unternehmer und sein Handeln; es hat zu Begriffen wie „schöpferische Zerstörung“ (Joseph Schumpeter) geführt. Die Zerstörung alter Strukturen durch fähige Unternehmer erhöht meist die allgemeine Wohlfahrt. Die Spinning Jenny zum Beispiel, die weltweit erste Spinnmaschine für Baumwollfasern, vervielfachte die Produktivität bei der Herstellung von Webgarn. Sie machte dadurch Tuch und Kleidung viel erschwinglicher für alle, und sie half den Weg zu bahnen für die Exportmacht der englischen Textilindustrie. Aber Jenny und die ihr folgenden Textilmaschinen raubten in England, auf dem europäischen Festland und in Übersee auch ungezählten handwerklich arbeitenden Menschen Lohn und Brot, und die Betroffenen haben die Gewalt dieser Veränderung oft erlitten und empfunden wie ein Kapitalverbrechen. Gewiss, in der längeren Frist wurden die vorindustriellen Webersleute Europas frei, in neuen Berufen ein weniger karges Dasein zu fristen. Zuerst aber brachte ihnen der technische Fortschritt noch größeres Elend, und Hilfen auf dem Weg zu neuem Auskommen suchten sie meist vergebens. Die englische Textilindustrie jedoch wurde so produktiv und politisch einflussreich, dass England seinen Indienhandel entsprechend manipulierte: Das blühende indische Textilgewerbe wurde mit hohen Abwehrzöllen auf Distanz gehalten und ausgezehrt, die indischen Einfuhrzölle für Textillieferungen der britischen Kolonialherren minimiert, die indische Baumwolle nach England gebracht, die daraus gefertigte Ware zum großen Teil teuer den Indern verkauft, und Hunderttausende indische Weber hungerten, weil ihre Handspinnräder zum Stillstand gezwungen waren. Mahatma Gandhi hat darum das Spinnrad zum Symbol des Widerstands gegen Ungerechtigkeit gemacht. So gleitend kann er sein, der Übergang von unternehmerischem Fortschritt und allgemeinem Wohlfahrtsgewinn zu räuberischen internationalen Handelsbedingungen mit kriegsähnlicher Not im Gefolge.2
Selbst ein vollkommen friedlich und fair erreichter, großer volkswirtschaftlicher Erfolg entwickelt nicht selten ein Eigenleben und erzeugt immer weiter ausgreifende und angreifende Sachzwänge, die zu Konfliktursachen werden können: Je erfolgreicher ein Land sich industrialisiert, desto mehr Rohstoffe müssen her und desto größere Absatzgebiete, und immer längere Liefer- und Vertriebswege verlangen nach immer mehr Infrastruktur. Je weiter das entsprechende Netz von Handelsniederlassungen und Auslandsinvestitionen, von Schürf- und Transportrechten, Lieferverträgen und Wirtschaftsabkommen, Häfen und Kanälen, Eisenbahntrassen und Flugplätzen ausgebaut wird, desto stärker wird dieses Netz wie von selbst zu einem internationalen Einflussfaktor und gewinnt Freunde, Verbündete und Abhängige, und desto mehr erscheint das Erreichte seinen Erbauern schützenswert und schutzbedürftig – was nahelegt, spätestens jetzt auch militärische Macht zu projizieren. All das weckt nur zu leicht den Argwohn anderer. Die erblicken womöglich selbst in fairen Handels- und Finanzbeziehungen ein Austauschverhältnis, von dem sie relativ weniger als die Gegenseite profitieren, eine Leiter, auf der der Gegner von morgen ihnen über den Kopf steigt und die er umstößt, sobald er sich auf den „kommandierenden Höhen der Weltwirtschaft“ festgesetzt hat, von denen schon Lenin sprach. Darum lautet beim Thema Wirtschaftskriege ein Schlüsselbegriff: Latenz. Latenz bedeutet das allmähliche, zunächst kaum wahrnehmbare Reifen von Entwicklungen, das sachte Heranrücken der Ereignisse, das langsame Erkennen der im Gegebenen schlummernden Möglichkeiten.3 Wenn sich täglich die Fläche der Seerosenblätter auf dem Teich verdoppelt, dann mag das lange Zeit recht idyllisch und biodivers aussehen, und das noch am vorletzten Tag – aber dann kippt das Biotop plötzlich um. Für die Latenz vor dem Umschlag haben Groß- und Hegemonialmächte meist empfindlichere Fühler und ein wacheres Bewusstsein als Klein- und Mittelmächte. Die neigen mangels Gestaltungsmacht mehr dazu, sich in den Gegebenheiten einzurichten und zu hoffen: Meine Nische wird schon nicht verschwinden.
Die Anfänge im 16. Jahrhundert – Entdeckungen, Plünderung und Krieg
Bereits im friedlichen Handel und Wandel also stecken viel Druck und Stress, persönliches Leid und riskante internationale Dynamik. Oft bleibt es aber nicht friedlich, wo es um Handel, Rohstoffe und Märkte geht. Durch die Jahrhunderte wurden Zwischenhändler physisch ausgeschaltet, fremde Handelsstationen zerstört, Monopole aller Art errichtet, exklusive Wirtschafts- und Fischereizonen behauptet und mit Gewalt durchgesetzt, Länder okkupiert und Völker unterdrückt – alles für den Machterhalt und die weitere Expansion. Dabei wirken Staatsgewalt und Privatwirtschaft eng zusammen. Mal übernimmt die eine, mal die andere das operative Geschäft, und obendrein sind sie Gestaltwechsler: Hier verkappt sich der Staat als Unternehmen,4 dort übernehmen Firmen Hoheitsgewalt und stellen dafür ganze Armeen auf, wie es zum Beispiel die Britische Ostindien-Kompanie (East India Company, EIC) und ihr niederländisches Pendant getan haben.
Welche Akteure sind mit wirtschaftlichen Zielen oder Mitteln aggressiv, und was versprechen sie sich davon? Das hängt von der jeweiligen politischen Ordnung ab, vom Stand der Produktivkräfte und von den volkswirtschaftlichen Erkenntnissen und Denkgewohnheiten, von den logistischen und militärischen Möglichkeiten, von der öffentlichen Meinung (falls zugelassen), von der relativen Stärke der beteiligten Staaten und vom Weltbild und von den Erwartungen der Entscheider. Da liegt natürlich jeder historische Fall etwas anders, und die Faktoren der jeweiligen Willensbildung lassen sich im Nachhinein oft nur schwer rekonstruieren, gewichten und eindeutig bewerten. Doch es lassen sich mit Blick auf Wirtschaftskriege und ihre Ursachen immerhin unterschiedliche Epochen und eine wichtige geistesgeschichtliche Zäsur erkennen, und eine beliebte Theorie über den Kapitalismus und die Kapitalisten als angebliche Haupttreiber der meisten Konflikte lässt sich ausschließen.
Die Geschichte der Handels- und Wirtschaftskriege ab etwa 1500 wird ausführlicher in Kapitel 3 erzählt werden. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Motiven, Ideen und Interessengruppen, welche diese Kriege antrieben, und auf den Zusammenhängen zwischen wirtschaftlichen Faktoren, Handelskrieg, Eroberung und bewaffnetem Konflikt. Anfänglich wurden die Handelskriege befeuert von Draufgängertum und Profitgier in ihrer räuberischsten und brutalsten Form. Handel, Krieg und Piraterie gingen wirklich so ineinander über, wie es Mephistopheles behauptet. Im 16. Jahrhundert waren die meisten Handelsschiffe bewaffnet, und ihre Besatzungen waren bereit, je nach Gelegenheit Handel zu treiben, zu kämpfen, zu kapern und zu plündern5 (umso mehr, sobald sie europäische Gewässer verlassen hatten). Falls nötig, schlugen sie auch die Seeschlachten ihrer Länder – die meisten Schiffe in der Begegnung zwischen der spanischen Armada und der englischen Flotte (1588) waren Handelsschiffe.6 Wann immer fremde Reiche in Übersee oder ganze Kontinente erobert wurden, bildete den ersten Zyklus der Ausbeutung wüste Plünderei,7 gefolgt von allmählicher territorialer Vorherrschaft, die dann zu Zwangsabgaben, Zwangsarbeit (bis weit ins 20. Jahrhundert hinein)8 und Sklaverei führte. Konkurrierende Handelsnationen und Handelsniederlassungen wurden angegriffen, ob sie nun zu den „Ungläubigen“ gehörten oder zur europäischen Christenheit. Diese noch halb private gewalttätige Gier wurde von den europäischen Monarchien geduldet und ermutigt, weil diese noch nicht mit eigenen Schiffen und Armeen vorrücken konnten. Stattdessen gewährten sie „Kapitulationen“ (Verträge zwischen Ungleichen), verliehen Handelsprivilegien und verteilten Kaperbriefe, um an der Beute beteiligt zu werden und Anspruch auf alle Gebiete zu erheben, die „entdeckt“ und „erobert“ werden mochten.9 Jede Seereise bedeutete neues unternehmerisches Risiko und unbeständiges Kriegsglück, und weil Schiffsraum noch sehr knapp war, konzentrierten sich Handel, Überfälle und Beutezüge auf Luxusgüter mit geringem Stauraum wie Gold und Silber, Seide und Gewürze, Zucker, Pelze und Parfum. Doch die Netzwerke des schwer bewaffneten Handels und der staatlichen Herrschaft entwickelten sich, die Transportkapazitäten wuchsen, und bald füllten auch Tee und Porzellan, Baumwolle und Kleider die Schiffe – und immer mehr Sklaven. Hybride private Handelsgesellschaften, von ihren Heimatländern versehen mit quasisouveränen politischen Privilegien, bildeten das Rückgrat der europäischen Expansion, und sie bekämpften einander bis aufs Messer. Im Lauf des 17. und 18. Jahrhunderts festigten die modernen Staaten ihre Macht und ihr Monopol auf den Einsatz von Waffengewalt. Die Kämpfe um Beute und Handel wurden mehr und mehr zu innereuropäischen Staatenkonflikten, die freilich weltweit ausgefochten wurden, denn die Europäer strebten überall nach Handelsstationen und, wo immer möglich, auch nach Herrschaft. Der staatliche Zugriff auf den Überseehandel wurde zusehends fester. Das musste sogar die mächtige englische Ostindien-Kompanie erfahren, deren Privilegien für den Indienhandel im Lauf der Zeit immer mehr beschnitten wurden (sie mussten seit 1784 sogar alle 20 Jahre von der Regierung erneuert werden). Aber die alte Gewohnheit, in die Landesfarben gehüllt privaten Gewinn herauszuschlagen, hielt sich zäh. Selbst im späten 18. Jahrhundert wurden Kommandeure wie Colonel William Draper (der zeitlebens hoffte, doch noch das Lösegeld zu kassieren, das er dafür verlangt hatte, dass er 1762 Manila nicht plündern ließ) von der Aussicht auf Beute fast ebenso sehr angetrieben wie von der Gelegenheit, ehrenvoll und ruhmreich zu dienen.10
Vom Merkantilismus zur modernen Handelstheorie – mit der Konstante Sklaverei
Dennoch wandelte sich das Bild erheblich, je mehr die modernen Staaten und die absoluten Monarchien ihre Macht festigten. Im wirtschaftlichen und politischen Denken setzte sich die Überzeugung durch, alle Wirtschaftstätigkeit habe vor allem der Staatsmacht zu dienen, verkörpert in der Person des Monarchen. Die Doktrin des sogenannten Merkantilismus erklärte Gold und Silber zur wichtigsten Form des nationalen Reichtums. Darum erschien es einleuchtend, so viel wie möglich an das Ausland zu verkaufen und so wenig wie möglich von dort zu kaufen. Der Umfang des internationalen Handels wurde als begrenzt angesehen – und wenn der Kuchen nicht größer werden konnte, erschien es nur vernünftig, sich ein möglichst großes Stück davon für sich selbst abzuschneiden. Die Außenpolitik und der Außenhandel wurden als Nullsummenspiel um Macht und Reichtum betrachtet. Der Handel galt als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln – und umgekehrt.11 Der Merkantilismus wurde bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in unterschiedlichen nationalen Spielarten praktiziert, aber seine Grundannahmen und Ziele waren überall die gleichen: Er war wirtschaftlicher Nationalismus, um einen wohlhabenden und mächtigen Staat zu bauen. Die Regierungen strebten danach, Wohlstand anzuhäufen, und nahmen an, dass sie das nur auf Kosten der anderen Staaten tun könnten. Der Erfolg wurde am eigenen Handelsüberschuss und am Bestand an Gold und Silber in der Staatskasse gemessen. Um beides zu erreichen, arbeiteten die Eliten von Politik und Wirtschaft eng zusammen, und viele tummelten sich in beiden Sphären. Der Staat verlieh seinen Kaufleuten Monopolrechte und bevorzugte die heimische Wirtschaft, indem er sie vor auswärtiger Konkurrenz schützte und bei der Eroberung neuer Märkte subventionierte. Sie dankten es ihm durch Treue und Abgaben und dadurch, dass sie seine Flagge um die Welt trugen (und einrammten, wo immer möglich).
Für merkantilistisch denkende Akteure hatten Wirtschaftskriege aller Hitzegrade eine viel größere Plausibilität und ökonomische Unbedenklichkeit als für Regierungen und Gesellschaften, die mit der Kritik vertraut wurden, welche David Hume, Adam Smith und David Ricardo an den merkantilistischen Grundannahmen übten. Hier liegt die erwähnte geistesgeschichtliche Zäsur. Hume hatte bereits 1752 gezeigt, dass das Streben nach einem möglichst großen Handelsüberschuss, um einen möglichst hohen Zufluss von Gold und Silber zu erreichen, sinnlos war: Dieser Zufluss würde nur die Inlandspreise erhöhen und damit die eigenen Exporte für andere Länder teurer machen (also sinken lassen) und die Importe aus diesen Ländern relativ verbilligen (also wachsen lassen), bis sich die Handelsbilanz wieder ausgleichen würde. Smith und Ricardo hatten gezeigt, dass Freihandel alle beteiligten Nationen bereichert und selbst die am wenigsten entwickelten Länder profitieren können, wenn sie Handel treiben.12 Diese Argumente ließen immer mehr Geschäftsleute und Regierungen erkennen, dass ihre Volkswirtschaften auf tausenderlei Weise mit anderen verwoben waren und dass das Volumen des gewinnbringenden Handels praktisch unbegrenzt wachsen konnte.13 Auch diese Postmerkantilisten strebten weiterhin nach Wohlstand und Einfluss für ihre Nation, nach Gold und Größe für das Vaterland. Aber sie erkannten zunehmend, dass Kriege und Wirtschaftskriege zwischen den europäischen Nationen die internationale Arbeitsteilung störten und insgesamt zu Wohlstandsverlusten führten. So entwickelte sich allmählich eine neue Phase, die ungefähr gegen Ende der Napoleonischen Kriege begann. Es gab immer noch viel mehr Protektionismus als Freihandel, nicht zuletzt weil viele Staaten versuchten, sich hinter Schutzzöllen zu industrialisieren,14 und es wurden immer noch Handelskriege geführt. Viele europäische Mächte setzten weiterhin in Übersee ihre militärische Macht in Einklang mit der Palmerston-Devise ein, es sei die Aufgabe der Regierung, dem Handel die Wege zu bahnen und zu sichern.15 Aber es wurde zunehmend anerkannt, dass das eigentliche Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung nicht in merkantilistischer Verschlossenheit lag, sondern im Eintauchen der Nation in den möglichst freien Welthandel. Auch diese viel positivere Sichtweise hatte jedoch ihre aggressiven Seiten. Beginnend in den 1830er-Jahren, wurde Waffengewalt angewandt, um in asiatische Märkte wie Japan, China und Vietnam einzudringen, wobei man den Angegriffenen mitunter wortreich die Segnungen des Freihandels pries.16
Gleichzeitig nahm wegen der Industrialisierung die Sklaverei massiv zu.17 Seit Jahrhunderten waren Sklaven gezwungen worden, in europäischen Gold- und Silberminen in Südamerika und auf Zucker- und Gewürzplantagen auf Madeira, im Golf von Guinea, in Indonesien und in der Karibik zu arbeiten.18 Nun wuchsen die Kapazität der westlichen Industrien, Baumwolle zu spinnen und zu weben, und die Nachfrage nach ihren Produkten so schnell, dass Baumwolle knapp wurde. Da Europa größtenteils zu kalt und zu nass war, um dort Baumwolle anzubauen, wurde mit der auf Sklaverei gegründeten Produktion auf den Westindischen Inseln und in Südamerika begonnen (allein die französischen Karibikinseln „importierten“ zwischen 1784 und 1791 eine Viertelmillion afrikanischer Sklaven).19 Weil jedoch die industrielle Produktivität um Hunderte von Prozent zunahm20 und das Kolonialland Indien aufgrund der hohen Transportkosten und seines eigenen Handels mit China nicht genügend Rohbaumwolle liefern konnte, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zum Hauptlieferanten. Dort wurde die Baumwolle vor allem in den neu erworbenen und annektierten Gebieten der Südstaaten durch Sklavenarbeit gewonnen. Wie abhängig die europäischen Produzenten von dieser Baumwolle wurden, zeigte sich im amerikanischen Bürgerkrieg: Als Präsident Lincoln 1862 mit seinen Ministern seine Absicht diskutierte, die Sklaverei in den sezessionistischen Südstaaten für abgeschafft zu erklären, warnten manche, eine solche Erklärung werde zur völkerrechtlichen Anerkennung der Südstaaten durch Europa führen.21 Die Ära der modernen europäischen Sklaverei, die im 15. Jahrhundert begonnen hatte, als Portugiesen die Bewohner der Kanarischen Inseln für den Zuckeranbau versklavten, dauerte praktisch bis 1908, als der sogenannte Kongo-Freistaat beendet wurde. Das war ein Gebiet, das der belgische König Leopold II. im Zuge des europäischen „Wettlaufs um Afrika“ als sein „Eigentum“ erworben hatte22 und so brutal ausbeuten ließ, dass ganz Europa entsetzt war.23
Der Kapitalismus als Kriegstreiber, oder die Kapitalisten?
Jenes Gerangel um Afrika (als „Scramble for Africa“ bezeichnete die Londoner Times 1884 das Konkurrenzverhalten der europäischen Mächte)spielte sich zwischen ungefähr 1870 und 1910 ab. Die europäischen Mächte teilten den afrikanischen Kontinent unter sich auf: 1870 stand erst ein Zehntel Afrikas unter europäischer Herrschaft, 40 Jahre später war kaum noch ein Zehntel – Liberia, Äthiopien – unabhängig.24 Im gleichen Zeitraum waren die Japaner damit beschäftigt, in Kriegen mit China und Russland Kolonien zu erobern, und die USA vergrößerten ihre Territorien durch Krieg gegen Spanien. Der erneute Aufschwung des europäischen Imperialismus veranlasste John A. Hobson, einen englischen Journalisten und Wirtschaftswissenschaftler, zur Veröffentlichung der Studie Imperialism,25 die auf ihrem Gebiet als Klassiker gilt. Hobson war von der Theorie beeinflusst, in den reifen Volkswirtschaften seiner Zeit sinke die Profitrate immer weiter. Er führte diesen Rückgang auf Unterkonsumtion zurück und argumentierte: Die britischen Kapitalisten verdienten zu viel und ihre Arbeiter nicht genug, sodass das, was in England produziert werde, dort nicht auch konsumiert werden könne. Infolgedessen stagniere die Wirtschaft, die bereits erzielten Gewinne blieben ungenutzt, und die Profitrate schrumpfe. Folglich suchten die Kapitalisten in Übersee nach neuen Märkten, um ihre Produkte zu verkaufen und ihre Gewinne zu investieren, und setzten ihre Regierungen unter Druck, den Weg dahin mit imperialistischer Waffengewalt zu ebnen. Hobson war davon überzeugt, dass diese Art von Wirtschaftsimperialismus keineswegs unvermeidlich sei: „Es besteht keine Notwendigkeit, neue ausländische Märkte zu erschließen; die heimischen Märkte sind in der Lage, unbegrenzt zu expandieren. Was auch immer in England produziert wird, kann in England konsumiert werden, vorausgesetzt, das ‚Einkommen‘ oder die Macht, Waren nachzufragen, wird richtig verteilt.“26 Hobson glaubte an die Reformierbarkeit des kapitalistischen Systems seiner Zeit: Der Anteil der Arbeitnehmerschaft an den Gewinnen der Kapitalisten könne erhöht werden.
Sozialistische und kommunistische Theoretiker wie Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg und Wladimir Iljitsch Lenin27 stimmten Hobsons Analyse des Wirtschaftsimperialismus ausdrücklich zu und bauten auf ihr auf, aber sie hielten den Kapitalismus für nicht reformierbar – da Parlamente und Regierungen bloß Marionetten der herrschenden Klasse der Kapitalisten seien, wie könnten sie gegen deren Interessen handeln?28 Der Kapitalismus könne nicht reformiert, sondern er müsse durch proletarische Revolution überwunden werden. Nach der Entkolonialisierung blieben all diese Thesen in Theorien über die angebliche neokoloniale Ausbeutung des globalen Südens präsent.
Hobsons Optimismus in Bezug auf Reformen war berechtigt. Die westlichen kapitalistischen Länder erwiesen sich als reformfähig: Sie weiteten das Wahlrecht aus und ließen Gewerkschaften und Arbeiterparteien zu; sie stärkten die soziale Sicherheit und sorgten für eine Umverteilung von Einkommen; sie bewahrten den Pluralismus und sicherten ein hohes Niveau von Binnenkonsum und Lebensstandard.29 Hobsons Theorie des modernen Wirtschaftsimperialismus hingegen weist schwerwiegende Mängel auf.30 Abgesehen von wirtschaftstheoretischen Einwänden, stützen schon die reinen Fakten Hobsons These nicht. Die meisten Kolonien waren arm und boten darum keine wertvollen Märkte für den Export von Industriegütern; sie waren infrastrukturell unterentwickelt und lieferten darum keinen großen Teil der damals gehandelten Rohstoffe. Sie hatten zudem kleine Volkswirtschaften und verdrängten darum keinen bedeutenden Teil des regen Handels zwischen den großen Industrieländern. Und sie wurden kostenbewusst verwaltet und waren darum keine exklusiven Wirtschaftszonen, die allein den jeweiligen Kolonialherren vorbehalten waren, sondern sie verkauften ihre Produkte an den jeweils Meistbietenden, während die imperialistischen Staaten nichts dabei fanden, auch mit den Kolonien ihrer Rivalen Handel zu treiben.31 Die Kolonien erhielten aus Europa nicht einmal allzu große Investitionen. Hobson wies auf das zeitliche Zusammentreffen von Imperialismus und beträchtlichen Kapitalexporten hin, aber die meisten dieser Exporte gingen überhaupt nicht in die Kolonien. Weder Großbritannien noch die Vereinigten Staaten, Frankreich oder Deutschland investierten viel in ihre Kolonialreiche. Und weder waren alle entwickelten kapitalistischen Länder Imperialisten, noch waren alle Imperialisten kapitalistisch verfasst. Insgesamt lässt sich sagen, dass es keine immanente, unveränderliche, unvermeidliche Verbindung zwischen dem Kapitalismus an sich und der kriegerischen Eroberung von Märkten und Rohstoffquellen gibt.
Aber selbst dann, so lässt sich einwenden, könnten ja kommerzielle Interessen eine besonders wichtige Triebfeder für Kriege und den Imperialismus gewesen sein. Doch auch das ist alles andere als offensichtlich. Es reicht nicht aus, darauf hinzuweisen, dass manche Kapitalisten und vor allem Waffenproduzenten von Rüstungsmaßnahmen und der Führung von Kriegen profitieren wollen – gewiss tun sie das.32 Aber führen sie die Kriege auch herbei? Es hat Fälle gegeben, in denen Kapitalisten ihre Regierungen erfolgreich dazu gebracht haben, private Profite durch militärische Gewalt und Eroberung zu schützen oder zu fördern. Aber solche Fälle sind wenig mehr als ein anekdotischer Beleg. Die deutsche Intervention in Kamerun (1884–1885)33 mag ein Beispiel dafür sein, ebenso wie die Protektorate, die Frankreich über Tunesien (1881) und Marokko (1912) errichtete,34 die britischen Interventionen in Ägypten (1882, Aktionärsinteressen, Beherrschung des Suezkanals, Empire), Burma (1885, Öl)35 und im südlichen Afrika (ab 1877, Diamanten und Gold) und die japanische Besetzung von Teilen Chinas ab 1931.36 Zu diesen Fällen zählt vielleicht auch der „Salpeterkrieg“ Chiles gegen Bolivien und Peru 1879–1884, der vor allem um Salpetervorkommen, ihren Abbau, ihre Besteuerung und um ein Abbauunternehmen geführt wurde, von dessen Anteilseignern einige Regierungsmitglieder waren. Selbst da schwangen jedoch in der Entscheidung für den Krieg hegemoniale Absichten und nationalistische Verfeindungen mit, und es wurmte die Erkenntnis, dass der Krieg eigene Investitionen in Feindesland gefährdete, dass also die eigene wirtschaftliche Interessenlage vielschichtig war. In den meisten derartigen Fällen hatten die beteiligten Politiker vielfältige machtpolitische Ziele und nationale Sicherheitsinteressen im Sinn.37 Diese These stützen auch und gerade zwei Interventionen, die häufig als Beispiele für angeblichen „Neoimperialismus“ angeführt werden: Als die Central Intelligence Agency (CIA), ein Auslandsgeheimdienst der USA, die Stürze der Regierungen in Iran (1953) und in Guatemala (1954) einzufädeln half, ging es den USA zwar auch um Interessen der United Fruit Company bzw. der von Großbritannien geführten Anglo-Iranian Oil Company, aber zuallererst um die Eindämmung des Kommunismus und der Sowjetunion.38
Andererseits gibt es viele Fälle, in denen Regierungen den Schutz oder die Durchsetzung privater Interessen bloß als Vorwand für kriegerische Entscheidungen genutzt haben, und Fälle, in denen sich die Regierenden aggressiven Wirtschaftslobbys gegenüber als gleichgültig erwiesen oder sie sogar entschlossen bekämpften.39 Ein Beispiel dafür ist die US-Regierung im Ersten Weltkrieg.40 Nach dem Ende des Krieges waren die amerikanische Politik und Öffentlichkeit enttäuscht und angewidert von den engstirnigen und undurchführbaren Reparationsbestimmungen des Versailler Vertrags (dazu in Kapitel 2 mehr) und wütend auf Frankreich und Großbritannien, weil sie die Kriegskredite, die sie in den Vereinigten Staaten aufgenommen hatten, nicht umgehend zurückzahlten. Das half den Boden zu bereiten für die Behauptung, vor allem gierige US-Banker und „Händler des Todes“ hätten die Nation in ein sinnloses Blutbad zwischen europäischen Imperien verwickelt, und für das Gelöbnis, in jedem künftigen Konflikt neutral zu bleiben.41 Aber Präsident Woodrow Wilson war weit davon entfernt gewesen, die Außenpolitik der heimischen Finanz- und Rüstungsindustrie zu überlassen: Zunächst prangerte seine Regierung Kredite an die europäischen Kriegsparteien als schlimmste Konterbande an (da Britannia die Wellen und Seewege immer effizienter beherrschte, kamen ohnehin nur Kredite und Lieferungen an die Westalliierten – die Entente – infrage). Dann milderte die Regierung ihre Position ab durch eine Unterscheidung zwischen verbotenen Krediten mittels Zeichnung ausländischer Kriegsanleihen und zulässigen Krediten von US-Banken für den Kauf von US-Produkten. Dies geschah jedoch nicht aus Sorge um die amerikanischen Bankiers, die den kriegführenden Mächten Kredite gewähren wollten, sondern um den amerikanischen Farmern zu helfen, ihre Produkte weiterhin zu verkaufen (der erste kreditfinanzierte Kauf betraf Pferde im Wert von zwölf Millionen Dollar). Als die Höhe dieser Kredite dann alle Erwartungen übertraf und die kreditfinanzierten Exporte die Lebenshaltungskosten in den USA in die Höhe trieben und die Kaufkraft der Arbeiter schmälerten, wies Wilson Sondierungen der Banken hinsichtlich eines weiteren Milliardenkredits an die Entente zurück und billigte Pläne zur Besteuerung von Exporten nach Europa, worauf das amerikanische Big Business gegen ihn mobilmachte. Dennoch wurde Wilson Anfang November 1916 wegen seines Versprechens und mit dem klaren Auftrag wiedergewählt, das Land aus dem Krieg herauszuhalten. Er veranlasste nun die amerikanische Zentralbank, ihren Mitgliedern mitzuteilen, sie halte es nicht länger für wünschenswert, dass amerikanische Investoren ihre Bestände an britischen und französischen Wertpapieren erhöhten – worauf die Kurse an der Wall Street abrutschten und das Pfund Sterling und der französische Franc erzitterten. Der Präsident ließ dem im Dezember 1916 eine Note folgen, in der er zu einem Frieden ohne Sieg aufrief, was die Rüstungsaktien weiter in den Keller trieb und Verzweiflung in Paris und London auslöste, wo der König, wie berichtet wird, weinte.42 Im Januar 1917 sprach der Präsident vor dem US-Senat und wies hellsichtig darauf hin, ein Siegfriede gleich welcher Kriegspartei werde nur zu Demütigung, Zwang, Ressentiments und Verbitterung führen, sodass der Frieden wie auf Treibsand gebaut wäre. Erst als Deutschland, in törichter Unkenntnis der finanziellen Notlage der Entente,43 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegen die neutrale Schifffahrt erklärte, der mexikanischen Regierung ein Militärbündnis für den Fall eines Krieges zwischen Deutschland und den USA anbot und Zustimmung signalisierte, sollte Mexiko dann Texas, New Mexico und Arizona zurückerobern,44 erst da hatte Wilson keine andere politische Wahl mehr, als dem US-Kongress die Kriegserklärung vorzuschlagen. Es stimmt, dass das amerikanische Bankhaus J. P. Morgan & Co. einen entscheidenden Beitrag zu den alliierten Kriegsanstrengungen leistete, als der Krieg erst ausgebrochen war: Morgan organisierte die US-Kredite und die damit getätigten Käufe, verhandelte hart mit US-Lieferanten „über Corned Beef und Stacheldraht, Lokomotiven und Prothesen“,45 half neue Fabriken zu errichten und trieb die US-Gewehrproduktion in die Höhe. Aber John Piermont Junior, genannt „Jack“, Morgan, der Chef des Bankhauses, hatte noch am 31. Juli 1914 einen Appell zum Frieden veröffentlicht,46 und erst als Großbritannien und Frankreich im August in den Krieg eintraten, ergriffen die Partner von Morgan aus Tradition, Instinkt und Überzeugung für die Alliierten Partei.47 Andere amerikanische Bankhäuser waren prodeutsch oder antirussisch eingestellt,48 was fast auf dasselbe hinauslief, aber die erfolgreiche britische Seeblockade gegen Deutschland (und das britische Kappen der deutschen Unterseetelegrafenkabel) machten ihre Präferenzen weitgehend irrelevant.
Apropos Bankiers: Der US-amerikanische Professor für Politikwissenschaft Jonathan Kirshner hat überzeugend dargelegt, dass zumindest seit der Wende zum 20. Jahrhundert (und wahrscheinlich auch schon viel früher) „Finanzkreise innerhalb von Staaten vorsichtige nationale Sicherheitsstrategien bevorzugen und Kriegen und Politiken, die ein Kriegsrisiko bergen, entschieden abgeneigt sind. Diese allgemeine Feststellung trifft zu jeder Zeit und an jedem Ort zu, in einer Vielzahl von politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.“49 Der Grund dafür liege darin, dass Banken, der Finanzdienstleistungssektor, Versicherungsgesellschaften (insbesondere für Währungen, Anleihen und Aktien) und ihre Partner in den Regierungen (fast immer die Zentralbanken und in der Regel die Finanzministerien) allesamt gesamtwirtschaftliche Stabilität wünschen, und mit der ist Krieg weitgehend unvereinbar.50 Das muss nicht unbedingt immer gut sein – die Finanzwelt hat auch Englands und Frankreichs Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler-Deutschland befürwortet und schwächte Frankreichs Willen zur Aufrüstung.51 Außerdem bevorzugt die Finanzwelt „Frieden nicht aus Herzensgüte, sondern“52 aus Eigeninteresse. Aber dennoch: „Wenn man die Präferenzen der Finanzwelt aus dem Mix herausnimmt, sind die verbleibenden Einflussnahmen von Kapitalismus und Kommerz“ auf Handelskriege und Imperialismus noch „weniger offensichtlich und stattdessen eher flüchtig, unbestimmt und zufällig“.53 Es darf hinzugefügt werden: Selbst im so verbleibenden „Mix“ werden die Kapitalisten eines Landes unterschiedliche Meinungen vertreten, weil Konflikte, Kriege und Eroberungen nie allen Wirtschaftszweigen einer Volkswirtschaft nützen, sondern immer einigen schaden.
Um unsere bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen: Man kann eine unterkapitalisierte erste Phase der frühen, halbprivaten, räuberischen europäischen Expansion unterscheiden. Ihr folgte ein staatszentrierter Merkantilismus, der nach territorialer Vorherrschaft in Übersee und nach Handelsbilanzüberschüssen strebte, und ab dem 19. Jahrhundert setzte sich eine immer größere Offenheit für freien, beiderseitig vorteilhaften Handel durch. Während die treibenden Kräfte anfangs vor allem ungezügelte Gier und Abenteuerlust waren, wurden die Eroberung, Beherrschung und Ausbeutung im Laufe der Zeit immer staatlicher und rationaler betrieben, wenn auch keineswegs humaner, wie schon allein die Sklaverei beweist. Der „moderne“ Imperialismus seit 1870 war weder eine zwangsläufige Folge des Kapitalismus an sich, noch wurde er von profitsuchenden Kapitalisten herbeigeführt. Einige Wirtschaftskreise befürworteten sicherlich Handelskriege und Eroberungen – aber nicht alle, nicht immer und selten ausschlaggebend. Hobson und marxistische Autoren wie Lenin haben sich geirrt (und übrigens sind die aus ihrem Denken abgeleiteten Theorien des Neokolonialismus durch den stupenden Aufstieg Asiens nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs widerlegt worden). Zumindest historisch gesehen, scheint das Gegenteil der marxistischen These zuzutreffen: Nationen, die sich nicht protektionistisch verhalten und marktwirtschaftlich und demokratisch verfasst sind, werden anscheinend seltener in militärische Konflikte verwickelt als Nationen mit anderen Strukturen und Haltungen.54
Der „moderne“ Imperialismus vor allem in Afrika hatte andere Wurzeln:55 Er war das Ergebnis politischer Rivalitäten zwischen den damaligen Großmächten und nicht vorrangig von wirtschaftlichen Überlegungen. Den Staatsmännern der damaligen Zeit erschien es rational, die Sicherheit, die Macht, die internationale Bedeutung und den Einfluss ihrer Nationen durch den Erwerb von Kolonien zu stärken. Die würden, nahm man an, die außenpolitischen Optionen und die diplomatische Verhandlungsmasse vermehren und die wirtschaftliche und strategische Schlagkraft des Staates stärken. Darüber hinaus ließen technische Innovationen die Eroberung Afrikas weit weniger kostspielig erscheinen als je zuvor:56 Die Chininprophylaxe gegen Malaria beendete die erschreckende Todesrate unter den Europäern und ermöglichte es ihnen, ins Landesinnere vorzustoßen. Dampfgetriebene Kanonenboote mit geringem Tiefgang revolutionierten den Krieg auf den Flüssen (wie sie das auch in Asien taten) und schalteten die Mittelsmänner im Flusshandel aus. Schnell schießende Hinterladergewehre, Maschinengewehre und leichte Artillerie verwandelten Schlachten in Massaker. So senkte neue Technik die Einstiegskosten des Kampfes um Afrika drastisch. Sie machte Aggression billig – für die Aggressoren.
Jene besondere historische Kombination aus diplomatischer Rivalität, technischer Überlegenheit und rücksichtslosem Imperialismus einmal beiseite: Wirtschaftlicher Wohlstand ist immer ein wichtiges politisches Ziel und Machtmittel. Alle modernen Staaten streben danach, ihn zu erlangen und zu sichern. Zu diesem Zweck mag selbst eine vernünftige und verantwortungsbewusste Regierung Handelskriege und Schlimmeres riskieren – nicht um das schnöde Erwerbsinteresse kleiner interessierter Kreise zu befriedigen, sondern im Dienste dessen, was sie als das nationale Interesse ansieht. Entschieden wird aus Sorge um die nationale Sicherheit, die meist auch auf gute Handelsperspektiven und Versorgungssicherheit angewiesen ist, aus Nationalismus und Sendungsbewusstsein, aus Furcht vor den bösen Absichten anderer Mächte und aus Angst, im weltweiten Machtgefüge abzusteigen. Es lässt sich gut begründen, dass spätestens seit etwa 1500 die Anarchie zwischen konkurrierenden souveränen Staaten und der Wettbewerb auf den internationalen Wirtschaftsmärkten immer die zwei Seiten derselben Medaille waren.57 Die politischen Motive dahinter sind zeitlos58 und bleiben in den Staatenbeziehungen virulent. Sie sorgen für eine Grundspannung auch in Friedenszeiten, die einem rauen Wettbewerbsklima in der Privatwirtschaft entspricht. Mit Recht stellt John Conybeare, Professor für Volkswirtschaftslehre, fest: „Warum haben wir nicht die ganze Zeit Wirtschaftskriege? Vielleicht lautet die vernünftigste unmittelbare Antwort: Haben wir doch! […] Es herrscht im System immer ein gewisses Maß an Wirtschaftskrieg, aber es befindet sich nicht immer auf sehr hohen Konfliktstufen.“59 Selbst in Organisationen, die der internationalen Zusammenarbeit dienen, wird unerbittlich um nationale Vorteile gerungen. Der Zusammenhang zwischen internationaler wirtschaftlicher Verflechtung, nationalen Handelserwartungen und zwischenstaatlichen Konflikten bis hin zum Krieg wird in Kapitel 7 ausführlicher behandelt.
Eine abschließende Bemerkung: Hobsons Hypothese, nationale Unterkonsumtion führe zu internationalen Konflikten, sollte nicht pauschal verworfen werden. In jüngster Zeit wurde argumentiert, dass in den vergangenen Jahrzehnten in Ländern wie China und Deutschland übermäßige Wohlstandstransfers von den Arbeitnehmern zu den „Eliten“ heimische Unterkonsumtion herbeigeführt, den Export von Industrieerzeugnissen und Kapital angekurbelt und Millionen von Industriearbeitsplätzen im Ausland vernichtet haben, was dort wiederum populistische Forderungen nach Protektionismus und Handelskrieg hervorgerufen habe. Folgerichtig gaben die Verfechter dieser Auffassung ihrer Studie den Titel Trade wars are class wars (Handelskriege sind Klassenkämpfe) und stellten ihr ein Zitat aus Hobsons Imperialism voran.60 In dieser Renaissance seines Denkens liegt eine wichtige Mahnung, mächtige Interessengruppen in Schach zu halten und auf Verteilungsgerechtigkeit zu achten, um das westliche Modell wieder zum Leuchten zu bringen (wie eine der Empfehlungen in Kapitel 10 lautet).
Kapitel 2Die Begriffe Sanktion, Handelskrieg und Wirtschaftskrieg
Es gibt für keinen der drei Begriffe eine allgemein als verbindlich anerkannte Definition. Regierungen, Politiker, Juristen, Ökonomen, Politikwissenschaftler und Medien verwenden unterschiedliche Terminologien (auch innerhalb der jeweiligen Fachgebiete), wobei es inhaltlich viele Überschneidungen gibt.1 Wir unterscheiden wie folgt: (Wirtschafts)Sanktionen, Handelskriege und Wirtschaftskriege sind allesamt politische Phänomene, denn sie betreffen die Kommunikation und die wechselseitigen Beziehungen zwischen Staaten, Staatenkoalitionen und zwischenstaatlichen Organisationen. Die Beschränkung auf zwischenstaatliche Beziehungen trägt dem Umstand Rechnung, dass Staaten die entscheidenden Akteure der Weltpolitik und der Weltwirtschaft sind und bleiben.2 Solche politischen Beziehungen können im Einzelfall auch dann vorliegen, wenn allein Privatpersonen oder Unternehmen betroffen sind oder handeln, denn genau das kann von einem Staat gewollt, veranlasst oder geduldet sein und ist ihm dann zurechenbar. Falls eine solche Zurechenbarkeit von einem anderen Staat vermutet wird, macht auch das die Angelegenheit zu einer politischen.
Wirtschaftssanktionen
Wirtschaftssanktionen3 zielen darauf ab, ein politisches Ziel zu erreichen. Dafür werden Maßnahmen ergriffen wie Handelsverbote, Lieferstopps, die Beschlagnahme von Vermögenswerten und das Einfrieren des Zahlungsverkehrs oder ausgewählter Konten. Das politische Ziel ist in der Regel kein wirtschaftliches, sondern ein außenpolitisches. Die Sanktionen können eingesetzt werden, um Unfreundlichkeit zu signalisieren, Missbilligung auszudrücken, Änderungen im Verhalten des Adressaten zu erzwingen oder seine Optionen und Fähigkeiten zu verringern. Darum haben Sanktionen oft Strafcharakter und zeugen von angespannten Gesamtbeziehungen. Oft, aber nicht immer, denn Sanktionen kommen auch zwischen demokratischen Freunden und Verbündeten recht häufig vor, und sie scheinen in solchen Fällen sogar etwas erfolgreicher zu sein.4 Vermutlich liegt das just daran, dass die Beziehungen insgesamt gut sind. Dann erscheint es unvernünftig, den Streit zu verhärten oder sogar auszuweiten und so die Beziehung zu gefährden, zudem herrscht nicht die Gefahr, das Gesicht zu verlieren. Darum gibt der Adressat der Sanktion leichter nach, oder es wird ein Kompromiss geschlossen.
Wirtschaftssanktionen können für einen kurzen Zeitraum oder auch über Jahrzehnte hin verhängt werden; sie können sich gegen nur wenige Akteure oder Sektoren richten oder allumfassend sein; und sie können so einschneidende Ziele verfolgen wie einen Regimewechsel beim Adressaten. Strenge, umfassende und lang anhaltende Sanktionen mit ehrgeizigen Zielen gehen in Wirtschaftskrieg über. Manchmal sind Sanktionen mit „Fahrplänen“ (Roadmaps) verbunden, die festlegen, welche Bedingungen der Adressat erfüllen muss, damit die Sanktionen nach und nach wieder aufgehoben werden. Gelegentlich sind sie mit zusätzlichen Anreizen verbunden, das heißt mit dem Versprechen von Vorteilen, die über die bloße Aufhebung der Sanktionen hinausgehen.5 In solchen Fällen tritt der Verhandlungsaspekt von Sanktionen besonders hervor. Sanktionen können den Einsatz von Waffengewalt vorbereiten, sowohl wirtschaftlich als auch diplomatisch. Die Sanktionen, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) 1990/91 gegen das Regime von Saddam Hussein verhängte, taten beides: Sie blockierten seine Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl und schwächten damit seine Macht, und obwohl sie ihn nicht dazu brachten, seine Truppen aus Kuwait abzuziehen, trugen sie dazu bei, innerhalb der UN den Boden zu bereiten für die Genehmigung des Einsatzes bewaffneter Gewalt („Operation Desert Storm“) durch den Sicherheitsrat.6 Auch in solchen Fällen gehen Wirtschaftssanktionen in Wirtschaftskriegführung über. Sanktionen, die meisten davon wirtschaftlicher Art, gehören zum Alltag der internationalen Beziehungen. Viele Staaten, allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch internationale Organisationen wie die UN und die Europäische Union (EU) setzen Sanktionen immer häufiger ein.7 Das für Sanktionen, Handelskrieg und Wirtschaftskrieg geltende Völkerrecht und die danach zulässigen UN-Maßnahmen werden in Kapitel 5 behandelt.
Die USA stützten ihre Sanktionen ursprünglich vor allem auf den Trading with the Enemy Act von 1917 und den International Emergency Economic Powers Act (1977). Auch das sogenannte Jackson-Vanik Amendement (1974) gehört in den Sanktionszusammenhang: Es sah vor, dass vor allem der Sowjetunion und der Volksrepublik China gegenüber abhängig von ihrer Menschenrechtsbilanz alljährlich neu entschieden werden musste, ob ihnen handelspolitisch „Meistbegünstigung“ gewährt wurde (das heißt die Handelsbedingungen, die die von den USA „meistbegünstigten“ Drittstaaten genossen).8 Der Helms-Burton Act (1996), Iran and Libya Sanctions Act (1996), Patriot Act (2001), Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (2016, nach dem Magnitsky Act von 2012) und der Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (2017) haben weitere wichtige Rechtsgrundlagen hinzugefügt. Sanktionen können sowohl vom Präsidenten als auch vom Kongress verhängt werden, was manchmal zu Dissonanzen und manchmal zu einer außenpolitischen Arbeitsteilung à la good cop, bad cop führt. Häufig enthalten die Sanktionsgesetze und -programme Bestimmungen, die es dem Präsidenten erlauben, Personen, Firmen oder Länder von den Sanktionen auszunehmen, wenn er dies als im nationalen Interesse liegend erachtet.9 Auch das sorgt allerdings oft für innenpolitischen Streit. Aktive Sanktionsprogramme10 werden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verwaltet. Andere Ministerien haben ergänzende Zuständigkeiten, zum Beispiel das Außenministerium solche für Reiseverbote. Die USA haben den territorialen und persönlichen Geltungsbereich ihrer Sanktionsvorschriften ständig erweitert. Wenn sie beispielsweise Geschäfte mit einem bestimmten Staat verbieten, dann bemühen sie sich, dieses Verbot nicht allein gegen US-Staatsangehörige auf dem eigenen Territorium durchzusetzen, sondern gegen alle Personen oder Unternehmen, die dem US-Recht unterliegen, die Transaktionen im US-Finanzsystem tätigen, die Geschäfte in den USA tätigen oder zu tätigen beabsichtigen oder die US-Staatsangehörige dazu veranlassen, gegen die Verbote zu verstoßen. Die USA können außerdem US-Banken und -Unternehmen verbieten, Geschäfte mit sanktionierten ausländischen Firmen zu tätigen. Die Drohung, strafrechtlich verfolgt zu werden, hohe Geldstrafen zahlen zu müssen oder vom äußerst attraktiven US-Markt und aus dem Dollarsystem ausgeschlossen zu werden, veranlasst viele ausländische Marktakteure dazu, sich den US-Sanktionsregelungen zu fügen, selbst gegen den Willen und die Politik ihrer eigenen Regierungen. Solche (im amerikanischen Sprachgebrauch) „sekundären Sanktionen“ waren schon die Quelle erheblicher Spannungen zwischen den USA und der EU11 (dazu sogleich).
Die EU betreibt derzeit über 40 Sanktionsregimes.12 Sie werden vom Rat der EU auf der Grundlage von Vorschlägen des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik (Außenbeauftragter) mit Einstimmigkeit beschlossen. Auf der Grundlage des jeweiligen Beschlusses legen der Außenbeauftragte und die Europäische Kommission (EU-Kommission) einen Vorschlag für die Umsetzung durch eine EU-Verordnung vor, die vom Rat beschlossen wird. Die Verordnung muss von allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden, was von der EU-Kommission überwacht wird. Die Sanktionen dienen dem Schutz des Völkerrechts, insbesondere der Menschenrechte,13 der Förderung von Frieden und Sicherheit und der Konfliktverhütung. Sie können sich gegen Staaten, Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen richten. Die EU-Kommission behauptet, dass die „restriktiven Maßnahmen“ der EU „nicht strafend“ (not punitive) seien, sondern „auf bösartiges Verhalten“ (malign behaviour) abzielen – eine ziemlich feine Unterscheidung, die vielleicht nicht alle Adressaten überzeugen wird. Die EU betont, dass ihre Sanktionen ausschließlich innerhalb ihrer Jurisdiktion gelten: Sie binden nur „EU-Staatsangehörige oder Personen, die sich in der EU aufhalten oder hier geschäftlich tätig sind“. Diese Beschränkung ist die Kehrseite der Tatsache, dass die EU es für völkerrechtswidrig hält, wenn andere Staaten ihre Gesetze „extraterritorial“, also außerhalb des eigenen Jurisdiktionsbereichs, anwenden und durchzusetzen versuchen (wobei der EU vor allem die USA mit ihren „sekundären Sanktionen“ ein Dorn im Auge sind). Um „EU-Wirtschaftsteilnehmer“ vor solchen extraterritorialen Sanktionen Dritter zu schützen, hat die EU 1996 die sogenannte Blocking-Verordnung beschlossen.14 Sie verbietet es den EU-Wirtschaftsteilnehmern unter Strafandrohung grundsätzlich, die extraterritorialen Rechtsakte einzuhalten. Der Schutz gegen diese Rechtsakte besteht darin, dass sie in der EU nicht „anerkannt“ werden und nicht vollstreckt werden dürfen und dass diejenigen, die durch die Anwendung solcher Rechtsakte Schäden erleiden, gerichtlich Schadenersatz verlangen können.15 Im Jahr 2018 wurde die Blocking-Verordnung aktualisiert, um extraterritoriale US-Sanktionen abzuwehren, die sich gegen aus Sicht der EU legitime Geschäfte in und mit dem Iran richteten.16 Allerdings hatte bereits die ursprüngliche Verordnung den EU-Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit eingeräumt, „eine Genehmigung zu beantragen, damit sie die gelisteten extraterritorialen Rechtsakte ganz oder teilweise einhalten dürfen, sofern anderenfalls ihre Interessen oder die der Union schwer geschädigt würden (Artikel 5 Absatz 2)“.17 Und mittlerweile ließ der Europäische Gerichtshof Verständnis selbst für EU-Wirtschaftsteilnehmer erkennen, die sogar ohne eine solche Genehmigung versuchen, nicht in Konflikt mit US-Sanktionen zu geraten.18 Der Druck der US-Sanktionen und der Sog des attraktiven US-Markts sind für die meisten EU-Wirtschaftsteilnehmer einfach zu stark. Auch deshalb wird gefordert, das von der EU derzeit erwogene Anti-Coercion-Instrument nicht allein gegen Zwangsmaßnahmen auszurichten, die „in unzulässiger Weise in die politischen Entscheidungen der EU oder der EU-Mitgliedstaaten eingreifen“,19 sondern auch private Akteure gegen extraterritoriale Sanktionen zu schützen.20 Der transatlantische Streit über „sekundäre“ US-Sanktionen geht also weiter. Sie bewegen sich in einer völkerrechtlichen Grauzone und können als Ausübung souveräner Rechte verstanden werden, um alle Aktivitäten innerhalb des eigenen Territoriums zu ordnen, Übergriffe von jenseits der eigenen Landesgrenzen und gegenüber eigenen Staatsangehörigen im Ausland abzuwehren und die Verletzung universeller Werte, Prinzipien und Normen zu ahnden.21 Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages kamen denn auch zu dem Schluss, dass nichtexzessive extraterritoriale US-Sanktionen völkerrechtlich nicht überzeugend als unzulässig angreifbar sind.22
Außerdem lassen sich extraterritoriale Sanktionen oft politisch rechtfertigen: Internationale Banken haben immer wieder, wie im Präzedenzfall BNP Paribas 2014, „wissentlich, ‚absichtlich und mutwillig‘ Milliarden Dollar durch das US-Finanzsystem geschleust und damit gegen Sanktionen verstoßen“.23 Rohstoffhändler halfen Saddam Hussein dabei, das UN-Programm „Öl für Lebensmittel“ zur Stabilisierung seiner Tyrannei zu missbrauchen, und knüpften zu dem Zweck Netze aus Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen.24 Warum sollten die USA solche Praktiken tolerieren? Wenn sich die EU und die USA über die Anwendung exterritorialer Sanktionen in bestimmten Fällen (wie im Fall Iran) nicht einig sind, sollten sie statt juristischer Streitereien einen politischen Konsens erstreben oder von Ausnahmegenehmigungen Gebrauch machen. Wenn kein Konsens oder Modus Vivendi gefunden werden kann, sollte das immer ein Anlass zu großer politischer Besorgnis sein und zu Anstrengungen führen, das Bündnis wieder zu stärken. Die westlichen Demokratien sollten sich möglichst einig darüber sein, welche Ziele sie mit Sanktionen verfolgen, und sie sollten dabei zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Die Wirksamkeit und der Nutzen von Wirtschaftssanktionen werden in Kapitel 7 erörtert.
Handelskriege
Handelskriege spielen sich im zwischenstaatlichen Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr ab. Ihre wichtigsten Waffen sind darum Instrumente, die sich direkt auf die wirtschaftlichen Aktivitäten auswirken, nämlich Zölle, Steuern sowie Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen. Bei Handelskriegen geht es allerdings um die gesamten Austauschbedingungen, und die werden von vielen Faktoren beeinflusst: von Subventionen und Wechselkursen, von bewusster Lohnzurückhaltung und technologischem Wandel. Ein Staat kann sich beispielsweise Handelsvorteile verschaffen, indem er einheimische Unternehmen subventioniert, die exportieren oder mit Importen konkurrieren; er kann den Wechselkurs seiner Währung manipulieren, um Exporte zu relativ niedrigeren Preisen zu ermöglichen; er kann ausländische Firmen ausspionieren und ihre Geschäftsgeheimnisse an inländische Unternehmen weitergeben. Für andere Handelsnationen wird dadurch das, was idealerweise ein ebenes Spielfeld sein sollte, zu einem Wettkampf, den sie bergauf führen müssen, und folglich kommt es zum Streit. Eine weitere wichtige Ursache für Handelskonflikte sind Streitigkeiten über den Zugang zu Bodenschätzen unter dem Meer, denn die sind oft weniger klar zugeordnet als Lagerstätten auf dem Festland. So gibt es etwa derzeit starke Spannungen zwischen der Türkei, Griechenland, Zypern und Frankreich wegen der Erkundung und Ausbeutung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer,25 und ähnliche Konflikte könnten sich eines Tages in der Arktis entwickeln, zwischen ihren Anrainerstaaten und mit China.26 Kontroversen über Fischereirechte und -quoten sind eine weitere häufige Ursache für Streitereien wie etwa die zwischen der EU, Großbritannien und Frankreich im November 2021.27 Es wurde schon hervorgehoben, dass in der Weltwirtschaft immer ein gewisses Maß an Konflikt herrscht. Um es zu begrenzen, wurden ungezählte Handelsverträge geschlossen, Regeln und Verfahren vereinbart und internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) gegründet. Sie verhindern oft, dass Konflikte eskalieren. Ein Beispiel dafür ist der 16 Jahre andauernde „Bananenkrieg“ zwischen der EU, mehreren lateinamerikanischen Ländern und den USA.28 1993 begann die EU, Bananeneinfuhren aus ehemaligen europäischen Kolonien zu begünstigen, indem sie Zölle auf alle anderen Bananeneinfuhren erhob. Das kostete die lateinamerikanischen Bananenerzeuger und US-Firmen wie Chiquita, Dole und Del Monte Umsätze in Höhe von angeblich Hunderten von Millionen Dollar pro Jahr. 1996 beantragten Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko und die USA gemeinsam ein WTO-Streitbeilegungsverfahren. Ein WTO-Panel (Panel wird die erste Instanz des WTO-Streitbeilegungsverfahrens genannt) befand die EU-Vorschriften für unvereinbar mit dem internationalen Handelsrecht. Die EU änderte ihre Bananenregelung mindestens zweimal, doch der Streit ging weiter, und die USA beantragten bei der WTO die Genehmigung, Vergeltungszölle auf europäische Erzeugnisse zu erheben. Schließlich unterzeichneten die EU und alle beteiligten amerikanischen Staaten 2009 ein Handelsabkommen, das ihren Bananenkrieg beendete. Der britische Botschafter in Washington in jenen Kriegszeiten, Christopher Meyer, hat später enthüllt, wie er darum kämpfen musste, Vergeltungsmaßnahmen der USA gegen schottische Kaschmirwolle abzuwenden. Er machte dazu mit dem US-Senator Trent Lott (von stolzer schottischer Abstammung, Vertreter des Staates Mississippi, welcher eng mit der Verschiffung von Bananen und mit Chiquita-Interessen verbunden war, und daher im Bananenkrieg besonders einflussreich) ein Geschäft zum wechselseitigen Vorteil: Lott sorgte für Schottlands Verschonung, und Meyer half ihm, 2001 auf den Stufen des Kapitols den ersten Tartan Day (Schottenkaro-Tag, begangen im Schottenrock) auszurichten, und bot zu dem Anlass sogar den in Schottland geborenen Sean Connery auf (wenn auch nicht James Bond).29
Leider kommen nicht alle Handelsstreitigkeiten zu einem heiteren Abschluss. Manche werden bitter, und es ist schwer zu unterscheiden, wann sie sich zu einem Handelskrieg oder gar zu einem Wirtschaftskrieg auswachsen. Auch hier sind die Übergänge wieder fließend, ähnlich wie zwischen Sanktionen und Wirtschaftskrieg und zwischen Wettbewerb und Konflikt.30 Als Faustregel lässt sich angeben: Ein Handelskrieg liegt vor, wenn ein erheblicher Teil der gesamten Wirtschaft eines Beteiligten beeinträchtigt wird, wenn politische Kerninteressen auf dem Spiel stehen oder wenn die beteiligten Volkswirtschaften zum Kampfplatz von ohnehin bereits angespannten und polemischen Gesamtbeziehungen werden. Wann tatsächliche oder drohende Verluste von Arbeitsplätzen oder ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts die Gesamtwirtschaft „erheblich“ beeinträchtigen, bestimmt als politischen Schwellenwert jedes Land für sich selbst (der Wert dürfte bei um die zwei Prozent Verlust liegen). In diesem Sinne „erheblich“ dürften auch erlittene oder drohende sektorübergreifende strukturelle Nachteile sein, zum Beispiel infolge andauernder ausländischer Regelverstöße, Produktpiraterie oder Wirtschaftsspionage. Politische Kerninteressen betreffen in erster Linie territoriale Fragen, die nationale Sicherheit und das internationale Prestige. Die erwähnte Krise im östlichen Mittelmeerraum aufgrund der Gas- und Ölvorkommen ist ein Beispiel dafür, wie ein Wirtschaftskonflikt zu einem Handelskrieg und Schlimmerem eskalieren kann: Es geht potenziell um großen Reichtum, die nationale Sicherheit und territoriale Grenzen sind betroffen, und es sind geopolitische Strategien und alte Feindschaften im Spiel. Die Türkei schickte Kriegsschiffe, um Bohrarbeiten zu eskortieren; Frankreich unterstützte Zypern und Griechenland und demonstrierte Stärke zur See; Griechenland forderte Spanien und Deutschland auf, Militärverkäufe zu stoppen, die die türkische Marine ertüchtigen würden;31 die EU diskutierte wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei;32 Ägypten33 und das NATO-Verteidigungsbündnis wurden in den Konflikt hineingezogen;34 und für viele Beobachter drohte die Türkei sogar mit einem militärischen Konflikt.35 Die EU-Mitgliedschaft Griechenlands und Zyperns senkt das Risiko einer Eskalation, da weder die Türkei noch die EU einen Handelskrieg gegeneinander führen wollen. Ohne die ausschließliche Zuständigkeit der EU in Außenhandelsfragen wäre es aber gewiss schon jetzt zu einem Handelskrieg zwischen den drei hauptsächlich beteiligten Staaten gekommen.