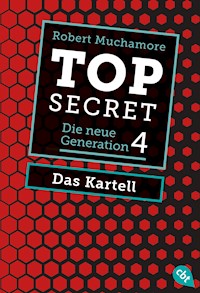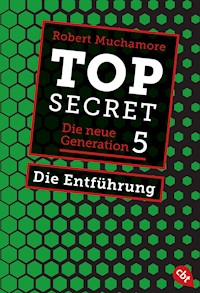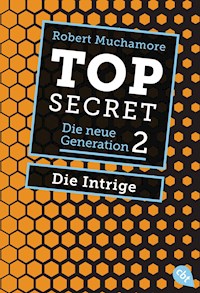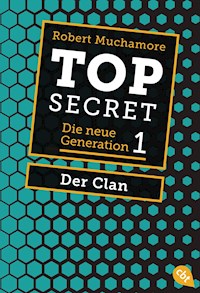8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Top Secret (Serie)
- Sprache: Deutsch
Aufregenden Einsätze in allen Teilen der Welt - Action und Spannung pur!
Jugendliche Agenten ermitteln für den MI 5!
CHERUB ist eine Unterorganisation des britischen Geheimdienstes MI 5 und das Geheimnis ihres Erfolges sind – mutige Kids. Die jungen Agenten werden weltweit immer da eingesetzt, wo sie als unverdächtige Jugendliche brisante Informationen beschaffen können. Doch vorher müssen sie sich in einer harten Ausbildung qualifizieren!
Auch James brennt nach diesem Härtetest auf seinen ersten Einsatz: Eine Gruppe von Öko-Terroristen bereitet einen Anschlag mit tödlichen Viren vor ...
Überzeugende, sympathische Charaktere und temporeiche Action: "Top Secret" ist brillante Action mit Tiefgang und aktuellen Themen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DER AUTOR
Robert Muchamore, Jahrgang 1972, lebt in London und arbeitet dort als Privatdetektiv. Er hasst es, von Kühen gejagt zu werden, das Landleben überhaupt, bärtige Frauen, Ketschup und Majonäse, Schnulzenfilme und Leute, die zehn Minuten lang an der Bushaltestelle warten und erst dann anfangen, nach Kleingeld zu kramen, wenn sie vor dem Busfahrer stehen.
Er hat einen sehr schwarzen Humor und seine Lieblingsfernsehserie ist »Jackass«. »CHERUB – Der Agent« ist sein erster Roman.
Mehr zu Robert Muchamore und CHERUB unter: www.cherubcamps.com
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2004 der Originalausgabe by Robert Muchamore
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »CHERUB: The Recruit« bei Hodder Children’s Books, London.
© 2005 der deutschsprachigen Ausgabe bei cbt / cbj Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Tanja Ohlsen
Umschlagkonzeption: init.büro für gestaltung, Bielefeld
If · Herstellung: CZ
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-11999-7
V004
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Was ist CHERUB?
Im Zweiten Weltkrieg gründeten französische Zivilisten eine Widerstandsbewegung zur Bekämpfung der deutschen Streitkräfte im besetzten Frankreich. Dabei bestanden viele ihrer hilfreichsten Einheiten aus Kindern und Jugendlichen. Einige von ihnen arbeiteten als Kundschafter oder Boten, andere freundeten sich mit den von Heimweh geplagten deutschen Soldaten an und erhielten so Informationen, mit deren Hilfe die Widerstandsbewegung militärische Operationen der Deutschen sabotieren konnte.
Mit diesen französischen Kindern arbeitete fast drei Jahre lang ein britischer Spion namens Charles Henderson. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien nutzte er seine in Frankreich erworbenen Kenntnisse, um zwanzig britische Jungen für Undercover-Operationen auszubilden. Der Codename für diese Einheit lautete CHERUB.
Henderson starb 1946, doch die von ihm gegründete Organisation bestand fort. Mittlerweile arbeiten für CHERUB über zweihundertfünfzig Agenten, die siebzehn Jahre oder jünger sind. Obwohl es seit der Gründung
1.
James Choke hasste Naturkunde.
In der Grundschule hatte er sich immer vorgestellt, dass es im ganzen Raum Teströhrchen, Gasflammen und Funken geben müsse. Stattdessen hockte er eine Stunde lang auf seinem Stuhl und sah zu, wie Miss Voolt die Tafel voll schrieb. Und obwohl der Kopierer bereits vor vierzig Jahren erfunden worden war, musste man alles abschreiben.
Es war die vorletzte Stunde, draußen regnete es, und es begann, dunkel zu werden. James war müde, denn im Labor war es heiß und außerdem hatte er bis spät in die Nacht »Grand Theft Auto« gespielt.
Neben ihm saß Samantha Jennings. Die Lehrer liebten sie: Sie meldete sich ständig freiwillig, trug eine adrette Uniform und hatte lackierte Fingernägel. Sie malte ihre Diagramme in drei verschiedenen Farben und schlug ihre Lehrbücher in Geschenkpapier ein, damit sie besonders schön aussahen. Doch wenn die Lehrer nicht hinsahen, zeigte Samantha ein anderes Gesicht. James hasste sie. Ständig hänselte sie ihn, weil seine Mutter so dick war.
»James’ Mutter ist so fett, dass er die Badewanne schmieren muss, damit sie nicht drin stecken bleibt.«
Samanthas Freundinnen lachten, wie immer.
James’ Mutter war riesig. Sie musste ihre Kleider aus einem Spezialkatalog für Dicke bestellen. Mit ihr gesehen zu werden, war ein Albtraum. Die Leute starrten sie an und zeigten mit dem Finger auf sie. Kleine Kinder ahmten ihren Gang nach. James liebte seine Mutter zwar, aber er versuchte trotzdem, Ausreden zu finden, wenn sie mit ihm irgendwohin gehen wollte.
»Gestern bin ich zehn Kilometer gejoggt«, sagte Samantha. »Zwei Runden um James’ Mutter.«
James sah von seinem Übungsbuch auf.
»Sehr witzig, Samantha. Fast noch witziger als die ersten drei Mal, die du’s erzählt hast.«
James war einer der härtesten Jungs der siebten Klasse. Jeder Junge, der seine Mutter beleidigte, hätte eine Ohrfeige bekommen. Aber was machte man bei einem Mädchen? In der nächsten Stunde würde er sich möglichst weit weg von Samantha setzen.
»Deine Mutter ist so fett...«
James hatte es satt. Er sprang auf, sein Stuhl kippte nach hinten.
»Was soll das, Samantha?«, schrie er.
Im Labor wurde es still. Alle Augen richteten sich auf sie.
»Was hast du denn, James?«, lächelte Samantha. »Verstehst du keinen Spaß?«
»James Choke, heb deinen Stuhl auf und arbeite weiter«, rief Miss Voolt.
»Noch ein Wort, Samantha, und ich...«
James war noch nie sehr schlagfertig gewesen.
»Ich werde verdammt...«
Samantha kicherte. »Was wirst du tun, James? Heimgehen und mit der dicken, fetten Mama kuscheln?«
James konnte das dämliche Grinsen in Samanthas Gesicht nicht länger ertragen. Er zog sie vom Stuhl hoch, schlug sie gegen die Wand und drehte sie dann zu sich um. Geschockt hielt er inne. Blut lief ihr übers Gesicht. In ihrer Wange klaffte ein langer Schnitt von einem Nagel, der aus der Wand ragte.
James fuhr zurück. Er bekam Angst. Samantha hielt die Hände über die Wunde und schrie wie verrückt.
»James Choke, du bekommst großen Ärger!«, schrie Miss Voolt.
Alle aus James’ Klasse kreischten wild durcheinander. James konnte nicht fassen, was er getan hatte. Keiner würde glauben, dass es ein Unfall war. Er lief zur Tür.
Miss Voolt griff ihn am Blazer.
»Wo willst du hin?«
»Lassen Sie mich!«, schrie James.
Er versetzte Miss Voolt einen Stoß, sodass sie rückwärts hinfiel und mit den Armen und Beinen in der Luft zappelte wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt.
James knallte die Klassentür hinter sich zu und rannte den Gang entlang. Das Schultor war verschlossen, doch er entkam über die Schranke am Lehrerparkplatz.
Fluchend stürmte James von der Schule weg, während seine Wut langsam ab- und seine Angst zunahm, als er sich klar machte, dass er in den größten Schwierigkeiten seines Lebens steckte.
In einigen Wochen würde er zwölf werden. Er fragte sich, ob er noch so lange leben würde. Seine Mutter würde ihn umbringen. Mit Sicherheit würde er einen Verweis bekommen; wahrscheinlich war es sogar schlimm genug, um von der Schule zu fliegen.
Als James den kleinen Spielplatz in der Nähe seiner Wohnung erreichte, war ihm schlecht. Er sah auf die Uhr. Wenn er um diese Zeit nach Hause kam, wusste seine Mutter sofort, dass etwas passiert war, aber für einen Becher Tee an der Imbissbude fehlte ihm das Geld. So konnte er nur auf den Spielplatz gehen und sich in der Betonröhre vor dem Nieselregen verkriechen.
Der Tunnel erschien James enger als früher. Überall waren Graffitis aufgesprüht und es stank nach Hundepisse. James kümmerte es nicht. Er verdiente es, an einem kalten Ort zu sein, der nach Hund roch. Um seine Hände zu wärmen, rieb er sie aneinander, und er erinnerte sich an die Zeit, als er noch klein war.
Damals war seine Mutter noch längst nicht so dick gewesen. Ihr Gesicht war mit einem irren Grinsen am Ende des Tunnels erschienen, und mit tiefer Stimme hatte sie gesagt: Ich komm dich fressen, James! Das war cool, denn die Röhre hatte ein klasse Echo, wenn man darin saß.
James probierte es aus: »Ich bin ein Vollidiot!«
Das Echo stimmte ihm zu. Er zog sich die Kapuze über und schloss den Reißverschluss, sodass sein Gesicht halb verdeckt war.
Nach einer halben Stunde Grübeln wusste James, dass er zwei Möglichkeiten hatte: Er konnte den Rest seines Lebens in dieser Röhre verbringen oder nach Hause gehen und sich umbringen lassen.
James betrat die Diele der Wohnung und warf einen Blick auf das Mobiltelefon auf dem Tisch unter der Garderobe.
12 ANRUFE IN ABWESENHEIT UNBEKANNTE NUMMER
Anscheinend hatte die Schule versucht, seine Mutter zu erreichen, sie war aber nicht ans Telefon gegangen. James dankte Gott, wunderte sich jedoch, warum sie nicht abgehoben hatte. Dann sah er Onkel Rons Jacke am Haken hängen.
Onkel Ron war aufgetaucht, als James noch ein Kleinkind war. Es war, als hätte man einen lauten, stinkenden Teppich in der Wohnung. Ron rauchte, trank und verließ das Haus nur, um in die Kneipe zu gehen. Einmal hatte er auch einen Job gehabt, aber nur vierzehn Tage lang.
James hatte Ron immer für einen Idioten gehalten und seine Mutter stimmte ihm schließlich zu und warf Ron hinaus. Allerdings erst nachdem sie ihn geheiratet und seine Tochter geboren hatte. Selbst jetzt hatte James’ Mutter noch etwas für Ron übrig. Sie waren nie geschieden worden. Alle paar Wochen tauchte Ron auf, angeblich um seine Tochter Lauren zu sehen. Er kam jedoch meist, wenn Lauren in der Schule war und er Geld brauchte.
James ging ins Wohnzimmer. Gwen, seine Mutter, hing auf dem Sofa, ihre Füße auf einem Hocker. Das linke Bein war bandagiert. Ron saß im Lehnstuhl, die Füße in den löchrigen Socken auf dem Couchtisch. Beide waren betrunken.
»Mum, du sollst doch nicht trinken, wenn du deine Medikamente nimmst«, sagte James und vergaß vor lauter Ärger seine eigenen Probleme.
Ron richtete sich auf und nahm einen Zug an seiner Zigarette.
»Hi, Jamieboy, Daddy ist zu Hause«, grinste er.
Ron und James starrten einander an.
»Du bist nicht mein Vater, Ron«, sagte James.
»Nein«, antwortete Ron. »Dein Vater ist getürmt, als er deine hässliche Visage gesehen hat.«
Vor Ron wollte James eigentlich nichts von der Schule erzählen, doch die Wahrheit nagte an ihm.
»Mum, in der Schule ist was passiert. Ein Unfall.«
»Hast dir wieder in die Hosen gemacht, was?«, kicherte Ron.
James ging nicht darauf ein.
»Hör zu, James, Liebling«, lallte Gwen undeutlich. »Egal was für Schwierigkeiten du hast, wir reden später drüber. Geh und hol deine Schwester von der Schule ab. Ich hab ein bisschen zu viel getrunken und kann nicht mehr fahren.«
»Es tut mir Leid, Mum, aber es ist wirklich ernst. Ich hab...«
»Geh einfach deine Schwester abholen, James«, jaulte seine Mutter. »Mir dröhnt der Schädel.«
»Lauren ist alt genug, um allein nach Hause zu kommen«, widersprach James.
»Ist sie nicht«, warf Ron ein. »Tu, was man dir sagt! Wenn du mich fragst, braucht der Junge mal einen Stiefel im Hintern.«
»Wie viel Geld braucht er diesmal?«, fragte James sarkastisch.
Gwen wedelte mit der Hand vor ihrem Gesicht. Sie hatte genug von den beiden.
»Könnt ihr beide nicht zwei Minuten in einem Raum verbringen, ohne euch zu streiten? James, geh an meinen Geldbeutel und bring uns auf dem Heimweg etwas zum Abendessen mit. Ich koche heute nicht.«
»Aber...«
»Geh jetzt, James, bevor ich die Geduld verliere.«
James konnte es nicht erwarten, bis er alt genug war, um Onkel Ron zu verprügeln. Wenn er nicht da war, war seine Mutter O.K.
2.
Einige Kinder waren mit einer Spielekonsole glücklich. James Choke besaß alle möglichen, jedes Spiel und alles Zubehör. In seinem Zimmer gab es einen PC, einen MP3-Player, ein Nokia-Handy, einen Großbildfernseher und einen DVD-Spieler. Er kümmerte sich nicht um die Dinger. Wenn eines kaputtging, bekam er ein neues. Er hatte acht Paar Nike-Turnschuhe. Ein Spitzenskateboard. Ein Rennrad für sechshundert Pfund. Wenn sein Zimmer unordentlich war, sah es aus, als hätte eine Bombe in einen Spielwarenladen eingeschlagen.
James besaß dies alles, weil Gwen Choke eine Diebin war. Von ihrem Sessel aus regierte sie ein ganzes Ladendiebstahl-Imperium, während sie sich Nachmittagssoaps im Fernsehen ansah und sich mit Pizza und Schokolade voll stopfte. Sie selbst stahl nicht. Gwen nahm Bestellungen an und vermittelte sie an Diebe, die für sie arbeiteten. Sie verwischte ihre Spuren und kam selbst den gestohlenen Waren nie nahe. Alle paar Tage wechselte sie das Handy, damit die Polizei ihre Anrufe nicht verfolgen konnte.
Seit er vor den Sommerferien die Grundschule abgeschlossen hatte, war er zum ersten Mal wieder hier. Vor dem Tor standen einige tratschende Mütter.
»Wo ist deine Mutter, James?«, fragte jemand.
»Die ist voll«, antwortete James säuerlich. Da sie ihn aus der Wohnung geworfen hatte, hatte er keine Lust, sie zu decken. Er sah die anderen Mütter Blicke tauschen.
»Ich bräuchte ›Medal of Honour‹ für die PlayStation«, sagte eine von ihnen. »Kann deine Mutter mir das besorgen?«
James zuckte die Schultern. »Klar. Halber Preis, nur Bargeld.«
»Du denkst dran, ja, James?«
»Nein. Geben Sie mir einen Zettel mit Namen und Telefonnummer und ich geb’s weiter.«
Die Ansammlung von Müttern begann, Sachen aufzuschreiben, Turnschuhe, Schmuck, ferngesteuerte Autos. James steckte die Zettel in seinen Blazer.
»Ich brauche es bis Dienstag«, sagte jemand.
James war nicht in Stimmung.
»Wenn Sie meiner Mutter etwas mitteilen möchten, schreiben Sie es auf. Ich vergesse so was.«
Die Kinder kamen allmählich aus der Schule. Die neunjährige Lauren kam als Letzte ihrer Klasse. Sie hatte die Hände in den Taschen ihrer Bomberjacke vergraben und Matsch auf ihrer Hose vom Fußballspielen mit den Jungen in der Mittagspause. Lauren hatte blondes Haar, wie James, doch sie fragte ihre Mutter ständig, ob sie es schwarz färben dürfte.
Lauren lebte in einer anderen Welt als die meisten Mädchen ihres Alters. Sie besaß nicht ein einziges Kleid oder einen Rock. Mit fünf hatte sie ihre Barbiepuppen in die Mikrowelle gesteckt und seitdem keine mehr angefasst. Gwen Choke behauptete, dass Lauren, wenn es zwei Möglichkeiten gab, etwas zu tun, mit Sicherheit die dritte wählen würde.
»Ich hasse diese alte Kuh«, sagte sie, als sie zu James trat.
»Wen?«
»Mrs Reed. Sie hat uns Rechenaufgaben gestellt. Ich habe dafür zwei Minuten gebraucht und musste den Rest der Stunde stillsitzen und warten, bis die anderen, dummen Kinder auch fertig waren. Ich durfte nicht mal zur Garderobe und mein Buch holen.«
James erinnerte sich, dass Mrs Reed drei Jahre zuvor das Gleiche mit ihm gemacht hatte, als sie seine Lehrerin gewesen war. Es war, als würde man dafür bestraft, clever zu sein.
»Warum bist du eigentlich hier?«, fragte Lauren.
»Mum ist betrunken.«
»Sie soll doch vor der Operation nicht trinken.«
»Das musst du mir nicht sagen«, sagte James. »Was soll ich denn machen?«
»Wie kommt es, dass du früh genug zu Hause warst, um mich abzuholen?«
»Ich habe mich geprügelt. Sie haben mich heimgeschickt.«
Lauren schüttelte den Kopf, musste aber doch lächeln.
»Schon wieder eine Prügelei. Das war die dritte in diesem Halbjahr, nicht wahr?«
James wollte nicht darüber sprechen.
»Was willst du zuerst hören«, fragte er, »die gute Nachricht oder die schlechte?«
Lauren zuckte mit den Achseln. »Egal.«
»Dein Vater ist da. Die gute Nachricht ist, dass Mum uns Geld fürs Abendessen gegeben hat. Er dürfte weg sein, bis wir nach Hause kommen.«
Sie landeten in einem Burger-Laden, wo James sich einen doppelten Cheeseburger kaufte. Lauren wollte nur Zwiebelringe und eine Cola. Sie hatte keinen Hunger, also griff sie sich eine Hand voll Milch- und Zuckerpäckchen und schmierte damit den Tisch ein, während James aß. Sie kippte den Zucker aus, tränkte ihn mit Milch, zerriss dann die Papierverpackung und rührte alles um.
»Wozu machst du das?«, fragte James.
»Um es genau zu sagen«, klärte Lauren ihn scharf auf, »hängt die gesamte Zukunft der westlichen Zivilisation davon ab, dass ich mit diesem Ketchup ein Smiley-Gesicht mache.«
»Dir ist klar, dass irgendein armes Schwein das alles wegmachen muss?«
»Nicht mein Problem.«
James schluckte den letzten Bissen seines Burgers herunter, hatte jedoch immer noch Hunger. Lauren hatte ihre Zwiebelringe kaum angerührt.
»Isst du die noch?«, fragte er.
»Du kannst sie haben, wenn du willst. Sie sind eiskalt.«
»Mehr gibt es heute Abend nicht. Du solltest besser etwas essen.«
»Ich habe keinen Hunger«, sagte Lauren. »Ich mach später ein paar Sandwiches.«
James liebte Laurens Sandwichtoasts. Sie waren irre: Lauren nahm dazu Nutella, Honig, Puderzucker, Sirup und Schokochips. Alles, was süß war, kam in Mengen darauf. Außen waren sie knusprig und in der Mitte war ein etwa drei Zentimeter dicker heißer Klumpen. Man konnte sie nicht essen, ohne sich die Finger zu verbrennen.
»Diesmal machst du aber besser hinterher sauber«, sagte James. »Das letzte Mal, als du Sandwiches gemacht hast, ist Mum ausgerastet.«
Als sie in ihre Straße einbogen, war es fast dunkel. Hinter einer Hecke kamen zwei Jungen hervor. Einer von ihnen packte James, presste ihn gegen eine Mauer und drehte ihm den Arm auf den Rücken.
»Hallo, James«, sagte er, seinen Mund dicht an James’ Ohr. »Wir haben auf dich gewartet.«
Der andere griff sich Lauren und hielt ihr den Mund zu, um sie am Schreien zu hindern.
James fragte sich, wo er seinen Grips gelassen hatte. Während er sich um den Ärger mit seiner Mutter, der Schule und eventuell sogar mit der Polizei gesorgt hatte, hatte er etwas vergessen: Samantha Jennings hatte einen sechzehnjährigen Bruder.
Greg Jennings hing mit einer Bande von Verrückten herum. In dem Viertel, wo James wohnte, waren sie die Kings: Sie zertrümmerten Autos, überfielen Leute und fingen Schlägereien an. Wenn ein Kind sie sah, schaute es auf seine Schuhe, kreuzte die Finger und war froh, wenn es mit einem zerschlagenen Gesicht davonkam und ihm nur Geld abgenommen wurde. Eine gute Möglichkeit, die Bande aufzuscheuchen, war, eine ihrer kleinen Schwestern zu verprügeln.
Greg Jennings rieb James’ Gesicht an der Ziegelmauer entlang.
»Jetzt bist du dran!«
Er ließ James’ Arm los. James fühlte, wie ihm das Blut über Nase und Wangen lief. Es hatte keinen Sinn, sich zu wehren, Greg konnte ihn zerbrechen wie einen Zweig.
»Angst?«, fragte Greg. »Solltest du auch haben.«
James versuchte zu sprechen, doch seine Stimme versagte, und so, wie er zitterte, war das Antwort genug.
»Hast du Geld?«, fragte Greg.
James zog den Rest der vierzig Pfund aus der Tasche.
»Nicht schlecht«, meinte Greg.
»Bitte tut meiner Schwester nicht weh«, bat James.
»Meine Schwester hat acht Stiche im Gesicht«, sagte Greg und zückte ein Messer. »Glücklicherweise laufe ich nicht herum und verletze kleine Mädchen, sonst könnte deine Schwester mit achtzig Stichen enden!«
Greg schnitt James’ Schulkrawatte ab. Dann trennte er die Knöpfe von seinem Hemd und schlitzte seine Hosen auf.
»Das ist erst der Anfang, James«, sagte Greg. »Wir werden uns noch häufig sehen.«
Eine Faust landete in James’ Magen. Ron hatte James ein paar Mal geschlagen, doch nie so fest. Greg und sein Helfer schlenderten davon und James ging zu Boden.
Lauren kam zu ihm herüber. Sie hatte nicht viel Mitleid mit ihm.
»Du hast dich mit Samantha Jennings geschlagen?«
James sah zu seiner Schwester auf. Er hatte Schmerzen und er schämte sich.
»Sie hat sich verletzt. Es war ein Unfall. Ich wollte ihr nur Angst machen.«
Lauren wandte sich ab.
»Hilf mir, Lauren, ich kann nicht laufen.«
»Dann kriech doch!«
3.
James stolperte in die Diele, eine Hand auf den Magen gepresst. Er warf einen Blick auf das Display des Handys seiner Mutter.
48 ANRUFE IN ABWESENHEIT 4 TEXTNACHRICHTEN
Er stellte das Telefon aus und steckte den Kopf ins Wohnzimmer. Das Licht war aus, der Fernseher an. Seine Mutter schlief in ihrem Sessel. Von Ron keine Spur.
»Er ist weg«, sagte er.
»Gott sei Dank«, erwiderte Lauren. »Er küsst mich immer und sein Atem riecht grauenvoll.«
Lauren schloss die Wohnungstür und hob eine handgeschriebene Notiz von der Fußmatte auf.
»Von deiner Schule.«
Lauren kämpfte mit der schlechten Handschrift, als sie sie vorlas: »Sehr geehrte Mrs Choke, bitte rufen Sie entweder die Schulsekretärin oder mich dringend unter einer der unten genannten Nummern an, be... be-irgendwas?«
»Bezüglich«, vermutete James.
»Bezüglich James’ Verhalten in der Schule«, las Lauren weiter. »Michael Rook, stellvertretender Schulleiter.«
Lauren folgte James in die Küche. Er nahm sich ein Glas Wasser und ließ sich am Küchentisch nieder. Lauren setzte sich ihm gegenüber und kickte ihre Turnschuhe weg.
»Mum wird dich massakrieren«, grinste sie. Sie freute sich darauf, James leiden zu sehen.
»Kannst du nicht die Klappe halten? Ich versuche, nicht daran zu denken.«
James schloss sich im Bad ein. Sein Spiegelbild schockierte ihn. Die linke Gesichtshälfte und die Spitzen seines blonden Haares waren rot von Blut. Er leerte seine Taschen aus und stopfte die ruinierten Kleidungsstücke in eine Mülltüte. Später würde er sie unter dem anderen Müll verstecken, damit seine Mutter sie nicht fand.
Dass er in solch einem Schlamassel steckte, brachte James dazu, über sich selbst nachzudenken. Er wusste, dass er kein besonders guter Mensch war. Er stritt sich ständig. Er war intelligent, aber faul, und bekam deshalb schlechte Noten. Er erinnerte sich an all die Male, in denen die Lehrer ihm gesagt hatten, dass er sein Potenzial verschwende und dass es einmal ein schlimmes Ende mit ihm nehmen würde. In Millionen von Schulstunden hatte er sein Gehirn völlig abgeschaltet. Nun wurde ihm langsam klar, dass sie zum größten Teil Recht hatten, und dafür hasste er sie umso mehr.
James öffnete die Tube mit der Wundsalbe, merkte jedoch, dass die Salbe nichts nutzen würde, wenn er nicht erst das Blut abwusch. Wohltuend traf der Strahl der heißen Dusche sein Gesicht und seinen Körper, während sich zu seinen Füßen ein roter Strudel bildete.
Er war nicht sicher, ob Gott existierte, konnte sich jedoch auch nicht vorstellen, wie alles um ihn herum entstanden sein konnte, ohne dass irgendetwas es gemacht hatte. Wenn es je eine Zeit für Gebete gab, dann jetzt. Er fragte sich kurz, ob man nackt in der Dusche beten dürfe, kam jedoch zu dem Schluss, dass das ziemlich schnuppe wäre, und faltete die nassen Hände.
»Hallo, Gott... Ich bin nicht immer gut. Eigentlich sogar nie. Hilf mir doch einfach, gut zu sein und so. Hilf mir, ein besserer Mensch zu werden. Danke... Amen. Und sorg dafür, dass Greg Jennings mich nicht umbringt!«
Nicht ganz von der Macht des Gebetes überzeugt, sah James unsicher auf seine Hände.
Nach der Dusche zog James seine Lieblingsklamotten an, ein T-Shirt von Arsenal und ein paar zerrissene Nike-Trainingshosen, die er vor seiner Mutter verstecken musste, die alles wegwarf, was nicht so aussah, als sei es gerade die Woche zuvor geklaut worden. Sie verstand einfach nicht, dass es viel cooler war, wenn Klamotten etwas abgewetzt aussahen.
Nachdem er ein Glas Milch getrunken, zwei von Laurens getoasteten Sandwiches verdrückt und eine halbe Stunde »GT4« unter der Bettdecke gespielt hatte, fühlte er sich etwas besser, abgesehen davon, dass sein Magen höllisch wehtat, wenn er sich abrupt bewegte, und dass er sich nicht gerade darauf freute, seiner Mutter zu erzählen, was passiert war, wenn sie aufwachte. Nicht dass es aussah, als würde sie bald aufwachen; sie musste jede Menge getrunken haben.
James’ Wagen krachte in die Absperrung und sechs Autos rasten an ihm vorbei, was ihn auf den letzten Platz zurückwarf. Er warf das Joypad weg. Diese Kurve kriegte er nie. Die vom Computer gesteuerten Autos liefen wie auf Schienen, sodass es schien, als reibe das Spiel ihm seine Fehler auch noch unter die Nase. Es war langweilig, alleine zu spielen, aber es hatte auch keinen Sinn, Lauren zu fragen. Lauren hasste Computerspiele. Sie wollte immer nur Fußball spielen oder zeichnen.
James griff nach seinem Handy und rief seinen Freund Sam an, der ein Stockwerk tiefer wohnte und in seine Klasse ging.
»Hallo, Mr Smith. Hier ist James Choke. Ist Sam da?«
Sam nahm das Telefon in seinem Zimmer ab. Er klang aufgeregt.
»Hi, Psycho!«, lachte er. »Du hast gigantische Schwierigkeiten!«
So hatte James eigentlich nicht anfangen wollen.
»Was war los, nachdem ich weg war?«
»Mann, das war das Krasseste, was ich je erlebt hab! Samantha lief Blut übers Gesicht, über die Arme und überallhin. Sie haben sie im Krankenwagen weggebracht. Miss Voolt hat sich den Rücken verletzt, sie hat geheult und gerufen: >Jetzt reicht’s! Ich geh in Frührente! ‹ Sowohl der Direktor als auch der stellvertretende Schulleiter sind gekommen. Miles hat einen Verweis gekriegt, weil er gelacht hat.«
James konnte es kaum glauben. »Einen Verweis nur fürs Lachen?«
»Der Direktor war außer sich. Du bist von der Schule geflogen, James.«
»Unmöglich!«
»Wohl möglich, Psycho. Du hast es nicht einmal bis zu den ersten Ferien geschafft. Das ist wohl Rekordzeit für einen Rauswurf. Hat deine Mutter dich verprügelt?«
»Sie weiß es noch nicht. Sie schläft.«
Wieder brach Sam in Gelächter aus. »Sie schläft! Glaubst du nicht, dass sie geweckt werden möchte, damit du ihr erzählst, dass du von der Schule geflogen bist?«
»Interessiert sie doch nicht«, log James und versuchte, cool zu wirken. »Willst du rüberkommen und PlayStation spielen?«
Sams Stimme klang ernst. »Nein, Mann, ich muss Hausaufgaben machen.«
James lachte. »Du machst nie Hausaufgaben!«
»Ich fange damit an. Meine Leute setzen mich unter Druck. Die Geburtstagsgeschenke sind in Gefahr.«
James wusste, dass Sam log, konnte sich jedoch nicht vorstellen, warum. Normalerweise fragte er seine Mutter, ob er kommen durfte, und sie sagte immer Ja.
»Was? Was habe ich dir getan, Mann?«
»Nichts, James, aber...«
»Aber was, Sam?«
»Ist das nicht offensichtlich?«
»Nein.«
»Du bist mein Kumpel, James, aber wir können nicht mehr zusammen rumhängen, bis die Sache abgekühlt ist.«
»Warum zum Teufel nicht?«
»Weil Greg Jennings dich absolut fertig machen wird, und wenn man mich mit dir sieht, bin ich auch dran.«
»Du könntest mir helfen, mich gegen ihn zu wehren«, sagte James.
»Mein mickriger Hintern hilft dir nicht viel gegen diese Kerle. Ich mag dich wirklich, James, du bist ein guter Freund, aber im Moment wäre es Selbstmord, mit dir rumzuhängen.«
»Vielen Dank für die Hilfe, Sam!«
»Du hättest dein Hirn einschalten sollen, bevor du die Schwester des härtesten Jungen an der Schule an einen rostigen Nagel gehängt hast.«
»Ich wollte ihr nicht wehtun. Es war ein Unfall.«
»Ruf mich wieder an, wenn du Greg Jennings dazu kriegst, das zu glauben.«
»Ich kann nicht fassen, dass du mir das antust, Sam!«
»An meiner Stelle würdest du das Gleiche tun, das weißt du.«
»Das war’s also. Ich bin ein Aussätziger.«
»Es ist übel, James. Tut mir Leid.«
»Ja, klar.«
»Wir können immer noch telefonieren. Ich mag dich immer noch.«
»Danke, Sam.«
»Ich mach besser Schluss. Tschüss, James. Tut mir echt Leid.«
»Viel Spaß bei den Hausaufgaben.«
James beendete das Gespräch und fragte sich, ob er noch einmal beten sollte.
James sah sich irgendeinen Mist im Fernsehen an, bis er einschlief. Er träumte, dass Greg Jennings auf seinen Eingeweiden stand, und erwachte mit einem Ruck. Er musste dringend aufs Klo. Der erste Tropfen Urin, der die Toilette traf, war rot. James fuhr zurück. Knallrot! Er pisste Blut! Nachdem er auf dem Klo war, ließ der Schmerz nach, aber er hatte Angst. Er musste es seiner Mutter sagen.
Der Fernseher im Wohnzimmer lief immer noch auf voller Lautstärke. James schaltete ihn ab. »Mum?«
James fühlte sich merkwürdig. Seine Mutter war zu still. Er fühlte ihre Hand. Kalt. Er hielt seine Hand vor ihr Gesicht. Sie atmete nicht. Kein Puls. Nichts.
Auf dem Rücksitz des Krankenwagens nahm James Lauren in den Arm. Die Leiche ihrer Mutter befand sich einen halben Meter entfernt, zugedeckt mit einem Laken. Laurens Hand krallte sich in seinen Rücken, was ihn wahnsinnig machte, aber er versuchte, sich zurückzuhalten, damit sie sich nicht noch schlechter fühlte.
Als der Krankenwagen vor der Unfallstation hielt, beobachtete James, wie seine Mutter auf einem Wagen weggerollt wurde, und ihm wurde schlagartig klar, dass dies seine letzte Erinnerung an sie sein würde: eine unförmige Masse unter einem gewölbten Laken, von blauen Blitzlichtern erleuchtet.
Als er aus dem Krankenwagen stieg, hing Lauren immer noch an ihm und wollte ihn um keinen Preis loslassen. Sie weinte nicht mehr, aber sie keuchte wie ein Tier und ging wie ein Zombie. Der Fahrer führte sie durch den Warteraum in ein Krankenzimmer, wo eine Ärztin wartete, die bereits wusste, was geschehen war.
»Ich bin Dr. May. Ihr müsst Lauren und James sein.«
James rieb Laurens Schulter, um sie zu beruhigen.
»Lauren, kannst du deinen Bruder loslassen, damit wir uns unterhalten können?«
Lauren stellte sich taub.
»Es ist, als sei sie tot«, sagte James.
»Sie hat einen Schock. Ich muss ihr etwas zur Beruhigung geben, sonst wird sie ohnmächtig.«
Dr. May nahm eine Spritze von einem Rollwagen und zog den Ärmel von Laurens T-Shirt hoch.
»Halt sie fest.«
Sobald die Nadel sie nur berührte, wurde Lauren schlaff. James legte sie auf das Bett, während Dr. May ihre Beine hochlegte und sie mit einer Decke zudeckte.
»Danke«, sagte James.
»Du hast dem Fahrer des Krankenwagens gesagt, dass du Blut im Urin hattest«, stellte Dr. May fest.
»Ja.«
»Hat dich irgendetwas in den Magen getroffen?«
»Irgendjemand«, berichtigte James. »Ich habe mich geprügelt. Ist das schlimm?«
»Als du geschlagen wurdest, hast du innerlich geblutet. Es ist wie eine äußerliche Wunde und sollte von selbst heilen. Komm wieder, wenn es morgen Abend noch nicht aufgehört hat.«
»Was passiert jetzt mit uns?«, fragte James.
4.
Am nächsten Morgen erwachte James in einem fremden Bett mit Laken, die nach Desinfektionsmitteln rochen. Er hatte keine Ahnung, wo er war. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, dass ihm eine Krankenschwester eine Schlaftablette gegeben hatte und dass er mit einem tonnenschweren Kopf zu einem Wagen gegangen war.
Seine Sachen hatte er noch an, aber seine Turnschuhe lagen auf dem Boden. Als er den Kopf hob, sah er Lauren im Nachbarbett liegen. Sie schlief mit dem Daumen im Mund, was James nicht mehr an ihr gesehen hatte, seit sie klein war. Was auch immer sie träumte, der Daumen war kein gutes Zeichen.
Er stieg aus dem Bett. Die Pille hatte seinen Kopf schwer gemacht, sein Kiefer fühlte sich steif an und ein dumpfer Schmerz pochte hinter seiner Stirn. Obwohl die Vorhänge zugezogen waren, war es hell im Zimmer. James schob eine Tür auf und fand die Dusche und die Toilette. Erleichtert nahm er zur Kenntnis, dass sein Urin wieder die normale Farbe angenommen hatte. Er spritzte sich Wasser ins Gesicht. Eigentlich hätte ihn der Tod seiner Mutter mehr aufregen sollen, aber er fühlte sich innerlich wie betäubt. Alles war so irreal, als säße er in einem Sessel und sähe sich selbst im Fernsehen.
James sah aus dem Fenster. Draußen liefen haufenweise Kinder herum. Soweit er sich erinnerte, war eine der Lieblingsdrohungen seiner Mutter gewesen, ihn in ein Kinderheim zu stecken, wenn er sich nicht benahm.
Als er das Zimmer verließ, ertönte ein Summer, und aus einem Büro kam eine Sozialarbeiterin, die ihm die Hand hinstreckte.
»Hallo, James, ich bin Rachel. Willkommen in Nebraska House. Wie geht es dir?«
James zuckte die Achseln.
»Es tut mir Leid, was mit deiner Mutter passiert ist.«
»Vielen Dank, Miss.«
Rachel lachte.
»Du bist hier nicht in der Schule, James. Man gibt mir hier alle möglichen Namen, aber Miss nennt mich keiner.«
»Tut mir Leid.«
»Ich führe dich erst mal herum und dann kannst du frühstücken. Hast du Hunger?«
»Ein bisschen«, antwortete James.
»Hör zu, James«, sagte Rachel im Gehen. »Dieser Ort ist ein Loch, und ich weiß, dass dir dein Leben im Moment schrecklich vorkommt. Aber hier gibt es eine Menge guter Leute, die dir helfen können.«
»O.K.«, meinte James.
»Unsere Luxus-Badelandschaft.« Rachel zeigte aus dem Fenster. Dort stand ein Planschbecken voller Regenwasser und Zigarettenkippen. James lächelte schwach. Rachel schien nett zu sein, auch wenn sie wahrscheinlich jedem Freak, der hier landete, das Gleiche sagte.
»Hochmoderne Sportanlagen. Benutzung vor Erledigung der Hausaufgaben strikt verboten.«
Sie gingen durch ein Zimmer mit einem Dartspiel und zwei Billardtischen. Der grüne Filz war mit Teppichband geklebt und in einem Schirmständer lehnten zersplitterte Queues ohne Spitzen.
»Die Zimmer sind oben. Im ersten Stock sind die Jungen, im zweiten die Mädchen. Bäder und Duschen sind hier unten«, fuhr Rachel fort. »Meist haben wir Schwierigkeiten, euch Jungs hineinzubekommen.«
»In meinem Zimmer ist eine Dusche.«
»Das ist der Empfangsraum für Neuankömmlinge. Dort ist man nur die erste Nacht.«
Als Nächstes erreichten sie den Speisesaal, wo sich ein paar Dutzend Kinder, zumeist in Schuluniform, aufhielten. Rachel zeigte ihm alles.
»Da ist das Besteck, warmes Essen gibt es an der Theke. Müsli und Saft. Toast kannst du dir selber machen, wenn du möchtest.«
»Cool.«
Er fühlte sich alles andere als cool. Der Raum voller fremder, lärmender Kinder war Furcht einflößend.
»Komm in mein Büro, wenn du gegessen hast.«
»Was ist mit meiner Schwester?«, fragte James.
»Ich bringe sie zu dir, sobald sie aufwacht.«
James holte sich ein paar Frosties und setzte sich abseits. Die anderen Kinder ignorierten ihn. Neuankömmlinge waren offenbar nichts Ungewöhnliches.
Rachel telefonierte gerade. Auf ihrem Schreibtisch stapelten sich Papiere und Akten. In einem Aschenbecher brannte eine Zigarette. Rachel legte den Hörer weg und nahm einen Zug. Sie fing James’ Blick auf das Rauchverbotsschild auf.
»Wenn das ein Kündigungsgrund wäre, würden ihnen sechs Mitarbeiter fehlen«, erklärte sie. »Willst du eine?«
Es schockierte James, von einem Erwachsenen eine Zigarette angeboten zu bekommen.
»Ich rauche nicht.«
»Gut«, fand Rachel. »Sie verursachen Krebs, aber wir geben sie euch lieber, als dass ihr sie aus den Läden stehlt. Pack meinen Kram weg und mach es dir bequem.«
James räumte einen Stapel von dem am wenigsten beladenen Stuhl und setzte sich.
»Wie fühlst du dich?«
»Ich glaube, die Schlaftablette, die ich gekriegt habe, macht mich groggy.«
»Das gibt sich. Ich meine, wie fühlst du dich nach dem, was mit deiner Mutter passiert ist?«
James zuckte die Achseln. »Schlecht, denke ich.«
»Es ist wichtig, dass du das nicht für dich behältst. Wir machen einen Termin mit einer Therapeutin aus, aber in der Zwischenzeit kannst du jederzeit mit einem von uns Hauseltern reden. Selbst um drei Uhr morgens.«
»Weiß man, woran sie gestorben ist?«
»Soweit ich weiß, hat deine Mutter Schmerzmittel genommen, wegen eines Geschwürs an ihrem Bein.«
»Sie hätte nicht trinken dürfen«, erklärte James. »Daran lag es, nicht wahr?«
»Der Alkohol und die Schmerztabletten zusammen haben deine Mutter in einen tiefen Schlaf versetzt. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Wenn es dir ein Trost ist, deine Mutter hat nicht gelitten.«
»Was passiert mit uns?«, fragte James.
»Du hast keine Verwandten, stimmt’s?«
»Nur meinen Stiefvater. Ich nenne ihn Onkel Ron.«
»Die Polizei hat ihn letzte Nacht ausfindig gemacht.«
»Wahrscheinlich in einer ihrer Zellen«, vermutete James.
Rachel lächelte. »Ich dachte mir schon, dass ihr zwei nicht gut miteinander auskommt, als ich ihn gestern Abend gesprochen habe.«
»Sie haben mit Ron gesprochen?«
»Ja... Kommst du gut mit Lauren aus?«
»Meistens«, antwortete James. »Wir streiten uns zwar zehn Mal am Tag, aber wir lachen auch immer wieder zusammen.«
»Ron war mit deiner Mutter immer noch verheiratet, als sie gestorben ist, auch wenn sie getrennt gelebt haben. Ron ist Laurens Vater, daher erhält er automatisch das Sorgerecht, wenn er es will.«
»Wir können nicht bei Ron leben. Er ist ein Penner!«
»James, Ron will auf keinen Fall, dass Lauren in ein Heim kommt. Er ist ihr Vater. Wir können nichts dagegen tun, es sei denn, es läge Missbrauch vor. Tatsache ist jedoch...«
James konnte es sich selbst ausrechnen.
»Er will mich nicht, stimmt’s?«
»Tut mir Leid.«
James sah zu Boden und versuchte, sich nicht aufzuregen. Im Heim zu sein, war schwer. Aber dass Lauren bei Ron bleiben musste, war schlimmer. Rachel ging um den Schreibtisch herum und legte ihm den Arm um die Schultern. »Es tut mir wirklich Leid, James.«
James fragte sich, warum Ron Lauren überhaupt bei sich haben wollte. »Wie lange können wir zusammenbleiben?«
»Ron meinte, er käme irgendwann am späten Vormittag.«
»Können wir nicht wenigstens ein paar Tage zusammenbleiben?«
»Das ist jetzt vielleicht schwer zu verstehen, James, aber es macht die Sache nur schlimmer, wenn die Trennung herausgezögert wird. Ihr könnt euch immer noch besuchen.«
»Er wird sich nicht richtig um sie kümmern! Mum hat die ganze Hausarbeit gemacht und so. Lauren hat Angst im Dunkeln. Sie kann nicht alleine zur Schule gehen. Ron wird ihr nicht helfen. Er ist nutzlos!«
»Versuch, dir keine Sorgen zu machen, James. Wir werden sie regelmäßig besuchen, um zu sehen, wie sich Lauren in ihrem neuen Zuhause zurechtfindet. Wenn nicht richtig für sie gesorgt wird, wird etwas geschehen.«
»Und was passiert mit mir? Muss ich hierbleiben?«
»Bis wir eine Pflegefamilie für dich gefunden haben, ja. Das heißt, du wirst in einer Familie leben, die für ein paar Monate Kinder wie dich aufnimmt. Es besteht außerdem die Chance, dass du adoptiert wirst, also dass sich ein Ehepaar dauerhaft um dich kümmert, als wären es deine richtigen Eltern.«
»Und wie lange dauert das alles?«, wollte James wissen.
»Mindestens einige Monate. Im Augenblick haben wir nicht genug Pflegefamilien. – Vielleicht solltest du noch etwas Zeit mit deiner Schwester verbringen, bevor Ron kommt.«
James ging in sein Zimmer zurück. Sanft weckte er Lauren, die nur langsam zu sich kam, sich aufsetzte und sich den Schlaf aus den Augen rieb.
»Was ist das hier?«, fragte sie. »Ein Krankenhaus?«
»Kinderheim.«
»Mein Kopf tut weh«, beklagte sie sich lahm. »Ich fühl mich ganz wackelig.«
»Erinnerst du dich an letzte Nacht?«
»Ich erinnere mich daran, dass du mir gesagt hast, Mum wäre tot, und dass wir auf den Krankenwagen gewartet haben. Ich muss eingeschlafen sein.«
»Sie haben dir eine Spritze gegeben, um dich ruhig zu stellen. Die Krankenschwester sagte schon, dass du dich komisch fühlen würdest, wenn du aufwachst.«
»Bleiben wir hier?«
»Ron kommt später, um dich abzuholen.«
»Nur mich?«
»Ja.«
»Ich glaub, ich muss kotzen«, sagte Lauren.
Sie hielt die Hand vor den Mund. James sprang zurück, da er nicht angespuckt werden wollte. »Da drüben ist das Klo.«
Lauren schoss ins Badezimmer. James hörte sie würgen. Sie hustete und betätigte dann die Toilettenspülung. Eine Weile war es ruhig. Schließlich klopfte James.
»Bist du O.K.? Kann ich reinkommen?«
Da Lauren nicht antwortete, steckte James den Kopf zur Tür hinein. Lauren weinte.
»Und wie soll ein Leben mit diesem Kerl aussehen?«, schluchzte sie.
James schlang die Arme um seine Schwester. Ihr Atem roch nach Erbrochenem, aber das kümmerte ihn nicht. Lauren war immer einfach da gewesen. Er hatte nie gewusst, wie sehr er sie vermissen würde, wenn sie weg wäre.
Lauren beruhigte sich etwas und duschte. Sie hatte keine Lust auf Frühstück, daher setzten sie sich in den Spielraum. Die anderen Kinder waren in der Schule.
Die Zeit, bis Onkel Ron kam, war schmerzlich. James wollte irgendetwas sagen, um sie aufzumuntern und die Dinge richtig erscheinen zu lassen. Lauren sah zu Boden und schlug die Hacken ihrer Reeboks ans Stuhlbein.
Ron brachte Eis mit. Lauren wollte keins, nahm es aber schließlich doch, da sie keine Lust zum Diskutieren hatte. Vor Ron wollte James nicht weinen, und Lauren hatte einen Kloß im Hals, sodass sie nicht reden konnte.
»Wenn du Lauren sehen willst, hier ist die Nummer«, sagte Ron und gab James einen Zettel.
»Ich lasse die Wohnung räumen«, fuhr er fort. »Ich habe mit der Sozialarbeiterin draußen gesprochen. Sie gehen später mit dir hin. Alles, was am Freitag noch von dir rumliegt, wandert in den Müll.«
James konnte es nicht fassen, dass Ron sich an einem Tag wie diesem absichtlich so eklig benahm.
»Du hast sie umgebracht«, warf James ihm vor. »Du hast den ganzen Alkohol in unsere Wohnung gebracht.«
»Ich habe sie nicht gezwungen zu trinken«, sagte Ron. »Und mach dir ja keine Hoffnungen, Lauren allzu häufig zu sehen.«
James war kurz davor zu explodieren. »Wenn ich groß genug bin, bringe ich dich um«, drohte er. »Das schwöre ich bei Gott.«
5.
James ordnete die Billardkugeln und stieß die weiße Kugel in die Mitte. Es war egal, wohin sie flogen, er brauchte lediglich eine Ablenkung von den grauenvollen Dingen, die ihm durch den Kopf gingen. Er hatte stundenlang gespielt, als ein segelohriger Typ um die Zwanzig eintrat und sich vorstellte: »Kevin McHugh. Mädchen für alles, früherer Insasse.« Er lachte. »Ich meine natürlich Bewohner.«
»Hi«, sagte James. Er war nicht zu Scherzen aufgelegt.
»Lass uns deine Sachen holen.«
Sie gingen zu einem Minibus.
»Ich habe von deiner Mutter gehört, James. Das ist hart.« Kevin verdrehte den Hals, als er versuchte, eine Lücke im fließenden Verkehr zu finden.
»Danke, Kevin. Du hast früher hier gewohnt?«
»Drei Jahre. Mein Vater wurde wegen bewaffneten Raubüberfalls eingebuchtet und meine Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich kam mit dem Personal hier ganz gut aus, daher bekam ich diesen Job, als ich siebzehn wurde.«
»Ist es O.K. hier?«, fragte James.
»Ist kein schlechter Ort. Aber du solltest auf deine Sachen aufpassen, es wird viel gestohlen. Kauf dir bei der ersten Gelegenheit ein gutes Vorhängeschloss für deinen Schrank. Und schlaf mit dem Schlüssel um den Hals. Nimm ihn nicht mal zum Duschen ab. Wenn du Bargeld hast, kaufen wir dir auf dem Rückweg ein Schloss.«
»Ist es hart?«
»Du schaffst das schon. Du siehst aus, als könntest du dich wehren. Wie überall gibt es auch hier ein paar Härtefälle. Leg dich einfach nicht mit ihnen an.«
In der Wohnung herrschte Chaos. Eine Menge wertvoller Sachen, wie der Fernseher, das Videogerät und die Stereoanlage, waren verschwunden. Das Telefon aus dem Flur und die Mikrowelle in der Küche waren ebenfalls weg.
»Was ist denn hier passiert?«, wunderte sich Kevin. »Sah das gestern Abend auch schon so aus?«
»Ich hab das fast erwartet«, meinte James. »Ron war hier und hat ausgeräumt. Ich hoffe, er hat meinen Kram dagelassen.«
Er lief nach oben in sein Zimmer. Sein Fernseher, sein Videorekorder und der Computer waren weg.
»Ich stech ihn ab!«, schrie er und trat gegen die Schranktür. Zumindest hatte Ron die PlayStation 2 und das meiste andere Zeug stehen lassen.
»Das wirst du nicht alles mitnehmen können«, meinte Kevin mit einem Blick auf die vielen Sachen. »Deine Mutter muss es recht dicke gehabt haben.«
»Wir nehmen besser so viel wie möglich. Ron sagt, am Freitag wird das Haus geräumt.«
Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er bat Kevin, anzufangen, seine Kleider in Müllsäcke zu packen, und ging ins Zimmer seiner Mutter. Ron hatte den tragbaren Fernseher und die Schmuckschachtel mitgenommen, aber das war nicht weiter schlimm, da er die wertvollen Schmuckstücke bereits vor Jahren gestohlen hatte.
James öffnete den Schrank seiner Mutter und sah sich den Safe an. Darin waren tausende von Pfund. Gwen Choke war eine Kriminelle und konnte ihr Geld nicht auf die Bank bringen, ohne dass sich jemand fragte, woher es kam. Dem Werkzeug auf dem Teppich und den Kratzern an der Safetür nach zu schließen, hatte Ron einen ziemlich erfolglosen Versuch unternommen, die Tür aufzubrechen. Er würde bald mit besserem Werkzeug wiederkommen.
James war klar, dass er den Safe niemals würde aufbrechen können. Als er geliefert wurde, mussten ihn drei Mann die Treppe hinauftragen. Es gab keinen Schlüssel, man stellte eine Zahlenkombination an dem dicken Knopf an der Tür ein. James’ einziger Hinweis war, dass er einmal seine Mutter dabei überrascht hatte, wie sie den Safe öffnete. Dabei hielt sie ein Buch von Danielle Steel in der Hand. Es war einleuchtend, dass sie die Kombination in einem Buch verstecken würde, das er und Ron nicht einmal mit einer Kneifzange anfassen würden. Aber was, wenn sie die Kombination später geändert hatte? Doch es war für James die einzige Chance, Ron das Geld wegzuschnappen. Er musste es wenigstens versuchen. Auf einem Regal über Gwens Bett standen einige Romane. James fand den Band von Danielle Steel und blätterte die Seiten durch.
»Alles in Ordnung, James?«, rief Kevin vom anderen Zimmer aus.
James war so angespannt, dass er fast einen Meter in die Höhe sprang und das Buch fallen ließ.
»Alles klar«, rief er.
Er hob das offene Buch auf. Am Rand der Seite vor ihm standen einige Zahlen. Das Buch musste hunderte von Malen an derselben Stelle geöffnet worden sein, sodass es nun von selbst an dieser Stelle aufschlug, als er es losließ. Zum ersten Mal seit Tagen glaubte James, das Glück auf seiner Seite zu haben. Er schlitterte über den Teppich und wählte die Nummern: 262, 118, 320, 145, 007. Er fasste den Griff an. Nichts geschah. Es funktionierte nicht. Der Gedanke, dass Onkel Ron das Geld bekommen würde, schnürte ihm fast die Luft ab.
Dann bemerkte er einen Aufkleber unter dem Zahlenknopf, auf dem die Funktion des Safes beschrieben wurde. Er las die erste Anweisung:
(1) Stellen Sie die erste Zahl der Kombination ein, indem Sie die Zahlenscheibe gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Es war James nicht klar gewesen, dass die Richtung, in die man den Knopf drehte, eine Rolle spielte. Er stellte die erste Zahl ein und las weiter:
(2) Stellen Sie die nächsten vier Zahlen ein, indem Sie die Zahlenscheibe wie folgt drehen: im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn. Andernfalls wird der Mechanismus nicht funktionieren.
Er stellte die nächsten drei Zahlen ein.
»Was machst du denn da?«, fragte Kevin.
James fuhr hoch. Kevin stand in der Tür, aber glücklicherweise versperrte ihm die offene Schranktür den Blick auf den Safe. Kevin schien nett zu sein, doch James war sicher, dass jeder Erwachsene, der von dem Safe erfuhr, ihn zwingen würde, den Inhalt entweder der Polizei oder Onkel Ron zu übergeben.
»Ich such was«, sagte James, überzeugt, dass er verdächtig klang.
»Komm und hilf mir packen! Ich weiß ja nicht, was du mitnehmen willst.«
»Ich komme in einer Minute«, versicherte James. »Ich suche nur ein paar Fotoalben.«
»Soll ich dir suchen helfen?«
»Nein«, lehnte James ab, wobei sich seine Stimme fast überschlug.
»Wir haben noch fünfzehn Minuten«, sagte Kevin. »Ich muss in einer Stunde zur Schule fahren.«
Endlich ging Kevin ins andere Zimmer zurück. James stellte die letzte Zahl ein, woraufhin der Safe ein befriedigendes Klicken von sich gab. Bevor er den Griff aufzog, las er die dritte Anweisung und musste lächeln:
(3) Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Aufkleber entfernen, sobald Sie mit dem Safe umgehen können.
James zog die schwere Tür auf. Da das Metallgehäuse so dick war, war das Innere des Safes relativ klein. Vier große Stapel Bargeld und ein kleiner Umschlag lagen darin. James nahm eine Mülltüte und warf das Geld hinein. Den Umschlag schob er in die Tasche.
James stellte sich Rons Gesicht vor, wenn er kam und den offenen Safe sah. Dann fiel ihm noch etwas Besseres ein. Er zog den Aufkleber mit den Anweisungen ab und legte ihn zusammen mit dem Danielle-Steel-Buch in den Safe. Zur Krönung, um Ron so richtig wild zu machen, nahm er ein gerahmtes Bild von sich vom Nachttisch seiner Mutter und stellte es im Safe auf, sodass es das Erste war, was Ron sehen würde, wenn er es schaffte, ihn zu öffnen. James schlug die Tür zu, verdrehte die Zahlenscheibe und legte das Werkzeug wieder genauso hin, wie Ron es liegen gelassen hatte.
Als er mit dem Bargeld wieder in sein Zimmer ging, fühlte James sich etwas besser. Der Raum sah kahl aus. Kevin hatte alle Kleidung und das Bettzeug eingepackt, das normalerweise über den Boden verteilt herumlag.
»Ich habe die Fotoalben gefunden«, sagte James.
»Gut. Aber ich fürchte, du wirst einige Opfer bringen müssen, James. In Nebraska House hast du nur einen Schrank, eine Kommode und ein Schließfach.«
James begann, die Spielsachen und den Müll auf dem Boden zu durchsuchen. Es überraschte ihn, wie wenig er an dem meisten Kram hing. Er wollte nur seine PlayStation 2, das Handy und den tragbaren CD-Spieler, sonst nichts. Alles andere waren Spielsachen und Zeug, für das er mittlerweile zu alt war. Ärgerlich war nur, dass Ron seinen Fernseher mitgenommen hatte, sodass James nicht mit der PlayStation spielen konnte.
Kevin bückte sich und betrachtete ein Sega Dreamcast und einen Nintendo Gamecube.
»Willst du die nicht haben?«, fragte er.
»Ich brauche nur die PlayStation 2«, klärte James ihn auf. »Du kannst sie haben, wenn du willst.«
»Ich darf von Heimbewohnern keine Geschenke annehmen.«
James trat die Konsolen in die Mitte des Zimmers. »Ich will nicht, dass mein Stiefvater Geld dafür bekommt, wenn er sie verkauft. Ich nehme sie nicht mit. Wenn du sie nicht nimmst, mache ich sie kaputt.«