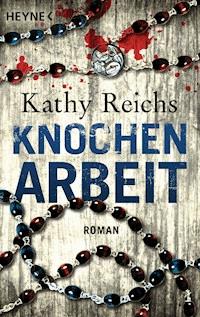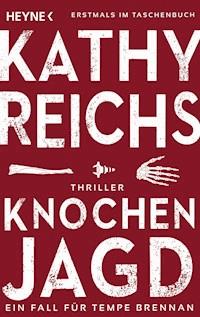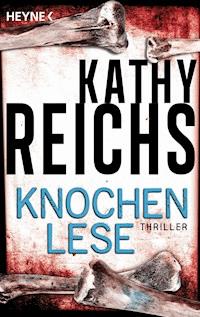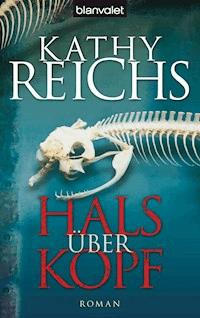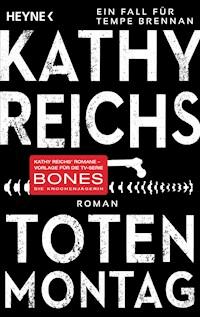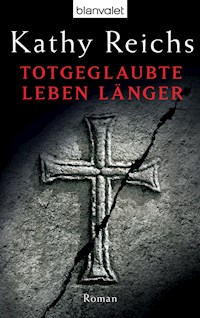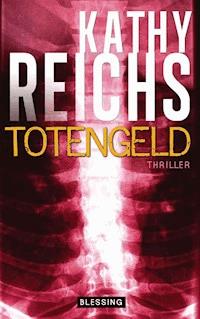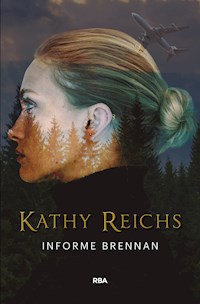8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Knochenjob für die bekannteste Forensikerin der Welt
Tempe Brennan ist forensische Anthropologin in Montreal. Skelette und verweste Körperteile gehören zu ihrem Alltag. Als die 23-jährige Isabelle missbraucht, erdrosselt und zerstückelt in Müllsäcken aufgefunden wird, erinnert sich Tempe an einen Fall ein Jahr zuvor. Sie versucht, die beiden Verbrechen mit drei weiteren Leichen in Verbindung zu bringen. Doch Detective Luc Claudel nimmt sie nicht ernst. Sie recherchiert auf eigene Faust und lenkt so die Wut des Serienkillers zunächst auf ihre Freundin Gabby, dann auf ihre Tochter Katy und schließlich auf sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch Als die Polizei Tempe Brennan an einem sonnigen Junitag um ihre Hilfe bittet, passt ihr das zunächst gar nicht. Doch was die Spezialistin für Skelette, Wasserleichen und verweste Körperteile auf einem alten Friedhof vorfindet, fesselt sofort ihre ganze Aufmerksamkeit. Die verstümmelte Leiche erinnert sie an eine grausam zugerichtete junge Frau, die sie ein Jahr zuvor untersucht hatte. Quälende Bilder drängen sich ihr auf. Bald werden weitere Opfer gefunden, die auf dieselbe Art getötet wurden. Tempe ist sich sicher, dass ein psychopathischer Serienmörder am Werk ist und stellt unbequeme Fragen. Durch ihre Beharrlichkeit gerät sie ins Visier des Täters ... Die Autorin Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie ist Professorin für Soziologie und Anthropologie, eine von nur knapp hundert vom American Board of Forensics Anthropology zertifizierte forensischen Anthropolog:innen und unter anderem für gerichtsmedizinische Institute in Quebec und North Carolina tätig. Ihre Romane erreichen regelmäßig Spitzenplätze auf internationalen und deutschen Bestsellerlisten und wurden in dreißig Sprachen übersetzt. Für den ersten Band ihrer Tempe-Brennan-Reihe wurde sie 1998 mit dem Arthur Ellis Award ausgezeichnet. Die darauf basierende Serie "BONES - Die Knochenjägerin" wurde von Reichs mitkreiert und -produziert.
Kathy Reichs
Tote lügen nicht
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Thomas A. Merk
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe Déja Dead erschien bei Scribner, New York.
Copyright © 1997 by Kathleen C. Reichs
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1998 Karl Blessing Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © 2011 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur München – Zürich Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-10665-2 V005
www.heyne.de
Für Karl und Marta Reichs, die liebenswürdigsten und großzügigsten Menschen, die ich kenne. Paldies par jûsu mîlestîbu, Vecamâmma un Paps.
Karlis Reichs 1914–1996
1
Ich dachte nicht mehr an den Mann, der sich in die Luft gesprengt hatte. Jetzt ging es nur darum, seinen Schädel zusammenzusetzen. Zwei größere Bruchstücke lagen vor mir auf dem Tisch, und ein drittes, das ich soeben aus mehreren Splittern zusammengeklebt hatte, stand zum Trocknen in einer mit Sand gefüllten Edelstahlschale. Damit hatte ich genügend Teile, um die Identität des Toten zu bestätigen. Der Leichenbeschauer würde zufrieden sein.
Es war der Spätnachmittag des 2. Juni 1994. Ein Donnerstag. Während ich darauf wartete, dass der Klebstoff fest wurde, ließ ich meinen Gedanken freien Lauf. Damals wusste ich noch nicht, dass es in ein paar Minuten an meiner Tür klopfen und sich mein Leben ebenso entscheidend verändern würde wie mein Wissen um die Abgründe menschlicher Grausamkeit. Ahnungslos genoss ich den herrlichen Ausblick auf den St.-Lawrence-Strom, der das einzig Erfreuliche an meinem viel zu kleinen und viel zu vollgestopften Büro ist. Irgendwie hat der Anblick von gleichmäßig fließendem Wasser immer eine belebende Wirkung auf mich. Mit stehenden Gewässern kann ich hingegen sehr viel weniger anfangen. Warum, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass Sigmund Freud dafür eine plausible Erklärung gehabt hätte.
Gedanklich war ich mit dem kommenden Wochenende beschäftigt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nach Quebec City zu fahren, aber ich hatte noch keine konkreten Pläne. Nur dass ich mir ein richtig touristisches Ziel suchen wollte, zum Beispiel die Plains of Abraham, wo ich Crêpes und Muscheln essen und mir billigen Schmuck von den Straßenhändlern kaufen wollte. Obwohl ich schon seit einem Jahr hier in Montreal als forensische Anthropologin arbeitete, war ich noch nie in Quebec City gewesen. Es wurde höchste Zeit, mir die Stadt einmal anzusehen. Außerdem sehnte ich mich danach, ein paar Tage lang keine Skelette, verwesten Körperteile oder Wasserleichen sehen zu müssen.
Ich bin ein Mensch, dem es eigentlich nie an Ideen mangelt, nur mit der Umsetzung hapert es oft. Normalerweise halte ich mir bei allen meinen Plänen ein Hintertürchen offen, so dass ich es mir jederzeit wieder anders überlegen kann. Dieser Wankelmut trifft allerdings nur auf mein Privatleben zu. Beruflich neige ich eher zu zielstrebiger Besessenheit.
Noch bevor er klopfen konnte, wusste ich, dass Pierre LaManche vor der halbgeöffneten Tür meines Büros stand. Für einen Mann von seiner Statur bewegte er sich erstaunlich leise, aber der Geruch nach kaltem Pfeifenrauch verriet ihn. LaManche, der seit fast zwei Jahrzehnten der Leiter des Laboratoire de Médecine Légale war, kam nie ohne einen triftigen Grund zu mir ins Büro. Deshalb schwante mir Böses, als er durch ein leises Klopfen auf sich aufmerksam machte.
»Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich, Temperance?« , fragte LaManche, der mich als Einziger mit meinem vollen Vornamen anspricht. Alle anderen nennen mich Tempe. Vielleicht hat LaManche was gegen Tempe in Arizona, vielleicht nennt er mich aber auch nur deshalb Temperance, weil es sich so schön auf France reimt.
»Oui.« Nachdem ich fast ein Jahr hier in Montreal war, antwortete ich ganz automatisch auf Französisch. Anfangs hatte ich mit dem Français Québecois meine liebe Mühe gehabt, aber langsam fand ich mich immer besser damit zurecht.
»Ich habe gerade einen Anruf bekommen«, sagte LaManche und neigte den Kopf nach unten, um von einem rosafarbenen Notizblock etwas abzulesen. Immer wenn ich sein Gesicht mit den senkrechten Falten auf Stirn und Wangen, der kerzengeraden Nase und den länglichen Ohren sah, musste ich unwillkürlich an einen Bassett denken. Sein Gesicht hatte vermutlich schon in der Jugend älter gewirkt, als es war, und seine charakteristischen Züge hatten sich im Lauf der Jahre lediglich vertieft. Selbst heute war es nicht leicht, LaManches wirkliches Alter zu schätzen.
»Zwei Arbeiter von den Elektrizitätswerken haben heute ein paar Knochen gefunden«, meinte LaManche und warf einen kurzen Blick auf mein nicht allzu glückliches Gesicht, bevor er sich wieder dem Block in seiner Hand zuwandte.
»Die Fundstelle liegt nicht weit von dem alten Friedhof entfernt, der im vergangenen Sommer entdeckt wurde«, sagte er in makellosem, aber etwas steif klingendem Französisch. Ich habe nie gehört, dass er eine umgangssprachliche Wendung verwendet hätte, geschweige denn Dialekt oder gar Polizeijargon. »Sie waren doch damals bei der Ausgrabung dabei. Vielleicht handelt es sich ja bei den jetzt gefundenen Knochen um etwas Ähnliches. Auf jeden Fall brauche ich jemanden, der sich an Ort und Stelle davon überzeugt, dass es sich dabei nicht um einen Fall für den Leichenbeschauer handelt.«
Als er von seiner Notiz aufsah, fiel ihm das Nachmittagslicht schräg ins Gesicht und ließ dessen Falten noch tiefer erscheinen. Als LaManche zu einem säuerlichen Lächeln ansetzte, verschoben sich vier von diesen dunklen Schluchten ein wenig nach oben.
»Sie glauben also, dass es wieder ein alter Friedhof ist?«, fragte ich, um ihn hinzuhalten. Ein Leichenfund passte überhaupt nicht in meine Vorbereitungen fürs Wochenende. Wenn ich wirklich am Freitag wegfahren wollte, dann musste ich heute meine Sachen aus der Reinigung holen, ein paar Dinge aus der Apotheke besorgen, den Koffer packen, bei meinem Wagen den Ölstand überprüfen und Winston, dem Hausmeister, erklären, wann er meine Katze füttern sollte.
LaManche nickte.
»Okay«, sagte ich, obwohl ich die Sache ganz und gar nicht okay fand.
LaManche gab mir den Notizzettel. »Brauchen Sie einen Streifenwagen, der Sie hinbringt?«
»Nein, nicht nötig«, sagte ich mit betont niedergeschlagener Stimme. »Ich bin heute mit dem Wagen da.« Der Friedhof lag ohnehin auf meinem Nachhauseweg.
Pierre LaManche entfernte sich so leise, wie er gekommen war. Er trug gerne Schuhe mit Kreppsohlen und achtete darauf, dass er nichts in den Hosentaschen hatte, was klappern oder klirren konnte. Er bewegte sich nahezu lautlos, wie ein durchs Wasser gleitendes Krokodil, was viele seiner Untergebenen als ausgesprochen nervtötend empfanden.
Ich stopfte einen Overall und meine Gummistiefel in einen Rucksack, hoffte dabei aber insgeheim, dass ich beides nicht brauchen würde. Dann nahm ich den Laptop, meine Aktentasche und den bestickten Feldflaschenbezug, der mir in diesem Sommer als Handtasche diente und machte mich auf den Weg. Bis Montag, dachte ich, als ich mein Büro verließ, aber irgendetwas in meinem Hinterkopf sagte mir, dass das nur ein frommer Wunsch war.
Im Sommer erinnert mich Montreal immer an eine Rumbatänzerin in buntem Rüschenkleid, die mit nackten Schenkeln und schweißnasser Haut von Juni bis September durchtanzt.
Nach den langen und harten Wintern wird hier die heiß ersehnte warme Jahreszeit gefeiert: Straßencafés haben Hochkonjunktur, Fahrradfahrer und Rollerblader machen sich den Platz auf den Radwegen streitig, und auf den Gehsteigen wimmelt es von Menschen, die von einem Straßenfest zum nächsten zu ziehen scheinen.
Wie sehr unterscheiden sich die Sommer an den Ufern des St.-Lawrence-Stroms doch von denen in meiner Heimat North Carolina, wo man sich vorzugsweise am Strand, in den Bergen oder auf der eigenen Terrasse in der Sonne räkelt. In den Südstaaten ist es schwierig, ohne einen Blick auf den Kalender eine genaue Grenze zwischen Frühling, Sommer und Herbst zu ziehen, deshalb hat mich in meinem ersten Jahr hier oben im Norden das ungestüme Frühlingserwachen noch mehr überrascht als der bitterkalte Winter. Mit einem Schlag hat es das Heimweh vertrieben, unter dem ich während der langen Kälte und Dunkelheit oft litt.
Diese Gedanken beschäftigten mich, als ich unter der Jacques-Cartier-Brücke hindurchfuhr und nach Westen auf die Viger Avenue abbog. Links von mir lag am Ufer des Flusses das weitläufige Gelände der Molson-Brauerei, hinter dem sich das runde Hochhaus von Radio Canada erhob. Im Vorbeifahren musste ich an all die Leute denken, die in diesem Büroturm eingeschlossen waren wie Affen im Käfig. Ich stellte mir vor, wie sie hinter ihren Fenstern saßen und sehnsüchtig hinaus in die verlockende Junisonne starrten, wie sie an ihre Boote, Fahrräder oder Turnschuhe dachten und dabei immer wieder auf die Uhr sahen.
Ich fuhr die Fenster meines Wagens nach unten und schaltete das Radio ein.
»Aujourd’hui je vois la vie avec les yeux du coeur«, sang Gary Boulet. Ich übersetzte die Worte automatisch und sah dabei den empfindsamen Mann mit dem wilden Lockenkopf und den dunklen Augen vor mir. Er hatte so leidenschaftliche Musik gemacht und war mit vierundvierzig Jahren viel zu früh verstorben.
Ein alter Friedhof, dachte ich. Damit hatten wir forensischen Pathologen es immer wieder zu tun. Hunde, Bauarbeiter, Totengräber oder das Hochwasser legten ständig irgendwelche alten Knochen frei. Wenn es menschliche Knochen sind, interessiert sich dafür zunächst der Leichenbeschauer, der eine Art Oberaufseher über den Tod in der Provinz Quebec darstellt. Wenn jemand nicht in seinem Bett oder unter der Aufsicht eines Arztes stirbt, will der Leichenbeschauer wissen warum. Er interessiert sich für alle, die gewaltsam oder unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind oder deren ansteckende Krankheit eine Gefahr für andere darstellen könnte. Knochen aus historischen Friedhöfen hingegen gehen ihn selbst dann nichts an, wenn die Toten dort einem ungesühnten Verbrechen oder einer schrecklichen Seuche zum Opfer gefallen sind. Dafür ist ihr Ableben zu lange her. Ist das Alter solcher Knochen erst einmal zweifelsfrei bestimmt, dürfen sich die Archäologen darum kümmern. Ich hoffte inständig, dass das auch bei den Gebeinen der Fall sein würde, zu denen ich jetzt unterwegs war.
Ich quälte mich durch den zähfließenden Verkehr in der Innenstadt und erreichte fünfzehn Minuten später die Adresse, die auf LaManches Zettel stand. Es war das Grand Séminaire, ein Überbleibsel des riesigen Grundbesitzes der katholischen Kirche. Das alte Priesterseminar befindet sich auf einem großen Grundstück in der Innenstadt, ganz in der Nähe des Viertels, in dem ich wohne. Es ist eine kleine grüne Insel in einem Meer aus Wolkenkratzern und gleichzeitig ein stummer Zeuge dafür, wie mächtig die Kirche einst in dieser Stadt war. Graue Steinmauern mit Wachtürmen umgeben düstere, burgartige Gebäude, zwischen denen sich gepflegte Rasenstücke und verwilderte Freiflächen erstrecken.
Als die Kirche auf dem Höhepunkt ihrer Macht stand, wurden hier Tausende junger Männer zu Priestern ausgebildet. Ein paar Seminaristen gibt es hier auch heute noch, aber es sind längst nicht mehr so viele wie damals. Die größeren Gebäude sind jetzt vermietet und beherbergen Behörden und städtische Schulen, in denen mehr im Internet gesurft als das Wort Gottes studiert wird.
Vielleicht ist das ja eine gute Metapher für den Zustand unserer modernen Gesellschaft, dachte ich. Wir sind alle viel zu sehr damit beschäftigt, mit aller Welt zu kommunizieren, um uns um einen allmächtigen Schöpfer zu kümmern.
Ich hielt in einer kleinen Straße gegenüber dem alten Priesterseminar und blickte die Rue Sherbrooke entlang nach Osten, wo sich der jetzt an das Collège de Montréal vermietete Teil des Seminargeländes befindet. Als dort nichts Ungewöhnliches zu erkennen war, ließ ich den linken Ellenbogen aus dem Wagenfenster hängen und drehte mich nach hinten. Das staubige Metall der Wagentür war so heiß, dass ich den Arm blitzartig zurück ins Innere des Wagens zog.
Als ich schließlich aus dem Rückfenster blickte, entdeckte ich einen blau-weißen Streifenwagen mit der Aufschrift Police – Comunauté Urbaine de Montréal, der irgendwie nicht so recht zu dem alten, steinernen Turm dahinter passen wollte. Davor stand ein grauer Lastwagen der Hydro-Québec, von dem Leitern und anderes Gerät abstanden wie die Antennen einer Raumstation. Neben dem Laster stand ein uniformierter Polizist, der mit zwei Männern in Arbeitskleidung sprach.
Ich fuhr wieder los, bog nach links ab und fädelte mich in den nach Westen strömenden Verkehr auf der Rue Sherbrooke ein. Während ich einmal um das Seminargelände herumfuhr, hielt ich Ausschau nach Presseleuten, konnte aber zum Glück keine entdecken. Begegnungen mit der Presse sind in Montreal noch anstrengender als in anderen Städten, denn hier gibt es sowohl französische als auch englische Sender und Zeitungen. Ich hasse es ohnehin, mit Fragen bedrängt zu werden, wenn ich sie dann aber auch noch in zwei Sprachen beantworten muss, platzt mir ziemlich rasch der Kragen.
LaManche hatte Recht gehabt. Ich war im vergangenen Sommer schon einmal hier gewesen, als man bei der Reparatur einer defekten Wasserleitung auf Knochen gestoßen war. Ich weiß noch, was ich damals in meinen Bericht geschrieben hatte: Kirchengrundstück, alter Friedhof, Sargreste, Archäologen verständigt. Hoffentlich würde ich bald Ähnliches notieren können.
Als ich meinen Mazda vor dem Lastwagen abstellte, hörten die drei Männer zu reden auf und blickten in meine Richtung. Dann stieg ich aus, und der Polizist, der mich einen Augenblick lang nachdenklich angesehen hatte, kam auf mich zu. Sein Gesicht war nicht gerade freundlich. Es war Viertel nach vier, und seine Schicht war vermutlich schon längst zu Ende. Wahrscheinlich war er ebenso ungern hier wie ich.
»Bitte fahren Sie weiter, Madam. Sie dürfen hier nicht parken«, rief er mir zu und wedelte ungeduldig mit der Hand. Es sah aus, als wollte er eine Fliege vom Salat wegscheuchen.
»Ich bin Dr. Brennan«, sagte ich, während ich die Autotür zuschlug. »Vom Laboratoire de Médecine Légale.«
»Wie bitte? Sie wollen vom Leichenbeschauer kommen?« Sein Ton hätte einen Verhörspezialisten vom KGB geradezu vertrauensselig klingen lassen.
»Ja. Ich bin die antropologiste judiciaire«, erklärte ich langsam wie eine Lehrerin in der zweiten Klasse Volksschule. »Zuständig für Ausbettungen und Knochenbefunde. Und wenn ich mich nicht irre, dürfte es sich hier wohl um beides handeln.«
Ich gab dem Polizisten meinen Ausweis und las auf dem Namensschild über seiner Brusttasche: Constable Groulx.
Der Polizist besah sich das Foto in meinem Ausweis. Dann fiel sein prüfender Blick auf mich. Ich wirkte wohl wenig vertrauenserweckend. Weil ich wusste, dass das Zusammensetzen des Schädels Spuren hinterlassen würde, hatte ich mir meine ältesten Klamotten angezogen: eine ausgewaschene braune Hose und ein Jeanshemd, dessen Ärmel ich hochgekrempelt hatte. Meine nackten Füße steckten in Segelschuhen, und aus meinen hochgesteckten Haaren hatten sich im Laufe des Tages ein paar Strähnen gelöst. Zudem war ich mit getrockneten Klebstoffresten übersät. Ich musste aussehen wie eine gestresste Hausfrau in mittleren Jahren, die gerade eine Pause beim Tapezieren ihrer Wohnung macht, um ihr Kind von der Schule abzuholen.
Nachdem der Polizist meinen Ausweis lange angesehen hatte, gab er ihn mir kommentarlos zurück. Eine forensische Anthropologin hatte er sich wohl anders vorgestellt.
»Haben Sie die Knochen schon gesehen?«, fragte ich.
»Nein, ich sichere nur den Fundort.« Mit einer ähnlichen Wedelgeste wie vorhin deutete er auf die beiden Arbeiter, die ihre Unterhaltung eingestellt hatten und uns interessiert beobachteten.
»Die da haben die Knochen gefunden. Ich habe die Zentrale verständigt. Die bringen Sie hin.«
Ich fragte mich, ob Constable Groulx wohl auch in der Lage war, kompliziertere Sätze zu bilden. Noch einmal deutete er hinüber zu den Arbeitern.
»Ich passe auf Ihren Wagen auf.«
Ich dankte ihm mit einem Nicken, aber er hatte sich bereits von mir abgewandt. Also ging ich hinüber zu den Arbeitern, die mich stumm ansahen. Beide Männer hatten fast identische Schnurrbärte, die sich wie umgedrehte Us über ihren Mündern nach unten bogen.
Der Linke war schmächtig, dunkelhaarig und erinnerte mich an einen Terrier. Er war älter als sein Kollege, und sein Blick wanderte rastlos umher. Auch mich sah er nur ganz kurz an und wandte sich schnell wieder ab, als könnte er sich durch längeren Augenkontakt mit einem anderen Menschen auf etwas einlassen, was er später bereuen würde. Er trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und zog alle paar Sekunden die Schultern ein.
Sein Kollege kam mir weitaus ruhiger vor. Er war einen Kopf größer, hatte ein wettergegerbtes Gesicht und lange, zu einem dünnen Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Als ich näher kam, grinste er mich an und zeigte dabei eine Zahnlücke. Irgendwie hatte ich sofort den Eindruck, dass er der Gesprächigere von beiden war.
»Bonjour. Comment ça va?«, fragte ich.
»Bien«, sagten beide fast gleichzeitig und nickten. Gut.
Ich zeigte ihnen meinen Ausweis und fragte, ob sie die Knochen gefunden hätten. Wieder nickten sie.
»Wie kam es dazu?«, fragte ich und zog ein kleines, spiralgebundenes Notizbuch aus meinem Rucksack. Ich klappte es auf, drückte die Mine aus meinem Kugelschreiber und lächelte die beiden aufmunternd an.
Der Mann mit dem Pferdeschwanz schien nur darauf gewartet zu haben, endlich sprechen zu dürfen. Die Worte strömten nur so aus seinem Mund. Für ihn schien die Sache ein richtiges Abenteuer zu sein. Ich musste schon genau hinhören, um sein Französisch zu verstehen, denn er ließ die Worte ineinanderfließen und verschluckte die Endungen, wie es weiter oben am St.-Lawrence-Strom üblich ist.
»Wir haben das Unterholz ausgelichtet. Das gehört zu unserem Job«, sagte er und deutete hinauf zu den Hochspannungsmasten. »Unter der Leitung dürfen keine Bäume wachsen.«
Ich nickte.
»Als ich zu der Senke da drüben kam …«, fuhr er fort und deutete auf ein Gehölz, das quer über das Grundstück lief, »… stieg mir ein komischer Geruch in die Nase.« Er hielt inne und blickte hinüber zu den Bäumen.
»Was verstehen Sie unter komisch?«
Er drehte sich wieder zu mir. »Na ja, vielleicht nicht direkt komisch«, meinte er und biss sich auf die Unterlippe, während er seinen Wortschatz nach dem richtigen Ausdruck durchforstete. »Eher tot«, sagte er schließlich. »Wissen Sie, wie etwas Totes riecht?«
Ich sagte nichts und wartete darauf, dass er weitersprach.
»Kennen Sie das, wenn sich Tiere irgendwohin verkriechen, um zu sterben?« Während er das sagte, zuckte er ganz leicht mit der Schulter und sah mich an, um von mir eine Bestätigung zu erhalten. Ich wusste genau, wovon er sprach. In meinem Job bin ich mit dem Geruch des Todes sozusagen per Du. Ich nickte.
»Ich dachte, dass vielleicht irgendwo in der Senke ein toter Hund oder Waschbär herumliegt, und stocherte mit dem Rechen ein bisschen im Laub herum. Auf einmal wurde der Geruch wirklich penetrant. Und dann sah ich, dass da ein paar Knochen waren.«
Schulterzucken.
»Verstehe«, sagte ich und verspürte ein mulmiges Gefühl in der Magengrube. Alte Gräber stinken nicht.
»Ich rief nach Gil …«, sagte der Arbeiter und blickte hinüber zu seinem Kollegen, der aber nur auf seine Fußspitzen starrte, »… und dann schaufelten wir zusammen Laub weg. Und was da zum Vorschein kam, sah nicht gerade wie ein Hund oder ein Waschbär aus.« Bei diesen Worten verschränkte der Arbeiter die Arme vor der Brust, senkte das Kinn und wippte auf seinen Fersen vor und zurück.
»Inwiefern?«
»Zu groß«, antwortete er und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Die Zungenspitze sah aus wie ein Regenwurm, der gerade aus der Erde kriecht.
»Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen?«
»Wie meinen Sie das?«
»Haben Sie vielleicht noch etwas anderes außer den Knochen gefunden?«
»Ja. Und genau das ist ja das Merkwürdige.« Er breitete die Arme aus, um die Abmessungen des Fundes zu zeigen. »So einen großen Plastiksack, in dem das Zeug drinsteckte, und …« Er zuckte wieder mit den Schultern und verstummte mitten im Satz.
»Was und?«, fragte ich. Mein mulmiges Gefühl verstärkte sich.
»Une ventouse«, sagte er rasch und klang dabei peinlich berührt und aufgeregt zugleich. Gil schien ebenso perplex zu sein wie ich, denn jetzt flog sein Blick rasend schnell zwischen seinem Kollegen und mir hin und her.
»Wie bitte?«, fragte ich für den Fall, dass ich mich verhört haben sollte.
»Une ventouse. So ein Gummisauger, wie man ihn verwendet, wenn das Waschbecken verstopft ist.« Er umfasste mit seinen Händen einen unsichtbaren Stiel und bewegte sie auf und ab. Die makabre kleine Pantomime erschien mir vollkommen deplatziert und jagte mir einen Schrecken ein.
Gil gab ein düsteres »Sacré…« von sich und starrte wieder auf seine Füße. Hier stimmte was nicht. Ich schrieb schnell noch ein paar Worte ins Notizbuch und klappte es zu.
»Ist es feucht da unten?«, fragte ich, denn ich wollte Gummistiefel und Overall nur dann anziehen, wenn es wirklich nötig war.
»Eigentlich nicht«, sagte der Mann mit dem Pferdeschwanz und sah zu Gil hinüber, der zur Bestätigung den Kopf schüttelte, aber nicht aufsah.
»Na schön. Dann sehen wir uns die Sache einmal genauer an.« Ich hoffte, dass ich ruhiger wirkte, als ich in Wirklichkeit war.
Der Arbeiter mit dem Pferdeschwanz ging voraus in das Gehölz. Langsam stiegen wir in eine kleine, mit Bäumen und Gestrüpp bewachsene Senke hinab. Der Arbeiter bog die dickeren Äste für mich zurück, und ich gab sie an Gil weiter. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass kleinere Zweige mir die Haare noch mehr durcheinanderbrachten. In der Senke roch es nach feuchter Erde und verrottetem Laub. Die Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach fielen, zeichneten ein Fleckenmuster auf den Boden, das aussah wie die Teile eines Puzzles. Kleine Staubpartikel tanzten im schräg einfallenden Licht. Insekten schwirrten mir ums Gesicht und summten in meinen Ohren, während irgendwelche Käfer oder Ameisen über meine nackten Knöchel krabbelten.
Als wir am Boden der Senke angekommen waren, musste sich der Arbeiter mit dem Pferdeschwanz kurz orientieren. Dann ging er nach rechts, und ich folgte ihm. Ich schlug nach Moskitos, bog Zweige zur Seite und spähte durch die herumtanzenden Wolken winziger Stechmücken nach vorn. Ab und zu flog mir eine von diesen Mücken direkt ins Auge, so dass ich heftig blinzeln musste. Bald stand mir der Schweiß in dicken Tropfen über der Oberlippe, und meine Haare klebten am Kopf. Um herumfliegende Strähnen brauchte ich mir nun keine Sorgen mehr zu machen. Gott sei Dank hatte ich keine besseren Klamotten angezogen.
Etwa fünfzehn Meter vom Fundort entfernt brauchte ich niemanden mehr, der mir den Weg wies. Jetzt nämlich durchdrangen die unverkennbaren Ausdünstungen des Todes das lehmige Aroma der vom Sonnenlicht erwärmten Walderde. Nichts auf der Welt riecht so schlimm wie verwesendes Fleisch. Dieser süßliche, übelkeiterregende Gestank verstärkte sich bei jedem meiner Schritte wie das Zirpen einer Grille, das langsam anschwillt, wenn man sich ihr nähert. Bald hatte er den Duft von Moos, Harz und Humus vollständig verdrängt.
Gil ließ sich immer mehr zurückfallen und blieb schließlich in ein paar Metern Entfernung stehen. Ihm genügte offenbar der Gestank, er musste nicht noch einmal einen Blick auf dessen Ursprung werfen. Sein Kollege hingegen ging noch ein paar Schritte weiter und deutete dann wortlos auf einen Laubhaufen, um den die Fliegen brummten und kreisten wie Akademiker um ein kaltes Büfett.
Als ich die Fliegen sah, krampfte sich mein Magen zusammen, und meine innere Stimme sagte: »Siehst du, ich habe es dir doch gleich gesagt.«
Voller böser Vorahnungen lehnte ich meinen Rucksack an einen Baumstamm und nahm ein paar Latexhandschuhe heraus. Dann tastete ich mich vorsichtig durch das dichte Geäst auf den Haufen zu. Beim Näherkommen entdeckte ich die Stelle, an der die beiden Arbeiter mit ihren Rechen das Laub weggeschoben hatten. Was ich dort sah, bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen.
Aus dem Laub ragte ein Brustkorb heraus, dessen Rippen mich an die Überreste eines kleinen, gestrandeten Bootes erinnerten. Als ich vor dem Haufen in die Hocke ging, erhob sich laut brummend ein Fliegenschwarm. Die fetten Leiber glänzten grünlich im Sonnenlicht. Mit einem Stöckchen entfernte ich Laub und Erde, bis ich sah, dass die Rippen noch von einem Stück Wirbelsäule zusammengehalten wurden. Dann holte ich tief Luft, zog die Handschuhe an und machte mich daran, die Knochen von Blättern und Kiefernnadeln zu befreien. Vom Sonnenlicht erschreckt, ergriffen ganze Scharen von Käfern und Asseln die Flucht und verkrochen sich in die Lücken zwischen den einzelnen Wirbeln.
Es dauerte etwa zehn Minuten, bis ich den Laubhaufen abgetragen und die von Gil und seinem Kollegen gefundenen Knochen vollständig freigelegt hatte. Ich strich mir mit meinen latexumhüllten Fingern eine Haarsträhne aus dem Gesicht und hockte mich auf meine Fersen, um das Ergebnis zu begutachten.
Auf etwa einem Quadratmeter Fläche lag der teilweise skelettierte Oberkörper einer menschlichen Leiche, deren Brustkorb, Wirbelsäule und Becken noch immer von vertrockneten Muskeln und Bändern zusammengehalten wurden. Während das Gehirn und innere Organe oft innerhalb weniger Wochen von Bakterien und Insekten aufgefressen werden, setzt das Bindegewebe den Verrottungsprozessen sehr viel mehr Widerstand entgegen. So dauert es Monate und manchmal sogar Jahre, bis es vollständig verwest ist.
Auch an diesem Torso konnte ich bei näherem Hinsehen an den Brust- und Unterleibsknochen bräunliche Reste eingetrockneten Gewebes entdecken. Während ich so dahockte, die Schmeißfliegen brummen hörte und nachdenklich das Schattenspiel der Blätter auf dem sonnenbeschienenen Waldboden betrachtete, wurden mir zwei Dinge klar: Erstens konnte es sich bei diesen Knochen nicht um die Überreste eines Tieres handeln, und zweitens lagen sie noch nicht allzu lange hier im Gehölz.
Und noch etwas wusste ich genau: Der Mensch, dem dieser Brustkorb und dieses Becken einmal gehört hatten, war ermordet und zerstückelt worden. Dann hatte jemand den Torso in einen ganz normalen, haushaltsüblichen Müllsack gesteckt und hierhergebracht. Der Sack, der von den Arbeitern aufgerissen worden war, lag immer noch unter dem Leichenteil, an dem Kopf und Gliedmaßen ebenso fehlten wie irgendwelche Gegenstände, anhand derer man es hätte identifizieren können. Bis auf einen natürlich: den Gummisauger.
Er stand zwischen den Beckenknochen, und dass sein Holzgriff wie ein umgedrehtes Eis am Stiel direkt im Beckenausgang steckte, war bestimmt kein Zufall.
Als ich aufstand, taten mir vom langen In-der-Hocke-Sitzen die Knie weh. Aus Erfahrung wusste ich, dass aasfressende Tiere Leichenteile über beachtliche Entfernungen fortschleppen können. Hunde zum Beispiel verstecken ihre Beute gerne im dichten Unterholz, und Füchse, Dachse und Waschbären schaffen oft kleinere Knochen oder Zähne in ihren Bau. Also wischte ich mir die Hände ab und sah mich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Torsos nach Tierspuren um.
Die Schmeißfliegen brummten, und weit, weit entfernt auf der Rue Sherbrooke hupte ein Auto. Bilder von anderen Wäldern, anderen Gräbern und anderen Knochen gingen mir wie zusammenhanglos aneinandergeklebte Schnipsel aus alten Filmen durch den Kopf. Aufmerksam suchte ich den Waldboden ab, und als ich dabei ganz langsam den Kopf drehte, meinte ich, im Muster des schattengefleckten Laubs ganz flüchtig etwas aufblitzen zu sehen. Es war mehr eine Ahnung als eine konkrete Sinneswahrnehmung gewesen und so flüchtig, dass ich es nicht hatte lokalisieren können. Ich drehte den Kopf noch einmal in dieselbe Richtung. Nichts. Obwohl ich mir schon nicht mehr sicher war, dass ich überhaupt etwas gesehen hatte, rührte ich mich nicht vom Fleck. Als ich die Insekten vor meinen Augen fortwedelte, bemerkte ich, dass es nicht mehr so warm war wie vorhin.
Mist. Noch immer starrte ich auf den Waldboden. Ein leichter Wind kam auf. Er fuhr mir durch die schweißnassen Haare und raschelte in den Blättern der Bäume. Und dann bemerkte ich es wieder. In einiger Entfernung blinkte etwas ganz schwach im Sonnenlicht. Unsicher machte ich ein paar Schritte darauf zu und konzentrierte mich dabei voll auf das zitternde Schattenmuster am Boden, wo aber beim besten Willen nichts zu sehen war. Vermutlich hatte ich mich doch getäuscht.
Aber dann bewegte ein Windstoß das Laub am Boden, und ich sah deutlich, wie das warme Nachmittagslicht ganz kurz von einer mattglänzenden Oberfläche reflektiert wurde. Mit angehaltenem Atem trat ich näher. Was ich fand, erstaunte mich nicht. Da haben wir die Bescherung, dachte ich.
Aus einem Hohlraum zwischen den Wurzeln eines Tulpenbaums schaute ein weiterer Plastiksack hervor. Rings um den Baum und den Sack wuchsen leuchtend gelbe Butterblumen, die aussahen, als wären sie soeben einer Illustration von Beatrix Potter entsprungen. Sie bildeten einen merkwürdigen Kontrast zu dem Müllsack, von dem ich schon jetzt wusste, dass er einen grausigen Inhalt bergen würde.
Laub raschelte, und kleine Zweige knackten unter meinen Füßen, als ich auf den Tulpenbaum zuging. Ich hielt mich mit einer Hand am Stamm fest und tastete mit der anderen nach dem Sack. Als ich genügend davon für einen sicheren Griff in der Hand hatte, zog ich vorsichtig daran. Der Sack bewegte sich nicht. Ich wand die Folie noch einmal um meine Finger, zog fester und spürte, wie er sich löste. Beim Ziehen merkte ich, dass etwas Schweres darin sein musste. Mücken schwirrten um mein Gesicht, und der Schweiß lief mir den Rücken hinab. Mein Herz hämmerte wie der Bass in einem Heavy-Metal-Song.
Nachdem sich der Sack mit einem letzten Ruck vollständig gelöst hatte, zog ich ihn ein Stück weit von dem Baum fort, um ihn zu öffnen. Irgendwie wollte ich das nicht zwischen den fröhlich blühenden Beatrix-Potter-Blümchen tun. An Form und Gewicht des Sacks hatte ich längst erraten, was er enthalten musste. Als ich den Knoten an der Öffnung des Sacks löste, schlug mir ein unerträglicher Verwesungsgeruch entgegen. Mit angehaltenem Atem zog ich die Plastikfolie auseinander.
Aus dem Müllsack starrte mir ein menschliches Gesicht entgegen. Weil die Plastikfolie es vor Insektenfraß geschützt hatte, waren seine Züge noch zu erkennen, auch wenn Hitze und Feuchtigkeit sie zu einer grausigen Totenmaske entstellt hatten.
Zwei kleine, eingeschrumpfte Augen starrten stumpf unter halbgeschlossenen Lidern hervor. Die Nase war umgeknickt und vom Gewicht des Kopfes so flach auf eine der eingefallenen Wangen gepresst worden, dass sich die Nasenlöcher in schmale Schlitze verwandelt hatten. Die dünnen Lippen waren zu einem ewigen Grinsen verzerrt und entblößten eine Reihe makelloser Zähne. Die teigig-weiße Gesichtshaut, die sich wie ein nasses Leintuch den Konturen der Schädelknochen anpasste, wurde umrahmt von vollem mattrotem Haar, dessen glanzlose Korkenzieherlocken von flüssig gewordener Gehirnmasse durchtränkt waren.
Erschüttert schloss ich den Sack und erinnerte mich auf einmal wieder daran, dass ich nicht allein in dem Gehölz war. Als ich mich nach den Arbeitern umdrehte, blickte mich der Mann mit dem Pferdeschwanz interessiert an. Sein Kollege wartete in einiger Entfernung. Er hatte die Schultern hochgezogen und seine Hände tief in den Taschen seiner Latzhose vergraben.
Ich zog die Latexhandschuhe aus und ging wortlos an den beiden vorbei. Auch sie sagten nichts, aber am Rascheln des Laubs hinter mir konnte ich hören, dass sie mir folgten. Ich verließ das Wäldchen und steuerte auf den Streifenwagen zu, der noch immer draußen auf der Straße stand.
Constable Groulx lehnte an der Kühlerhaube und rührte sich nicht, obwohl er mich auf sich zukommen sah. Ich hatte schon mit freundlicheren Beamten zu tun.
»Dürfte ich bitte mal Ihr Funkgerät benutzen?«, fragte ich in ziemlich kühlem Ton.
Groulx drückte sich mit beiden Händen in eine aufrechte Position und ging um den Wagen herum zur Fahrerseite. Er griff durch das geöffnete Fenster, nahm das Mikro aus seiner Halterung und sah mich fragend an.
»Die Mordkommission«, sagte ich.
Er warf mir einen überraschten Blick zu, den er aber gleich wieder zu bedauern schien. »Section des homicides«, sagte er mit ungerührter Miene ins Mikrofon. Es dauerte eine Weile, dann war durch das Rauschen des Funkgeräts die gereizte Stimme eines Beamten zu hören.
»Claudel hier. Was ist denn los?«
Constable Groulx gab mir das Mikro. Ich sagte, wer und wo ich war. »Ich habe ein Mordopfer entdeckt«, fuhr ich fort. »Dem ersten Anschein nach weiblich. Wahrscheinlich enthauptet. Vermutlich wurde sie woanders umgebracht. Sie sollten so schnell wie möglich die Spurensicherung vorbeischicken.«
Eine ganze Weile kam keine Antwort. Meine Nachricht, so schien es, wurde nicht gerade begeistert aufgenommen.
»Pardon?«
Ich wiederholte das Gesagte und bat Claudel, bei meinem Institut anzurufen und Pierre LaManche zu verständigen. Diesmal war es kein Fall für die Archäologen.
Ich gab Groulx, der alles mitangehört hatte, das Mikrofon zurück und fragte ihn, ob er schon die Aussagen der beiden Arbeiter aufgenommen habe. Als ihm dämmerte, dass sein Feierabend damit in noch weitere Ferne rückte, machte er ein Gesicht, als wäre er soeben zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Mein Mitleid mit ihm hielt sich in Grenzen, denn auch mit meinem Wochenende in Quebec City war es jetzt vorbei. Als ich später zu meiner Wohnung fuhr, hatte ich eine unbestimmte Ahnung, dass dieser Fall mir und anderen noch viele schlaflose Nächte bereiten würde. Schon bald sollten sich diese Befürchtungen als absolut berechtigt herausstellen. Was ich damals allerdings noch nicht ahnen konnte, war das Ausmaß des Grauens, das uns erwartete.
2
Der nächste Tag begann wieder warm und sonnig. Normalerweise hätte mich dieser Umstand in gute Laune versetzt. Ich bin eine Frau, deren Stimmung stark vom Wetter abhängt und sich mit dem Barometer hebt und senkt. An diesem Tag aber war mir das Wetter egal. Um neun Uhr früh war ich im Autopsieraum Nummer vier, dem kleinsten, den es im Laboratoire de Médicine Légale gibt. Dieser Arbeitsraum ist mit einer speziellen Entlüftungsanlage ausgestattet, und weil ich häufig an Leichen arbeite, die sich in einem miserablen Erhaltungszustand befinden, habe ich hier öfter zu tun. Natürlich ist diese Entlüftungsanlage nicht hundertprozentig effektiv. Auch die besten Ventilatoren und Desinfektionsmittel der Welt kommen nicht gegen den Gestank verwesender Leichen an, ebenso wenig wie der antiseptische Glanz des Edelstahls gegen die Bilder gequälten Fleisches auf dem Autopsietisch.
Die Überreste aus dem Grand Séminaire waren ganz eindeutig ein Fall für Raum Nummer vier. Am vergangenen Abend war ich nach einem raschen Abendessen noch einmal an den Fundort zurückgekehrt und hatte den Leuten von der Spurensicherung beim Bergen der Leichenteile geholfen, die jetzt in einem Leichensack auf der Rollbahre rechts neben mir lagen. Bei der allmorgendlichen Besprechung, während der die Arbeit des Tages auf die fünf Pathologen verteilt wird, hatte LaManche mich mit der Autopsie des Falles betraut, der inzwischen die Nummer 26704 erhalten hatte. Angesichts des nahezu skelettierten Zustands der Leiche war meine Expertise als forensische Anthropologin gefragt.
Weil sich einer der Autopsieassistenten krankgemeldet hatte, waren wir ausgerechnet heute unterbesetzt. Dabei hatte uns die vergangene Nacht reichlich Arbeit beschert: Ein Teenager hatte sich das Leben genommen, ein älteres Ehepaar war tot in seinem Haus aufgefunden worden, und in einem verbrannten Auto hatte man eine vollkommen verkohlte Leiche gefunden. Weil auf fünf Obduktionen nur vier Assistenten kamen, hatte ich angeboten, alleine zu arbeiten.
Ich trug grüne Chirurgenkleidung, eine Schutzbrille aus Plastik und Latexhandschuhe – ein entzückendes Outfit. Als Erstes reinigte und fotografierte ich den Kopf, damit er noch diesen Morgen geröntgt werden konnte. Danach würden wir ihn kochen, um das verweste Fleisch und die Reste des Gehirns zu entfernen, was mir wiederum eine genaue Untersuchung des Schädels ermöglichte.
Zuvor aber prüfte ich noch die Haare auf Fasern oder andere Spuren. Als ich die feuchten Strähnen in den Händen hielt, musste ich daran denken, wann die tote Frau dieses Haar wohl zum letzten Mal gekämmt hatte. Hatte sie zufrieden, frustriert oder gleichgültig in den Spiegel geblickt? War ihr letzter Tag ein guter oder schlechter Tag für ihre Haare gewesen?
Ich brach diese Überlegungen ab, steckte eine Probe des Haares in einen Plastikbeutel und schickte ihn für eine mikroskopische Untersuchung ans biologische Labor. Der Gummisauger und die Müllsäcke befanden sich schon dort, wo sie auf Fingerabdrücke, Rückstände von Körperflüssigkeiten und andere mikroskopische Spuren untersucht wurden, die möglicherweise Rückschlüsse auf die Identität von Täter oder Opfer zuließen.
Obwohl ich am vergangenen Abend noch drei Stunden lang auf Händen und Knien in Erde, Schlamm, Gras und Laub herumgesucht hatte, war ich am Fundort der Leichenteile auf keine weiteren Hinweise gestoßen. Bei Einbruch der Dunkelheit musste ich die Suche aufgeben und stand mit leeren Händen da. Keine Kleidung. Keine Schuhe. Kein Schmuck. Keinerlei persönliche Dinge. Heute wollten die Leute von der Spurensicherung weitersuchen, aber ich bezweifelte, dass sie noch etwas finden würden. Ich hatte also wieder einmal weder Schnallen noch Reißverschlüsse und auch keine Kleidungsstücke mit Herstelleretiketten oder Schuss- beziehungsweise Einstichlöchern, von Waffen oder Fesseln ganz zu schweigen, die einen Hinweis auf die Todesart hätten geben können. Die zerstückelte Leiche war splitternackt und – wenn man von dem Gummisauger einmal absah – ohne den geringsten Gegenstand, der irgendwelche Rückschlüsse auf ihre Identität zugelassen hätte, in die Plastiksäcke gesteckt worden. Der Mörder war beim Zerlegen der Leiche ganz systematisch vorgegangen. Ebenso wie den Torso und den Kopf hatte er – oder sie – Arme und Beine fein säuberlich in jeweils einem Müllsack verpackt. Zusammen ergab der Inhalt der vier Säcke, die wir nach und nach in dem Gehölz gefunden hatten, ein komplettes Skelett. Dass er die Tote einfach weggeworfen hatte wie ganz normalen Hausmüll, ließ in mir eine Wut hochsteigen, die ich aber sogleich wieder zurückdrängte. Ich musste mich auf meine Arbeit konzentrieren.
Obwohl sie alle oben zugeknotet gewesen waren, hatten die Säcke mit dem Torso und den Gliedmaßen nicht so gut dicht gehalten wie der, in dem der Kopf gesteckt hatte. So sah ich mich bei einer ersten Untersuchung der Leichenteile mit unterschiedlichen Erhaltungszuständen konfrontiert. Diese musste ich zunächst auf dem großen Autopsietisch aus Edelstahl anatomisch richtig einander zuordnen. Eine gründliche Untersuchung am Skelett würde ich erst später vornehmen, wenn die Knochen gereinigt waren.
Zuerst legte ich den Torso mit der Brust nach oben in die Mitte des Autopsietisches. Er war von allen Körperteilen am schlechtesten erhalten, so dass die einzelnen Knochen nur noch durch vertrocknete Muskeln und Sehnen zusammengehalten wurden. Die obersten Halswirbel fehlten, weshalb ich vermutete, dass diese sich noch am Kopf befinden mussten. Von den inneren Organen war bis auf ein paar eingetrocknete Reste nichts übrig geblieben.
Als Nächstes legte ich Arme und Beine neben den Torso. Die Gliedmaßen waren nicht so ausgetrocknet wie der Brustkorb und das Becken, daher fand ich an ihnen noch große Teile von halbverwestem weichem Gewebe. Als ich die Glieder aus dem Leichensack nahm, setzte ein fahlgelbes Gewimmel ein, dessen Anblick mir Übelkeit verursachte. Es waren unzählige Maden, die sich wie eine lebende Decke in einer schlaffen, wellenförmigen Bewegung von den Leichenteilen entfernten, sobald diese dem Licht ausgesetzt wurden. Wie ein leichter, aber beständiger Regen fielen sie auf den Autopsietisch und von dort auf den Boden, wo sie wie gelbe, sich windende Reiskörner vor meinen Füßen lagen. Ich versuchte, nicht auf sie zu treten. An die Maden würde ich mich wohl nie gewöhnen.
Ich nahm mein Klemmbrett zur Hand und füllte das entsprechende Formular aus. Name: Inconnue. Unbekannt. Datum der Autopsie: 3. Juni 1994. Untersuchende Beamte: Luc Claudel, Michel Carbonneau von der Séction des homicides, dem Morddezernat der Polizei in Montreal.
Ich trug noch die Nummer des Polizeiberichts, die Leichennummer und die Untersuchungsnummer des Laboratoire de Médicine Légale, abgekürzt LML-Nummer, ein. Wie jedes Mal angesichts solch nüchterner Zahlen packte mich die Wut über die arrogante Gleichgültigkeit unserer Bürokratie. Tote, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer fallen, haben keinen Intimbereich mehr. Nach dem Leben wird ihnen auch noch ihre Würde genommen. Ihre Leiche wird herumgetragen, untersucht, fotografiert, mit einem Zettel am großen Zeh versehen und zur Entnahme von Proben aus dem Kühlfach geholt. Auf diese Weise wird das Opfer zu einem Beweis- und Ausstellungsstück, das von Kriminalbeamten, Pathologen und forensischen Spezialisten begutachtet und schließlich den Geschworenen präsentiert wird. Obwohl ich selbst ein Teil dieser Untersuchungsmaschinerie bin, kann ich die Gefühllosigkeit, mit der sie den Toten ihre persönlichsten Geheimnisse entreißt, oft nur schwer ertragen. Ich rechtfertige meine Arbeit damit, dass ich unbekannten Toten ihren Namen wiedergebe. Wenn sie schon einen gewaltsamen Tod erleiden mussten, so sollen sie wenigstens nicht anonym beerdigt werden.
Ich wich von meiner normalen Untersuchungsroutine ab und suchte mir ein bestimmtes Formblatt heraus. Die Aufnahme des vollständigen Skelettbildes musste warten, denn die Detectives der Mordkommission wollten so schnell wie möglich Geschlecht, Alter und Rasse der Leiche wissen.
Letztere war noch das Offensichtlichste, denn die roten Haare und die Hautreste deuteten auf eine weiße Person hin. Natürlich wusste ich, dass der Verwesungsprozess bisweilen für die seltsamsten Verfärbungen an einer Leiche sorgen kann, und deshalb würde die Rasse des Opfers mit hundertprozentiger Sicherheit erst anhand der gesäuberten Knochen bestimmt werden können.
Was das Geschlecht anbelangte, so tippte ich auf weiblich. Nicht wegen der langen Haare, denn die könnte auch ein Mann haben, sondern wegen der zarten Gesichtszüge und des zierlichen Körperbaus.
Ich drehte das Becken ein wenig zur Seite und besah mir die Einkerbung unterhalb der Beckenschaufel. Sie war breit und flach. Ich brachte das Becken wieder in seine Ausgangslage und untersuchte die Schambeine im vorderen unteren Teil des Beckens. Auf den beiden bogenförmigen Knochen konnte ich feine, leicht erhöhte Linien erkennen, die nach hinten in ausgeprägte Dreiecke zusammenliefen – typische weibliche Merkmale. Selbstverständlich würde ich die Knochen später noch genau vermessen und ihre Daten vom Computer überprüfen lassen, aber auch so bestand schon jetzt für mich kein Zweifel mehr, dass ich es mit den sterblichen Überresten einer Frau zu tun hatte.
Als ich die Schambeine mit einem feuchten Lappen abdeckte, ließ mich das laute Klingeln des Telefons aufschrecken. Vor Anspannung hatte ich gar nicht bemerkt, wie still es im Autopsieraum war. Auf meinem Weg zum Telefon stieg ich über die Maden am Boden und erinnerte mich dabei an ein Spiel aus meiner Kindheit, bei dem man nicht auf die Fugen zwischen zwei Gehsteigplatten treten durfte.
»Hier Dr. Brennan«, sagte ich, während ich die Schutzbrille auf die Stirn schob und mich in den Stuhl neben dem Telefon sinken ließ. Mit einem Kugelschreiber schnippte ich eine Made vom Tisch.
»Claudel«, sagte eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Es war einer der beiden Detectives von der Montrealer Polizei, die an dem Fall arbeiteten. Ich warf einen Blick auf die Wanduhr. Zehn Uhr vierzig. Später als ich gedacht hatte. Nach seinem Namen sagte Claudel nichts mehr. Offenbar wartete er darauf, dass ich ihm mein Untersuchungsergebnis mitteilte.
»Ich habe sie gerade auf dem Obduktionstisch«, sagte ich und hörte ein knirschendes, metallisches Geräusch. »Eigentlich müsste ich …«
»Sie?«, unterbrach mich Claudel.
»Ja.« Ich sah zu, wie eine Made sich sichelförmig zusammenzog, sich wieder streckte und dann dasselbe in die andere Richtung wiederholte. Beeindruckend.
»Weiße?«
»Ja.«
»Wie alt?«
»Das kann ich Ihnen erst in einer Stunde sagen.«
Ich sah direkt vor mir, wie Claudel auf seine Uhr blickte.
»Okay. Dann komme ich nach dem Mittagessen vorbei.« Klick. Claudel hätte mich ja fragen können, ob mir sein Besuch in den Kram passte, aber das war ihm ganz offensichtlich egal.
Ich legte auf und wandte mich wieder der Toten auf dem Tisch zu. Ich nahm das Klemmbrett zur Hand und schlug die nächste Seite auf dem Formularsatz auf. Alter. Dass ich es mit einer Erwachsenen zu tun hatte, wusste ich bereits, denn bei der Untersuchung des Kopfes hatte ich im Mund alle vier Weisheitszähne entdeckt.
Zuerst untersuchte ich die Arme an den Stellen, wo sie von den Schultern abgetrennt worden waren. Die Enden der beiden Oberarmknochen waren voll ausgebildet, nirgends konnte ich eine Epiphysenfuge erkennen, die auf ein noch nicht voll abgeschlossenes Wachstum hätte schließen lassen. An den Enden der Oberschenkelknochen war dasselbe zu beobachten.
Irgendetwas an diesen abgetrennten Gelenken war allerdings merkwürdig. Das Gefühl ging über die normale Abscheu angesichts der Brutalität des Täters hinaus, aber war viel zu schwach, um konkret zu sein. Als ich das linke Bein zurück auf den Tisch legte, war mein Magen kalt wie Eis. Es war dieselbe Angst, die ich schon am Fundort der Leiche gespürt hatte. Ich schüttelte sie ab und konzentrierte mich wieder auf meine Arbeit. Wie alt war die Tote? Wenn man eine Leiche identifizieren wollte, war das Alter enorm wichtig.
Ich nahm ein Skalpell und legte die Knie- und Ellenbogengelenke frei. Das weiche, verweste Fleisch ließ sich leicht entfernen, und es wurde offensichtlich, dass die Knochen vollkommen ausgebildet waren. Um ganz sicherzugehen, musste ich natürlich Röntgenaufnahmen machen, aber ich konnte auch so schon sagen, dass die Knochen der Toten ausgewachsen waren. An den Gelenken waren weder Lippenbildung noch altersbedingte Abnutzung festzustellen. Ich hatte also eine junge Erwachsene vor mir. Auch die Zähne zeigten eine geringe Abnutzung, so dass sich diese Erkenntnisse deckten.
Aber ich wollte es genauer wissen. Claudel erwartete eine auf ein paar Jahre eingegrenzte Altersangabe von mir. Also prüfte ich die Enden der Schlüsselbeine. Das rechte hatte sich zwar vom Brustbein gelöst, aber die Gelenkpfanne war noch in einem Knoten aus getrocknetem Knorpel und Bindegewebe verborgen. Mit einer Schere schnitt ich so viel wie möglich von dem harten Material ab und wickelte das Ende des Schlüsselbeins ebenfalls in ein feuchtes Tuch, um den Rest des Knotens aufzuweichen.
Dann widmete ich mich wieder dem Becken. Nachdem ich das Tuch dort entfernt hatte, schnitt ich den Knorpel, der die beiden Beckenhälften vorne zusammenhielt, vorsichtig mit dem Skalpell auseinander. Obwohl die Feuchtigkeit den Knorpel etwas nachgiebiger gemacht hatte, war es eine langwierige und mühevolle Arbeit. Als ich die Schambeine schließlich voneinander getrennt hatte, schnitt ich die wenigen eingetrockneten Muskeln durch, die das Becken hinten mit dem unteren Ende der Wirbelsäule verbanden, und setzte die Schambeine im Waschbecken unter Wasser.
Zurück an der Leiche entfernte ich das feuchte Tuch vom Schlüsselbein. Das harte Gewebe um das Gelenk war inzwischen etwas weicher geworden, so dass wieder etwas mehr abgetragen werden konnte. Dann füllte ich ein Laborglas mit Wasser, stellte es neben den Brustkorb und steckte das Ende des Schlüsselbeins hinein.
Ich sah hinauf zur Wanduhr. Zwölf Uhr fünfundzwanzig. Ich trat vom Autopsietisch zurück, zog die Handschuhe aus und richtete mich auf. Langsam. Mein Rücken fühlte sich an, als hätte eine komplette Footballmannschaft darauf ihr Training absolviert. Ich stemmte die Hände in die Hüften, streckte mich und bewegte meinen Oberkörper in langsamen Kreisen vor und zurück. Auch wenn das nicht gegen die Schmerzen half, so konnte es wenigstens nicht schaden. In letzter Zeit hatte ich häufig mit Rückenproblemen zu kämpfen, und die drei Stunden in gebeugter Haltung über dem Autopsietisch hatten meiner Wirbelsäule auch nicht gerade gutgetan. Ich weigerte mich zuzugeben, dass das etwas mit meinem Alter zu tun haben könnte. Ebenso wenig wie die Lesebrille, die ich mir erst kürzlich hatte zulegen müssen, oder die Tatsache, dass sich mein Körpergewicht von zweiundfünfzig auf vierundfünfzigeinhalb Kilo erhöht hatte und nicht mehr wieder reduzieren ließ. Nichts hatte mit dem Alter zu tun.
Als ich mich umdrehte, bemerkte ich, wie Daniel, einer der Autopsiegehilfen, mich von der Tür aus beobachtete.
»Wann kann ich denn die Röntgenaufnahmen machen?«, fragte er und blickte mich über die Gläser seiner auf die Nase gerutschten Brille an.
»Ich müsste eigentlich so gegen drei Uhr hier fertig sein«, sagte ich und warf die Handschuhe in den Abfallbehälter. Auf einmal merkte ich, wie hungrig ich war. Mein Vormittagskaffee stand noch immer unberührt auf der Arbeitstheke und war inzwischen kalt geworden. Ich hatte ihn bei der Arbeit völlig vergessen.
»Okay«, sagte Daniel und machte ein paar Schritte nach hinten, bis er mit einer abrupten Drehung wieder im Büro verschwand.
Ich warf die Schutzbrille auf die Arbeitstheke, nahm eine weiße Papierdecke aus einer der Schubladen und breitete sie über die Leichenteile. Nachdem ich mir die Hände gewaschen hatte, ging ich in mein Büro im vierten Stock, zog mich um und verließ zum Mittagessen das Haus. Das tat ich selten, aber heute hatte ich große Sehnsucht nach frischer Luft und Sonnenlicht.
Claudel hatte Wort gehalten. Als ich um halb zwei wieder in mein Büro kam, saß er bereits auf dem Stuhl vor meinem Schreibtisch und betrachtete interessiert den rekonstruierten Schädel auf dem Arbeitstisch. Als er mich kommen hörte, drehte er den Kopf in meine Richtung, sagte aber nichts. Ich hängte meine Jacke an den Haken hinter der Tür und ging um ihn herum zu meinem Schreibtischstuhl.
»Bonjour, Monsieur Claudel. Comment ça va?« grüßte ich ihn.
»Bonjour«, antwortete er, ohne sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Auch recht. Dann wartete ich eben, bis er mir was zu sagen hatte. Charmante Zeitgenossen wie ihn hatte ich besonders gerne.
Claudel faltete die Hände über einem Schnellhefter, den er auf meinen Schreibtisch gelegt hatte. Sein Gesicht, dessen Züge in geraden Linien auf eine schnabelartig vorspringende Nase zuliefen, erinnerte mich an einen Papagei. Wenn Claudel lächelte – was allerdings selten der Fall war –, zog er die Mundwinkel eher nach oben als nach hinten, so dass sein Mund dann wie ein V aussah.
Claudel seufzte und zeigte mir damit, wie sehr ich seine Geduld strapazierte. Bisher hatte ich noch nie mit ihm zusammengearbeitet, aber ich kannte seinen Ruf. Claudel, so sagten seine Kollegen, hielt sich für einen außergewöhnlich intelligenten Mann.
»Ich habe da ein paar Namen, die passen könnten«, sagte er. »Alles Frauen, die in den vergangenen sechs Monaten verschwunden sind.«
Schon am Fundort der Leiche hatte ich Claudel eine erste Schätzung des Todeszeitpunkts mitgeteilt, und meine vormittägliche Arbeit im Autopsieraum hatte mir in dieser Hinsicht keine anderen Erkenntnisse beschert. Ich war mir noch immer sicher, dass sie vor nicht mehr als drei Monaten getötet worden war. Die Winter in Quebec sind zwar hart für die Lebenden, aber gut für die Konservierung von Toten, denn gefrorene Leichen verwesen nicht. Sie ziehen auch kein Ungeziefer an. Wäre die Leiche im vergangenen Herbst in das Wäldchen gebracht worden, dann hätte ich Larven oder Puppen von Insekten finden müssen. Aber es gab keine, sondern Maden, deren Anzahl unter Berücksichtigung des ungewöhnlich warmen Frühlings darauf schließen ließ, dass die Leiche etwa seit drei Monaten dort lag. Diese Theorie wurde auch durch den Umstand bestätigt, dass Eingeweide und Gehirn zwar verwest, das Bindegewebe aber noch vorhanden war.
Ich lehnte mich zurück und blickte Claudel wortlos an. Ich konnte ebenso reserviert sein wie er. Schließlich öffnete er seinen Hefter und blätterte darin herum. Ich wartete.
»Myriam Weider«, las er vor. Es folgte eine kurze Pause, in der er die Informationen auf dem Blatt durchging. »Verschwunden am 4. April 1994.« Wieder eine Pause. »Weiblich. Weiß.« Eine längere Pause. »Geboren am 6. September 1948.«
Wir rechneten beide nach. Fünfundvierzig Jahre.
»Möglicherweise«, sagte ich und bedeutete ihm mit einer Handbewegung, dass er weitermachen solle.
Claudel legte das Formular auf den Schreibtisch und nahm das nächste zur Hand. »Solange Leger. Ihr Mann hat sie vermisst gemeldet und zwar am…« Er hielt kurz inne, um das Datum zu entziffern, »… 2. Mai 1994. Weiblich. Weiß. Geburtsdatum 17. August 1928.«
»Nein«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Zu alt.«
Claudel steckte das Formular wieder in den Hefter und nahm ein anderes zur Hand. »Isabelle Gagnon. Zuletzt gesehen am 2. April 1994. Weiblich. Weiß. Geburtsdatum 15. Januar 1971.«
»Dreiundzwanzig.« Ich nickte langsam. »Könnte hinkommen.« Das Formular wanderte auf den Schreibtisch.
»Suzanne Saint-Pierre. Weiblich. Vermisst seit dem 9. März 1994.« Claudel verzog beim Lesen die Lippen. »Kam von der Schule nicht nach Hause.« Er verstummte und berechnete das Alter. »Sechzehn Jahre alt. Du meine Güte.«
Wieder schüttelte ich den Kopf. »Die ist zu jung. Die Leiche ist eine Erwachsene.«
Er runzelte die Stirn und nahm das letzte Formular zur Hand. »Evelyn Fontaine. Weiblich. Sechsunddreißig Jahre alt. Zuletzt gesehen in Sept Îles am 28. März. Ach ja. Sie ist eine Inuu.«
»Dann kommt sie wohl kaum infrage«, sagte ich. Der Knochenbau der Toten wies nicht auf eine Indianerin hin.
»Das war’s«, sagte Claudel. Vor uns auf dem Schreibtisch lagen zwei Formulare. Myriam Weider, fünfundvierzig Jahre alt, und Isabelle Gagnon, dreiundzwanzig. Vielleicht war die Tote, die unten im Autopsieraum Nummer vier lag, eine von diesen beiden. Claudel sah mich an und hob die Augenbrauen, die dabei prompt ein weiteres V bildeten, diesmal allerdings ein umgedrehtes.
»Wie alt war denn die Leiche nun?«, fragte er in einem Ton, der ein weiterer Hinweis auf seine strapazierte Geduld war.
»Gehen wir doch hinunter und sehen sie uns an«, sagte ich. Das wird dir ein wenig Sonnenschein in den Tag bringen, Claudel, dachte ich im Stillen.
Das war gemein von mir, denn ich wusste, dass Claudel den Anblick obduzierter Leichen scheute. Aber ich konnte nicht anders, ich musste dem arroganten Schnösel einfach eine reinwürgen. Einen Augenblick machte Claudel auch wirklich ein betretenes Gesicht, aber dann kehrte seine Überheblichkeit rasch zurück. Ich genoss es, ihm ein unangenehmes Gefühl bereitet zu haben, und nahm meinen Labormantel vom Haken an der Tür. Mit raschen Schritten ging ich den Gang entlang und steckte meinen Schlüssel ins Aufzugschloss. Beim Hinunterfahren sah Claudel wie ein Mann aus, der sich einer Prostatauntersuchung unterziehen musste. Auch wenn er ihn nur selten benutzte, wusste er genau, dass dieser Aufzug direkt hinunter in die Leichenhalle führte.
Die Leiche lag noch immer so da, wie ich sie verlassen hatte. Nachdem ich mir frische Handschuhe angezogen hatte, entfernte ich das weiße Tuch und sah aus dem Augenwinkel, dass Claudel noch immer im Türrahmen stand. Er war gerade mal so weit in den Autopsieraum getreten, dass er sagen konnte, er sei drin gewesen. Seine Blicke wanderten über die Arbeitstheke aus Edelstahl, die von der Decke hängende Waage und die Schränke mit ihren Glastüren, hinter denen durchsichtige Plastikbehälter in verschiedenen Größen und Formen zu sehen waren. Nur den Anblick der Leiche auf dem Autopsietisch mied er. Ich kannte dieses Verhalten von anderen Polizisten. Das Betrachten brutaler Tatortfotos macht den meisten nicht viel aus, weil dabei eine sichere Distanz zwischen ihnen und dem darauf abgebildeten Gemetzel bestand. Kein Problem. Ein Rätsel, das es zu studieren und zu lösen galt, weiter nichts. Führte man dieselben Polizisten aber vor eine auf dem Autopsietisch liegende Leiche, änderte sich die Lage schlagartig. Dann sahen fast alle aus wie jetzt Claudel, der ein möglichst unbeteiligtes Gesicht aufsetzte und hoffte, dass er dadurch ruhig und beherrscht wirkte.
Ich nahm die Schambeine aus dem Wasser und zog sie vorsichtig auseinander. Dann stocherte ich mit einer Sonde so lange an den Rändern des Knorpels am Ende des rechten Schambeins herum, bis sich dieser vom Knochen löste. Die darunterliegende Knochenfläche war von horizontal verlaufenden Furchen und Rippen durchzogen. Der äußere Rand der Fläche sah aus wie ein zarter, aber unvollständiger Kranz. Ich unterzog das linke Schambein derselben Prozedur und stellte fest, dass es genauso aussah.
Claudel hatte sich vom Türrahmen nicht weggerührt. Ich nahm das Becken und trug es zur Arbeitsfläche. Dann zog ich eine Lupenlampe heran, die an einem Wandarm befestigt war, und schaltete sie ein. Auf dem von hellem Neonlicht beleuchteten Knochen konnte ich mit Hilfe des Vergrößerungsglases Details sehen, die dem bloßen Augen verborgen blieben. Ich untersuchte den oberen Rand beider Hüftbeine und fand, was ich erwartet hatte.
»Monsieur Claudel«, sagte ich ohne aufzublicken. »Sehen Sie sich doch das einmal an.«
Claudel trat hinter mich, und ich rückte zur Seite, damit er durch die Lupe blicken konnte. Dann deutete ich auf eine Unregelmäßigkeit am oberen Rand des Hüftbeins. Zum Zeitpunkt des Todes hatte sich der Beckenkamm bereits verknöchert.
Ich legte das Becken wieder zur Seite. Claudel sah es fasziniert an, scheute sich aber davor, es zu berühren. Ich ging hinüber zum Autopsietisch, um das Schlüsselbein zu untersuchen, aber ich wusste schon, was ich dort finden würde. Nachdem ich es aus dem Wasser genommen hatte, entfernte ich das aufgeweichte Gewebe am brustseitigen Ende des Knochens. Ich legte die Gelenkfläche frei und winkte Claudel heran. Ohne etwas zu sagen, deutete ich auf den Knochen. Seine Oberfläche war ebenso wellig wie die der Schambeine. In der Mitte befand sich eine kleine Erhebung mit ausgeprägten und noch nicht verwachsenen Rändern.
»Und? Was bedeutet das nun?«, fragte Claudel. Ihm standen zwar Schweißperlen auf der Stirn, aber seiner Stimme war die Nervosität nicht anzuhören.
»Dass die Tote jung war. Vermutlich Anfang zwanzig.«
Ich hätte ihm natürlich erklären können, wie man an den Knochen das Alter eines Menschen ablesen kann, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er im Augenblick kein allzu aufmerksamer Zuhörer sein würde. Also wartete ich. Weil an meinen Handschuhen noch Fetzen von Bindegewebe hingen, hielt ich die Hände von mir gestreckt mit den Handflächen nach oben wie eine Bettlerin. Claudel schreckte zurück, als wäre ich mit dem Ebola-Virus infiziert. Seine Blicke waren zwar auf mich gerichtet, aber er schien durch mich hindurchzusehen, während er im Kopf die neue Information mit seiner Liste abglich.
»Gagnon«, sagte er schließlich. Es war eine Feststellung, keine Frage.
Ich nickte. Isabelle Gagnon. Dreiundzwanzig Jahre alt.
»Ich sage dem Leichenbeschauer, er soll sich die Unterlagen ihres Zahnarztes besorgen«, sagte Claudel.
Ich nickte abermals.
»Todesursache?«, fragte Claudel.
»Steht noch nicht fest«, antwortete ich. »Aber vielleicht geben die Röntgenbilder oder die gereinigten Knochen mehr Aufschluss.«
Claudel machte auf dem Absatz kehrt und verließ ohne Abschiedsgruß den Autopsieraum. Das überraschte mich zwar, aber ich war froh, ihn los zu sein. Dieses Gefühl beruhte vermutlich auf Gegenseitigkeit.
Ich zog die Latexhandschuhe aus und warf sie in den Abfall. Dann ging ich zum großen Autopsiesaal Nummer eins, um Daniel zu sagen, dass ich mit meiner Leiche für heute fertig sei. Außerdem bat ich ihn, mir Röntgenaufnahmen von allen Körperteilen und dem Schädel zu machen und zwar aus verschiedenen Winkeln. Auf dem Weg nach oben schaute ich noch im histologischen Labor vorbei und gab Bescheid, dass die Knochen der Leiche nun ausgekocht werden könnten. Allerdings bat ich um sorgfältige Behandlung, da die Tote zerstückelt worden sei und deshalb die Oberflächen der Knochen und Gelenkpfannen besonders wichtig für mich seien. Eigentlich war dieser Hinweis nicht nötig, denn niemand konnte Knochen so gut präparieren wie Denis, der Leiter des histologischen Labors. Ich war mir sicher, dass er mir in zwei Tagen ein vollständig gereinigtes und unbeschädigtes Skelett übergeben würde.
Den Rest des Nachmittags widmete ich dem Schädel, den ich am Vortag zusammengeklebt hatte. Obwohl er bei weitem nicht vollständig war, reichte das Material, um seinen früheren Besitzer zu identifzieren. Der Mann würde nie wieder einen Tankwagen mit Propangas fahren.
Zu Hause überfielen mich dieselben düsteren Vorahnungen, die ich auch schon im Wald und später bei der Untersuchung der abgetrennten Gliedmaßen gehabt hatte. Den ganzen Tag über hatte ich mich bemüht, sie in Schach zu halten, und mich vollkommen auf die Identifizierung der Leiche und das Zusammensetzen der sterblichen Überreste des Tankzugfahrers konzentriert. Während der Mittagspause war ich in den Park gegangen und hatte von einer Bank aus den Tauben zugesehen. Um mich von meinen trüben Gedanken abzulenken, hatte ich versucht, ihre genaue Hackordnung festzustellen. Eine dicke graue Taube war der Boss. Als Nächste schien ein Tier mit braunen Punkten im Gefieder zu kommen, und eine mickrige Taube mit schwarzen Flügeln stand ganz eindeutig sehr weit unten in der Rangordnung.
Jetzt am Abend würde ich Zeit zum Nachdenken haben. Es fing bereits an, als ich den Wagen in die Garage gefahren und das Autoradio ausgeschaltet hatte. Musik aus, Sorgen an. Nein, befahl ich mir. Jetzt iss erst einmal.
Als ich meine Wohnung betrat, hörte ich das Piepsen der Alarmanlage. Ich stellte aber bloß meine Aktentasche in den Flur, schloss die Tür wieder und ging zu dem libanesischen Lokal an der Ecke, um mir ein Shish Taouk und einen Teller Shawarma zu holen. Was mir an meiner Wohnung in der Innenstadt mit am besten gefällt, ist die Tatsache, dass sich hier im Umkreis von nur einem Block Restaurants aus aller Herren Länder befinden. Ob mein Gewicht in letzter Zeit vielleicht deshalb …? Quatsch.
Während ich auf mein Essen zum Mitnehmen wartete, betrachtete ich die Vitrine mit den Vorspeisen: Humus, Taboule, Feuilles de vignes. Ein Hoch der Multikultur, bei der Libanon und Frankreich aufeinandertreffen.