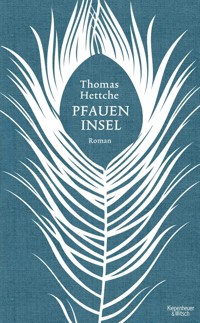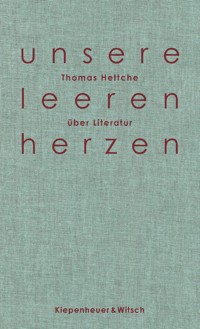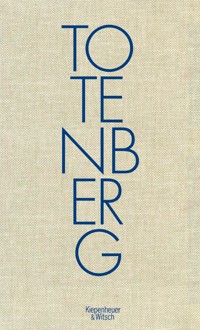
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine intellektuelle Autobiographie in zehn Begegnungen Dieses Buch ist eine Einladung: Thomas Hettche führt den Leser zu den Themen seines Lebens, indem er ihn zu Menschen mitnimmt, die ihm etwas bedeuten. Zehn Begegnungen, die ebenso viel über den Autor wie über unsere Zeit erzählen.Als kunstvoller Erzähler und kluger Essayist hat Thomas Hettche sich einen Namen gemacht. In »Totenberg«, wie der Hausberg seines Heimatortes tatsächlich heißt, erweist er sich nun als brillanter Wanderer zwischen den Welten, der radikal ehrliche autobiographische Skizzen mit theoretischen Diskursen verbindet. »Totenberg« ist ein Buch ganz unterschiedlicher Tonfälle, in dem es treffende Beschreibungen deutscher Landschaften, lebendige Porträts und scharfsinnige Auseinandersetzungen mit Positionen gibt, die den Autor beschäftigen. Mit Hans-Jürgen Syberberg spricht Hettche über die Bindung der Kunst an Landschaft, mit Christa Bürger über die Verantwortung des Intellektuellen, mit Henriette Fischer über die vergessene Ausdruckstänzerin Valeska Gert, mit Anita Albus über die Möglichkeit einer religiösen Kunst, mit Michael Klett über Ernst Jüngers Haltung und das Soldatische in unserer Gegenwart. Als Leitmotiv erweist sich dabei Hettches Gefühl der Heimatlosigkeit, das sich im leeren Koffer seiner sudetendeutschen Mutter auf dem Dachboden des hessischen Elternhauses manifestierte und sich erst in der Literatur beruhigte, die es dort nicht gab.Anschaulich, bildreich, spannend und reich an Dialogen mit überraschenden Wendungen – ein Lesegenuss!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas Hettche
Totenberg
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Thomas Hettche
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Thomas Hettche
Thomas Hettche, 1964 geboren, lebt in Berlin und der Schweiz. Sein Romandebüt »Ludwig muß sterben« wurde 1989 von der Kritik hymnisch aufgenommen. Es folgten 1992 der Erzählungsband »Inkubation«, 1995 »Nox«, ein Roman, der in der Nacht des Mauerfalls in Berlin spielt, und 1997 der Venedig-Essay »Animationen«. 2001 erschien »Der Fall Arbogast«, ein Justizroman, der in zwölf Sprachen übersetzt wurde. »Woraus wir gemacht sind«, 2006 bei Kiepenheuer & Witsch, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Zuletzt publizierte Hettche die Essaysammlung »Fahrtenbuch 1993–2007« (2007) und den Roman »Die Liebe der Väter« (2010).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Thomas Hettche führt den Leser zu den Themen seines Lebens, indem er ihn zu Menschen mitnimmt, die ihm wichtig sind. Das Ergebnis ist eine Autobiographie in zehn Begegnungen, die ebenso viel über den Autor wie über unsere Zeit erzählen.
Als Erzähler und Essayist hat Thomas Hettche sich einen Namen gemacht. In »Totenberg«, wie der Hausberg seines Heimatortes tatsächlich heißt, erweist er sich nun als Wanderer zwischen den Welten, der autobiographische Skizzen mit theoretischen Diskursen verbindet. Entstanden ist ein Buch ganz unterschiedlicher Tonfälle, treffender Beschreibungen deutscher Landschaften, lebendiger Porträts und Auseinandersetzungen. Mit Hans Jürgen Syberberg spricht Hettche über die Bindung der Kunst an Landschaft, mit Christa Bürger über die Aporien des Intellektuellen, mit Henriette Fischer über Sylt und die Ausdruckstänzerin Valeska Gert, mit Michael Klett über Ernst Jüngers Haltung und das Soldatische in unserer Gegenwart.
Als Leitmotiv erweist sich dabei Hettches Gefühl der Heimatlosigkeit, das sich im leeren Koffer seiner sudetendeutschen Mutter auf dem Dachboden des hessischen Elternhauses manifestierte und sich erst in der Literatur beruhigte, die es dort nicht gab.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Stephan Müller, Berlin
ISBN978-3-462-30619-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der Bunker
Nossendorf
Totenberg
Feindberührung
Unsere eigene Gestalt
Echo
Kathedralen
Die Seelen
Sand, Sand, Sand
Papyrii
Quellen
In memoriam
Ursula Koch (1923–2012)
1.) Erkenne die Lage.
2.) Rechne mit deinen Defekten, gehe von deinen Beständen aus, nicht von deinen Parolen.
Gottfried Benn
Der Bunker
Auf dem schmalen Holztisch zwei kleine Gläser und eine Wasserkaraffe auf einem runden Bastuntersetzer. Daneben liegt Christa Bürgers rechte Hand.
»Wann sind Sie hier eingezogen?«
»Genau an meinem neununddreißigsten Geburtstag. 1974.«
Ihre Mundwinkel zucken, und man weiß nicht, drückt sich ein bestimmter Gedanke darin aus oder nur Ungeduld über die Frage. Hinter ihr das Bücherregal und dahinter der große Raum. Der leere Schreibtisch am Fenster, das eine weiße Gardine sorgsam bis zum Fensterbrett verschließt. Keine Pflanzen darauf. Zu jung für den Krieg und zu alt für die Revolte von achtundsechzig, wurde den Bürgers die Universität zum Ort der Utopie. Peter Bürger gehörte 1971 zu den ersten Professoren der neugegründeten Bremer Reformuniversität, seine Theorie der Avantgarde ist ein akademischer Longseller. Christa Bürger, die bei Horkheimer und Adorno studierte, erhielt 1973 die Berufung nach Frankfurt. Zahlreiche Suhrkampbände dokumentieren ihre Arbeit an einer Kritischen Literaturwissenschaft, wie das damals hieß. Beide sind lange schon emeritiert. Vor dem Fenster eine ruhige Einbahnstraße mit Kopfsteinpflaster und jenen charakteristischen schmalen Bremer Doppelhäusern vom Beginn des letzten Jahrhunderts, die gerade von der nächsten Generation in Besitz genommen werden. Dem dunkelroten Klinker werden Wechselsprechanlagen mit glänzenden Kameraaugen appliziert. Das Haus von Christa und Peter Bürger ist eines der letzten in der Straße, das noch nicht renoviert wurde. Ein blondes Mädchen stand barfuß und braungebrannt in einem hellen Kleid unter dem weit über den Gehsteig ragenden üppigen Busch, der seine Blüten um sie auszustreuen schien. Sie sah mich neugierig an, als ich das Törchen zum Vorgarten aufstieß.
»Und Sie haben das Haus gleich gekauft?«
»Das war die einfachste Form. Aber es ging in keinem Augenblick – ich glaube, ich kann das sagen, auch wenn es unwahrscheinlich klingt – um den Besitz. Es ging um Ruhe, um die Möglichkeit, in Ruhe arbeiten zu können.«
»Von wann ist das Haus?«
»Es ist genauso alt wie ich. Es wurde 1935 gebaut.«
»Und was bedeutet sein Besitz heute für Sie?«
»Na ja, man wird das Haus nicht verlassen dürfen. Das Haus ist ja ein eigener Organismus, dem man Rechnung tragen muß. Vor allem natürlich, seit es Probleme hat.«
»Das Haus hat Probleme?«
»Es versinkt.«
»Es versinkt?«
»Ja.«
Durch das offene Fenster das Geräusch des leichten Regens. Nebenan steht eine ältere Dame mit weißer Bluse und Perlenohrringen auf ihrer überdachten Veranda. Ich verstehe nicht, was sie damit meint, daß das Haus versinke. Christa Bürger zieht die Hand vom Tisch. Eine kleine, äußerst grazile Frau. Die grauen Haare halblang und mittelgescheitelt. Alles Leben in den Augen konzentriert, die ständig ihren Ausdruck ändern.
»Wie würden Sie Ihren Lebensstil beschreiben?«
»Das muß ich nicht«, kommt die schnelle Antwort. »Das müssen Sie.«
Ich nicke. Ich weiß, so sollte es sein, in diesem Moment. Doch statt dessen überlege ich noch immer, was sie wohl damit meinte: Das Haus versinkt. Mein Glas ist leer, ich gieße mir nach. Sie rührt ihr Wasser nicht an. Ich trinke und muß dabei seltsamerweise an ein Erlebnis aus meiner Kindheit denken, eines der frühesten, an das ich mich noch erinnern kann, einen jener Spaziergänge, die ich nach meiner sicherlich falschen Erinnerung jeden Sonntagmorgen mit meinem Vater machte, während Mutter zu Hause das Essen zubereitete. Die legitime Alternative zum Kirchenbesuch.
Die Natur, sagte mein Vater, sei seine Kirche. Ich folgte dieser Argumentation mit jenem alles wortwörtlich, nämlich bildhaft nehmenden Kinderbewußtsein so unbedingt, daß die Buchenwälder in der Nähe des hessischen Dorfes, in dem ich geboren bin, sich für immer mit dem Kölner Dom verbinden, den meine Eltern einmal mit mir besuchten. Geld für Urlaube, gar im Ausland, gab es nicht, auch kein besonderes Interesse daran, etwas von der Welt zu sehen oder dem Kind zu zeigen. Köln aber lag im Radius eines Sonntagsausflugs mit dem VW-Käfer. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mich, überwältigt von diesem Raum, im Mittelschiff vortastete, während, ohne daß ich damals gewußt hätte, was das war, der Organist hoch oben Bachs Toccata und Fuge in d-Moll probierte, ansetzend, abbrechend, wieder beginnend, und ich zwischen den Säulen tatsächlich die Kühle und den Schimmer der silbrigen Stämme wiedererkannte. Ich weiß noch: Die glatte Rinde der weitstehenden, schlanken Bäume kam mir bei unseren Spaziergängen beinahe lebendig vor, ein schnurgerader Forstweg führte zwischen ihnen hindurch bergan.
Doch zunächst ging es am Waldrand entlang. Vater war Mitglied des örtlichen Vogelschutzvereins, dessen Plakate gegen die Singvogeljagd in Italien vielleicht den ersten Reim enthielten, den ich bewußt wahrnahm – Kein Urlaubsort, wo Vogelmord, –, und die Spaziergänge bestanden im Frühjahr vor allem darin, die Nistkästen zu kontrollieren. Man öffnete sie, indem man einen Sicherungsnagel an der Seite herauszog und die Front mit dem Einflugloch nach oben klappte, um zunächst die Nester aus dem Vorjahr zu entfernen. Einige Wochen später wurde überprüft, ob Vögel in den Kästen nisteten und wie viele Eier sich in den neuen Nestern fanden, die dann bestimmt werden mußten: Blaumeisen, Buntmeisen, einmal ein Kuckuck. Schließlich: Wann wurde geschlüpft? Wie viele Küken starben? Wann wurden sie flügge? Die Kästen waren numeriert, und all das wurde in lange Listen eingetragen, die mein Vater, der wochentags Maschinen konstruierte, mit Lineal und hartem Bleistift anlegte und mit jener akkuraten Normschrift führte, die ich als Kind, das gerade schreiben lernte, sehr bestaunte.
Bei jenem Spaziergang nun, an den ich seltsamerweise gerade jetzt wieder denken muß, wollte ich von meinen Vater wissen, was der Ostblock sei. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war, aber ich bin 1964 geboren, und so mag jenes Wort ein Reflex auf die Debatte um die Ostpolitik Brandts gewesen sein. Aber was für ein Interesse hatte sich an diesem Wort festgemacht? Ich erinnere mich an einen Kitzel, einen Schauer, etwas Unaussprechliches, das sich mit diesem Wort zu verbinden schien. Und ich erinnere mich daran, meine Frage gestellt zu haben, während wir am Wald entlanggingen, der für mich mit den Indianern der Lederstrumpffilme bevölkert war, die am Sonntagnachmittag nach dem Mittagessen, auf das der Spaziergang unvermeidlich zusteuerte, in einem der drei Fernsehkanäle in Schwarzweiß gezeigt wurden. Jener Wald sorgte dafür, daß ich die Antwort meines Vaters sofort wieder vergaß und statt dessen an mein damaliges Lieblingsspielzeug dachte, Indianer- und Cowboyfiguren, einen Planwagen und Indianerzelte aus Plastik, ein Fort aus Holz mit Ställen, Türmen und Palisaden. Und so war für mich Europa, wie ich es von der Wetterkarte der Tagesschau kannte, seit jenem Spaziergang und für lange Zeit im Osten von einer riesigen Palisadenmauer begrenzt, wobei ich mich heute stärker als an dieses Bild an die Empfindung erinnere, damit werde eher etwas verdeckt als enthüllt, die ich damals vielleicht zum allerersten Mal hatte.
Ich weiß nicht, wie ich den Lebensstil von Christa Bürger beschreiben soll. Nicht einmal, ob ich es will. Doch was will ich statt dessen? Ich sehe mich in dem Raum um, in dem wir sitzen, und sage noch immer nichts.
»Das, was Sie hier sehen, sind exakt die Möbel, die ich damals von meinen ersten beiden Gehältern gekauft habe«, kommentiert Christa Bürger meinen Blick.
Mein Schweigen muß sie irritiert haben. Ich nicke. Vier Stühle für den Eßtisch, mit schmalen, dreisprossigen und sanftgeschwungenen Lehnen. Vier Sessel, die sich jedoch nur durch ihre Höhe und schmale Armlehnen von den Stühlen unterscheiden. Dazu zwei niedrige Beistelltischchen. Ein Bücherregal über die ganze Breite der Wand, hineingehängt ein Schränkchen für Schallplatten, darauf Verstärker und CD-Player. Den Schneewittchensarg von Braun, dessen Fehlen man geradezu spürt, habe man, sagt sie, als ich danach frage, vor ein paar Jahren einem befreundeten Lehrer für das Museum seiner Schule geschenkt. Als Christa Bürger ihr autobiographisches Buch publizierte – Mein Weg durch die Literaturwissenschaft 1968–1998 –, überraschte mich, daß gerade sie, deren Hauptinteresse seit langem den Schwierigkeiten von Autorinnen gilt, Leben und Werk zu verbinden, darin beinahe jeden Bezug auf die eigene Herkunft unterließ. Woran das liege, frage ich.
»Das Problem meiner Kindheit ist gewesen, daß ich keine Sprache hatte. Mein Vater war Streckenarbeiter bei der Bahn in Frankfurt. Als ich ins Gymnasium kam, realisierte ich, mir fehlen unendlich viele Wörter, die meine Klassenkameradinnen hatten, die aus bürgerlichen Elternhäusern kamen. Mein Zugang zur Welt ist über Schule passiert. Schule war Befreiung.«
»Dennoch schreiben Sie von einer Schuld, die Sie mit der Kindheit verbände.«
»Die Schuld bezieht sich darauf, daß meine Eltern in dieser Sprachlosigkeit blieben und ich von einem bestimmten Zeitpunkt an eine Sprachherrschaft ausüben konnte. Was vor allem für meinen Vater außerordendlich schmerzhaft gewesen ist.«
»Also liegt die Schuld …«
»… in diesem selbstbewußten Heraustreten. Dem Raustreten aus dieser Sphäre.«
»Sie selbst haben entschieden, die Heimat zu verlassen.«
»Ja«, antwortet sie schnell, doch nach einem kurzen Zögern überlegt sie: »War es Heimat?«
Ihr Blick ist neugierig und skeptisch, als böte man ihr etwas an, von dem sie nicht weiß, ob sie es möchte. Sie schweigt lange und sagt dann leise: »Wir wohnten in der Niddastraße. Aber ich kann nicht sagen, daß es Heimat ist.«
Der ganze Schmerz, schießt es mir durch den Kopf, den die Kindheit hinterläßt, steckt noch in diesem Tempuswechsel: Präsens. Die Niddastraße ist eine Straße im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main. Viergeschossige Mietshäuser. Keine bürgerliche Wohngegend. Die Kränkung, die man als Kind erfahren zu haben glaubt, ist unaufhebbar. Fraglich nur, ob wir wirklich wissen, worauf sie sich bezieht.
»Sie sind 1935 geboren und schreiben über Ihre ältere Schwester, die BDM-Mädchen war.«
»Zu der BDM-Welt hatte ich keinen Zugang. Sie ist zehn Jahre älter als ich, und ich war noch klein. Die Uniform seh’ ich, die Lieder hör’ ich, die Photos der Fliegeridole in ihrem Zimmer, das sehe ich, aber diese Welt war mir verschlossen.«
»Sind Sie denn als Kind öfter umgezogen?«
»Nein, wir haben in dieser Wohnung immer gewohnt. Doch wegen der Bombenangriffe kam ich irgendwann 1943 oder 1944 in die Rhön zu weitläufigen Verwandten, die einen Bauernhof hatten. Und dann standen eines Tages meine Eltern da mit einem kleinen Köfferchen. Das war alles.«
»Was meinen Sie mit: ›Das war alles‹?«
»Die Stadt war nicht mehr! Aber darüber ist nicht gesprochen worden. Genau das, was Sebald in Luftkrieg und Literatur beschreibt. Und später, als wir nach Erzhausen evakuiert worden waren, zurück in die Nähe von Frankfurt, wachte ich eines Morgens auf, es lag Schnee, und der Schnee war schwarz. Darmstadt existierte nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, daß meine Eltern dazu etwas gesagt hätten.«
»Rebellieren Kinder nicht gegen ein solches Verschweigen?«
»Nein, ein Kind tut so etwas nicht.« Schweigen. Nachsatz: »Es weiß doch, daß es vorsichtig zu sein hat. Daß da etwas ausgelöst werden könnte, was es nicht einschätzen kann.« Ihre Mundwinkel zucken, als formulierte sie die Erläuterung zunächst mit geschlossenen Lippen. »Ich denke«, sagt sie dann, »das ist eine Generationserfahrung. Kennen Sie Fortes Haus auf meinen Schultern? Ganz großartig. Für mich das erste Zeugnis eines Menschen meiner Generation, dem es gelungen ist, seinem Gedächtnis das wieder abzuringen.«
»Sie meinen, diese Erfahrungen sind da, aber verschlossen?«
»Sie sind blockiert. Und ich hab’ auch nie dran gerührt. Wir haben – Peter geht es ganz ähnlich – immer diese goethesche Vorsicht, all zu sehr in sich hineinzusteigen und zu gucken, was in dieser Black Box drin ist, für außerordentlich weise gehalten. Wir sind ja auch ganz gut davongekommen.«
Kommt man wirklich davon? Wieder muß ich an jenen Buchenwald denken und jenes Wort: Ostblock. Und an den seltsamen Schauer, der sich noch immer mit jenen Spielzeugfiguren verbindet, den Indianern und Cowboys mit ihren Speeren und Gewehren. Christa Bürger sagt, daß sie die Bilder ihrer Kindheit im zerstörten Frankfurt nicht mehr sehe. Worte wie Mutter oder Heimat hätten für sie jede Bedeutung verloren. Der Vater erscheint in ihrer Perspektive lediglich unter dem Stichwort der Mitschuld der Reichsbahn am Holocaust. Ist es denkbar, daß jener Krieg auch in meine Kindheit noch hineingefunden haben sollte, und sei es in der Weise, wie er vergessen wurde?
»Ist dieses Haus für Sie denn jene Heimat geworden, die Sie als Kind nicht hatten?«
»Heimat? Nein. Nirgendwo ist Heimat, überall Modernisierung und Zerstörung. Das Haus ist das Haus. Mit einer Betonung, die möglicherweise durchaus etwas Zärtliches hat.« Ihr Lächeln scheint spöttisch. Oder ist es schüchtern?
»Fanden Sie es denn schön, als Sie es damals kauften?«
»Wir fanden es ästhetisch. Angemessen in den Proportionen. Und auch im sozusagen sozialen Zuschnitt. Wir hätten keine freistehende Villa haben wollen.«
»Sie waren stolz auf Ihr Haus?«
»Oje: nein!« Jetzt lacht sie. »Was sind denn das für Kategorien?«
»Na ja, ich probiere einige aus.«
»Nein. Wir waren glücklich in diesem Haus. Das heißt: Wir sind es.«
»Wissen Sie denn, wer es gebaut und wer hier vorher gelebt hat?«
»Da müßten wir die Nachbarn fragen, deren Eltern haben das Nebenhaus gebaut.«
»Sie wissen nichts über die Geschichte Ihres Hauses?«
»Nein, darum haben wir uns nie gekümmert. Es war ja da.«
»Was meinten Sie übrigens damit, daß es versinkt?«
Christa Bürger nickt.
»Kommen Sie. Ich zeige es Ihnen.«
Man habe damals beim Einzug kaum etwas verändert, erklärt sie beim Gang durch das Haus. Nur die Wände habe man weißen und die Dielen freilegen lassen. Die Küche etwa sei im wesentlichen so geblieben, wie man sie 1974 vorgefunden habe – man koche wenig. Im ehemaligen Eßzimmer im Erdgeschoß der große Schreibtisch mit Fax und Drucker, an dem man früher gemeinsam arbeitete. Jetzt haben beide im ersten Stock ihre Arbeitsräume, daneben das Schlafzimmer. Fremdartig schön Peter Bürgers Schreibtisch: Ein Stapel Blätter, mit Tinte in einer großen Handschrift beschrieben, daneben ein Stoß von kleineren Blättern und eine Schere, die das Buch offenhält. Mit der Schere werden Papierstreifen zugeschnitten und in das Manuskript eingeklebt, wenn Änderungen notwendig sind, oft auch Streifen an der unteren Kante angeheftet für neue Fußnoten und Anmerkungen. Weitere Stapel ebensolcher Blätter, jedes per Hand auf DIN A6 zugeschnitten, enthalten das Gedächtnis des Gelehrten: Exzerpte von Büchern und Zitate, seit Jahrzehnten gesammelt, nach Jahrhunderten und Autoren geordnet. Erst wenn die Rohfassung von Hand erstellt ist, wird aus dem untersten Regalfach ein Laptop hervorgeholt, dessen Plastikgehäuse sich zwischen Karteikästen aus Holz und Mappen aus Graupappe fremd ausnimmt.
Auch im Mansardenzimmer im zweiten Stock steht ein Schreibtisch und ein weiterer im Gästezimmer im Souterrain, das sich zum Garten öffnet. Hier im Keller erkennt man an den alten Holztüren und dem unebenen Terrazzoboden noch deutlich den Originalzustand des Hauses. Eine schmale, offenbar neu eingepaßte Tür aus hellen Fichtenbrettern fällt sofort ins Auge.
»Der Bunker«, sagt Christa Bürger und nickt in Richtung der Tür. »Er zieht das Haus hinab.«
Da ist er also wieder, der schwarze Schnee aus der Kindheit. »Ein Bunker?«
»Ja, den haben wir erst nach dem Einzug entdeckt. Die beiden Stahltüren, die zwei Männer nicht tragen konnten, haben wir rausnehmen lassen.«
»Warum?«
»Gewicht. Gewicht.«
Hinter der schmalen Tür ein enger Gang, so etwas wie eine winzige Schleuse. Der Raum dahinter zwei auf anderthalb Meter groß, natürlich fensterlos, die niedrige Betondecke mit dichtgesetzten T-Trägern armiert.
»Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier drin!«
Ich horche einen Moment lang auf ein Gefühl der Beklemmung, das sich einstellen soll, doch das Wissen um die offene Tür ist nicht zu überlisten. Statt dessen packt mich ein Schauer ganz ähnlich demjenigen des Kindes, das ich war. Ostblock. Das Wort gleicht diesem Bunker. Ich denke: So etwas wie ein negatives Geschenk.
»Waren Sie als Kind in Frankfurt im Luftschutzkeller?«
»Ja.«
»Dann können Sie sich ja vorstellen, wie es wäre.«
»Natürlich.«
»Aber im Ernstfall wäre so ein Ding doch auch ganz beruhigend, oder?«
»Im Krieg? Ohne mich. Ich würde nicht mitmachen.«
»Wie meinen Sie das? Sie würden sich weigern, Opfer zu sein?« Wie absurd das klingt, denke ich.
»Ja, ich würde mich weigern.«
Christa Bürger drückt die schmale Tür aus hellen Kieferbrettern behutsam ins Schloß. Zurück am Eßtisch, schildert sie ihre Angst vor dem langsamen Versinken des Hauses. »Der Untergrund hier ist Moor«, sagt sie und erzählt von den Rissen in den Wänden und den verzogenen Fenstern. Von achselzuckenden Handwerkern. Daß sie wegen des Gewichts niemals den Dachboden ausgebaut haben. Und wie sie den Estrich und die Fliesen von der Terrasse entfernen und durch Dachpappe ersetzen ließen. Und von den Büchern, vor allem den Kunstbänden, die sie irgendwann schweren Herzens auszusortieren begannen. Vom Sofa, das sie verschenkt haben, und von der Radierpresse, die weggeschafft wurde. Es gilt, Gewicht zu sparen.
»Aber zieht man dann nicht lieber aus?«
»Das kommt nicht in Frage.«
»Und warum nicht?«
»Wir halten den Dingen die Treue, weil sie uns nun einmal gedient haben. Es sind die Dinge, die seit über vierzig Jahren mit uns gelebt haben. Wir haben zu ihnen ein freundliches Verhältnis – ohne daß wir irgendeines von ihnen besetzen würden. Nicht daß es gerade dieser Tisch ist, ist wichtig.«
»Das kehrt natürlich das Freudige am Besitz um in Pflicht.«
»Ja, das war vielleicht etwas überstrapaziert.«
»Glaub’ ich nicht.«
»Warum?«
»Ist denn nicht auch in der Kritischen Theorie das Verhältnis zu den Dingen seltsam unentschieden? Da gibt es die aufgeladene Dingwelt bei Benjamin und zugleich die große Verachtung gegenüber Besitz.«
»Das mag sein, ja. In Rilkes Briefen über Cézanne kommt der Begriff des Dinge-Machens immer wieder vor. Ich kann es nicht, weil ich keine Künstlerin bin. Aber das scheint mir ganz wichtig.«
»Aber warum wäre das Dinge-Machen nur Sache des Künstlers? Warum erwerben Sie solch ein Haus, ohne etwas darin gestalten zu wollen?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht gehört dieses Zurücktreten zu meiner Art, zu sein.«
»Ist das kein Widerspruch zum Lehrersein?«
»Kein Widerspruch. Mein Ethos ist immer gewesen, den Schülern zu ermöglichen, zu tun, was sie selbst machen können. Verwirklichung gemäß den Möglichkeiten, die in dem anderen sind.«
»Während Sie innerlich am Rande stehen.«
»Vielleicht so etwas.«
»Dann gestalten natürlich andere, wenn man sich so zurücknimmt.«
»Ja. Aber vielleicht hat das damit zu tun, daß ich erlebt habe, wie Dinge zerstört werden. Daß das Leben der Dinge und der andern deshalb etwas unbedingt zu Respektierendes ist. Wenn man einen Grund sucht. Seltsam: Erst jetzt, im Gespräch, realisiere ich, daß das eine nicht unbedingt sehr verbreitete Weise ist, in einem Haus zu leben. Oder überhaupt.«
»Der Begriff des Erbes ist heikel, wenn man so lebt.«
»Warum?«
»Weil man den Dingen nichts hinzufügt.«
»Erbe ist für Peter Bürger und mich natürlich vor allem als Schreibende wichtig, als Literaturwissenschaftler, und da geht es auch wiederum um die ganz schwierige Balance zwischen der Anerkennung des Dings als das, was es gewesen sein mag, und dem Versuch, ihm seinen Ort in der Gegenwart zu geben.«
»Aber spricht aus solchem Pflichtbewußtsein nicht eine viel grundsätzlichere Reserviertheit? Ein Mißtrauen gegenüber dem, was ist? Und gehört genau dieses Mißtrauen gegenüber der Welt vielleicht immer zur Idee ihrer Veränderbarkeit? Zu dem also, was man einmal links nannte? Sie erwähnten in diesem Zusammenhang einmal Hans Henny Jahnn.«
»Ja, Jahnn mit seinem Angriff gegen die Schöpfung hat mich schon sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber für Peter und mich war der Gedanke gänzlich unangemessen, Eltern zu sein.«
Ich nicke und schaue in den Garten hinaus. Rhododendron und Holunder, Johannisbeersträucher, ein niedrigstämmiger Apfel- und ein Pflaumenbaum. Nichts, was Arbeit macht, sagt sie. Die Pflaume habe Peter im letzten Jahr mit Stützen versehen müssen und in diesem Jahr zum ersten Mal mit Tabaksud gegen Schädlinge besprüht. Die Birke, die nun hoch über das Haus ragt, hätten sie seinerzeit beim Einzug gepflanzt. Die Nachbarin, erzählt sie, habe sie irgendwann darauf hinweisen müssen, daß sich das Unkraut aus ihren nichtgepflegten Beeten über die Grundstücke verteile. Eigentlich hätten sie vorgehabt, den Garten zu ignorieren.
»Das Bedürfnis, daß alles, was geschieht, in einer bekömmlichen Weise geschieht. In einer kleinen Weise. Das Mindestnotwendige an Eingriffen.«
»Und das ist nicht Resignation?«
»Nein. Bestimmt nicht. Resignation ist nicht der richtige Ausdruck. Aber wir fühlen uns bestärkt in unserer Betrachterrolle, am Rande, in der gegenwärtigen kulturellen Situation in diesem Land. Da läuft etwas ab, darüber kann man entsetzt sein oder traurig. Aber da wir nie das Pathos des Eingreifens gehabt haben, ist das auch jetzt für uns keine Möglichkeit.«